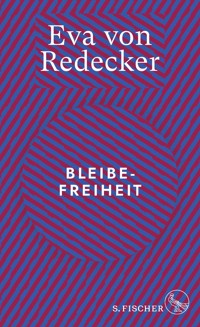12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine neue Kapitalismuskritik – und eine Liebeserklärung an menschliches Handeln In Zeiten der Krise entzündet sich politisches Engagement. Protestbewegungen wie Black Lives Matter, Fridays for Future und NiUnaMenos kämpfen derzeit weltweit gegen Rassismus, Klimakatastrophe und Gewalt gegen Frauen. So unterschiedlich sie scheinen mögen, verfolgen diese Widerstandskräfte doch ein gemeinsames Ziel: die Rettung von Leben. Im Kern richtet sich ihr Kampf gegen den Kapitalismus, der unsere Lebensgrundlagen zerstört, indem er im Namen von Profit und Eigentum lebendige Natur in toten Stoff verwandelt: Der Kapitalismus verwertet uns und unseren Planeten rücksichtslos. In autoritären Tendenzen und rassistischen Ausschreitungen, in massiven Klimaveränderungen und einer globalen Pandemie zeigt er seine verheerendsten Seiten. In den neuen Protestformen erkennt Eva von Redecker, die als Philosophin zu Fragen der Kritischen Theorie forscht und auf einem Biohof aufgewachsen ist, die Anfänge einer Revolution für das Leben, die die zerstörerische kapitalistische Ordnung stürzen könnte und unseren grundlegenden Tätigkeiten eine neue solidarische Form verspricht: Wir könnten pflegen statt beherrschen, regenerieren statt ausbeuten, teilhaben statt verwerten. Die erste philosophische Analyse des neuen Aktivismus. »Eine der aufregendsten Nachwuchsphilosophinnen des Landes.« Philosophie Magazin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Eva von Redecker
Revolution für das Leben
Philosophie der neuen Protestformen
Über dieses Buch
Eine neue Kapitalismuskritik und eine Liebeserklärung an menschliches Handeln.
Katastrophen können bloßlegen, was längst untragbar ist. Protestbewegungen wie Black Lives Matter, Fridays for Future und NiUnaMenos kämpfen derzeit weltweit gegen Rassismus, Klimakatastrophe und Gewalt gegen Frauen.
So unterschiedlich sie scheinen mögen, verfolgen diese Widerstandskräfte ein gemeinsames Ziel: die Rettung von Leben. Im Kern richtet sich ihr Kampf gegen den Kapitalismus, der unsere Lebensgrundlagen zerstört, indem er im Namen von Profit und Eigentum lebendige Natur in toten Stoff verwandelt.
Eva von Redecker, die als Philosophin zu Fragen der Kritischen Theorie forscht und auf einem Biohof aufgewachsen ist, schreibt von der einsetzenden Revolution für das Leben, die unseren Tätigkeiten eine neue, solidarische Form bietet: Wir könnten pflegen statt beherrschen, regenerieren statt erschöpfen, teilhaben statt verwerten.
»Eine der aufregendsten Nachwuchsphilosophinnen des Landes.« Philosophie Magazin
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Eva von Redecker, geboren 1982, hat in Kiel, Tübingen, Cambridge und Potsdam Philosophie studiert. Von 2009 bis 2019 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berliner Humboldt-Universität, 2015 unterrichtete sie für ein Semester als Gastdozentin an der New School for Social Research in New York. Ende 2020 tritt sie ein Marie-Skłodowska-Curie-Fellowship an der Universität Verona in Italien an. Sie arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt zum autoritären Charakter und ist freischaffend publizistisch tätig. Eva von Redecker ist auf einem Biohof aufgewachsen und hat dort viel über Erdbeeranbau, Direktvermarktung und Pferdezucht gelernt. Heute lebt sie wieder auf dem Land.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Büro KLASS, Hamburg
ISBN 978-3-10-491302-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
BEHERRSCHEN
Der Stutenberg
Land und Leute, Land ohne Leute
Sachherrschaft
Phantombesitz
Verwüstung
VERWERTEN
Die Knochenmühle
Fernhandel, Fabriken und Verpackungen
Sachliche Herrschaft
Selbstverwertung
Vermüllung
ERSCHÖPFEN
Unter dem Pflaster die Hand
Fühllose Körper und verfügbare Zeit
Sachliche Sachherrschaft
Eigenverantwortung
Burnout und Stehaufmännchen-Monster
ZERSTÖREN
Die-ins
Die kommende Katastrophe
Der Verlust der Welt
Der Verlust der Zeit
Die zärtliche Erzähler_in
REVOLUTION
O Fortuna!
Politik und ihr Radius
Das große Hamsterrad
Aneignen oder Ausbremsen?
Revolution für das Leben
RETTEN
Übersprudelndes, unvergittertes Leben
Sachherrschaft zu See
Was heißt Leben? Virale Furcht vs. Pilzgeflecht
Regime der Nicht-Rettung
Atmen können
RE-GENERIEREN
Wir wollen uns lebendig!
Flüssige Streikmacht
Solidarische Beziehungsweisen
Das eingekapselte Leben
Einander zur Welt bringen
TEILEN
Im Boden lassen
Besetzung und Verwurzelung
Freie Gaben
Anonyme Liebe
Das Gegebene
PFLEGEN
Wasser ist Leben
Weltwahrung
Standorte
Omnia sunt communia
Gegenwärtigkeit
Schluss
Danksagung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Sorgt doch, daß ihr die Welt verlassend
Nicht nur gut wart, sondern verlaßt
Eine gute Welt!
Bertolt Brecht, Die heilige Johanna der Schlachthöfe
In diesem Buch geht es um das Leben. Es geht, zumindest zwischendurch, um das Leben als Tanzen, Erzählen, Ernten, Nachdenken und Handeln. Und es geht um natürliche Zusammenhänge, die unsere Lebensgrundlage bilden: Ozeane, Wolken, Böden, Wälder und Atemluft. Hauptsächlich geht es jedoch um das Leben in einer spezielleren Hinsicht: der Befreiung von kapitalistischer Herrschaft.
Diese Befreiung ist kein hehrer Anspruch, sondern eine dringende Aufgabe. Denn der Kapitalismus zerstört das Leben. Die Befreiung von kapitalistischer Herrschaft ist auch deshalb mehr als ein bloßer Anspruch, weil sie an verschiedenen Stellen bereits stattfindet. Wir erleben eine Revolution für das Leben. Seit knapp zehn Jahren zeigt sich ein neuer Typus von Protest. Dieser Protest ist weder eine Wiederaufnahme der sozialen Revolutionen von vor gut einhundert Jahren noch lediglich eine Fortsetzung der über fünfzig Jahre währenden Bürgerrechtsbewegungen. Die neuen Formen des Widerstands gehen von einer Mobilisierung für akut bedrohte Leben aus und kämpfen für die Aussicht auf geteiltes, gemeinsam gewahrtes und solidarisch organisiertes Leben. Eine Revolution für das Leben findet sich in der antirassistischen Mobilisierung gegen Polizeigewalt, im feministischen Kampf gegen Frauenmorde und in der Klimabewegung, die das Schreckbild eines toten Planeten ins Bewusstsein gehoben hat. Alle diese Bewegungen verstehen sich als antikapitalistisch, aber sie führen ihren Kampf nicht als Aufstand der Arbeiter_innen gegen die Lohnarbeit, sondern als Aufstand der Lebenden gegen die Lebenszerstörung.
Unter den Bedingungen einer globalen Pandemie wird dieser Kampf greifbarer und allgegenwärtiger. Er wird auch verzweifelter. Ganze Sektoren der Lohnarbeit entpuppen sich nämlich unmittelbar als Lebenszerstörung.
In Lohnarbeit wird, mit nahezu mechanischen Bewegungen und von Kälte geschwollenen Handgelenken, Fleisch von Schweinehälften geschnitten. Die schweren, steifen Stücke werden mit motorisierten Messern zerteilt und auf Fließbänder geworfen. Sie werden maschinell in Plastik eingeschweißt oder zusammen mit Fett und Eingeweiden zu Wurst und Katzenfutter geschreddert. Gelegentlich gleiten die Klingen bei der Lohnarbeit aus den klammen, glitschigen Fingern, oder sie schnellen von Knorpeln zurück; die Arbeiter_innen schneiden sich. Aber wer zu häufig zum Arzt geht, erhält eine Kündigung. Ein Großteil der Arbeitsverträge läuft über Subunternehmen, die Scheinselbständigkeiten und Probezeiten fingieren. Auch die ersten Covid-19-Infizierten werden angewiesen, die Krankheit zu verschleiern. Als fast ein Viertel der 7000 Beschäftigten erkrankt ist, übernimmt der Landesminister die Darstellung eines Firmensprechers. Die osteuropäischen Mitarbeiter_innen hätten sich vermutlich bei Heimatbesuchen angesteckt. Sicher. Im Inneren der westeuropäischen Wirtschaft ist schließlich alles in bester Ordnung.
Diese Mischung aus Ausbeutung, Brutalität und Diffamierung findet sich nicht in allen Betrieben. Schon im selben Unternehmen arbeitet der besagte Firmensprecher unter gehobenen Bedingungen. Aber selbst wenn es gelänge, derart brutale Arbeitsverhältnisse durch Reformen und Ahndung von Verstößen weiter einzudämmen, charakterisierte ihre viehische Logik doch weiter den Kern der kapitalistischen Funktionsweise. Auch wenn es nicht überall und nicht für alle so aussieht: So leben wir. So stellen wir unsere Nahrungsmittel her, so erwirtschaften wir Reichtum, selbst wenn alle Schlachthöfe geschlossen würden. Die Verbrennung fossiler Ressourcen im Laufe der letzten zweihundert Jahre, die Grundlage also nahezu all unserer Produktion, hat den Planeten in ein sich unaufhaltsam erwärmendes Treibhaus verwandelt. Und dieses Treibhaus ist ein Schlachthof. Jeden Tag sterben 130 Tier- und Pflanzenarten aus. Wenn man die Biomasse aller Wildtiere auf der Erde berechnet – also das Gewicht all ihrer Körper addiert –, dann ist diese Summe in den letzten fünfzig Jahren um 82 Prozent gesunken. Die Reproduktion des Alltags in den reichen Industriestaaten schlachtet schneller als jede Keulanlage beim Wurstfabrikanten. Dabei verderben wir nicht nur unsere Lebensgrundlagen, sondern schneiden uns auch fortwährend ins eigene Fleisch. Aber warum schafft der Kapitalismus – schaffen wir im Kapitalismus – solch viehische Verhältnisse?
Der Begriff »Kapital« bezeichnet ein bestimmtes Eigentum. Es lässt sich als Investition verstehen, die den Privatbesitzern der Produktionsmittel erlaubt, Gewinn zu erzielen. Die, denen die Fabriken gehören, kaufen Schweine und Arbeitszeit und verkaufen die Wurst für mehr, als sie dabei ausgegeben haben. Begriffsgeschichtlich bezeichnete »Kapital« zunächst nur den Anteil an Vermögen, den jemand in ein Handelsunternehmen einbrachte. Ab dem 17. Jahrhundert bürgerte sich dann die Verwendung ein, dergemäß der gesamte Grundstock einer Firma als »Kapital« zusammengefasst wird. Kapital ist, womit gewirtschaftet werden kann.
Im Wortstamm verrät sich aber eine noch ältere Bedeutung. »Caput« bedeutet lateinisch zunächst einfach »Kopf«, aber auch »Rind« und »Eigentum«. Denn das nach Köpfen gezählte Vieh war lange Zeit, in agrarischer Wirtschaft und bevor es stabile Währungen gab, die beste Einheit, um Vermögen einzuschätzen. Der Begriff kehrt als »chattel« in der Definition der modernen Sklaverei wieder, einem System weißer Herrschaft, das auf juristisch abgesichertem und ökonomisch übertragbarem Besitz an geraubten schwarzen Menschen basierte. Das Porträt des Kapitalismus, das ich in diesem Buch zeichne, rückt die Eigentumsform – nicht nur die Eigentumsverteilung – in den Vordergrund. Das Kapital kann den Besitz nur mehren, wenn das Besitzen eine besondere Gestalt hat; es erfordert ein destruktives Weltverhältnis. Diese Destruktivität ist im modernen Eigentum, das seine Besitzer_innen zur Willkür berechtigt, angelegt. Sie übersetzt sich in diverse soziale Herrschaftsverhältnisse. Den Kapitalismus als Ordnung der Eigentumsfixierung zu analysieren, heißt somit, die Schädel – das »caput« oder »chattel« – sichtbar zu halten. Wenn wir »Kapital« lesen, sollten wir nicht nur seine Rendite klingeln hören, sondern auch seinen Totenkopfaufdruck entziffern.
In seinem Werk Black Marxism hat der afroamerikanische Denker Cedric Robinson vorgeschlagen, den Kapitalismus weniger als eine vereinheitlichende Modernisierungsmaschine zu verstehen – wie es zum Beispiel auch die Frankfurter Schule tut –, sondern als ein Spaltungswerkzeug. Der Kapitalismus überzieht die Welt mit Unterscheidungen, die sich mehr und mehr an rassistischen Markern orientieren – man denke an die Finte, den osteuropäischen Arbeiter_innen den Dreck und Infektionsdruck ihrer Arbeit selbst anzuhängen. Robinson selbst erklärt diese Spaltungen als Fortsetzung der feudalistischen Hierarchien, die den europäischen Ursprungskontext des Kapitalismus charakterisierten. Aber der Kapitalismus spaltet auf eine ganz eigene Weise. Er fasst Hierarchien neu und anders, modelliert nach dem Eigentum, das er ebenfalls neu und anders fasst.
Das moderne Eigentum stiftet ein Weltverhältnis der Verfügungshoheit und der Verletzungslizenz. Für dieses Weltverhältnis verwende ich den Begriff der »Sachherrschaft«. Wir sehen Sachherrschaft am Werke, wenn die Schlachtereimitarbeiterin die Kreatur zerlegt. Und wir sehen Sachherrschaft am Werke, wenn das Leben der Arbeiterin selbst als entbehrlich behandelt und, während die Vermögenden gut isoliert an den Fleischtöpfen sitzen, der Ansteckungsgefahr ausgeliefert wird.
Aus Weltverhältnissen, aus vielen alltäglichen Praktiken und Vollzügen, werden Selbstverständnisse und Überlegenheitsansprüche. Moderne Identitäten sind im Gefüge von Institutionen entstanden, die Besitztitel an Menschen schufen – an der gesamten Person in der Versklavung, an der gesamten Lebenszeit in Zwangsarbeit, an Sexualität und Sorgetätigkeit in patriarchaler Ehe. Diese sachherrschaftsbasierten Identitäten überleben den Verlust der verfügungsgarantierenden Institutionen. Die vormalig Kontrollberechtigten gebärden sich oft sogar noch bestialischer, nachdem das Glied ihrer Herrschaft amputiert wurde. Sie verfechten ihren leeren Besitzanspruch weiter. Sie sind, was die ältere Frankfurter Schule als »autoritäre Charaktere« bezeichnete, und was ich »Phantombesitzer_innen« nenne. Dem Phantombesitz, den die einst und jetzt Herrschenden haben, entspricht der Phantombesitz, zu dem die Beherrschten verdinglicht werden. Auch nach dem Verbot der Sklaverei werden schwarze Leben als entbehrlich betrachtet, auch nach Abschaffung der patriarchalen Ehe gilt das weibliche Geschlecht als Beute, trotz Arbeitsrecht und Sozialversicherung wird Arbeitsvermögen ausgepresst. All das ist Phantombesitz, und auf all das – sowie auf Rohstoffe, Energie und Schlachtvieh – baut der Kapitalismus.
Der Kapitalismus, den Robinson als Spaltungswerkzeug beschreibt, trennt doppelt. Der erste Schnitt, der seine Ordnung bestimmt, ist vom Eigentum gesetzt und verläuft zwischen Sachherrscher_innen und als verfügbar ausgestanztem Objekt. Der zweite Schnitt zerteilt das Objekt der Sachherrschaft. Die Verwertungsabsicht zieht eine Trennlinie zwischen Ware und Auswurf, zwischen Wert und Nichtigem. Oft ist es die Lohnarbeit, die angehalten ist, diese am Markt ratifizierte Scheidung vorzunehmen. Dreck und Gerippe in den Abfall, blutiges Wasser in die Kanalisation und Fleisch in die Büchse. Und als Ware verdankt sich die Lohnarbeit selbst dieser Scheidung: hier verwertbare Arbeitskraft, dort Freizeit oder unvermittelbare Kräfte. Hier die Hand, die das Messer führen kann, dort die Krankschreibung oder der verwundete Stumpf. Auch die Produktion veganer Schnitzel und die Arbeit im Homeoffice setzen solche Schnitte. Sojamonokulturen treiben Landnahme im globalen Süden voran; die Unterscheidung zwischen Kreativität und Prokrastination ist von der Verwertung diktiert. Wir reproduzieren dieses viehische System. Es herrscht durch und über uns. Mehr durch die einen und mehr über die anderen, aber doch auch wieder im Zusammenspiel beider.
Dieses Buch, das insgesamt etwas weniger blutig ist als seine Einleitung, spürt nichtsdestotrotz Auswegen nach. Es soll hier schließlich nicht nur um die kapitalistische Destruktion des Lebens gehen; es soll um eine in den Zwischenräumen bereits angebrochene Revolution gehen. Es ist eine Revolution um des Lebens willen und für ein anderes Leben, die sich im Versuch der »Selbstverständigung der Zeit über ihre Kämpfe und Wünsche« (so bestimmte Karl Marx einmal die Aufgabe kritischer Philosophie) erschließt. Unter der Rubrik der »Revolution für das Leben« versammle ich eine unvollständige Reihe politischer Gruppen, die ich als Beispiele des Aufbegehrens gegen die kapitalistische Sachherrschaft betrachte. Ich deute ihre Protestformen aber nicht nur als Widerstand gegen Missbrauch und Abspaltung, sondern auch als Vorwegnahme einer anderen Ordnung.
Bereits in der Katastrophenvergegenwärtigung durch Akteur_innen von Fridays for Future und Extinction Rebellion zeichnet sich eine Haltung ab, die die abgestumpfte Indifferenz gegenüber der Welt jenseits des eigenen Eigentums, die uns moderne Sachherrscher_innen auszeichnet, durchbricht. Wir könnten anders leben, wir könnten in unseren alltäglichen Handlungen andere Muster reproduzieren. Die Zerstörung ist nicht alternativlos. Black Lives Matter, mit ihrem unbedingten Beharren auf dem Gewicht rassistisch abgewerteter Leben, mit dem aktiven Einschreiten gegen alle rassistische Systemgewalt – die polizeiliche, aber auch die durch toxische Industrie und militarisierte Grenzsysteme –, eröffnen einen grundlegend neuen politischen Horizont. Wir könnten Leben retten, anstatt sie zu zerstören. Die lateinamerikanischen Feminist_innen, die unter dem Motto »Ni una menos« – »nicht eine weniger« – zum Protest gegen die nicht enden wollende Zahl an Frauenmorden durch Partner und Expartner aufrufen, führen im Zuge von Frauen*streiks vor, dass wir anders arbeiten könnten. Anstatt nach der Parole von Profit und Phantombesitz uns selbst und die Natur zu erschöpfen, könnte menschliche Tätigkeit regenerieren: Nähren, Versorgen – und Tanzen. Im gezielten Angriff auf die Kohleverstromung in Deutschland drängen die Aktivist_innen von Ende Gelände darauf, dass es eine gesellschaftliche Frage sein muss, wie wir produzieren und mit Ressourcen umgehen. Anstatt Güter zu verwerten, könnten wir sie teilen – oder auch einfach mal in der Erde lassen. Das Rückgrat der internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung, der sich auch Ende Gelände zuordnet, bilden indigene Widerstandsgruppen. Ein Beispiel ihrer Kämpfe ist die Blockade der Dakota Access Pipeline, die Öl durch das Stammesgebiet und Grundwassersammelbecken der Sioux leitet. Die Proteste unter dem Motto »Wasser ist Leben« – »mni wiconi« auf Lakota – berufen sich nicht auf moderne Eigentumsrechte, sondern auf Fürsorgepflichten gegenüber Land und Lebensgrundlagen. Wir könnten pflegen, was uns anvertraut ist, anstatt es zu unterwerfen.
Die Welt der kapitalistischen Sachherrschaft ist ein Schlachthof. Aber wie Bertolt Brecht den Impuls aller detaillierteren dialektischen Widerspruchsrekonstruktionen zusammenfasst: »Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht.« Und wir brauchen keinen großen Knall, um vom Hier in ein anderes Jetzt zu kommen. Denn so wie es ist, ist es nicht durchweg. Wir können selbst Ansatzpunkte suchen und schaffen, um von vielen Seiten und Orten zugleich ein anderes als das destruktive Weltverhältnis einzugehen. Wir können Leben retten statt zerstören, Arbeit regenerieren statt erschöpfen, Güter teilen statt verwerten und Eigentum pflegen statt beherrschen. Überall, wo wir damit beginnen und weitermachen, wächst die Revolution für das Leben.
BEHERRSCHEN
(Eigentum)
Wenn wir uns vor dem inneren Auge die Natur vorstellen, oder wenn wir tatsächlich hinaus ins Grüne fahren, sehen wir eine gegliederte Landschaft. Hecken, Wälle und Zäune trennen einzelne Felder und Wiesen voneinander, Wälder haben Kanten und Gräben klare Konturen. Das Eigentum ist der Welt gewissermaßen eingewachsen.
In seiner Abhandlung über Ungleichheit beklagte der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, dass es überhaupt Zäune gibt. Er schrieb 1755, dass es der Menschheit großes Leid erspart hätte, wenn »der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und auf den Gedanken kam, zu sagen ›Dies ist mein‹« aufgehalten worden wäre. Wie zahlreiche kritische Denker_innen nach ihm wollte Rousseau verstehen, warum europäische Gesellschaften trotz ihrer vermeintlich aufgeklärten Ideale Unheil anrichten. Habgier und Eingrenzungen schienen ihm wichtige Faktoren. Er begeht dabei allerdings den Fehler, die Eigentumsvorstellung seiner Zeit mit dem Eigentum überhaupt gleichzusetzen – als würden stets alle Zäune dasselbe bedeuten. Das tun sie aber nicht. Rousseaus Kritik von Zivilisation überhaupt ist zu grobmaschig – deshalb lohnt es sich, die Natur der Zäune, an denen man rüttelt, eingehender zu betrachten.
Der Stutenberg
Ich bin mit einer Geschichte aufgewachsen, die sich auf die Eingrenzung eines Guts bezieht, das später auch eine Weile meinen väterlichen Vorfahren gehörte. Es ist die Geschichte vom Stutenberg.
Als sich im 15. Jahrhundert das vom Deutschen Orden kolonisierte Ermland der polnisch-litauischen Krone unterstellte, wurde einem Ritter für besondere Verdienste vom König so viel Land zugewiesen, wie er an einem Tag umreiten könne. Er ritt am Morgen im vollen Galopp von einer kleinen Anhöhe los und kam abends wieder am Ausgangspunkt an, wo sein Pferd tot unter ihm zusammenbrach. Deshalb »Stutenberg«.
Diese Geschichte kursiert in ähnlicher Form über so viele Orte, dass nicht nachzuprüfen ist, ob sie sich je wirklich irgendwo zugetragen hat. Mich hat allerdings immer schon irritiert, dass sie stets im Tonfall des Triumphs erzählt wird. Warum sollte man dem Kerl ein Gut gönnen? Wie können die letzten Morgen sumpfigen Landes mehr wert gewesen sein als die beste Stute des zukünftigen Besitzers? Wieso handelt die Geschichte nicht davon, dass der Mensch sich verritten hat?
Die Legende in genau dieser Form eignet sich indessen gut, um sich den Besonderheiten des modernen Eigentums anzunähern. Die erste Besonderheit äußert sich schon darin, dass der Kreis beim Umreiten geschlossen werden muss. Denn erst die eindeutige Eingrenzung einer Sache macht sie kontrollierbar. Man muss entscheiden können, was dazugehört und was nicht. Viele Dinge, so wie Land und natürliche Ressourcen, haben nicht von sich aus die klar definierte Form einer abgeschlossenen Sache. Anders als bei einem Pferd oder einem Apfel wüsste man nicht sofort, worin der Besitztitel überhaupt besteht – auch »natürliche Grenzen« wie Flüsse oder Bergketten müssen zu solchen erklärt werden. Und tatsächlich gibt es doch selbst beim Pferd Regelungsbedarf: Ein Pferd verkauft man mit Halfter, aber ohne Sattel – denn ein Pferd, das man nicht festhalten kann, ist als Eigentum zu flüchtig. Wenn uns Landschaften heutzutage klar in verschiedene Felder gegliedert scheinen, dann spiegelt sich in den Hecken und Wällen ihre jahrhundertelange Handhabung als Eigentum. Diese Gestalt hat die Natur erst gewinnen müssen. Sie ist nicht von Natur aus da, sondern wird in einer Vielzahl von Momenten wie der in der Legende beschriebenen Umrundung geschaffen. Fortschritte in Kartographie und Verwaltung erlaubten schließlich auch wieder, von den einverleibten Grenzmarken abzusehen. Nicht die Hecken, sondern die Katasterkarten im Grundbuch gliedern die Erdoberfläche heute so, dass ihre Übertragung zügig und eindeutig vonstattengehen kann.
Die Linienführung löscht Vorausgegangenes. Schon die Einkreisung per Tagesritt hat etwas von der abstrakten Distanz einer Landkarte. Die Zuteilung geschieht auf eine sonderbare, autokratische Weise: als ob da vorher nichts gewesen sei. Den Besitztitel besiegelt nicht die Beziehung zu dem in Frage stehenden Land, nicht das Wissen um seine besondere Beschaffenheit, sondern allein die effektive Gewalt. Die Phantasie, es mit unberührter Landschaft zu tun zu haben, verschleiert, dass es weiterhin der Gewalt bedürfen wird, um innerhalb des Kreises herrschen zu können. Tatsächlich waren aber die masurischen Niederungen nicht unbewohnt, dort lebten baltische Prußen. Weiße Flecken auf der Landkarte hat es stets nur aus der beschränkten Sicht der Eroberer gegeben. Indem einfach neu vermessen, ein neuer Kreis gezogen wird, wird mit allen vorangegangenen Ansprüchen reiner Tisch gemacht. Das Eigentum erhält eine neue Geschichte – die seiner triumphalen Usurpation. Darin geht alles Vorausliegende unter, denn im Aneignungsmythos haben weder lebendige Bezüge noch Spuren der Vergangenheit Platz.
Der Eigentümer ist dem Eigentum in dieser Geschichte äußerlich. Die Eingrenzung des Guts ist zugleich die Abgrenzung von ihm. Vielleicht musste auch deshalb das Bindeglied geopfert werden. Die Stute ist schließlich einerseits Teil des Besitztums, andererseits ist sie der verlängerte Körper des Besitzers. Nur dank ihrer Kräfte konnte er sich zum Herrn aufschwingen. Und ihre Kräfte verweisen auf das Land. Sie wird vor Tagesanbruch gegrast haben, sie musste zwischendurch Wasser saufen. Sich ihrer zu entledigen, sie gewissermaßen dem Boden zuzuschlagen, hilft, den Übergang zwischen Herrscher und Beherrschtem zu verschleiern. Mit der Stute verscharrt der Ritter die Spuren seiner Anhängigkeit – dass er das Land nie allein errungen hätte. So kann dann der bloße Wille des Reiters – genau den richtigen Bogen geschlagen zu haben – dem leblosen Territorium souverän gegenüberstehen.
Das besondere Merkmal modernen Eigentums ist das neue Verhältnis zum vereinnahmten Objekt in Form uneingeschränkter Verfügung. Modernes Eigentum berechtigt den Besitzer nicht nur zu Kontrolle und Gebrauch, sondern auch zu Missbrauch und Zerstörung desselben. Die spätmittelalterliche Geschichte vom Stutenberg enthält diesen Aspekt nur in der Rahmenhandlung. Nach dem Ritt war es mit der Souveränität nämlich erst einmal wieder vorbei. Denn das Gut selbst, das Land, das da angeeignet wird, steht dem Besitzer nachher gerade nicht zur vollen Verfügung. Er selbst und seine erstgeborenen männlichen Nachfahren verwalten es im Namen der Krone. Das Land hat hier noch vormoderne Hecken; es darf als Lehen weder zerstört noch veräußert werden. Die zuschanden gerittene Stute, die das Schicksal des modernen Eigentums vorzeichnet, steht zunächst noch für etwas anderes. Es geht gar nicht so sehr um Besitzmaximierung, denn das Land war tatsächlich nicht lukrativ genug, um sich für ein bisschen mehr dermaßen anzustrengen. Es ging um den Beweis aristokratischer Herrschaftsgewalt. Der Reiter kann sein Pferd nicht einfach deshalb opfern, weil es ihm gehört – diese Logik wird erst später selbstverständlich –, sondern weil er damit in dieser Situation seine frisch erworbenen Standestugenden demonstriert. Wenn man das denn »Tugenden« nennen will.
Land und Leute, Land ohne Leute
Die Version des Eigentums, die uns vollkommen selbstverständlich scheint, ist historisch einmalig. Nur ihrgemäß bedeutet »dies ist mein«, dass ich damit machen kann, was immer ich will. Die Form, die die westliche Moderne für das Besitzen gefunden hat, lautet »absolute Sachherrschaft«. Sie beruht auf einer Vorstellung grenzenloser Verfügung, und sie hat mit Kolonialismus und kapitalistischer Globalisierung jeden Winkel der Welt erobert. Das Prinzip der Sachherrschaft ist in unseren alltäglichen Weltbezug ebenso wie in unsere gewagtesten Vorstellungen eingesickert – auch da, wo wir uns gar nicht mehr direkt auf Eigentum beziehen.
Am Ende der Modernisierung des Eigentumsverständnisses stand die Auffassung des Eigentums als absolute Sachherrschaft, die uns heute selbstverständlich ist. Schon im 18. Jahrhundert definierte ein Zeitgenosse Rousseaus, der britische Rechtsgelehrte William Blackstone, diese neue Form des Besitzens mit Nachdruck als »die alleinige und despotische Herrschaft, die ein Mensch über die Dinge … beansprucht und ausübt«. Nach der Französischen Revolution wurde dann im Code Napoléon die »Despotie« der Eigentümer erstmals in der Geschichte explizit als Recht ausformuliert. Der Eigentümer besaß neben Nutzungs- und Übereignungsrechten auch das ius abutendi, das Recht zum Missbrauch seines Eigentums.
Auch heute verstehen wir Eigentum als, wie es im Bürgerlichen Gesetzbuch heißt, »volles Dingrecht«. Es berechtigt die Eigentümerin dazu, frei über ihr Besitztum zu verfügen. Etwaige Einschränkungen müssen nachträglich formuliert werden, sie gehen von den Interessen anderer Eigentümer_innen, nicht dem Eigentumsverständnis oder den Dingen selbst aus.
Damit das Eigentumsverhältnis solcherart zur absoluten Sachherrschaft werden konnte, musste es sich zuerst aus dem Gefüge feudaler Herrschaft lösen. Das Lehnswesen beruhte auf Frondiensten, Schutzpflichten und vielgestaltigen Gewohnheitsrechten. Die Herrschaft über Land und Leute fiel darin stets in eins. Erst in der Neuzeit gibt es eine Trennung zwischen beiden Formen der Obrigkeit. Die Bedeutung von Herrschaft und Eigentum spaltete sich so, dass Herrschaft, lateinisch imperium, sich fortan bloß auf die Regierung von Menschen bezog. Diese wurden als frei und zumindest potenziell zustimmungsfähig betrachtet. Das Eigentumsverhältnis, lateinisch dominium, wurde auf Dinge beschränkt und zugleich intensiviert.
Die Trennung von Regierung und Eigentum löste den Anspruch auf Besitztitel von der Standeszugehörigkeit. Eigentum stand allen männlichen Bürgern zu, wenn sie es denn erwerben konnten. Der Erwerb wurde mit Arbeit in Zusammenhang gebracht und als solcher auf neue Art legitimiert. Die von John Locke vor über dreihundert Jahren ausformulierte Idee, dass einem zusteht, was man selbst erarbeitet, leuchtet noch immer ein, wenn wir sie uns an seinen Beispielen vor Augen führen: das Einsammeln von Nüssen oder das Ernten auf selbst urbar gemachtem Acker.
Tatsächlich erfolgte ein Teil der Aneignungsprozesse aber weiterhin durch Eroberung. Ins 17. Jahrhundert fiel die Hochzeit der niederländischen Kolonialmacht. Großbritannien baute seine Vorposten in Indien aus, nahm die karibischen Inseln in Besitz und besiedelte in wachsender Konkurrenz mit Frankreich Nordamerika. Der Umgang der in der vermeintlich »neuen« Welt lebenden Menschen mit der Natur wurde dabei als »Nicht-Arbeit« diskreditiert und das Land somit als »herrenlos« bestimmt. Gewitzten Kritikern fiel freilich schon zeitgenössisch auf, dass es nicht ganz ersichtlich sei, warum den nordamerikanischen Jägerstämmen ihre Prärie nicht, dem englischen König der Sherwood Forest hingegen schon gehören solle. Er ritt ja auch nur hindurch und erlegte ab und zu einen Hirsch.
Aber tatsächlich würde auch die königliche Hoheit bald nicht mehr allein als erbliche Würde zu rechtfertigen sein. Gemäß der neuen Vertragstheorien, wie Thomas Hobbes und John Locke sie formulierten, musste die moderne monarchische Regierung sich nicht nur durch Erbfolge legitimieren, sondern auch als Garant des Eigentums bewähren.
Unter männlichen Europäern schuf die Bejahung der Eigentumsordnung eine neue Ebenbürtigkeit, die sich in der beginnenden Aufhebung der Leibeigenschaft und der Übertragbarkeit von Ländereien durch Kauf widerspiegelte. Vor allem schuf sie aber ein vorher undenkbares Versprechen radikaler Freiheit: dass man seinem Hab und Gut gegenüber schalten und walten könne, wie man wolle.
Für westeuropäische Frauen verschlechterte sich indessen im 17. Jahrhundert die Rechtslage, so dass sie nur noch in seltenen Fällen im eigenen Namen Besitz verwalten durften. Das Vermögen verheirateter Frauen ging gemäß der als coverture bezeichneten Ehegesetze ausnahmslos auf ihre Ehemänner über. Auch hier wurde erobert, und nicht nur – wenn überhaupt – das Herz.
Das moderne Eigentum entstand also aus der bröckelnden feudalen Ordnung. Zugleich brach es dem neuen kapitalistischen System Bahn. Mit dem Wandel der Eigentumsform – also der Frage, was »gehören« bedeutete – ging eine Verschiebung der Besitzverhältnisse einher, also der Frage, wem was gehörte. Diese Verschiebung fiel zu Gunsten der bereits Begüterten aus. Die Grundherren besaßen ihr Land nämlich nunmehr auf neue und radikalere Art – sie waren nicht mehr zur Wahrung von Gewohnheitsrechten und der Versorgung ihrer Untertanen verpflichtet. Das machten sie sich in den frühneuzeitlichen Einhegungen – insbesondere in Großbritannien und Süddeutschland – zunutze und schieden Land und Leute nochmals auf handgreiflichere Weise. Sie umzäunten Wiesen und Allmenden, vertrieben die Landbevölkerung und verwendeten den Boden anstatt für deren Selbstversorgung für rentablere Landwirtschaft oder Viehzucht. Karl Marx betrachtete diesen Prozess, den er vor allem am recht späten Beispiel der Landnahme im Schottischen Hochland studierte, als Vorbedingung kapitalistischer Wirtschaft. In der »sogenannten ursprünglichen Akkumulation« wurde einerseits Reichtum konzentriert und eine frühe Form von Agrarkapital geschaffen. Andererseits entstand eine Klasse entwurzelter Besitzloser, die als Arbeitskräfte für das wachsende Manufaktur- und Fabrikwesen einsetzbar waren.
Am Ausgang dieser Entwicklung bietet sich das Bild einer paradoxen Emanzipation. Die freigesetzten Leibeigenen besaßen nun zwar das Recht, selbst Eigentümer zu sein, faktisch hatten sie aber gerade ihren Lebensunterhalt verloren. Als freie Personen galten sie als Besitzer ihrer Selbst. Das machte es den Besitzlosen aber zunächst überhaupt nicht schmackhaft, ihre Arbeitskraft in den neuentstandenen Fabriken und Manufakturen zu verkaufen. Gewöhnt an Allmendewirtschaft und feudale sowie gemeinschaftliche Versorgungsansprüche, suchten sie keine Anstellung, sondern alternative Formen der Selbstversorgung. Warum nicht umherziehen und auf den Straßen sein Glück suchen; warum sich nicht an der Wildnis und am Überfluss anderer bedienen? Trotz gesetzlicher Verfolgung zogen die meisten die Landstreicherei der Lohnarbeit vor und vereinigten sich immer wieder – oft angeführt von Frauen –, um die Hecken und Zäune um ihre vormaligen Äcker und Allmenden zu attackieren. Das Vagabundieren und Landstreichen war eine regelrechte Massenbewegung, die mit drakonischen Strafen gestoppt wurde. Aufgegriffene wurden mit Brandmalen versehen, wie sie auch für Tiere und versklavte Menschen gängig waren.
Die Ordnung hätte vermutlich nicht wiederhergestellt werden können, wenn nicht neben dem unter der Sachherrschaft privatisierten Land zusätzliche Formen fiktiver Eigentumsobjekte entstanden wären. Die gesellschaftliche Ordnung brauchte Kompensationsbesitztümer für die beraubten Selbsteigentümer. So etablierte sich zwischen der vermeintlich säuberlichen Trennung von Regierung und Eigentum, von imperium und dominium, eine neue Form der Herrschaft: »Sachherrschaft« unter Menschen.
Sachherrschaft
Das neue, maßlose Freiheitsversprechen des Eigentums – dass es etwas geben sollte, mit dem man absolut alles machen könne – musste für den Großteil der frühmodernen Bevölkerung ausgesprochen hohl klingen. Denn sie besaßen ja nichts. Die Befreiung aus der Leibeigenschaft mag lästige Fron beendet haben, aber anders als die Grundherren, die plötzlich uneingeschränkt über Wiesen und Wälder verfügten, fehlte den Landlosen der Gegenstand, an dem sie sich der neuen Freiheit hätten versichern können. Dies umso mehr, als sie ihre unmittelbarste Freiheit – gehen zu können, wohin einen die Beine tragen – im Zuge der Vagabunden-Verfolgung auch bereits wieder einbüßten.
Was gab es also zu gewinnen für die Unvermögenden? Warum machten sie nicht einfach damit weiter, alle Zäune auszureißen? Neben der Niederschlagung durch blanke Gewalt, wie etwa im Zuge der Bauernkriege im 16. Jahrhundert, wurden die Landstreicher und Rebellen befriedet, indem ein Teil von ihnen selbst in den Eigentümerstand einstieg. Nicht indem sie materielle Güter, sondern indem sie eigentumsförmige soziale Kontrollmacht gewannen. Die Verdinglichung sozialer Beziehungen nach dem Muster des Eigentums erlaubte es zumindest den weißen und männlichen Besitzlosen, sich ebenfalls zu Sachherrschern aufzuschwingen. Ihr »fiktives« Eigentum kann als geronnene Herrschaft verstanden werden; es besteht in den Verfügungsansprüchen, die die modernen Institutionen der Sklaverei und patriarchalen Ehe bereitstellen. Die Besitzlosen, so könnte man sagen, wurden auf Kosten der Machtlosen entschädigt.
Das Rätsel, warum einem das Eigentum an nichts als seiner Haut als attraktive Freiheit erscheinen solle, löst sich schlagartig, wenn als Kontrast nicht die allmendebegüterte Leibeigenschaft, sondern die moderne Sklaverei herangezogen wird.
Die Institution der Sklaverei war nicht von Anfang an entlang rassistischer Grenzen konzipiert. Im 17. Jahrhundert gab es in den karibischen Kolonien und den Südstaaten noch etliche weiße Schuldknechte, darunter auch viele Frauen. In der »Bacon’s Rebellion« im Bundesstaat Virginia kämpften 1676 englische und afrikanischstämmige Zwangsarbeiter_innen noch gemeinsam gegen die Plantagenbesitzer. Eine Generation später untermauerte der Virginia Slave Code die weiße Vorherrschaft mit gezielter Gesetzgebung, die den Zusammenhalt der Besitzlosen brechen und die Verdinglichung unfreier schwarzer Menschen kodifizieren sollte. Fortan durften keine gemischten Ehen mehr geschlossen werden, das Auspeitschen von versklavten Menschen wurde für legal erklärt und die Versklavung erblich. Weiß zu sein wurde selbst für Besitzlose zu einer Überlegenheitsversicherung, da freie schwarze Arbeitgeber keine Weißen mehr einstellen durften und Weiße unter keinen Umständen mehr versklavt werden konnten. Die Einordnung von Menschen nach äußeren Merkmalen und Abstammungslinien in entweder schwarz oder weiß wurde also ausdrücklich als Eigentumsmarker eingeführt. Hautfarbe galt in der Wirtschaftsordnung der Plantagen und im internationalen System des Sklavenhandels als Etikett, das auswies, wer als Eigentümer und wer als Eigentum zu betrachten war. Zwischenformen gab es in den USA nicht, da alle Kinder gemischter Herkunft kategorisch für schwarz erklärt wurden, um die versklavte Population zu vergrößern und uneheliche Kinder der Plantagenbesitzer von der Erbfolge auszuschließen. In der Geschichte von Kolonialismus und Sklavenhandel wurde die Klassifizierung als »schwarz« somit zum Zeichen der potenziellen Verfügbarkeit von Personenstatus, Arbeit und Mobilität.
Die Sklaverei diente nicht nur den überseeischen, sondern auch den über sie informierten europäischen Arbeiter_innen als Kontrastfolie für das eigene Los. Erst im Rahmen weißer Sachherrschaft war es möglich, der leidigen Freiheit als Selbsteigentümer genug abzugewinnen, um seine Arbeitskraft und Lebenszeit bereitwillig in der Lohnarbeit zu verdingen. Trotz dieses stabilisierenden Kontrasts fehlte aber den mittellosen Selbsteigentümern eine äußere Sphäre der Verfügung – die eigene Arbeitskraft musste man schließlich umgehend wieder den Fabrikanten, Manufakturbesitzern, Kapitänen und Herren übereignen. Es war die patriarchale Sachherrschaft, die es einem Teil der Besitzlosen in Europa – wie auch den Besitzenden und weißen Siedlern in den Kolonien – ermöglichte, die Willkürfreiheit des Eigentümers zu genießen.
Die Neufassung des Geschlechterverhältnisses ergab sich nicht ohne Gewalt. Die materialistische Feministin Silvia Federici hat in einer atemberaubenden Rekonstruktion der Hexenverfolgungen gezeigt, inwiefern diese zweihundertjährige Terrorkampagne gegen Frauen zur frühneuzeitlichen Transformation der Eigentumsverhältnisse beitrug. In der Dämonisierung des Wissens, das unter Frauen bezüglich Fragen der Geburt, Verhütung und Abtreibung kursierte, sieht Federici eine Fortsetzung der Enteignung von als Allmende geteilten Lebensgrundlagen. Sie entschlüsselt die historischen Kämpfe um weiblichen Gehorsam, um Zusammenschluss jenseits patriarchalem Einfluss, um Geschlechtsumwandlung und um Sodomie, sexuellen Exzess und sexuelle Unverfügbarkeit als Widerstand gegen die Enteignung von Frauen durch kirchliche und staatliche Obrigkeit. In der Inquisition und im verschärft patriarchalen Eherecht ging es aber nicht nur um die Übertragung vorher bestehender Vermögen – es ging darum, die vormodernen Geschlechterbeziehungen in eine neue Form zu überführen, die dem Verhältnis zwischen souveränem Eigentümer und verfügbarer Ressource entsprach.
Die Ehe unter Vormundschaft gewährte jedem Ehemann den Zugang zu einem Stück eingehegten Lebens. Ihm gehörte die volle Versorgungstätigkeit der Ehefrau: Anspruch auf ihr Vermögen, Entscheidungsmacht darüber, ob sie einer Lohnarbeit nachging, Recht auf sexuellen Zugriff, Verfügung über die Nachkommen. Diese verschiedenen Aspekte lassen sich als »Reproduktionsfähigkeit« zusammenfassen: all die lebendige Sorge und Regenerationstätigkeit, die ein Mensch aufbringen kann. Dass es überhaupt möglich wurde, diesen Komplex menschlichen Wirkens als »Weiblichkeit« einzuzirkeln, verdankt sich auch der modernen Sphärentrennung in häusliche Versorgungsarbeit und außerhäusige Lohnarbeit – ein bürgerliches Ideal, das mühsam gegen die Arbeiter_innenklasse durchgesetzt werden musste. Es war schließlich für Arbeiterinnen viel naheliegender, ihre Kleinkinder mit in die Fabrik zu bringen und dort zu stillen, als sie zu Hause in Obhut der Geschwister zu lassen oder sogar selbst ohne Lohn zu Hause zu bleiben. Räumliche Aufteilung ebenso wie bürgerliche Moral und Sexualität halfen, die Reproduktionsfähigkeit abzugrenzen und mehr und mehr als Attribut vergeschlechtlichter Körper statt als Aufgabenbereich menschlicher Tätigkeit darzustellen.
Es war die Ordnung der Sachherrschaft, die aus Frauen aneigenbare und in der Vereinzelung der Ehe jeweils dem männlichen Willen unterstehende Wesen machte. Als solche gaben sie Anlass zu dem Unbehagen, das Gewalt gegen Frauen bis heute strukturiert: dass sie ihrem Mann gehören sollen und doch lebendig genug sind, um ständig Zweifel an dessen exklusiver Verfügung aufkommen zu lassen. Schließlich wurden Hexen auch nicht als Verteidigerinnen der Allmende verbrannt, wie es bei Federici manchmal klingt, sondern als Eigentum – nur eben leider des falschen Mannes: in diesem Fall des Teufels.
Soziale Sachherrschaft ist die Verfügung über Aspekte lebendiger Gegenüber, als seien sie Eigentum. Dazu muss dieser Aspekt – etwa als Hautfarbe oder Geschlecht – eingegrenzt, abgelöst und externer Gewalt unterstellt werden. Und zwar, nach Maßgabe der modernen Eigentumsform, voll und uneingeschränkt unterstellt – als sei alles so umschriebene eine Sache. Was da übereignet wird, war nicht immer schon da, jedenfalls nicht in derselben Form. Es wird in der Markierung geschaffen. Unsere Körper sind das Ergebnis von vier Milliarden Jahren Evolution, aber sie sind zugleich die Reliefs menschlicher Herrschaftsbeziehungen. Eingewachsene Mauern sozusagen, auch hier.
Phantombesitz
Die Verheißung des modernen Eigentums schafft eine heikle Souveränität. Will sie sich ihrer selbst vergewissern, kann sie das nur im Exzess: Einmal in Frage gestellt, kann sie sich nur beweisen, wenn sie die Willkürfreiheit voll ausschöpft. So weiß der Sachherrscher erst, dass ihm etwas wirklich gehört, wenn es tot ist. Fjodor Dostojewski führt in seinem Roman Schuld und Sühne in einer düsteren Szene diesen Handlungsspielraum folgendermaßen vor Augen:
›Macht Platz!‹ brüllt Mikolka wie rasend, wirft die Deichsel fort, bückt sich abermals in den Wagen und holt eine eiserne Brechstange hervor. ›Aufgepaßt!‹ ruft er und läßt mit allen Kräften die Stange auf sein armes Pferd niedersausen. Der Schlag dröhnt dumpf; das Tier schwankt, knickt ein, will noch einmal anziehen, aber die Eisenstange trifft es mit voller Wucht ein zweites Mal auf den Rücken, und es stürzt zu Boden, als hätte man ihm alle vier Beine zugleich abgehackt … . Mikolka stellt sich an der Seite auf und drischt mit der Brechstange sinnlos auf den Rücken des Tieres ein. Die Stute streckt den Kopf vor, schnaubt noch einmal schwer und ist tot. ›Aus ist’s mit ihm!‹ schreit es in der Menge. ›Ja, warum ist es nicht im Galopp gelaufen!‹
›Es ist ja mein Eigentum!‹ kreischt Mikolka, die Brechstange in der Hand; seine Augen sind blutunterlaufen. Er steht da, als täte es ihm leid, daß niemand mehr da ist, den er prügeln könnte.
Dass rassistische Sachherrschaft und mitunter auch das Patriarchat seine Unterdrückten in die Nähe von Tieren rückt, hat nichts mit größerer Nähe zu Natur oder animalischen Regungen zu tun – es verdankt sich der geteilten Form des Eigentums, die auch Tieren gegenüber historisch entstanden ist. Dostojewskis grausige Szene markiert fraglos einen Extrempunkt eigentumsförmiger Gewalt, aber es ist ein Extrempunkt, der fest innerhalb der modernen Gesellschaft installiert ist. Mikolka handelt im Rahmen von Recht und Gesetz, ja mehr noch, er macht von eben jener Freiheit Gebrauch, die uns als moderne Selbsteigentümer auszeichnet. Man kann versuchen, Mikolkas Exzess einzuklammern. Dass die dumpfe Freiheit des Eigentümers ihn zur Willkür berechtigt, heißt ja nicht, dass er sie auch üben muss. Die meisten Menschen haben zartere Gefühle; meist hat doch gerade der Eigentümer Interesse daran, sein Eigentum zu erhalten. Aber all dies schafft die Sphäre nicht aus der Welt, die dadurch definiert ist, Zerstörung legitim zu machen. Sicher, als Eigentümer mag man sein Eigentum erhalten wollen, aber in welcher Form? Lebend hat das lahme Pferd Mikolka nichts mehr genützt.
Ein Mittel, um all die Domänen der Herrschaft einzudämmen, die in der modernen Geschichte zwischen Mensch-Regierung und Ding-Besitz gewuchert sind, ist rechtlicher Art. Viele Emanzipationsbestrebungen der letzten zweihundert Jahre haben darauf gedrängt, den vollen, unversehrten Selbstbesitz aller Menschen auf rechtlicher Ebene abzusichern. Es sind Fortschritte zu verzeichnen, auch wenn es in den Details schleppend geht: Vergewaltigung in der Ehe wurde erst 1996 verboten; volle Abtreibungsrechte bleiben Frauen vorenthalten; Mobilität wird vielerorts weiterhin eingeschränkt. Dennoch ist es in liberalen Demokratien gelungen, das rechtlich gesicherte Eigentum an anderen Menschen abzuschaffen und das an anderen Tieren durch Tierschutzbestimmungen einzuschränken.
Der Entzug ihrer Objekte schafft die Aspirationen der Sachherrschaft aber nicht automatisch aus der Welt. Auch hier gilt das Diktum von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer: dass die vollends aufgeklärte Erde im Zeichen triumphalen Unheils strahlt. Denn der neuerrungene Selbst-Besitz der einen erscheint den anderen als Amputation, als Verlust einer äußeren Sphäre ihres Willens. Was übrig bleibt, ist ein gespenstischer Schatten der überwundenen Herrschaft. Anstelle der Sachherrschaft macht sich »Phantombesitz« breit. Wie ein Schmerz an einer leeren Stelle, dort, wo früher ein Glied war, dass man kontrollieren konnte, bleiben die gegenstandslosen Herrschaftsansprüche bestehen. Sie bilden »Phantombesitz«.
Phantombesitz ist ein Grundbaustein moderner Identitäten. Er besteht einerseits im Anspruch über bestimmte andere zu verfügen und andererseits darin, auf bestimmte Weisen als verfügbar zu erscheinen. Phantombesitz kann man also haben – oder sein. Phantombesitz ist keine volle Sachherrschaft, denn er beruht nach rechtlicher Emanzipation nicht mehr auf institutionell überschriebenem Eigentum.
Besitz, im Gegensatz zu Eigentum, ist ein abgeleiteter Titel, der demjenigen zukommt, der über ein Gut unmittelbar, aber nicht absolut verfügt. Derjenige also, dem zum Beispiel in Pacht oder Miete die Nutzung überlassen wurde. Moderne Identitäten sind in gewisser Weise eine Erbpacht der Sachherrschaft. Wir haben ihre Muster und Hierarchien verinnerlicht. Wir können die Sachherrschaftsgelüste beschränken, wir können die Grenzen des neuen, emanzipativen Selbstbesitzes befestigen, aber noch haben wir fast alle ein allzu gutes Gespür dafür, wer im Zweifelsfall nimmt und wer genommen wird. So reaktiviert der Phantombesitz die Sachherrschaft episodisch, indem er den Kreis um ihre Affekte und Begierden geschlossen hält.
Tatsächlich ist eine der bemerkenswertesten Begleiterscheinungen des Zugewinns an weiblicher Gleichberechtigung in den letzten Jahrzehnten eine Intensivierung der Markierung, eine Einteilung der ganzen Welt in Blau und Rosa. Frauen müssen sich längst nicht mehr alles gefallen lassen. Sie werden – zumal mit dem kapitalistischen Wettbewerb im Nacken – regelrecht darauf getrimmt, sich bloß nie über den Tisch ziehen zu lassen. Aber sie müssen die Welt mit rosa-roter Schönheit ausstatten und weiter für andere mit aufräumen. Und sie haben kaum eine Ahnung, wie es sich anfühlen würde, keine Angst vor Übergriffen zu haben – sie wissen also sehr genau, was es heißt, Phantombesitz zu sein.
Was rassistischen Phantombesitz betrifft, können sich weiße Europäerinnen wie ich auf eine ganze öffentliche Infrastruktur verlassen, die mir nahezu weltweite Bewegungsfreiheit und einen gesicherten Personenstatus gewährt, während andere im Mittelmeer ertrinken oder – wie Sachen – in Lagern deponiert werden. Sie haben sich einer Mobilität schuldig gemacht, die für sie nicht vorgesehen ist. Und wo die Mobilität gewährt wird, lichtet sich die Verfügbarkeit nicht. Migrant_innen wird oft begegnet wie potenziellen Eindringlingen. Es ist ja nicht ihr Land; jede Lebensäußerung kann als Angriff auf den Phantombesitz der Eingesessenen empfunden werden.
Zugleich werden schwarze Deutsche, muslimische oder für muslimisch gehaltene Deutsche und andere People of Colour in der Öffentlichkeit, in Erziehungseinrichtungen und von Seiten der Polizei anders behandelt als weiße. Und dieses »anders«, das alle Rassismuserfahrenen bezeugen können und viele weiße Deutsche immer wieder aus der Welt zu reden versuchen, ist nicht einfach eine Abwertung oder Hierarchisierung. Einen Menschen rassistisch zu sehen heißt, ihn – als potenzielles Ding oder als potenziellen Dieb – in die Nähe des verfügbaren Eigentums zu rücken. Wo dieser Mensch sich aufhält, was er tut und worauf er Anspruch hat, ist plötzlich die Angelegenheit seines weißen Gegenübers – so äußert sich weißer Phantombesitz. Und gerade weil historisch die extremsten Formen dieser Verdinglichung und Kriminalisierung ausagiert worden sind, erlauben sich Weiße gegenüber denjenigen, denen diese historischen Traumata allzu präsent sind, ständig eine unheimliche Selbstgerechtigkeit. Denn es gibt unzählige Varianten der skalierten rassistischen Wahrnehmung. Als »wirklich rassistisch« setzt man dann immer die Variante, die man sich selbst »nie erlauben« würde, und profiliert dagegen seine eigene Verfügbarkeitsprojektion als legitim. Man fragt ja nur, wo jemand herkommt, man will die Person gar nicht dorthin zurückschicken. Die rechtsextreme Jugendorganisation »Die Identitären« beschreibt sich auch als nicht rassistisch. Sie hätten nichts gegen schwarze, muslimische, türkische, arabische und asiatische Menschen – solange diese woanders lebten. In einem genozidversierten Land gibt es immer noch eine Endlösung, dergegenüber der eigene Rassismus relativiert werden kann.
Gewalt findet weiter statt, auch wenn sie rechtlich sanktioniert ist. Und sie findet nicht in wahllosen, spontanen Exzessen statt, sondern folgt merklich den patriarchalen und rassistischen Aneignungsmustern. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Expartner ermordet. Im Jahr 2017 kam es zu 326 tätlichen Übergriffen auf Asylsuchende – mit Messern, Schlagstöcken, Schusswaffen und in einem Fall Hammerschlägen direkt ins Gesicht. Mikolka lässt grüßen, aber Mikolka macht von Mustern Gebrauch, die ihm unsere Gesellschaften überreicht haben. Die Gräben und die Verfügungsansprüche sind nach wie vor als Phantombesitz eingewachsen. Wir können uns eine Person kaum vorstellen, ohne die Markierungen abzumessen. Geschlecht. Hautfarbe. Status. Manche können vereinnahmt werden; andere vereinnahmen. Wenn man an einer Figur wie Mikolka nur die brutalen Mittel skandalisiert – den Knüppel in der Hand – und nicht die historisch vorgezeichnete Hiebrichtung erkennt, verleugnet man noch in der Kritik Phantombesitz.
Indessen finden sich mehr und mehr Kontexte, in denen direkt zur Verteidigung der amputierten Ansprüche übergegangen wird. Der Zerstörungswut, mit der einige Gruppen ihre vermeintliche Enteignung rächen und ihren Phantombesitz verteidigen wollen, begegnet frappierend viel Verständnis. Gejohlt wird nicht nur am Straßenrand, gejohlt wird auch am Katheder und im Kulturteil.
»Es geht ja auch alles ein bisschen zu weit!« (Nein, es hat noch gar nicht ernsthaft angefangen.)
»Man weiß gar nicht mehr, was man sagen darf!« (Umso besser, dann können wir vielleicht schönere Worte finden.)
»Das macht die Leute verrückt!« (Die Leute sind wir alle. Und verrückt waren wir schon vorher.)