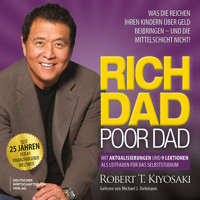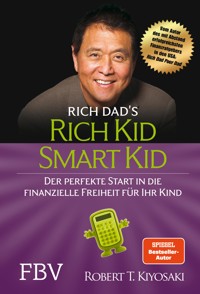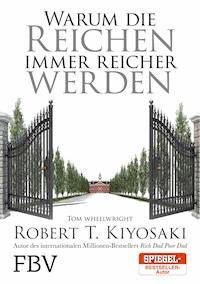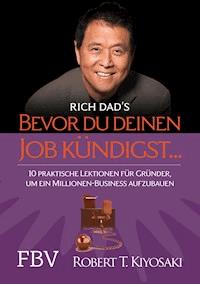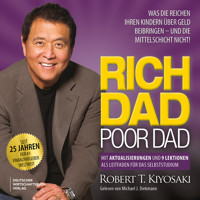
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil die Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld umgehen müssen, und die anderen nicht! Die meisten Angestellten verbringen im Laufe ihrer Ausbildung lieber Jahr um Jahr in Schule und Universität, wo sie nichts über Geld lernen, statt selbst erfolgreich zu werden. Robert T. Kiyosaki hatte in seiner Jugend einen »Rich Dad« und einen »Poor Dad«. Nachdem er die Ratschläge des Ersteren beherzigt hatte, konnte er sich mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Er hatte gelernt, Geld für sich arbeiten zu lassen, statt andersherum. In Rich Dad Poor Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie jeder erfolgreich sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
WAS DIE REICHENIHREN KINDERN ÜBER GELDBEIBRINGEN – UND DIEMITTELSCHICHT NICHT!
RICHDAD
POOR DAD
Robert T. Kiyosaki
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Wir freuen uns auf eure Anregungen und Fragen [email protected]
Wichtiger Hinweis
Die im Buch veröffentlichten Empfehlungen wurden von Verfasser und Verlag erarbeitet und geprüft. Der Inhalt dieses Buches beruht ausschließlich auf den persönlichen Erfahrungen des Autors und erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Die benutzten Begrifflichkeiten sind wertfrei. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen, Sach und Vermögensschäden ausgeschlossen.
1. Auflage 2025© 2025 Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag,Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag GmbH, ChristophRodtStraße 11, 86476 Neuburg an der Kammel www.deutscherwirtschaftsbuchverlag.comAlle Rechte vorbehalten.
Copyright der Originalausgabe: © 1997, 2011, 2017, 2022 by Robert T. Kiyosaki This edition published by arrangement with Rich Dad Operating Company, LLC.First edition [05] [2025] First German edition printed by Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag.
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors nicht zulässig. Das gilt gleichermaßen für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Verfilmungen und Einspeicherung und Verarbei tung in elektronischen Systemen. Wir behalten uns die Nutzung der Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. Falls die Publikation Links zu externen Webseiten Dritter enthält, haben wir auf deren Inhalte keinen Einfluss; für diese fremden Inhalte können wir keine Gewähr übernehmen. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung nicht erkennbar.
Auch wenn eine gendergerechte Sprache wünschenswert ist, gibt es aus Sicht des Verlages bisher keine befrie digende, gut lesbare Lösung. Der leichten Lesbarkeit zuliebe haben wir des Öfteren von der Doppelung männlicher und weiblicher Formen Abstand genommen. Selbstverständlich liegt es uns fern, dadurch einen Teil der Bevölkerung zu diskriminieren.
Übersetzung: Petra Pyka Satz: inpunkt[w]oKorrektorat: Silvia Kinkel, Rainer WeberCover und Umschlaggestaltung: www.b3kdesign.de, © 2025 Andrea Schneider & diceindustries Coverfoto: Seymour & Brody StudioIllustration: CASHFLOW, Rich Dad, Rich Dad Advisors, and ESBI are registered trademarks of CASHFLOW Technologies, Inc.; Cone of Learning from Dale. AudioVisual Methods in Teaching, 1 E. © 1969 SouthWestern, a part of Cengage, Inc. Reproduced by permission.eBook: ePUBoo.com
ISBN Print: 9783690660426ISBN EBook (PDF): 9783690660440ISBN EBook (EPUB, Mobi): 9783690660432
»Rich Dad Poor Dad ist der richtige Einstieg für jeden, der seine finanzielle Zukunft in den Griff bekommen möchte.«
USA TO
WARUM MEILENSTEINESO WICHTIG SIND
Menschen aller Kulturen und Länder feiern Meilensteine.
Anhand von Meilensteinen messen wir Zeit, zeigen Fortschritte auf, re flektieren Gelerntes und honorieren Leistung. In Meilensteinen bringen wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zusammen. Wir bli cken auf unsere Anfänge zurück, schauen darauf, wo wir heute stehen … und darauf, was uns die Zukunft verspricht.
Meilensteine verleihen einer Reise Bedeutung. Sie helfen uns, nicht nur jeden kleinen Schritt zu würdigen, sondern auch die großen Sprünge an zuerkennen, die uns nach vorn katapultieren. Ob es um einen Geburtstag geht oder um ein Jubiläum, darum, wie viele Jahre sich ein Unternehmen schon gegen die Konkurrenz durchsetzt, um den Tod einer Ikone oder um eine Innovation, die unser Leben verändert – Meilensteine sind Teil dessen, was wir sind … und was wir werden.
Seit der Erstveröffentlichung von Rich Dad Poor Dad – vor 25 Jahren am 8. April 1997 – ist ein Vierteljahrhundert vergangen. Unsere Welt hat sich seither gewaltig verändert. Unverändert besteht jedoch die dringende Not wendigkeit, sich Finanzbildung anzueignen, die auch heute noch viel be wirken kann.
Geld ist nach wie vor eine tragende Säule unseres Lebens, ob uns das gefällt oder nicht. Und die Technologie hat Tempo und Innovationen in die Welt des Geldes gebracht. Umso mehr Grund, so scheint es, zu tun, was wir können, um klüger mit unserem Geld umzugehen, so viel wie möglich darüber zu lernen und unsere finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
Anlässlich dieses Meilensteins, den The Rich Dad Company feiert, blicke ich bewundernd auf die Geschichten von Menschen aus aller Welt, die die RichDadGrundsätze in ihrem Leben umgesetzt haben und an ihre Ange hörigen und Freunde weitergeben, was sie gelernt und erreicht haben.
Die letzten 25 Jahre sind wie im Flug vergangen. Und in so vieler Hin sicht haben wir den »weniger begangenen« Weg gemeinsam zurückgelegt. Ich habe gelernt, dass ich immer noch vieles nicht weiß … und ich lerne weiter. Doch eines weiß ich sicher: Mein Leben ist heute reicher, und das verdanke ich den Millionen Menschen in aller Welt, die Finanzbildung für sich entdeckt haben – als wichtiges, effektives Werkzeug zur Gestaltung einer Zukunft, die sie verdienen.
Robert Kiyosaki
Die Lektionen aus Rich Dad Poor Dad haben sich bewährt
Obwohl inzwischen 25 Jahre vergangen sind, seit Rich Dad Poor Dad er schienen ist, werden Sie feststellen, dass sich das Buch kaum verändert hat. Wir haben das Cover im Laufe der Jahre ein paar Mal aktualisiert und anlässlich des Meilensteins eines 20jährigen Jubiläums ein paar Margi nalien und Anmerkungen ergänzt. Mehr aber auch nicht, denn die Lehren über Geld und die Grundsätze von Rich Dad Poor Dad haben sich nicht verändert.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn er belegt, dass dieses häufig als »Klas siker« bezeichnete Buch über privates Finanzmanagement dem Zahn der Zeit standgehalten hat.
Neue Generationen stellen fest, dass jeder die zeitlose Weisheit und die pragmatischen Lektionen dieses Buches in seinem eigenen Leben anwen den kann. Ich danke all den Eltern und Großeltern, Tanten und Onkeln, Mentoren, Lehrern und Vordenkern aus aller Welt, die Exemplare von Rich Dad Poor Dad an die Menschen weitergegeben haben, die ihnen am Herzen liegen.
Wenn diese Jubiläumsausgabe in Druck geht, ist Rich Dad Poor Dad nach wie vor die Nummer eins unter allen je geschriebenen Büchern über pri vates Finanzmanagement, bricht weltweit Verkaufsrekorde und belegt auf Amazons Bestsellerlisten hartnäckig den ersten Platz in den Kategorien »Personal Finance«, »Parenting« und »Investment«.
Es wurde in 38 Sprachen übersetzt und weltweit über 40 Millionen Mal verkauft.
RTK
An alle Eltern, die ersten und wichtigsten Lehrer eines Kindes, und an alle, die Kinder erziehen, prägen und ihnen ein Vorbild sind.
INHALT
25 Jahre …MEILENSTEINE UND RÜCKBLICK
Vor fünf Jahren, als wir mit dem 20. Jahrestag der Erstveröffentlichung von Rich Dad Poor Dad unseren ersten bedeutenden Meilenstein erreicht hatten, schrieb ich Folgendes:
Am 1. Juni 1967 brachten die Beatles ihr Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band heraus. Es war ein durchschlagender kommerzieller Erfolg, stand 27 Wochen lang an der Spitze der britischen AlbumCharts und war 15 Wochen lang die Nummer eins in den Vereinigten Staaten. Time Magazine bezeichnete Sgt. Pepper als »historischen Moment in der Entwicklung der Musik«. Das Album gewann 1968 vier Grammy Awards sowie den Titel Album of the Year – als erstes RockAlbum, dem diese Ehre zuteilwurde.
Rich Dad Poor Dad wurde vor 20 Jahren veröffentlicht, an meinem 50. Ge burtstag, dem 8. April 1997. Anders als das BeatlesAlbum war es nicht sofort ein Erfolg – und schon gar kein durchschlagender. Tatsächlich war nach der Veröffentlichung des Buches und dem daraufhin einsetzenden Feuersturm der Kritik sogar das Gegenteil der Fall.
Rich Dad Poor Dad erschien ursprünglich im Selbstverlag, denn alle Verle ger, denen wir es angeboten hatten, lehnten es ab. Manche Absagen enthiel ten Kommentare wie: »Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie sprechen.« Ich begriff: Die meisten Verleger glichen offenbar eher meinem hochgebilde ten armen Vater, nicht meinem reichen. Die meisten Verleger fanden nicht gut, was mein reicher Vater über Geld zu sagen hatte … so wie mein armer Vater.
20 Jahre später
1997 war Rich Dad Poor Dad eine Warnung – ein Buch mit Lehren über die Zukunft.
20 Jahre später kennen Millionen von Menschen die Warnungen meines reichen Vaters und seine Lehren über die Zukunft. Weil man hinterher klü ger ist, halten viele seine Lehren inzwischen für Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Ein paar dieser Lehren sind:
Rich-Dad-Lektion Nr. 1: »Die Reichen arbeiten nicht für Geld.
« Vor 20 Jahren lehnten mehrere Verleger mein Buch ab, weil sie mit dieser ersten Lektion meines reichen Vaters nicht einverstanden waren.
Heute sind sich die Menschen der wachsenden Kluft zwischen den Rei chen und allen anderen stärker bewusst. Von 1993 bis 2010 flossen über 50 Prozent des Zuwachses beim Nationaleinkommen in den Vereinigten Staaten dem reichsten 1 Prozent der Bevölkerung zu. Das hat sich seither tendenziell noch verstärkt. Ökonomen an der University of California haben festgestellt, dass 95 Prozent der Einkommenszuwächse zwischen 2009 und 2012 ebenfalls auf dieses reichste 1 Prozent entfielen.
Die Lehre: Einkommenssteigerungen landen bei Unternehmern und In vestoren, nicht bei den Angestellten – nicht bei den Menschen, die für Geld arbeiten.
Rich-Dad-Lektion: »Die Sparer sind die Dummen.«
Vor 20 Jahren widersprachen die meisten Verleger dieser Lektion meines reichen Vaters vehement. Für die Armen und die Mittelschicht ist »Sparen« eine Religion – die finanzielle Erlösung von Armut und der Schutz vor der grausamen Welt. Sparer als »die Dummen« zu bezeichnen, finden viele geradezu grotesk.
Die Lehre: Ein Bild ist mehr wert als 1000 Worte. Schauen Sie sich den Chart an, der den Dow Jones Industrial Average über 120 Jahre abbildet. Dann sehen Sie sofort, warum die Sparer die Dummen sind – und wie es dazu gekommen ist.
Der Chart zeigt, dass es in den ersten zehn Jahren dieses neuen Jahrhun derts drei heftige Börsenstürze gab. Der Chart auf der Folgeseite illustriert diese drei Crashs.
Der erste Einbruch war der DotcomCrash um das Jahr 2000. Als Zweites und Drittes folgten der ImmobilienCrash von 2007 und im Anschluss der BankenCrash von 2008.
Der große Crash von 1929
Ein Vergleich der ersten drei BörsenCrashs des 21. Jahrhunderts mit dem großen Crash von 1929 vermittelt einen Eindruck davon, wie unbestreitbar groß die ersten drei Börsencrashs dieses Jahrhunderts tatsächlich waren.
Das Anwerfen der Druckmaschinen
Nachstehende Grafik zeigt, dass die USRegierung und die USNotenbank (Federal Reserve) nach jedem Crash prompt begannen, »Geld zu drucken«.
Die Rettung der Reichen
Vorgeblich, um die Wirtschaft zu retten, senkten die Banken in aller Welt in der Zeit von 2000 bis 2016 immer wieder die Zinsen und druckten Geld.
Während unsere Regierungschefs angeblich die Welt retten wollten, retteten sich die Reichen in Wirklichkeit selbst – und ließen die Armen und die Mit telschicht im Regen stehen.
Heute sind die Zinsen in vielen Ländern im negativen Bereich, weshalb die Sparer die Dummen sind. Die größten Verlierer sind aktuell die Armen und die Mittelschicht – die Menschen, die sparen und arbeiten, um Geld zu verdienen.
Rich-Dad-Lektion: »Ihr Haus ist kein Vermögenswert.«
Vor 20 Jahren, also 1997, hatte jeder Verleger, der mir eine Absage schickte, etwas an der RichDadLektion auszusetzen, dass »ein Eigenheim kein Ver mögenswert« ist.
Zehn Jahre später, nämlich 2007, als die ersten minderwertigen Hypo theken von den Kreditnehmern nicht mehr bedient wurden, platzte die glo bale Immobilienblase und Millionen von Eigenheimbesitzern mussten auf die harte Tour lernen, dass mein reicher Vater recht hatte. Ihr Haus war eben doch kein Vermögenswert.
Das eigentliche Problem
Die meisten Menschen wissen nicht, dass der Immobiliencrash gar keiner war.
Es waren nicht die Armen, die den Immobiliencrash auslösten. Es waren die Reichen. Die Reichen erfanden finanztechnische Produkte, die als De rivate bezeichnet werden – Produkte, die Warren Buffett zu »finanziellen Massenvernichtungswaffen« erklärte. Als die ersten solcher Waffen explo dierten, brach der Immobilienmarkt zusammen. Die Schuld schob man den armen Menschen zu, die minderwertige Hypotheken aufgenommen hatten.
2007 waren Finanzderivate in Höhe von schätzungsweise 700 Billionen Dollar in Umlauf.
Heute wird das Volumen an Finanzderivaten auf 1,2 Billiarden Dollar ge schätzt. Man könnte auch sagen, das Problem ist nur noch größer gewor den, nicht kleiner.
Rich-Dad-Lektion: »Warum die Reichen weniger
Steuern zahlen«. Vor 20 Jahren kritisierten einige Verleger an Rich Dad Poor Dad, dass darin offengelegt wurde, wie und warum die Reichen weniger Steuern zahlen. Einer fand diese Lektion sogar gesetzeswidrig.
Zehn Jahre später, 2007, trat Präsident Barack Obama im Rennen um die Wiederwahl gegen den ehemaligen Gouverneur Mitt Romney an. Als bekannt wurde, dass Präsident Obama Steuern in Höhe von rund 30 Prozent seines Einkommens abführte, Gouverneur Romney aber nur 13 Prozent, be gann Mitt Romneys Niedergang, der ihn den Wahlsieg kosten sollte. Auch bei der USPräsidentenwahl 2016 waren Steuern wieder ein wichtiges Thema.
Doch statt herauszufinden, wie Menschen wie Mitt Romney und Präsi dent Donald Trump es anstellen, legal weniger Steuern zu zahlen, ärgern sich die Angehörigen der unteren und mittleren Einkommensschichten darüber.
Präsident Trump verspricht zwar, die Steuern für die Armen und die Mit telschicht zu senken, doch in Wahrheit werden die Reichen immer weni ger Steuern zahlen. Der Grund dafür geht auf die erste RichDadLektion zurück: »Die Reichen arbeiten nicht für Geld.« Solange jemand für Geld arbeitet, wird er auch Steuern zahlen.
Selbst als Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton versprach, die Steuern für die Reichen anzuheben, meinte sie damit die Besteuerung hoher Ein kommen – von Menschen wie Ärzten, Schauspielern und Anwälten –, nicht die Besteuerung der wirklich Reichen.
Vor 20 Jahren
Obwohl Rich Dad Poor Dad nicht auf Anhieb so erfolgreich war wie das Sgt.-Pepper-Album der Beatles, schaffte es das Buch im Jahr 2000 auf die Bestsellerliste der New York Times und konnte sich dort fast sieben Jahre lang halten. Im selben Jahr kam der Anruf von Oprah Winfrey. Eine ganze Stunde lang war ich bei Oprah! zu sehen. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.
Rich Dad Poor Dad hat sich zum erfolgreichsten Finanzratgeber der Ge schichte entwickelt. Schätzungen zufolge wurden von den Büchern der Rich DadReihe weltweit fast 40 Millionen Exemplare verkauft.
Gab es den reichen Vater wirklich?
Millionen fragen: »Gab es tatsächlich einen reichen Vater?« Die Antwort auf diese Frage kann Ihnen sein Sohn Mike geben – als Gast der Rich Dad Radio Show. Die Sendung können Sie auf Richdadradio.com nachhören.
Die weiterführende Rich-Dad-Schule
Rich Dad Poor Dad wurde so einfach wie möglich geschrieben, damit auch wirklich jeder die Lektionen meines reichen Vaters verstehen kann.
Wer anlässlich des 20. Jubiläums gern mehr erfahren möchte, für den habe ich Warum die Reichen immer reicher werden geschrieben.
Warum die Reichen immer reicher werden geht in die Tiefe und erklärt de tailliert, was unser reicher Vater seinem leiblichen Sohn und mir wirklich beigebracht hat, wenn es um Geld und Kapitalanlage geht.
Warum die Reichen immer reicher werden ist sozusagen Rich Dad Poor Dad für Fortgeschrittene – die weiterführende Schule für alle RichDadZöglinge.
Eine Warnung … und eine Einladung
Ich habe mir große Mühe gegeben, Warum die Reichen immer reicher werden möglichst einfach zu formulieren, doch das, was die Reichen tun, ist nicht so einfach – und auch nicht so leicht zu erklären. Es erfordert finanzielle Vorbildung, und die wird in unseren Schulen nicht vermittelt.
Ich empfehle Ihnen, zunächst Rich Dad Poor Dad zu lesen, und dann, wenn Sie mehr wissen möchten, vielleicht noch Warum die Reichen immer reicher werden.
VIELEN HERZLICHEN DANK … FÜR 25 FANTASTISCHE JAHREAll unseren Lesern, den früheren, den gegenwärtigen und den zukünftigenIhnen von uns allen bei The Rich Dad Company:»Danke für 25 unglaubliche Jahre.« Unsere Mission ist es, das finanzielle Wohlergehen der Menschen zu steigern, und das beginnt immer mit einem Leben und einem Menschen.
EinleitungRICH DAD POOR DAD
Mit zwei Vätern hatte ich die Wahl zwischen zwei sehr unterschiedlichen Ansichten: denen eines reichen und denen eines armen Mannes.
Ich hatte zwei Väter – einen reichen und einen armen. Einer war sehr gebil det und hochintelligent. Er hatte promoviert und ein eigentlich vierjähriges Studium in nur zwei Jahren absolviert. Anschließend studierte er an der Stanford University, der University of Chicago und der Northwestern Uni versity weiter, stets mit Vollstipendien. Mein anderer Vater hat nicht einmal die achte Klasse beendet.
Beide waren beruflich erfolgreich und haben ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet. Beide verdienten nicht schlecht. Doch nur einer litt immer un ter finanziellen Problemen. Der andere avancierte zu einem der reichsten Männer Hawaiis. Einer vererbte seiner Familie, verschiedenen gemeinnützi gen Organisationen und seiner Kirche zig Millionen Dollar. Der andere hin terließ bei seinem Tod unbezahlte Rechnungen.
Beide Männer waren stark, charismatisch und einflussreich. Beide gaben mir Ratschläge, rieten mir aber nicht dasselbe. Beide waren überzeugt vom Wert der Bildung, empfahlen aber unterschiedliche Bildungswege.
Mit nur einem Vater hätte ich seinen Rat annehmen oder ablehnen müs sen. Aber bei zwei Vätern konnte ich zwischen unterschiedlichen Standpunk ten wählen: dem eines reichen und dem eines armen Mannes.
Statt den einen oder den anderen einfach zu akzeptieren oder abzuleh nen, geriet ich ins Grübeln, wog ab und traf dann meine eigenen Entschei dungen. Das Problem dabei: Mein reicher Vater war damals noch nicht reich und mein armer Vater noch nicht arm. Beide standen am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn, und beide mussten sehen, wie sie mit ihrem Geld auskamen und ihre Familien durchbrachten. Doch ihre Ansichten über Geld waren diametral entgegengesetzt.
So sagte beispielsweise mein leiblicher Vater: »Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels.« Der andere Vater behauptete dagegen: »Der Mangel an Geld ist die Wurzel allen Übels.«
Als kleiner Junge fand ich es gar nicht so einfach, mit zwei Vätern klarzu kommen, die beide Einfluss auf mich ausübten. Ich wollte gern ein braver Sohn sein und auf sie hören, doch die beiden sagten mir nicht dasselbe. Ihre Ansichten, vor allem über Geld, widersprachen sich derart, dass ich neugierig wurde. Die Sache interessierte mich. Ich begann, gründlich über alles nachzudenken, was sie mir erklärten.
Damit verbrachte ich einen Großteil meiner Freizeit. Ich stellte mir Fra gen wie: »Warum sagt er so etwas?« Und dann stellte ich mir dieselbe Fra ge zur Aussage des anderen Vaters. Es wäre so viel einfacher gewesen, zu sagen: »Also gut, er hat recht. Ich bin seiner Meinung.« Oder ihm zu wider sprechen: »Der alte Herr hat ja keine Ahnung.« Doch weil ich zwei Väter hatte, die ich beide liebte, musste ich zwangsläufig nachdenken und mir eine eigene Meinung bilden. Dieser Prozess des eigenständigen Denkens erwies sich auf lange Sicht als weitaus wertvoller, als wenn ich einen Stand punkt kritiklos übernommen oder abgelehnt hätte.
Einer der Gründe, aus denen die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer und die Mittelschicht mit Schulden kämpft: Wissen über Geld wird nicht in der Schule vermittelt, sondern zu Hause. Die meis ten von uns lernen von ihren Eltern, was sie über Geld wissen. Was aber können arme Eltern ihren Kindern über Geld beibringen? Sie sagen bloß: »Geh weiter zur Schule und lerne fleißig.« Vielleicht macht das Kind dann einen hervorragenden Abschluss, doch in finanzieller Hinsicht denkt es wie die Armen – und entsprechend ist es programmiert.
Leider ist Geld kein Schulfach. Die Schulen fokussieren sich auf wissen schaftliche und berufliche Kompetenzen, aber nicht auf Finanzwissen. Das erklärt, warum clevere Banker, Ärzte und Steuerberater, die sehr gute Noten hatten, finanziell manchmal ihr Leben lang zu kämpfen haben. Unsere ge waltige Staatsverschuldung ist zum großen Teil dem Umstand zuzuschrei ben, dass hochgebildete Politiker und Staatsbeamte Finanzentscheidungen treffen, obwohl sie in diesem Fach kaum oder gar nicht unterrichtet wurden. Ich frage mich heute oft, was wohl passiert, wenn irgendwann viele Mil lionen Menschen finanzielle oder medizinische Unterstützung brauchen. Sie werden auf ihre Familien oder auf den Staat angewiesen sein, der ih nen finanziell unter die Arme greifen muss. Was geschieht, wenn der ge setzlichen Krankenversicherung, der Renten und Sozialversicherung das Geld ausgeht? Wie soll ein Land überleben, wenn es den Eltern überlassen bleibt, ihren Kindern Wissen über Geld zu vermitteln – Eltern, von denen die meisten arm sein werden oder bereits arm sind?
Weil ich zwei Väter hatte, die mich beeinflussten, lernte ich von beiden. Ich musste mir die Ratschläge beider Väter zu Herzen nehmen, und dabei gewann ich wertvolle Erkenntnisse darüber, wie viel Macht und Einfluss unsere Gedanken auf unser Leben ausüben. So pflegte einer meiner Väter zu sagen: »Das kann ich mir nicht leisten.« Der andere Vater verbot mir rundheraus, so etwas auch nur zu denken. Er bestand darauf, dass ich statt dessen fragen sollte: »Wie kann ich mir das leisten?« Das eine ist eine Aus sage, das andere eine Frage. Mit der Aussage sind Sie aus dem Schneider. Die Frage zwingt Sie dazu, sich Gedanken zu machen. Derjenige meiner Väter, der später reich werden sollte, erklärte mir, die spontane Aussage »Das kann ich mir nicht leisten« schalte das Gehirn aus. Die Frage »Wie kann ich mir das leisten?« dagegen aktiviere die grauen Zellen. Er meinte damit nicht, dass man sich alles kaufen soll, was man gern haben möchte. Er war nur strikt der Ansicht, dass man seinen Verstand gebrauchen sollte – den leistungsfähigsten Computer der Welt. Er meinte: »Mein Gehirn wird jeden Tag stärker, weil ich es trainiere. Und je stärker es wird, desto mehr Geld kann ich verdienen.« Den reflexartigen Ausspruch »Ich kann mir das nicht leisten« hielt er für ein Zeichen geistiger Trägheit.
25 JAHRE SPÄTER …DIE SCHULDENUHR
1997, als Rich Dad Poor Dad erstveröffentlicht wurde, betrug die Staatsverschuldung der USA knapp 5,5 Billionen Dollar. Heute, 25 Jahre später, hat sie gerade die schwindelerregende Marke von 29 Billionen Dollar überschritten. Billionen – mit B.
Obwohl meine Väter beide hart arbeiteten, stellte ich fest, dass der eine sein Gehirn gewöhnlich abschaltete, wenn es um finanzielle Dinge ging, während der andere sein Gehirn arbeiten ließ. Langfristig führte das dazu, dass der eine Vater finanzi ell stärker wurde, der andere schwächer. Das ist nicht viel anders, als wenn einer regelmäßig ins Fitnessstu dio geht, um zu trainie ren, während ein anderer vor dem Fernseher auf der Couch sitzt. Das richtige körperliche Training erhöht die Aussichten auf ein ge sundes Leben, das richtige mentale Training die Aussichten, reich zu werden.
Meine beiden Väter hatten also widersprüchliche Ansichten, und das wirkte sich auf ihr Denken aus. Der eine Vater fand, die Reichen sollten mehr Steuern zahlen und sich um die weniger Begünstigten kümmern. Der andere sagte: »Steuern bestrafen die Produktiven und belohnen die Unproduktiven.«
Der eine Vater riet mir: »Lerne fleißig, dann kannst du einen Arbeitsplatz bei einem soliden Unternehmen finden.« Der andere empfahl: »Lerne flei ßig, dann kannst du ein solides Unternehmen finden, um es zu kaufen.«
Der eine Vater sagte: »Ich bin nicht reich, weil ich Kinder habe.« Der an dere meinte: »Ich muss reich sein, weil ich Kinder habe.«
Der eine begrüßte es, wenn bei Tisch über Geld und Geschäfte gespro chen wurde, der andere untersagte diese Themen beim Essen.
Der eine sagte: »Wenn es um Geld geht, setze auf Sicherheit. Gehe keine Risiken ein.« Der andere sagte: »Lerne, mit Risiken umzugehen.«
Der eine glaubte: »Unser Haus ist unsere größte Investition und unser größter Aktivposten.« Der andere meinte: »Mein Haus ist ein Passivpos ten. Wenn dein Haus deine größte Investition ist, dannhast du ein Problem.«
25 JAHRE SPÄTER …IHR HAUS IST NOCH IMMER KEIN VERMÖGENSWERT
Als 2008 der Immobilienmarkt einbrach, war das eine klare Botschaft: Ihr Eigenheim ist kein Vermögenswert. Es bringt Ihnen nicht nur kein Geld ein, Sie können sich noch nicht einmal darauf verlassen, dass es im Wert steigt.
Heute sind die Immobilienpreise in vielen großen Städten in den Himmel gestiegen. Doch andere erleben genau das Gegenteil. Ihr Haus kann ein Aktivposten sein – aber nur, wenn Sie es mit Gewinn verkaufen.
Beide Väter bezahlten ih re Rechnungen pünktlich, doch der eine sofort, der andere so spät wie möglich. Ein Vater glaubte daran, dass ein Arbeitgeber oder der Staat sich schon um die Menschen und ihre Belange kümmert.
Er machte sich ständig Gedanken um Gehaltser höhungen, Altersvorsorge, Krankenversicherung, Lohn fortzahlung im Krankheits fall, Urlaubstage und andere Nebenleistungen. Mit Ehr furcht schaute er auf zwei seiner Onkel, die beim Militär nach 20 Jahren aktivem Dienst bis an ihr Lebensende abgesichert waren. Er fand es toll, dass das Mili tär seinen Pensionären medizinische Versorgung und Einkaufsprivilegien bot. Auch das universitäre System, das eine unbefristete Anstellung vorsah, sagte ihm zu. Manchmal schienen ihm lebenslange Arbeitsplatzsicherheit und Ne benleistungen wichtiger als der Job an sich. Er sagte oft: »Ich arbeite hart für den Staat und habe Anspruch auf diese Leistungen.«
Mein anderer Vater war überzeugt, dass jeder finanziell auf eigenen Fü ßen stehen sollte. Er sprach sich gegen die Versorgungsmentalität aus und kritisierte, dass diese schwache und finanziell abhängige Menschen hervor bringe. Er betonte stets die Bedeutung von Finanzkompetenz.
Mein leiblicher Vater hatte Mühe, ein paar Dollar beiseitezulegen. Der an dere investierte. Ein Vater brachte mir bei, wie ich eine überzeugende Be werbung schreiben konnte, um einen guten Job zu finden. Der andere lehrte mich, überzeugende Business und Finanzpläne zu erstellen, damit ich Ar beitsplätze schaffen konnte.
Als Produkt zweier starker Väter genoss ich den Luxus, selbst zu beobach ten, wie sich ihre unterschiedliche Denkweise auf ihr Leben auswirkte. Ich stellte fest: Wie ein Mensch denkt, prägt tatsächlich sein Leben.
So sagte mein armer Vater beispielsweise stets: »Ich werde nie reich.« Und diese Prophezeiung erfüllte sich. Mein reicher Vater dagegen bezeich nete sich stets als reich. Von ihm hörte ich Dinge wie: »Ich bin ein reicher Mann, und Reiche machen das nicht.« Selbst als er nach einem größeren finanziellen Rückschlag praktisch vor dem Ruin stand, bezeichnete er sich weiter als reich. Er erklärte das so: »Es ist ein Unterschied, ob man arm oder pleite ist. Pleite ist man vorübergehend. Arm ist man für immer.«
Mein armer Vater pflegte zu sagen: »Geld interessiert mich nicht« oder »Geld ist nicht wichtig«. Mein reicher Vater sagte immer: »Geld ist Macht.«
Die Kraft der Gedanken lässt sich vielleicht nicht messen oder bewerten, doch mir wurde schon als Kind klar, dass es wichtig war, mir bewusst zu sein, was ich denke und wie ich mich äußere. Ich merkte: Dass mein armer Vater arm war, lag nicht daran, wie viel Geld er verdiente – was natürlich eine Rolle spielte –, sondern daran, wie er dachte und handelte. Als kleiner Junge mit zwei Vätern wurde mir klar: Ich musste mir gut überlegen, wel che Denkweise ich übernehmen wollte. Sollte ich auf meinen reichen Vater hören oder auf meinen armen?
Obwohl beide Männer enorme Hochachtung vor Bildung und Wissenser werb hatten, waren sie unterschiedlicher Meinung dazu, was man unbe dingt lernen sollte. Einer wollte, dass ich studieren, einen Abschluss machen und einen guten Job finden sollte, um Geld zu verdienen. Er wollte, dass ich lernte, um mich fachlich zu qualifizieren – als Anwalt oder Steuer berater oder an einer Business School, wo ich einen MBA erwerben konnte. Der andere animierte mich, zu lernen, um reich zu werden – um zu verstehen, wie Geld funktioniert, und um zu erfahren, wie ich es für mich arbeiten lassen konn te. »Ich arbeite nicht für Geld!« hat er immer wieder gesagt. »Das Geld arbeitet für mich!«
Es ist ein Unterschied, ob man arm oder pleite ist. Pleite ist man vorübergehend. Arm ist man für immer.
Als ich neun Jahre alt war, beschloss ich, in Gelddingen auf meinen rei chen Vater zu hören und von ihm zu lernen. Damit entschied ich mich dagegen, auf meinen armen Vater zu hören, obwohl er derjenige mit all den akademischen Abschlüssen war.
Eine Lektion von Robert Frost
Robert Frost ist mein Lieblingsdichter. Ich mag viele seiner Gedichte, aber mein absoluter Favorit ist »The Road Not Taken«. Was ich daraus gelernt habe, wende ich fast täglich an.
Der unbegangene Weg*In einem gelben Wald, da lief die Straße auseinander, und ich, betrübt, daß ich, ein Wandrer bleibend, nicht die beiden Wege gehen konnte, standund sah dem einen nach so weit es ging: bis dorthin, wo er sich im Unterholz verlor.Und schlug den andern ein, nicht minder schönals jener, und schritt damit auf dem vielleicht, der höher galt, denn er war grasig und er wollt begangen sein,obgleich, was dies betraf, die dort zu gehen pflegten, sie beide, den und jenen, gleich begangen hatten.Und beide lagen sie an jenem Morgen gleicherweise voll Laubes, das kein Schritt noch schwarzgetreten hatte.Oh, für ein andermal hob ich mir jenen ersten auf!Doch wissend, wie’s mit Wegen ist, wie Weg zu Weg führt, erschien mir zweifelhaft, daß ich je wiederkommen würde.Dies alles sage ich, mit einem Ach darin, dereinst und irgendwo nach Jahr und Jahr und Jahr: Im Wald, da war ein Weg, der Weg lief auseinander,und ich – ich schlug den einen ein, den weniger begangnen,und dieses war der ganze Unterschied.
Und dieses war der ganze Unterschied.
Ich habe im Laufe der Jahre oft über Robert Frosts Gedicht nachgedacht. Die Entscheidung, nicht auf den Rat meines hochgebildeten Vaters und auf seine Einstellung zum Geld zu hören, war schmerzhaft – doch es war eine Entscheidung, die den Rest meines Lebens prägte.
Als ich mich entschieden hatte, auf wen ich hören wollte, begann mei ne Finanzerziehung. Mein reicher Vater unterrichtete mich über einen Zeitraum von 30 Jahren – bis ich 39 Jahre alt war. Als er merkte, dass ich wusste und vollständig begriffen hatte, was er mir in meinen mitunter di cken Schädel einbläuen wollte, beendete er den Unterricht.
Geld ist eine Form der Macht. Noch mächtiger aber ist Finanzbildung. Geld kommt und geht, doch wer gelernt hat, wie es funktioniert, der hat Einfluss darauf und kann anfangen, sich ein Vermögen aufzubauen. Positives Denken allein reicht deshalb nicht, weil die meisten Menschen zwar zur Schule gegangen sind, aber nie gelernt haben, wie Geld funktioniert. Des halb arbeiten sie ihr Leben lang für Geld.
Weil ich bereits mit neun Jahren mit meiner Finanzausbildung anfing, waren die Lehren meines reichen Vaters einfach formuliert. Letzten En des liefen aber alle auf sechs Hauptlektionen hinaus, die 30 Jahre lang im merfort wiederholt wurden. Um diese sechs Lektionen dreht sich dieses Buch – so einfach wie möglich beschrieben, genauso einfach eben, wie sie mir mein reicher Vater vermittelte. Diese Lektionen sollen keine Antworten liefern, sondern als Leitlinien dienen, die Ihnen und Ihren Kindern und Familien zu mehr Wohlstand verhelfen – ganz gleich was in einer Welt pas siert, die immer unsteter und ungewisser wird.
* In der Übersetzung von Paul Celan: Paul Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden. Band 5: Übertragungen II. Frankfurt (Suhrkamp) 1983, S. 405.
Kapitel 1LEKTION 1: DIE REICHEN ARBEITEN NICHT FÜR GELD
Für Geld arbeiten nur die Armen und die Mittelschicht.Die Reichen lassen Geld für sich arbeiten.
»Dad, kannst du mir sagen, wie man reich wird?«
Mein Vater legte die Abendzeitung zur Seite. »Warum willst du denn reich werden, mein Sohn?«
»Weil heute Jimmys Mutter in ihrem neuen Cadillac vorgefahren ist. Sie wollten übers Wochenende in ihr neues Strandhaus. Er hat drei Freunde eingeladen, aber Mike und mich nicht – weil wir arme Kinder sind, haben sie gesagt.«
»Das haben sie gesagt?«, fragte mein Vater entgeistert.
»Ja«, bestätigte ich zerknirscht.
Mein Vater schüttelte nur wortlos den Kopf, rückte seine Brille auf der Nase zurecht und vertiefte sich wieder in seine Zeitung. Ich stand da und wartete auf eine Antwort.
Das war 1956. Damals war ich neun Jahre alt. Einer Laune des Schicksals war es zu verdanken, dass ich auf dieselbe staatliche Schule ging, auf die auch die reichen Leute ihre Kinder schickten. Unsere Kleinstadt auf Hawaii lebte in erster Linie von den Zuckerrohrplantagen. Die Manager der Plantagen und andere gut betuchte Leute wie Ärzte, Unternehmer und Banker schickten ihre Kinder auf diese staatliche Grundschule. Nach der sechsten Klasse gin gen solche Kinder dann gewöhnlich auf Privatschulen. Ich besuchte dieselbe Schule nur, weil meine Familie zufällig auf der richtigen Straßenseite leb te. Hätten wir auf der anderen Seite der Straße gewohnt, wäre ich auf eine andere Schule gegangen – mit Kindern aus Familien wie meiner. Nach der sechsten Klasse würden diese Kinder und ich dann auf eine staatliche weiter führende Schule wechseln. Privatschulen kamen für uns nicht infrage.
Schließlich senkte mein Vater seine Zeitung. Er dachte nach, das konnte ich sehen.
»Tja, mein Sohn«, setzte er zögernd an. »Wenn du reich werden willst, musst du lernen, wie man Geld macht.«
»Und wie kann ich Geld machen?«, wollte ich wissen.
»Gebrauche deinen Verstand, mein Junge«, schmunzelte mein Vater. Doch selbst mir war klar, was das wirklich bedeutete: Ich weiß darauf keine Antwort, also frag nicht weiter.
Wie wir Partner wurden
Am nächsten Morgen erzählte ich meinem besten Freund Mike, was mein Vater gesagt hatte. Soweit ich wusste, waren Mike und ich die einzigen ar men Kinder an unserer Schule. Auch Mike besuchte diese Schule nur durch einen Zufall. Im Schulamt hatte jemand bei der Einteilung der Schulbezirke einen Fehler gemacht. Deshalb waren wir auf der Schule mit den reichen Kindern gelandet. Wir waren nicht wirklich arm, aber wir kamen uns so vor, weil die anderen Jungs alles neu bekamen – BaseballHandschuhe, Fahrräder, alles eben.
Unsere Eltern versorgten uns mit allem, was wir brauchten, wie Nahrung, ein Dach über dem Kopf und Kleidung. Mehr aber auch nicht. Mein Vater sagte immer: »Wenn du etwas haben möchtest, musst du dafür arbeiten.« Wir wollten vieles haben, doch die Arbeitsmöglichkeiten für Neunjährige waren begrenzt.
»Also, was sollen wir tun, um reich zu werden?«, fragte Mike.
»Weiß ich nicht«, entgegnete ich. »Aber willst du mein Partner sein?«
Er war einverstanden. So kam es, dass Mike und ich eines Samstagmor gens unsere erste geschäftliche Partnerschaft gründeten. Wir verbrachten den ganzen Vormittag damit, uns zu überlegen, wie wir Geld machen könnten. Immer wieder kamen wir dabei auch auf die »coolen Jungs« zu sprechen, die sich gerade in Jimmys Strandhaus vergnügten. Das tat ein bisschen weh, doch der Schmerz war insofern positiv, als er uns dazu an hielt, weiter darüber nachzudenken, wie wir reich werden konnten. Am Nachmittag hatten wir dann die zündende Idee. Sie stammte aus einem naturwissenschaftlichen Buch, das Mike gelesen hatte. Begeistert besiegel ten wir es mit einem Handschlag. Nun war klar, dass unsere Partnerschaft ein Geschäftsmodell hatte.
Mehrere Wochen lang waren Mike und ich in unserem Viertel unterwegs, klopften an Türen und fragten bei den Nachbarn nach, ob sie uns wohl ihre lee ren Zahnpastatuben überlassen würden. Die Erwachsenen schauten zwar erstaunt, doch die meisten versprachen es lächelnd. Manche fragten auch, was wir damit vorhätten. Dann antworteten wir: »Das können wir nicht verraten. Es ist ein Geschäftsgeheimnis.«
Das ging ein paar Wochen so. Dann wurde es meiner Mutter zu bunt. Wir hatten uns nämlich den Platz neben ihrer Waschmaschine ausgesucht, um unser Rohmaterial zu lagern. In einem braunen Karton, der ursprüng lich KetchupFlaschen enthalten hatte, wuchs unser Vorrat an leeren Zahn pastatuben allmählich an.
Schließlich sprach meine Mutter ein Machtwort. Sie wollte sich nicht länger die verschmierten, zusammengerollten alten Zahnpastatuben ihrer Nachbarn anschauen. »Was habt ihr zwei eigentlich vor?«, fragte sie. »Und ich will nicht hören, dass das ein Geschäftsgeheimnis ist. Schafft mir die sen Plunder vom Hals, sonst kommt er auf den Müll.«
Mike und ich flehten und bettelten. Wir erklärten ihr, es würde nicht mehr lange dauern, bis wir genügend beisammen hätten, um mit der Produktion zu beginnen. Wir erzählten, wir würden nur noch darauf warten, dass ein paar Nachbarn ihre Tuben leer bekämen, damit wir sie haben könnten. Mei ne Mutter gewährte uns eine Woche Aufschub.
Wir zogen den Termin für den Produktionsbeginn vor. Jetzt wurde es ernst. Meiner ersten Firma drohte bereits die Zwangsräumung – und das durch meine eigene Mutter! Mikes Aufgabe bestand darin, die Nachbarn da zu zu bringen, ihre Tuben schneller zu leeren. Er erklärte ihnen, ihr Zahnarzt wäre bestimmt dafür, dass sie sich die Zähne häufiger putzten. Ich arbeitete währenddessen an unserer Fertigungsstraße.
Eines Tages bog mein Vater mit einem Freund in unsere Einfahrt ein und traf dort auf zwei Neunjährige, deren Produktion auf vollen Touren lief. Alles war mit einem feinen weißen Pulver überzogen. Auf einem langen Tisch standen kleine Milchkartons aus der Schule, und die rotglühenden Kohlen im HibachiGrill unserer Familie entwickelten maximale Hitze.
Mein Vater kam vorsichtig näher. Er hatte unten an der Straße parken müssen, da unsere Produktionsanlage die Zufahrt zum Carport versperrte. Als er sich mit seinem Freund langsam näherte, sahen die beiden, dass auf den Kohlen ein Stahltopf stand, indem die Zahnpastatuben schmolzen. Damals gab es noch keine Zahncreme in Kunststofftuben. Die Tuben wa ren aus Blei. Sobald die Farbe abgebrannt war, warfen wir die Tuben in den kleinen Stahltopf. Sie schmolzen, und wenn sie flüssig waren, gossen wir das Blei mithilfe der Topflappen meiner Mutter durch ein kleines Loch auf der Oberseite eines Milchkartons.
Die Milchkartons waren mit Gips gefüllt, daher das weiße Pulver überall. In meiner Hektik hatte ich den Sack umgestoßen, deshalb sah es aus, als sei ein Schneesturm über uns hinweggefegt. Die Milchkartons hielten die Gipsformen zusammen.
Mein Vater und sein Freund sahen zu, wie wir das geschmolzene Blei be hutsam durch ein kleines Loch auf der Oberseite in den Gipsquader gossen.
»Seid bloß vorsichtig«, mahnte mein Vater.
Ich nickte, ohne aufzusehen.
Als die Form voll war, setzte ich den Stahltopf ab und strahlte meinen Vater an.
»Was macht ihr beide denn da?«, fragte er mit angestrengtem Lächeln.
»Na, wir machen, was du mir gesagt hast. Wir wollen nämlich reich werden«, erklärte ich.
»Genau«, grinste Mike und nickte dazu. »Wir sind Partner.«
»Und was ist da in den Milchkartons?«, wollte mein Vater wissen.
»Ich zeig’s dir«, sagte ich. »Das hier müsste ein gelungenes Exemplar sein.«
Mit einem kleinen Hammer klopfte ich auf die Teilungsnaht des Quaders. Vorsichtig zog ich die obere Hälfte der Gipsform ab. Heraus fiel ein bleier nes Fünfcentstück.
»Das darf doch nicht wahr sein!«, rief mein Vater aus. »Ihr gießt Fünf centstücke aus Blei!«
»Genau«, verkündete Mike. »Wir tun, was Sie uns gesagt haben: Wir ma chen Geld.«
Der Freund meines Vaters wandte sich lachend ab. Mein Vater schüttelte amüsiert den Kopf. Vor ihm standen zwei kleine Jungs, über und über mit weißem Staub bedeckt, die übers ganze Gesicht strahlten.
Er bat uns, alles stehen und liegen zu lassen und uns zu ihm auf die Ein gangstreppe unseres Hauses zu setzen. Mit einem Lächeln erklärte er uns einfühlsam, was eine »Fälschung« ist.
Unsere Träume zerplatzten wie Seifenblasen. »Sie meinen, das ist illegal?«, fragte Mike mit bebender Stimme.
»Lass sie doch«, mischte sich der Freund meines Vaters ein. »Vielleicht sind sie ja Naturtalente.«
Mein Vater warf ihm einen strafenden Blick zu.
»Ja, das ist illegal«, meinte er nachsichtig. »Aber ihr habt große Kreativi tät bewiesen und einen originellen Einfall gehabt. Macht so weiter. Ich bin wirklich stolz auf euch!«
Enttäuscht schwiegen Mike und ich uns etwa 20 Minuten lang an. Dann räumten wir alles auf. Unser Unternehmen überlebte nicht einmal einen Tag. Als ich das Gipspulver zusammenkehrte, schaute ich zu Mike hinüber und sagte: »Wahrscheinlich haben Jimmy und seine Freunde recht. Wir sind arm.«
Mein Vater kam in dem Moment aus dem Haus und hörte meine Worte.
»Jungs«, sagte er daraufhin. »Arm seid ihr nur, wenn ihr aufgebt. Das Wich tigste ist, dass ihr etwas unternommen habt. Die meisten Leute reden und träumen nur davon, reich zu werden. Ihr habt etwas dafür getan. Ich bin sehr stolz auf euch beide. Und ich sage es noch einmal: Macht weiter so. Gebt nicht auf.«
Mike und ich standen stumm da. Das war alles gut und schön, aber was wir tun sollten, wussten wir immer noch nicht.
»Warum bist du nicht reich, Dad?«, fragte ich.
»Weil ich mich dafür entschieden habe, Lehrer zu werden. Lehrer denken eigentlich nicht ans Reichwerden. Wir unterrichten gern. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, aber ich weiß wirklich nicht, wie man zu Geld kommt.«
Mike und ich wandten uns wieder den Aufräumarbeiten zu.
»Wartet mal, da fällt mir etwas ein«, sagte mein Vater. »Wenn ihr lernen wollt, wie man reich wird, fragt nicht mich. Sprecht doch mal mit deinem Vater, Mike.«
»Mit meinem Vater?«, fragte Mike und verzog das Gesicht.
»Ja, mit deinem Vater«, entgegnete mein Vater lächelnd. »Dein Vater und ich sind bei derselben Bank, und mein Berater dort schwärmt in den höchs ten Tönen von deinem Vater. Er hat mir schon mehrmals gesagt, dein Vater sei ein wahres Finanzgenie.«
»Mein Vater?«, fragte Mike erneut ungläubig. »Wie kommt es dann, dass wir kein dickes Auto fahren und kein großes Haus haben wie die reichen Kinder in der Schule?«
»Ein dickes Auto und ein großes Haus bedeuten nicht unbedingt, dass jemand reich ist oder weiß, wie man zu Geld kommt«, erwiderte mein Va ter. »Jimmys Vater arbeitet für das Zuckerrohrunternehmen. Er ist genauso angestellt wie ich. Er arbeitet für ein Unternehmen, ich für den Staat. Sein Auto hat ihm das Unternehmen gekauft. Doch das Zuckerunternehmen hat finanzielle Probleme, und vielleicht steht Jimmys Vater bald vor dem Nichts. Bei deinem Vater ist das anders, Mike. Er baut sich offenbar ein Imperium auf, und ich gehe davon aus, dass er in ein paar Jahren ein sehr reicher Mann sein wird.«
Das versetzte Mike und mich wieder in Hochstimmung. Mit neuer Energie räumten wir die Überreste unseres schon auf der Startlinie gescheiterten ersten Unternehmens weg. Während wir fegten und putzten, schmiedeten wir Pläne für unser Gespräch mit Mikes Vater. Das Problem war, dass dieser sehr lange arbeitete und oft erst spät nach Hause kam. Mikes Vater besaß Lagerhäuser, ein Bauunternehmen, eine Ladenkette und drei Restaurants. Und die Restaurants waren schuld, dass er abends noch so lange unterwegs war.
Mike fuhr mit dem Bus nach Hause, nachdem wir alles aufgeräumt und gesäubert hatten. Er wollte noch am selben Abend mit seinem Vater spre chen und ihn fragen, ob er uns beibringen könne, wie man reich wird. Mike versprach, mich anzurufen, sobald er mit seinem Vater geredet hatte, selbst wenn es dann schon spät war.
Um halb neun abends klingelte das Telefon.
»Also gut, nächsten Samstag«, sagte ich am Ende des Gesprächs und legte auf. Mikes Dad war bereit, sich mit uns zusammenzusetzen.
Am Samstagmorgen bestieg ich um halb acht den Bus, der in das ärmere Viertel der Stadt fuhr.
Der Unterricht beginnt
Um acht Uhr an jenem Morgen trafen wir uns mit Mikes Vater. Er war bereits seit über einer Stunde bei der Arbeit und hatte viel zu tun. Sein Polier stieg gerade aus seinem Pickup, als ich auf das einfache, kleine, aber schmucke Haus zuging. Mike kam mir schon entgegen.
»Dad ist am Telefon. Wir sollen hinten auf der Veranda auf ihn warten«, sagte er, als er mich ins Haus führte.
Der alte Holzboden knarzte, als ich über die Schwelle in das Haus trat, das schon bessere Zeiten gesehen hatte. Gleich hinter der Tür lag eine billige Matte. Sie sollte verbergen, wie abgetreten der Fußboden von den vielen Schritten war, die er schon ausgehalten hatte. Er war zwar sauber und ge pflegt, konnte aber eine Renovierung vertragen.
Ich bekam Platzangst, als wir das kleine Wohnzimmer betraten, das vol ler muffiger, alter Polstermöbel stand, die heute Sammlerstücke wären. Auf der Couch saßen zwei Frauen, beide ein bisschen älter als meine Mutter. Gegenüber hatte sich ein Mann in Arbeitskluft niedergelassen. Er trug khaki farbene Hosen und ein khakifarbenes Hemd – ordentlich gebügelt, aber nicht gestärkt – und polierte Arbeitsstiefel. Er war etwa zehn Jahre älter als mein Vater. Alle lächelten, als Mike und ich an ihnen vorbei auf die Veranda gingen. Ich lächelte schüchtern zurück.
»Was sind das für Leute?«, fragte ich Mike.
»Oh, die arbeiten für meinen Vater. Der ältere Mann leitet seine Lager häuser, die Frauen führen die Restaurants. Und als du gekommen bist, bist du dem Polier begegnet, der etwa 80 Kilometer von hier ein Straßenbau projekt betreut. Den anderen Polier, der mehrere Häuser baut, hast du nur knapp verpasst.«
»Geht das hier die ganze Zeit so zu?«, wollte ich wissen.
»Nicht immer, aber sehr oft«, meinte Mike lächelnd, nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben mich.
»Ich habe meinen Vater gefragt, ob er uns beibringen würde, wie man reich wird«, sagte Mike.
»Und, was hat er gesagt?«, fragte ich neugierig.
»Na, erst hat er komisch geschaut. Dann meinte er, er wolle uns ein An gebot machen.«
»Oh«, sagte ich und kippelte mit dem Stuhl, bis er mit der Rückenlehne an die Wand stieß. Dann balancierte ich auf den beiden hinteren Stuhlbei nen.
Mike tat es mir nach.
»Weißt du, was das für ein Angebot ist?«, fragte ich.
»Nein, aber das werden wir gleich erfahren.«
Unvermittelt kam Mikes Vater durch die klapprige Fliegentür zu uns auf die Veranda. Mike und ich sprangen auf die Füße – nicht aus Respekt, son dern weil wir so überrascht waren.
»Seid ihr bereit?«, fragte Mikes Vater, als er sich einen Stuhl heranzog und sich zu uns setzte.
Wir nickten, rückten von der Wand ab und setzten uns vor ihn hin.
Mikes Vater war groß, etwa 1,80 Meter, und brachte 100 Kilo auf die Waage. Mein Vater war sogar noch etwas größer, bei ähnlichem Gewicht, und fünf Jahre älter. Sie sahen sich irgendwie ähnlich, wenn sie auch nicht den selben ethnischen Hintergrund hatten. Aber beide strahlten eine ähnliche Energie aus.
»Mike sagt, ihr wollt lernen, Geld zu machen? Stimmt das, Robert?«
Ich nickte prompt, aber ein bisschen beklommen. Da war jetzt eine Men ge Energie hinter seinen Worten und seinem Lächeln.
»Also gut, hier ist mein Angebot. Ich werde euch unterrichten, aber nicht wie in der Schule. Ich bringe es euch bei, wenn ihr für mich arbeitet. Sonst nicht. Ich kann euch schneller etwas beibringen, wenn ihr arbeitet. Wenn ihr euch nur hinsetzen und zuhören wollt wie in der Schule, dann ist das für mich verschwendete Zeit. Das ist mein Angebot. Überlegt es euch.«
»Äh, darf ich vorher was fragen?«, traute ich mich zu fragen.
WEISHEIT, DIE SICH BEWÄHRT HATENTSCHLUSSFREUDIGKEIT
Die Welt wird immer schnelllebiger. Geschäfte auf dem Aktienmarkt finden in Millisekunden statt. Ge schäfte im Internet kommen und gehen im Minutentakt. Immer mehr Menschen stehen im Wettbewerb um gute Geschäfte. Je schneller Sie eine Entscheidung treffen können, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Chancen wahrnehmen können – bevor Ihnen jemand zuvorkommt.
»Nein. Sagt einfach Ja oder Nein. Ich habe zu viel zu tun, um meine Zeit zu verschwen den. Wenn ihr euch nicht ent scheiden könnt, dann lernt ihr sowieso nie, wie man zu Geld kommt. Chancen kommen und gehen. Zu wissen, wann man eine schnelle Entscheidung treffen muss, ist eine wichtige Fähigkeit. Ihr bekommt die Chance, um die ihr gebeten habt. Die Ausbildung beginnt jetzt – oder sie ist in 10 Sekun den vorbei«, meinte Mikes Vater und lächelte undurchschaubar.
»Ich sage Ja«, sagte ich.
»Ich sage auch Ja«, sagte Mike.
»Gut«, sagte Mikes Vater. »In zehn Minuten kommt Mrs. Martin. Wenn ich mit ihr gesprochen habe, nimmt sie euch mit in meinen Gemischt warenladen. Dort könnt ihr anfangen. Ich zahle euch 10 Cent die Stunde und ihr arbeitet jeden Samstag drei Stunden.«
»Aber ich habe heute noch ein Baseballspiel«, wandte ich ein.
Mikes Vater senkte die Stimme und sagte in ernstem Ton: »Ihr könnt an nehmen oder ablehnen.«
»Ich nehme an«, erwiderte ich und entschied mich dafür, zu arbeiten und zu lernen, statt Baseball zu spielen.
30 Cent später
Um 9 Uhr an jenem Tag arbeiteten Mike und ich bereits für Mrs. Martin. Sie war eine liebe, geduldige Frau. Sie sagte immer, Mike und ich erinner ten sie an ihre beiden erwachsenen Söhne. Obwohl sie so nett war, glaubte sie an harte Arbeit und hielt uns ordentlich auf Trab. Drei Stunden lang nahmen wir Dosen aus den Regalen, staubten sie mit einem Staubwedel ab und stapelten sie wieder ordentlich. Dabei langweilten wir uns entsetzlich.
Mikes Vater, den ich meinen reichen Vater nenne, besaß neun dieser klei nen Supermärkte, und jeder hatte einen großen Parkplatz. Sie waren ein Vorläufer der 7ElevenFilialen – kleiner Lebensmittelläden vor Ort, wo die Leute Dinge wie Milch, Brot, Butter und Zigaretten kaufen konnten. Das Problem: Damals waren Klimaanlagen auf Hawaii noch nicht sehr verbrei tet, und die Läden konnten wegen der Hitze die Türen nicht geschlossen halten. Auf beiden Seiten, zur Straße und zum Parkplatz hin, mussten die Türen weit offen stehen. Jedes Auto, das vorbeifuhr oder auf den Parkplatz einbog, wirbelte Staub auf, der sich im Laden absetzte. Wir wussten, solange es keine Klimaanlage gab, würde uns die Arbeit nicht ausgehen.
Drei Wochen lang fanden Mike und ich uns pünktlich bei Mrs. Martin ein und arbeiteten unsere drei Stunden ab. Mittags waren wir fertig, und sie drückte uns jeweils drei Zehncentstücke in die Hand. Für einen Neunjähri gen waren 30 Cent Mitte der 1950erJahre nicht sehr viel Geld. ComicHefte kosteten damals 10 Cent. Gewöhnlich gab ich mein Geld also dafür aus und ging nach Hause.
Am Mittwoch der vierten Woche war ich drauf und dran, auszusteigen. Ich hatte mich ja nur deshalb bereiterklärt, zu arbeiten, weil ich von Mikes Vater lernen wollte, wie man reich wird – und nun leistete ich für 10 Cent die Stunde Sklavenarbeit. Hinzu kam, dass ich Mikes Vater seit dem ersten Samstag nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte.
»Ich schmeiße hin«, eröffnete ich Mike beim Mittagessen. Die Schule war öde, und jetzt konnte ich mich noch nicht einmal mehr auf den Sams tag freuen. Am meisten ärgerte ich mich aber über die 30 Cent.
Da lächelte Mike.
»Was gibt’s denn da zu grinsen?«, fragte ich sauer und frustriert.
»Dad hat das vorhergesehen. Er hat gesagt, wir sollen uns mit ihm tref fen, wenn du so weit bist, hinzuschmeißen.«
»Was?«, fragte ich empört. »Er hat nur darauf gewartet, dass ich genug habe?«
»So ungefähr«, meinte Mike. »Dad ist eigen. Er unterrichtet nicht so wie dein Vater. Dein Vater und deine Mutter halten Vorträge. Mein Vater sagt nicht viel. Warte bis Samstag. Ich sage ihm, dass du so weit bist.«
»Du meinst, er hat mich reingelegt?«
»Nein, nicht wirklich. Oder vielleicht doch. Dad wird dir das am Samstag schon erklären.«
Samstägliches Schlangestehen
Ich war bereit für die Konfrontation mit Mikes Vater. Selbst mein leiblicher Vater war sauer auf ihn. Mein leiblicher Vater, den ich den armen Vater nen ne, dachte, mein reicher Vater habe Gesetze gegen Kinderarbeit missachtet und gehöre angezeigt.
Mein gebildeter armer Vater erklärte mir, ich müsse verlangen, was mir zustehe – nämlich mindestens 25 Cent die Stunde. Er wies mich an, sofort aufzuhören, wenn ich nicht mehr Geld bekäme.
»Du brauchst diesen blöden Job nicht«, schimpfte er entrüstet.
Am Samstagmorgen stand ich um 8 Uhr vor Mikes Tür. Sein Vater öff nete.
»Setz dich hin und warte, bis zu dran bist«, sagte er, als ich eintrat. Dann drehte er sich um und verschwand in seinem kleinen Arbeitszimmer neben dem Schlafzimmer.
Ich schaute mich vergeblich nach Mike um. Mit einem unbehaglichen Gefühl setzte ich mich zögernd neben die beiden Damen, die schon vier Wo chen zuvor ebenfalls da gewesen waren. Sie lächelten und machten mir auf der Couch Platz.
Nach einer Dreiviertelstunde kochte ich. Die beiden Damen hatten schon mit Mikes Vater gesprochen und waren seit einer halben Stunde weg. Ein älterer Herr war 20 Minuten lang bei Mikes Vater im Büro gewesen und ebenfalls schon wieder weg.
Das Haus war leer, und ich saß an einem schönen Sonnentag auf Hawaii in dem muffigen, dunklen Wohnzimmer und wartete auf ein Gespräch mit einem Geizhals, der Kinder ausbeutete. Ich konnte ihn hören. Er raschelte in seinem Büro mit Papier, telefonierte und ignorierte mich. Am liebsten wäre ich gegangen, aber aus irgendeinem Grund blieb ich sitzen.
Noch 15 Minuten später schließlich, um Punkt 9 Uhr, kam mein reicher Vater aus seinem Büro und winkte mich wortlos herein.
»Wie ich höre, willst du kündigen, wenn du nicht mehr Geld bekommst«, meinte mein reicher Vater und wippte auf seinem Bürostuhl.
»Na ja, Sie haben unsere Abmachung nicht eingehalten«, platzte es aus mir heraus. Ich war den Tränen nahe. Einen Erwachsenen zur Rede zu stel len, machte mir Angst.
»Sie haben gesagt, Sie würden mir etwas beibringen, wenn ich für Sie arbeite. Ich habe für Sie gearbeitet. Ziemlich hart sogar. Ich habe auf meine Baseballspiele verzichtet, um für Sie zu arbeiten. Aber Sie haben Ihr Wort nicht gehalten. Sie haben mir gar nichts beigebracht. Sie sind ein Betrüger – das denken alle in der Stadt. Und Sie sind geldgierig. Sie möchten alles Geld behalten und kümmern sich nicht um Ihre Angestell ten. Sie haben mich warten lassen und mich respektlos behandelt. Ich bin zwar nur ein kleiner Junge, aber trotzdem verdiene ich eine bessere Behandlung.«
Mein reicher Vater kippte seinen Drehstuhl vor und zurück, stützte sein Kinn auf die Hände und schaute mich nur an.
»Gar nicht schlecht«, sagte er. »Nach noch nicht einmal einem Monat hörst du dich schon an wie die meisten meiner Leute.«
»Wie bitte?«, fragte ich verdattert. Ich begriff nicht, was er mir sagen woll te, und setzte meine Litanei fort. »Ich dachte, Sie würden Ihren Teil der Abmachung einhalten und mir etwas beibringen. Stattdessen wollen Sie mich bloß quälen. Das ist gemein. Richtig fies ist das.«
»Aber ich bringe dir doch etwas bei«, konterte mein reicher Vater gelas sen.
»Was haben Sie mir denn beigebracht? Gar nichts!«, wetterte ich wütend.
»Sie haben ja noch nicht einmal mit mir gesprochen, seit ich mich bereit erklärt habe, für ein paar Cent für Sie zu arbeiten. Zehn Cent die Stunde! Das ist ja lächerlich! Ich sollte Sie anzeigen. Bei uns gibt es nämlich Gesetze gegen Kinderarbeit, wissen Sie? Mein Vater arbeitet beim Staat, falls Ihnen das nicht bekannt ist.«
»Wow!«, sagte mein reicher Vater. »Jetzt hörst du dich an wie die meisten der Leute, die nicht mehr für mich arbeiten – solche, die ich entlassen habe oder die freiwillig gegangen sind.«
»Was haben Sie denn dazu zu sagen?«, fragte ich und kam mir für einen kleinen Jungen sehr mutig vor. »Sie haben mich angelogen. Ich habe für Sie gearbeitet, und Sie haben Ihr Wort nicht gehalten. Sie haben mir nichts beigebracht.«
»Woher willst du wissen, dass ich dir nichts beigebracht habe?«, fragte mein reicher Vater ruhig.
»Na ja, Sie haben ja gar nicht mit mir gesprochen. Ich arbeite seit drei Wochen für Sie, und Sie haben mir nichts beigebracht«, wiederholte ich beleidigt.
»Muss man denn sprechen oder Vorträge halten, um jemandem etwas beizubringen?«, fragte mein reicher Vater.
»Na klar«, entgegnete ich.
NACH WIE VOR AKTUELL …
DIE LERNPYRAMIDE