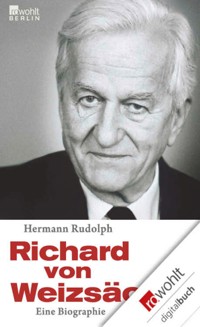
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Rowohlt Monographie
- Sprache: Deutsch
Richard von Weizsäcker gehört zu den herausragenden deutschen Politikern der Nachkriegszeit – und zu den wenigen, die weltweit Gehör gefunden haben. Sein Wirken als Bundespräsident hat, nicht zuletzt durch die Rede zum vierzigsten Jahrestag des Kriegsendes, Maßstäbe gesetzt, er selbst ist zu einer geistig-moralischen Autorität geworden. Hermann Rudolph, Herausgeber des «Tagesspiegel», begleitet den Lebensweg Richard von Weizsäckers seit Jahrzehnten – daraus erwachsen ist diese Biographie. Der Autor schildert nicht nur Weizsäckers Familiengeschichte, seine Herkunft aus dem württembergischen Bildungsbürgertum, sondern auch die Erlebnisse des jungen Soldaten im Russlandfeldzug, seine Karriere in der Wirtschaft und sein kirchliches Engagement, die beide in eine glänzende politische Laufbahn mündeten: erst als Regierender Bürgermeister von Berlin, dann als ein Bundespräsident, der dem obersten Staatsamt ein Gewicht und eine Ausstrahlung gegeben hat wie außer ihm nur noch Theodor Heuss. Und natürlich widmet er sich der Frage, was den Menschen Weizsäcker im Innersten antreibt. Das einfühlsame Lebensporträt des Staatsmannes und Visionärs Richard von Weizsäcker – und zugleich eine packende Zeitreise durch neun Jahrzehnte deutscher Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Hermann Rudolph
Richard von Weizsäcker
Eine Biographie
Inhaltsverzeichnis
Die Kraft der Synthese: das Phänomen Weizsäcker
Eine deutsche Vergangenheit
«Halber Schwabe, ganzer Berliner»: Herkunft und Familie
«Grausamer Zerstörer des Lebens»: der Krieg
«Wie ausgetrocknete Schwämme»: Studentenjahre
«Die Dämonie des Bösen»: der Wilhelmstraßenprozess
Der Weg in die Politik
«Wo die wesentlichen Entscheidungen fallen»: Karriere in der Wirtschaft
«Lobbyist der Vernunft»: Kirchentag und Polen-Denkschrift
«Beinahe ein richtiges Wendegefühl»: Lehrjahre im Parlament
«Der Prophet in der Löwengrube»: der Kampf um die Ostverträge
«Noch nie so viel gelernt»: Regierender Bürgermeister in Berlin
«Die bewegende Kraft der Mitte»: Ortstermin mit der Geschichte
Der Präsident
«Es kömmt, wie es kömmt»: von Berlin nach Bonn
«Der Wahrheit ins Auge sehen»: die Rede zum 8. Mai
«Ihn einfach als Ereignis wahrnehmen»: Leitgestalt eines besseren Deutschland
«Tiefe und erstaunte Freude»: Mauerfall und Vereinigung
«Es bedarf einer großen inneren Kraft»: Präsident aller Deutschen
«Die dritte Amtszeit»: Elder Statesman
Personenregister
Zur Literatur
Die Kraft der Synthese: das Phänomen Weizsäcker
Zehn Jahre war er Bundespräsident, und man kann sagen, dass er Epoche gemacht hat. Rechnet man die Zeit als Abgeordneter und Regierender Bürgermeister von Berlin dazu und den höchst lebendigen Elder Statesman, zu dem er danach geworden ist, so gehört Richard von Weizsäcker seit mehr als einem halben Menschenalter zum öffentlichen Leben der Bundesrepublik – seine Reden und Interviews, seine Urteile und Einsprüche, seine Präsenz als Autorität und nationales Gewissen. Ziehen diese Jahrzehnte zwischen dem Ende der Ära Adenauer und Angela Merkels Kanzlerschaft am inneren Auge vorbei, so taucht unweigerlich sein Umriss auf: die markante Physiognomie, der einnehmende Blick, ein Hauch Selbstironie, die Silberlocke, dazu die Wirkung seiner Rede – kein hoher Ton, stattdessen konzentrierte Eindringlichkeit–, die Souveränität seines Auftretens, formbewusst, doch nie steif. Wenn es in einem so irdischen Gebilde wie Staat und Gesellschaft so etwas wie eine höhere Sphäre gibt, ein Reservoir an Orientierung und Konsensus, ist er einer ihrer Fixsterne, jedenfalls ein helles, ziemlich unverrückbares Gestirn – er gehört zu der Handvoll von Politikern und repräsentativen Figuren, ohne die man sich dieses Land nicht vorstellen kann, ohne die es anders aussähe. Das Deutschland, das wir geworden sind: es trägt auch die Züge des Richard von Weizsäcker.
Das ist ein ziemlich bemerkenswerter Vorgang, zumal für einen Bundespräsidenten, der zwar seinem Verfassungsrang gemäß ganz oben steht, aber in der praktischen Politik nicht viel zu bestellen hat. Das Amt sei eine Gewalt, die «mehr durch ihr Dasein als durch ihr Tun wirkt», schrieb Carlo Schmid, einer der Väter des Grundgesetzes, als es geschaffen wurde. Die Chancen des Präsidenten, sich mit wegweisenden Leistungen in das Geschichtsbuch einzutragen, sind begrenzt. Die Wiedervereinigung zum Beispiel, das gewichtigste Ereignis in Weizsäckers langer Amtszeit, bleibt mit Helmut Kohl verbunden, der Bundespräsident konnte sie zwar fördern und beeinflussen, dann aber nur ihren Vollzug verkünden. Doch dieser Bundespräsident hat seine vermeintliche Machtlosigkeit wenn schon nicht in Macht, so doch in einen Einfluss auf das politische und intellektuelle Klima verwandelt, der realer Macht schon fast gleichkommt. Er ist zu einer moralisch-politischen Größe im Gewaltengefüge dieser Republik geworden – und ist es bis heute geblieben.
Es gehört zu dieser Erfolgsgeschichte, dass der Versuch, das Phänomen Weizsäcker zu ergründen, leicht zum Aufmarsch von Lobesformeln gerät. In Weizsäckers Präsidentschaft – so heißt es da – seien Amt und Person in idealer Weise verschmolzen. In ihr sei der immer wieder beklagte Gegensatz von Macht und Moral, Intellektualität und Politik endlich aufgehoben. Betont wird seine Fähigkeit zum Ausgleich und zur Vermittlung, aber auch seine Kraft, Klärung und Orientierung zu schaffen, Maß und Mitte zu verkörpern und für so rare Tugenden wie Glaubwürdigkeit und Autorität einzustehen. Auch als Charakter eindrucksvoll: ausgewogen und verbindlich, gleichermaßen mit Ernst und Witz ausgestattet, und gebildet, keine Frage, sei er ohnedies. Entspricht Weizsäcker nicht dem, was die Franzosen den «guten König» nennen? Verkörpert er nicht den guten Deutschen schlechthin, das Gegenbild zu allem teutonischen Auftrumpfen? Schließlich konnten sich auf Weizsäcker immer so ziemlich alle einigen. Das hat ihm in Umfragen gewaltige Zustimmung beschert – und der Kritik an seiner Person, die es natürlich auch gab, ein schlechtes Echo.
Erschwerend kommt hinzu, dass diese Urteile im Großen und Ganzen ja zutreffen. Richard von Weizsäcker ist in der Tat ein vorzüglicher Präsident gewesen. Er hat die öffentliche Rede – das einzige Instrument, über das der Bundespräsident uneingeschränkt verfügt – in unvergesslicher Weise genutzt und mit ihr Marksteine gesetzt. Er hat Themen zur Sprache gebracht, die sonst auf dem Forum der Öffentlichkeit kaum stattgefunden hätten. Wo die Regierung wichtige Entscheidungen scheute oder sie ganz schuldig blieb, war er oft das nötige Gegengewicht. Überhaupt hat er sich in vielen Auseinandersetzungen als eminent politischer Präsident erwiesen, der den Nerv der Probleme traf. Und war er nicht bei zahllosen Staatsbesuchen der Botschafter eines besseren, nachdenklichen und weltoffenen Deutschland? «Wenn man einen idealen Bundespräsidenten synthetisch herstellen könnte», so hat die ihm freundschaftlich verbundene Marion Gräfin Dönhoff enthusiastisch geschrieben, «dann würde dabei kein anderer als Richard von Weizsäcker herauskommen.»
Das ist, sieht man genau hin, ein Lob mit Widerhaken. Tatsächlich hat die Sehnsucht der Deutschen nach einem Ersatzmonarchen – im Fall der Gebildeten erhöht zum «Philosophen auf dem Thron» – an Weizsäcker ein fast zu schönes Objekt. Manchmal hat man den Eindruck, an ihm wiederhole sich, was bereits Theodor Heuss, dem ersten Präsidenten der Bundesrepublik, widerfuhr: so wie dieser zum «Papa Heuss», zur Galionsfigur des Neo-Biedermeier der fünfziger Jahre, verniedlicht wurde, avancierte Weizsäcker zu einer Art Ideal-Staatsmann – und wie Heuss ist er nicht ganz immun gegen die Verführung gewesen, an seiner Verklärung mitzuwirken. Seine präsidiale Begabung war von Anfang an nicht zu übersehen, das aristokratische Element steuerte die Herkunft bei, und den Rest besorgte das Bedürfnis der Bürger nach einer unbestrittenen Autorität, gerade in den Zeiten der Politikverdrossenheit. Dazu kam Weizsäckers erheblicher Wirkungswillen, ein beträchtliches Selbstbewusstsein und ein gehöriges Quantum Eitelkeit. Die leichte Distanz, die ihm anhaftet, kam dieser Rolle ebenso zugute wie der elitäre Hauch, der ihn umweht.
Sofern sich überhaupt Unbehagen an Weizsäcker regte, hat es sich an diesem Punkt entzündet. Kaum ins Amt gelangt, wurde er in den konservativen Quartieren der Republik zur Rede gestellt – wegen des Verdachts übermäßiger Toleranz mit nachfolgendem Relativismus. Verdankt sich sein Erfolg – so fragte streng der scharfsinnige Publizist Ludolf Herrmann nach der berühmten Rede vom 8.Mai 1985 – nicht der «Mehrheit der Unpolitischen»? Und komme er damit nicht der verhängnisvollen Neigung der Deutschen entgegen, sich von der Politik entlasten zu wollen? Kaum sehr viel anders die Bedenken auf der linken Seite des politischen Spektrums: Treten in der Bewunderung für Weizsäcker nicht nachgerade vordemokratische Züge zutage – also ein altes, fragwürdiges deutsches Erbe? Wird dieser Präsident nicht immer mehr zum Denkmal der fatalen Sehnsucht nach Überparteilichkeit?
Es muss ja auch auffallen, dass Weizsäckers Bereitschaft, sich für umstrittene Themen zu verkämpfen, ihre Grenzen hat. Viele seiner Bewunderer hätten Weizsäcker gerne öfter und offensiver auf den politischen Barrikaden gesehen – etwa im Streit um das Asylrecht oder im Kampf gegen die Ausländerfeindlichkeit. Stattdessen machten seine Gesprächspartner die Erfahrung, dass er zwar ihre Meinung gelten ließ, aber ebenso der Gegenmeinung ihre Berechtigung einräumte. War er denn überhaupt so liberal, wie es sein Image versprach? Oder doch in erster Linie ein Konservativer? Noch verdächtiger: ein linker Tory? Ein gewisses Bedauern steckt selbst in dem pointierten, im Übrigen zutreffenden Urteil, dass sogar Weizsäckers Attacken – so der Journalist Gunter Hofmann – den Eindruck erweckten, «als seien sie wattiert. Er packt Politik ein. Weizsäcker ist Christo».
Aber existiert nicht auch – so hat man dagegen gefragt – ein Bedürfnis nach Übereinstimmung, das weder vordemokratisch noch Ausdruck einer unpolitischen Haltung ist, sondern eine notwendige Bedingung der vernünftigen politischen Auseinandersetzung in einer Demokratie? Hat Weizsäcker mit seiner Amtsführung nicht gerade den Beweis dafür erbracht, dass es einen Umgang mit Politik gibt, der dieses Bedürfnis zu seinem Recht kommen lässt? Dieser Präsident hat die Probleme gerade nicht verkleinert oder Brüche geglättet. Er hat im Gegenteil die Spannungen beim Namen genannt. Aber er hat dabei auch immer deutlich gemacht und – was vielleicht noch mehr ist – spüren lassen, dass es Regeln, Prinzipien und Loyalitäten gibt, ja, geben muss, die Konflikte und Konfrontationen steuern und beherrschbar machen, sie gleichsam zivilisieren. Die befreiende Wirkung seiner Reden, der Effekt, hier spreche endlich einmal einer aus, wie die Dinge wirklich liegen, verdankt sich gerade dem Umstand, dass er den Problemen nichts schuldig blieb. Er verkleisterte Widersprüche nicht, um einen Konsens herzustellen. Seine Argumentation zielt vielmehr auf Übereinstimmung in der Anerkennung von Gegensätzen und Spannungen.
Ist es das, was Richard von Weizsäcker meint, wenn er beansprucht, ein «Kind der Aufklärung» zu sein? Es ist wahr, dass seine Reden einen «sokratischen Charakter» haben, wie der Publizist Thomas Kielinger es nannte: sie stellen Fragen, um sich ihren Themen und Thesen zu nähern, und wenn sie eine «starke Dosis Ambivalenz» ins Spiel bringen, dann nicht aus «geistiger Frivolität», sondern als Zeugnis der «Gabe des Aushaltenkönnens intellektueller Gegensätze, die sich – statt sich aufzuheben – gegenseitig ergänzen». Durchweg zeichnet Weizsäcker die Anstrengung des Unterscheidens aus, des Abwägens der Unterschiede – beim entschlossenen Willen, die Dinge zusammenzuführen und die Probleme ins Licht zu rücken. Dahinter steht seine Überzeugung, dass ein vernünftiger Umgang mit den schwierigen Bedingungen unserer politischen, gesellschaftlichen und historischen Existenz möglich sei. Ein vordemokratischer Impetus? Vielleicht doch eher der Ausdruck einer, um erneut Kielinger zu zitieren, «demokratischen Leidenschaft – der neugiergestützte Vorstoß in die Kammern moderner Komplexität».
Allerdings hat dieser Umgang mit Politik den hartnäckigen Argwohn nach sich gezogen, Weizsäcker sei kein richtiger Politiker. Als «ökumenischen Weihbischof» hat Strauß ihn verspottet, andere haben sich ähnlich, nur weniger drastisch geäußert. Weizsäcker selbst hat Wert darauf gelegt, dass er nicht dem «politischen Parteileben» entstamme – und damit den Hohn all derer herausgefordert, die sich daran erinnerten, dass er sich, natürlich, auch um politische Ämter bemüht hat. Tatsächlich hat Weizsäcker im politischen Kleinkrieg seinen Mann gestanden – den «Machtmenschen aus der Präsidenten-Suite» hat ihn Peter Glotz genannt. Kein Zweifel, dass es Weizsäcker nicht an Professionalität fehlte. Kaum ein anderer Politiker ist so perfekt auf den Wellenkämmen der kollektiven Stimmungen geritten wie er, und den Umgang mit den Medien hat er zu hoher Kunst entwickelt. Hat nicht die Behauptung etwas für sich, dass er – wie der Politologe Hans-Peter Schwarz meint – die «unterschwelligen Motive im deutschen Establishment auf den Punkt brachte»? Dass er sich oft jenseits des Mainstreams bewegte, hat ihn jedenfalls nicht zum Außenseiter werden lassen – und seine Freude am intelligenten Gedankenspiel konnte nie verdecken, dass er sehr genau wusste, was er war und was er wollte, und darum, wenn nötig, auch gekämpft hat.
Gleichwohl ist es richtig, dass seine Wurzeln und Motive anderswo liegen – und das Phänomen Weizsäcker hat damit zu tun. Er ist auch als Politiker Protestant, ein Vertreter des politischen Protestantismus der Bundesrepublik; das gibt ihm die Aura des Moralischen und Gewissensbetonten. Außerdem ist er ein Bildungsbürger, ja, ein Intellektueller, der aus der Anteilnahme an der Diskussion lebt, aus Lektüre und der Aufgeschlossenheit gegenüber dem kulturellen Leben. In einer Weise, wie es in der Reihe der Präsidenten nur Theodor Heuss gelang, sind seine Reden Dokumente der Auseinandersetzung mit den geistigen Strömungen der Zeit. Es ist dieser Charakter des Politikers Weizsäcker, den die Journalistin Nina Grunenberg auf den Begriff gebracht hat: Er war ein Bundespräsident, «der die Entwicklung von Gedanken zu einer Möglichkeit des Einflusses macht».
Vor allem aber steht hinter Weizsäckers Wirkung ein Leben, das ein Jahrhundertleben ist, mittlerweile, wunderbarerweise, fast auch an Jahren, aber vor allem an Ereignissen und Erfahrungen. Mit ihm ist einer unter uns, für den das, was für fast alle anderen Geschichte ist – graues Schulbuchwissen oder bunte Erzählung–, sein Lebensstoff war. Es gibt seinem Reden und Schreiben, ja, auch seiner Haltung und seinem Verhalten einen Resonanzboden durchlebter und aufbewahrter Zeit. Vermutlich ist es dieser Umstand, der einen phantasiebegabten Schriftsteller wie den Niederländer Cees Nooteboom herausforderte, sich vorzustellen, dass der bei einem Empfang in Schloss Bellevue sein Sektglas balancierende Bundespräsident «derselbe Körper ist, in dem seine Seele schon hauste, als sie sich beide 1943 vor Leningrad befanden». Mit Weizsäcker reicht die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart. Er ist Zeitzeuge und Deuter in einem. Er hat das deutsche Thema von Kontinuität und Bruch am eigenen Leibe erfahren. Wenn er, wie ihm die Zeithistoriker bescheinigen, mit der Rede zum vierzigsten Jahrestag des 8.Mai 1945 der «politisch-normativen Großdeutung». (Norbert Frei) des Zusammenbruchs zur Durchsetzung verholfen hat, dann wegen des lebensgeschichtlichen Fundus, aus dem heraus er gesprochen hat.
Außerdem ist Weizsäcker ein Exemplar jener traditionellen deutschen Elite, die aus der politischen Führungsschicht der Bundesrepublik so gut wie verschwunden ist. Es gehörte schon zur Physiognomie der jungen Bundesrepublik, dass – wie Wolf Jobst Siedler in der Frühzeit der Republik angemerkt hat – «mit Konrad Adenauer, Eugen Gerstenmaier, Heinrich Lübke, Franz Josef Strauß und all den anderen… die Söhne von Regierungspräsidenten, Kammergerichtsräten und Professoren durch die Enkel von Angestellten, Unteroffizieren und Handwerkern abgelöst worden» sind; seither haben die Zentrumssöhne und mittelständischen Aufsteiger das Ruder übernommen. Weizsäcker kommt anderswo her, kaum ein Politiker seiner Generation reicht so weit hinein in das alte Deutschland wie dieser Sohn eines Diplomaten, Enkel eines königlichen Ministerpräsidenten. Wer könnte, zum Beispiel, sagen, dass er den Generalobersten Beck, den Mann des 20.Juli 1944, «noch gut vor Augen» habe, beim Tee im Garten der Eltern? Mit dem Blick von außen hat die kluge Französin Brigitte Sauzay, Dolmetscherin der Präsidenten von Pompidou bis Mitterrand und Deutschen-Kennerin, bemerkt, Richard von Weizsäcker sei «unter dem Politikerpersonal der so prosaischen Bundesrepublik derjenige, der die Aura und das Charisma des ‹Deutschland› von ehedem am meisten bewahrt hat».
Doch es sind Glanz und Elend der alten deutschen Führungsschicht, die uns in ihm noch berühren. Man muss sich klarmachen, dass der Richard von Weizsäcker, der 1993 in München so eindrucksvoll zum Gedenken der Geschwister Scholl spricht, der Jahres- und Generationsgenosse dieser beiden großen Gestalten des deutschen Widerstands ist – er selbst Jahrgang 1920, Hans und Sophie Scholl 1918 und 1921.Die Toten bleiben jung, doch Weizsäcker hat das Ende des alten Deutschland traumatisch erfahren. Das Hineintauchen und Hineingetauchtwerden des deutschen Bürgertums in das Dritte Reich ist für ihn in der Rolle des Vaters, des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt, zum Exempel geworden. Als sein Hilfsverteidiger beim Kriegsverbrecherprozess vor dem Nürnberger Gerichtshof war Weizsäcker tief in dieses Familienkapitel involviert.
Sein ganzes Leben lang haben ihn deshalb Mutmaßungen über die Motive seines politischen Engagements und seiner Amtsführung als Präsident verfolgt: Ist seine Beschäftigung mit der Vergangenheit etwa psychologisch zu verstehen, als Kompensation dieses familiären Schicksals? Ist die Amtsführung dieses Präsidenten die Antwort auf die «Wunde». (Gunter Hofmann), die der Prozess gegen den Vater in sein Leben gerissen hat? Oder zumindest der Versuch, «die merkwürdige Blindheit seines geliebten Vaters durch eine Politik des angemessenen Wortes zu korrigieren». (Gustav Seibt)? Weizsäcker selbst hat – ebenso wie sein Bruder Carl Friedrich – durchweg mit großer Empfindlichkeit reagiert, wann immer die Rede auf den Vater kam.
Nicht zuletzt ist in Richard von Weizsäcker ein Politiker zu besichtigen, der ungewöhnlich geschichtsbewusst und geschichtsgeprägt ist. Für ihn ist das Bekenntnis, dass er sich keine verantwortliche Politik vorstellen könne, «die unwillig ist, die Geschichte zur Kenntnis zu nehmen, oder unfähig, aus ihr zu lernen», mehr als der fällige Tribut an die hergebrachte nationalpädagogische Rolle der Historie. Seine immer wieder geäußerte Überzeugung, die Nachkriegszeit als Erinnerung an den Krieg und seine Folgen sei noch längst nicht zu Ende, weil diese Lektion auch in der Welt von heute weiterwirke, gibt seiner Sicht der Gegenwart die Tiefendimension. Doch Geschichte ist für Weizsäcker tatsächlich noch die gestaltende Macht in Politik und Weltgeschehen. Sein Denken und Urteilen lebt und webt geradezu in Geschichte, ist durchdrungen von Bezügen und Beispielen, hinter denen ein ausgeprägtes Geschichtsbild erkennbar wird. Wer sonst, zum Beispiel, fände eine Epoche, seine Lieblingsepoche, die frühe Aufklärung, aufgehoben in einem Menzel-Bild, der Begegnung von FriedrichII. mit Kaiser JosephII.? Und immer wieder das Grundgefühl des Historismus: Nicht wir beherrschen die Geschichte – wir gehören ihr an. Ins Persönliche gewendet: «Ich war schon vor mir da, also bin ich.» Dabei steht der Weltbürger Weizsäcker mit seinem historischen Standbein fest in der überkommenen Fragen- und Gestaltenwelt der deutschen Geschichte– Dreißigjähriger Krieg und Preußen, Luther und Bismarck, Sonderweg und Weg nach Westen–, und gerne erzählt er von einem Wartburg- und Weimar-Besuch François Mitterrands, der seine Pointe in dem Dank des französischen Staatspräsidenten findet, endlich die Entstehungsorte deutscher Kultur kennengelernt zu haben – bisher habe man ihn nur den Rhein hinauf- und hinuntergeführt. Im mitteldeutschen Geschichtsraum, in Magdeburg und im Harzvorland, nicht in Köln oder München, sieht Weizsäcker den Anfang der deutschen Nation. Und wenn in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» Sachsen-Anhalt eine nur «geringe kulturelle Substanz» bescheinigt wird, bekommt das Blatt einen geharnischten Leserbrief des Altbundespräsidenten: das Land gebe «einen unübertrefflichen und unersetzbaren Begriff von den Ursprüngen deutscher politischer und kultureller Identität».
Schließlich zeichnet Weizsäcker aus, dass er der erste Präsident des geeinten Deutschland war, weshalb ihm auch zukam, den deutschen Staatsakt schlechthin zu zelebrieren – die Verkündung der Wiedervereinigung eines über vier Jahrzehnte getrennten Landes. Und wer wäre dafür berufener gewesen? Sein ganzes politisches Leben hindurch hat die deutsche Frage ihn umgetrieben. Aber zugleich offenbarte sich in dieser Krönung seiner Laufbahn ein irritierendes Moment. Die deutsche Einheit kam ja nicht so, wie es Weizsäcker und alle die anderen Deutschlandpolitiker seit den sechziger Jahren angestrebt und gewünscht hatten, nämlich im Kontext eines zusammenwachsenden Europas, sondern sie «bahnte sich ihren eigenen Weg». (Peter Bender), mit Montagsdemonstrationen und Mauerfall. Für einen wichtigen Augenblick, die Phase der Weichenstellung nach dem 9.November 1989, verlor der Bundespräsident, die überragende politische Identifikations- und Integrationsgestalt der alten Bundesrepublik, seine orientierende Kraft.
Das hat das Phänomen Weizsäcker nicht ernstlich beschädigt, aber es hat es verändert. Eingezwängt zwischen der Erkenntnis, dass die Vereinigung nicht anders möglich gewesen wäre, und der Überzeugung, dass sie anders hätte verlaufen müssen, machte er die Schieflage im Seelenleben der Nation zu seinem Thema, halb Mutmacher, halb Therapeut. Wurde der Präsident, in dem sich doch die alte Bundesrepublik repräsentiert sah, zur Stimme der Ostdeutschen? Jedenfalls sah Weizsäcker es nun als seine Aufgabe an, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das Gelingen der deutschen Einheit nicht allein von den Milliardenbeträgen abhing, die aus der Alt-Bundesrepublik in den Osten überwiesen wurden, sondern auch davon, wie die Deutschen (West) mit den Deutschen (Ost) umgingen. Die kritischere Tonlage gegenüber der politischen Klasse in der Bundesrepublik ist nicht zu überhören.
Sie findet ihren Adressaten, wie bekannt, nicht zuletzt im damaligen Bundeskanzler. Aber der Blick auf das Phänomen Weizsäcker kommt ohnedies an seinem Verhältnis zu Helmut Kohl nicht vorbei – und das nicht nur, weil die zehnjährige Amtszeit des Bundespräsidenten vollständig zusammenfällt mit der noch längeren Ära Kohl. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik wurde die – ohnehin nicht einfache – Beziehung der beiden obersten Repräsentanten des Staates derart zu einer Funkenstrecke. Zum ersten Male standen Bundespräsident und Kanzler in einem «nicht nur komplementären, sondern auch konkurrierenden Verhältnis». (Wolfgang Jäger). Zu deutlich wurden ihre unterschiedlichen Positionen in vielen Fragen, zu offenbar die Differenz der politischen Charaktere. Und das aufgeheizte Klima der achtziger Jahre tat das seinige dazu, dass beide gegeneinander in Stellung gebracht wurden – allerdings auch der Umstand, dass keiner von beiden viel getan hat, diesen Eindruck auszuräumen. Präsident und Kanzler, der Repräsentant ohne Macht und der Träger der Macht, erschienen als Fixpunkte von Gegensätzen, von Gereiztheiten bis hin zur offenen Rivalität – obwohl sie andererseits, wie der britische Politologe Timothy Garton Ash fand, «eines der effektivsten Doppel der letzten Jahre an der Spitze eines europäischen Staates» gewesen seien.
In diesem Konflikt steckten eine lange, persönliche Geschichte von Frustrationen und Verletzungen, aber auch zwei unterschiedliche Politikauffassungen: Machtpolitik oder Konzeptionspolitik, Parteiinteresse oder Staatsräson, Bauch oder Kopf. Doch schlug sich in der Zuspitzung ihres Verhältnisses nicht auch die Entsagung nieder, die das Amt des Staatsoberhaupts einem politisch ambitionierten Mann wie Weizsäcker abverlangte? Außer dass er gern Bundespräsident war, wäre Richard von Weizsäcker wohl auch gern etwas anderes gewesen, Kanzler oder vielleicht lieber noch Außenminister, über welchem Kanzler auch immer.
Das heißt nicht, dass irgendetwas an dieser politischen Existenz unerfüllt geblieben wäre. Richard von Weizsäckers Lebenswerk als öffentliche Figur, als Parlamentarier, Regierender Bürgermeister, Bundespräsident, steht außer allem Zweifel. Aber dazu gehört auch, dass die Abgründe und Abbrüche, die dieses Leben mitgeformt haben, zu groß sind, um einfach mit der Erfolgsgeschichte der Nachkriegszeit verrechnet werden zu können. Ist es ein Zufall, dass die Titel seiner Erinnerungen, «Vier Zeiten», und ihrer Ergänzung, «Drei Mal Stunde Null?», geradewegs Chiffren für ein Leben im Spannungsfeld von Kontinuitäten und Brüchen sind? Seine große Wirkung rührt vermutlich aus den historischen Synthesen, die er vor diesem Hintergrund postuliert, mehr noch: gelebt hat. Sie begründen das Phänomen Weizsäcker – einen Politiker, der mit seinen Fragen und Anregungen, Thesen und Antithesen ein Bild der Deutschen entstehen ließ, das ihnen Vertrauen gab, nicht zuletzt zu sich selbst. Dabei war und ist er nicht der Prinzipienansager der Nation, auch nur bedingt der Mann einer Partei, und mit Ideologien kann er ohnedies nichts anfangen. Er ist ein Gratwanderer, ein Vermittler, ein Zusammenführer. Wie ihm das möglich war, bleibt, wie alles Individuelle, ein Geheimnis. Wie es dazu gekommen ist, bleibt ein spannendes Kapitel unserer Geschichte und Gegenwart.
Teil 1
Eine deutsche Vergangenheit
«Halber Schwabe, ganzer Berliner»: Herkunft und Familie
Es ist nichts Geringeres als eine Zeitenwende, in die hinein er geboren wird. Auch dass Richard von Weizsäcker am 15.April 1920 im Neuen Schloss in Stuttgart das Licht der Welt erblickt, verdankt sich weniger der Herkunft der Familie als der Unruhe, die auf die militärische Niederlage und die Revolution im November 1918 folgt. Der feudale Geburtsort ist in Wahrheit eine Mansarde der Dienstwohnung seines Großvaters mütterlicherseits, des Generals Fritz von Graevenitz, der Generaladjutant des württembergischen Königs gewesen war, und für die Familie des Seeoffiziers Ernst von Weizsäcker bilden die Räumlichkeiten im Seitenflügel des Schlosses auch nur ein zeitweiliges Refugium. Der Vater hat den Posten des Marineattachés an der deutschen Gesandtschaft in Den Haag, den er nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches übernommen hatte, bereits ein halbes Jahr später wieder aufgeben müssen und die Familie nach Stuttgart gebracht, damit Marianne von Weizsäcker dort ihr viertes Kind zur Welt bringen kann. Überdies ist die Reise der Weizsäckers in ihre württembergische Heimat ein heikles Unternehmen: Weil der Kapp-Putsch vom März 1920, ein Umsturzversuch reaktionärer Kreise, den die Gewerkschaften mit einem Generalstreik beantworteten, den Verkehr lahmgelegt hat, findet sie auf einem holländischen Frachtdampfer statt. Sechs Tage sind Eltern und Kinder unterwegs, durch das vom Untergang der Monarchie gezeichnete Rheinland, das sich unter alliierter Besatzung befindet. Die rote Fahne, die nach allen Erzählungen über dem Schloss weht, als Richard von Weizsäcker ins Leben tritt, ist ein Sinnbild chaotisch bewegter Zeiten.
Die dramatische Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts hat in Vergessenheit geraten lassen, wie tief der Umbruch war, den der Ausgang des Ersten Weltkriegs bedeutete. Mit der Revolution und der Errichtung der Weimarer Republik stürzen nicht nur Kaiser, Könige und Landesfürsten; es endet auch eine Ordnung, mit der die Deutschen seit unvordenklichen Zeiten gelebt haben. Dass innerhalb von wenigen Tagen die gewohnte Herrschaftsform, der monarchische Obrigkeitsstaat, dahinsinkt, bewegt viele von ihnen mehr als die Hoffnungen, die sich mit der Republik verbinden. Dazu kommt der dem Deutschen Reich im Juni 1919 von den alliierten Siegermächten auferlegte Versailler Vertrag, der als nationale Katastrophe empfunden wird. Die Erschütterung dringt in alle Schichten der Gesellschaft ein. Sämtliche überlieferten Sicherheiten scheinen in Frage gestellt zu sein: «Man wundert sich, wenn man aus dem Haus geht, dass Häuser und Bäume noch stehen», notiert der liberale Theologe Ernst Troeltsch.
In Württemberg ist zwar das Verhältnis von Monarchie und Volk durch eine ausgeprägte landsmannschaftliche Verbundenheit bestimmt, und gern wird der Ausspruch eines führenden Sozialdemokraten zitiert, dass man zwar eine Republik anstrebe, sich aber als Präsidenten keinen Besseren als den König denken könne. Gleichwohl endet die Monarchie auch hier, und die Unruhe im Reich ergreift dieses Land. Die Herren, die ein Zeitungsfoto etwas verloren auf dem Schlossplatz vor dem Neuen Schloss zeigt, wo Weizsäcker zwei Wochen später geboren wird, sind Mitglieder von Reichsregierung und Reichstag – beide sind vor dem Kapp-Putsch nach Stuttgart geflohen.
Der Zeitenumbruch berührt die Familie der Weizsäckers unmittelbar, denn sie ist eng mit der alten Ordnung verbunden. Richard von Weizsäckers Großvater väterlicherseits, Karl, ist seit 1906 württembergischer Ministerpräsident – ein Mann von eher liberalem Temperament, gleichwohl konservativer Überzeugung, der mit seinem klugen Urteil das katastrophale Ende des Krieges schon früh vorausgesagt hat. Auch die expansionistische, auf die Erweiterung des Reiches gerichtete Kriegszielpolitik hat er scharf abgelehnt und sich zugleich gegen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg gewendet, mit dem die Scharfmacher in der militärischen Führung 1917 noch die Wende im Krieg erzwingen wollen. Aber sein Leitbild bleibt der monarchische Beamtenstaat; entschieden stemmt er sich gegen eine Parlamentarisierung, wie Sozialdemokraten und Liberale sie fordern. Obwohl treuer Württemberger, denkt er ganz vom Bismarck-Reich her, das Deutschland die staatliche Einheit gebracht hat.
Auch der Sohn Ernst von Weizsäcker lebt in dieser Vorstellungswelt, umso mehr als Angehöriger der Marine, die ein Symbol des Kaiserreichs ist. Dort hat er eine respektable Laufbahn absolviert – Offizier in der Flottenführung, Teilnehmer an der legendären Schlacht am Skagerrak, schließlich Vertreter der Marine bei der Obersten Heeresleitung. Nun steht er, knapp vierzigjährig, vor den Trümmern seiner bisherigen beruflichen Existenz und der Notwendigkeit eines Neuanfangs. Zu dem Umbruch kommen die Wunden, die der Krieg der Familie geschlagen hat: Ein Bruder des Vaters, zwei Brüder der Mutter sind gefallen – dass Richard von Weizsäcker den Vornamen des einen erhält, lässt erkennen, wie stark die Gegenwart im Banne dieser jüngsten Vergangenheit steht.
Vor allem ist die Familie tief in Württemberg verwurzelt. Wenn Theodor Heuss, der Amtsvorgänger Richard von Weizsäckers, für den ersten deutschen Präsidenten, Friedrich Ebert, das Wort gefunden hat, er sei «aus dem Schatten der hinteren Häuser einer alten Volksgeschichte» gekommen, so könnte man für Weizsäcker sagen, dass sein Hintergrund die Kanzeln, Studierzimmer und Amtsstuben des alten Württemberg sind. Denn die Weizsäckers sind typische Vertreter des schwäbischen Bildungsbürgertums. Mit ihrer Herkunft aus einem Müllergeschlecht in der Nähe des hohenloheschen Städtchens Öhringen und einem sozialen Aufstieg, der sie bis in die oberen Ränge der Gesellschaft führt, sind sie Stoff vom Stoff des Landes, vielfältig hineinverzweigt in seine Bildungs- und Oberschicht. Der Familie entstammen Theologen, Historiker, Juristen und Verwaltungsbeamte – einer der berühmtesten war im neunzehnten Jahrhundert Rektor und Kanzler der Universität Tübingen und verfasste die nach Luther am weitesten verbreitete Übersetzung des Neuen Testaments; ein anderer gelangte auf einen historischen Lehrstuhl der Berliner Universität, als diese Ende des Jahrhunderts die erste in Deutschland war; wieder ein anderer, Victor von Weizsäcker, begründete die psychosomatische Medizin.
Es ist eine bürgerliche Geschichte, die durchaus in der Nähe der großen Gestalten stattfindet, die den Ruhm des Landes verkörpern, der Erfinder, Unternehmer und Denker, deren schöngeistige Aufgipfelung in der schwäbischen Selbstdeutung den stolzen Vers ergibt: «Der Schelling und der Hegel,/der Schiller und der Hauff,/die sind bei uns die Regel,/die fallen gar nicht auf.» In dem württembergischen Ministerpräsidenten gewinnt sie ihren Höhepunkt und reicht zugleich noch in die Lebenszeit Richard von Weizsäckers hinein. Denn obgleich Karl von Weizsäcker schon 1926 stirbt, ist der «Großpapa Weizsäcker» – wie er in der Familie genannt wird – für ihn noch ganz präsent. Der Enkel erinnert sich an «seinen kleinen Wuchs und seinen spitzen Bauch, seine rasche und scharfe Zunge, seinen Witz und sein Wohlwollen». Er habe sich durch «starke Willenskraft und entschiedene politische Überzeugungen» sowie durch seine unbezweifelbare Autorität ausgezeichnet, in der sich das Erbteil des neunzehnten Jahrhunderts und die selbstbewusste Auseinandersetzung mit der neuen Zeit vereinigen. Noch als Bundespräsident reagiert Weizsäcker vergnügt, wenn er in einem Interview darauf angesprochen wird, dass man von dem Vorfahren gesagt habe, er sei eine «eiserne Hand im Samthandschuh» gewesen. In gewissem Sinne lebt gerade er in der Familie fort, denn von ihm leitet sich der erbliche Adel her. Den persönlichen, nicht vererbbaren Adel besaß bereits Carl Heinrich, der Tübinger Theologe und Universitätskanzler. 1916 erhebt der König seinen Ministerpräsidenten in den Freiherrenstand. Richard von Weizsäcker ist der Erste, der den Titel von Geburt an trägt.
Ist Weizsäcker also Schwabe? Es steht außer Frage, dass der Hintergrund von Familie und Herkunft für ihn beträchtliches Gewicht hat – und dass dazu Schwaben gehört, auch wenn er nur sein erstes Lebensjahr dort verbrachte. Das Land hat seine eigene Prägekraft– Theodor Heuss, der ein selbstbewusster Schwabe war, hat die «Eindringlichkeit» als die Eigenschaft hervorgehoben, mit der Kultur und Geschichte in diesem Land fortwirke; die Schwaben seien wenn nicht der «komplizierteste», dann «gewiss der spannungsreichste unter den deutschen Stämmen». Weizsäcker selbst beschreibt seine Herkunftsregion als eine «parzellierte, vielfältige, etwas enge Landschaft, die den neugierigen Drang in die Welt herausfordert, ohne dass es die Heimatliebe lockern würde.» Dieses Fluidum des Schwäbischen hat auch Richard von Weizsäcker zweifellos in der Familie umgeben. In ihr «herrschte das schwäbisch-geistige Element vor», denn die Eltern sind gute Schwaben, obwohl sie entscheidende berufliche Jahre hoch im Norden, in Kiel und Wilhelmshaven, den Häfen der kaiserlichen Marine, und dann in Berlin zubringen.
Zumindest die Nord-Süd-Spannung hält die landsmannschaftlichen Besonderheiten fest, auch in der Familie Weizsäcker. In dem seit seiner Gründung 1871 gerade erst in ein mittleres Staatenalter hineingewachsenen Deutschen Reich gleichen Nord- und Süddeutschland noch lange zwei Festlandplatten, die sich aneinander reiben – aus den Briefen und Tagebüchern von Ernst von Weizsäcker dringt immer wieder einmal der Stolz der Württemberger und die Distanz gegenüber dem Norden heraus, «dem man mit seinem kleinen Gehirn helfen muss». Die Andersartigkeit Süddeutschlands gegenüber dem preußischen Norden bleibt noch lange zumindest unterschwellig eine mentale Größe – in den Wirren der Revolutionszeit 1918/19 ist keineswegs ganz ausgeschlossen, dass Deutschland in Norden und Süden auseinanderfallen könnte. Andererseits wächst gerade in den Jahren ihres Aufstiegs zur Reichshauptstadt die Neigung der Schwaben zu Berlin, was sie nach dem bekannten Bonmot zur größten Minderheit neben den Türken gemacht hat.
Doch anders als für seine Eltern spielt für Richard von Weizsäcker die landsmannschaftliche Zugehörigkeit keine maßgebende Rolle mehr. Er versteht sich nicht als Schwabe, allenfalls – wie er gelegentlich formuliert – als «Schwabe im Exil», als «Schwabe ohne Schwaben», und wenn er als Bundespräsident beim Besuch in ebendem Neuen Schloss, in dem er geboren ist, von «uns Stuttgartern» spricht, so ist das in erster Linie ein Tribut an das Selbstbewusstsein der Stadt. Er hat auch nichts dagegen, wenn man ihm preußische Züge bescheinigt; jedenfalls habe ihn das Leben zum «halben Preußen» gemacht, auch wenn er «ein bißchen mehr Schwabe» geblieben sei. Ohnedies empfindet er sich als Berliner – die Stadt wird für ihn zum entscheidenden Schauplatz seiner Jugend, und das, obwohl er das Schicksal von Diplomatenkindern teilt: viele Orte, wechselnde Schulen, kaum irgendwo Zeit zum Einwurzeln. Auf die Kleinkindjahre in Basel, wo der Vater Generalkonsul war, folgt die Einschulung in Dänemark – er hat nach eigener Auskunft damals Dänisch so gut wie Deutsch gesprochen–, später kommen ein halbes Jahr Norwegen und drei Jahre Bern hinzu.
Oder ist es gerade der häufige Ortswechsel, der den Berliner Jahren das Gewicht gibt? In dieser Zeit, von 1927 bis 1933, zwischen dem siebten und dem zwölften Lebensjahr, so schreibt er in den «Erinnerungen», beginnt «mein bewusstes Leben». Und dies unter den Umständen der Großstadt: nicht im Villenviertel, sondern in einer typischen Berliner Etagenwohnung, die die Weizsäckers in Wilmersdorf bewohnen. Sie befindet sich in der Fasanenstraße, etwas dunkel, aber geräumig, im Nebenhaus wohnt der SPD-Reichstagsabgeordnete Rudolf Breitscheid, auf den heute eine Gedenktafel hinweist, während das Weizsäcker’sche Haus einem Neubau Platz machen musste. Hier, mitten im alten Westen, wo die Mietshäuser der Jahrhundertwende das Stadtbild bestimmen, verbringt Richard von Weizsäcker «prägende, glückerfüllte Jahre». Damals ist Berlin für ihn «zum Mittelpunkt des Denkens und Fühlens, zur eigentlichen Heimat geworden und ist es bis zum heutigen Tag geblieben». Er ist auch der Erste in der Familie, der, wie er einräumt, nie richtig Schwäbisch sprechen konnte, stattdessen aber «anständig berlinerisch lernte». Das ist für ihn auch ein Mittel, sich gegenüber den älteren Geschwistern zu behaupten – und erlaubt es ihm später, 1981, damit kokettieren zu können, dass er der erste Regierende Bürgermeister der Nachkriegszeit sei, der wirklich berlinern könne…
Das Berlin, in dem Weizsäcker seine frühen Jahre erlebt, ist die Stadt, in der sich das deutsche Schicksal zuspitzt. Es ist die Stadt der auslaufenden zwanziger Jahre, des Niedergangs der Weimarer Republik und des aufziehenden Dritten Reiches– Golden Twenties und braune Diktatur fast noch auf Tuchfühlung. Doch für den jungen Richard bedeutete diese Zeitspanne vor allem das Aufwachsen in einer Familie, die für ihn – wie er bekennt – ein «entscheidender Rückhalt und Segen im Leben» gewesen und geblieben ist. Immer wieder sei ihm bewusst geworden, «dass das Schicksal mir mit der Familie einen Vorzug von unschätzbarem Wert geschenkt hat». Das Urteil beeindruckt durch die Entschiedenheit, mit der es ein Essential der eigenen Lebenserfahrung bilanziert – und das in einer Zeit, in der die Gesellschaft sich rapide verändert und neue Umgangsformen an Boden gewinnen. Richard von Weizsäckers Diktum kehrt nachgerade die Tendenzen des Zeitgeistes um: «Die Maßstäbe für das Leben kamen nicht von außen, sie kamen aus der Familie.» Er und seine Geschwister erfuhren «das durch nichts zu überbietende Glück, uns ganz in der Familie entfalten zu können». Bekanntschaften spielten für sie erst vergleichsweise spät eine Rolle.
Richard von Weizsäcker muss – wie er plastisch formuliert – drei älteren Geschwistern «hinterherwachsen». Der kleine Richard ist offenbar ein lebendiges, aufgewecktes und aufgeschlossenes Kind gewesen, allerdings auch keck und gelegentlich etwas nervend – was ihm den Spitznamen «Kikeriki» einträgt sowie den liebenswürdigen, unüberhörbar schwäbisch intonierten Spott des Vaters, das größte «Lümple» unter den Kindern zu sein. Zu dem acht Jahre älteren Carl Friedrich ist eine leise Distanz nicht zu verkennen – der künftige Philosoph und Physiker ragt durch seine hohe Begabung hervor und ist schon dabei, sich dem späteren Nobelpreisträger Werner Heisenberg anzuschließen. Die Schwester Adelheid und der Bruder Heinrich, vier beziehungsweise drei Jahre älter, bilden das nähere Umfeld der Kinderjahre, wobei ihm der Bruder am nächsten ist; ihm gehört seine tiefe Zuneigung – sein Relief, angefertigt von Fritz von Graevenitz, einem Onkel, steht auf der Terrasse seines Berliner Hauses.
Doch vor allem ist es das Bild der Mutter, das die Erinnerung an den Familienkreis beherrscht. Sie sei «Mittelpunkt und Herz» der Familie gewesen, und das nicht nur, weil ihr die häusliche Arbeit und die Kindererziehung oblagen. Es ist die seelische Kraft, die sie auszeichnet. «Ein lautes Wort habe ich zeitlebens nicht von ihr gehört», erinnert er sich und hebt ihre «willensstarke Selbstbeherrschung» hervor, die Konsequenz, die sie den Kompromissen spürbar vorzog und die durch «keine nervöse Aufgeregtheit verwirrt» werden konnte; ganz ähnlich beschreibt sie Carl Friedrich, der Bruder: «leise, eigentlich sehr leidenschaftlich, unglaublich beherrscht». Der Vater verkörpert den anderen Part: ihn kennzeichnete, so Richard von Weizsäcker, die den Schwaben eigene Scheu vor Gefühlsäußerungen. Er sei eher ein Verstandesmensch gewesen, mit klaren Prinzipien und großer Autorität. Aber die Mutter sei, obgleich in klassischem Muster ihrem Mann voller Liebe und Zuneigung zugetan, am Ende doch die Stärkere gewesen.
Im Hause Weizsäcker ist eine Familien- und Kinderwelt noch lebendig, die anrührend gestrig erscheint. Da wird sonntagnachmittags gemeinsam gelesen, Dramen mit verteilten Rollen oder Gedichte, der «Zerbrochene Krug» oder Lessings «Nathan», und den «Handschuh» von Schiller kann Richard schon als kleines Kind auswendig. Und kann man zweifeln, dass auch der übrige schwäbische Parnass der Uhland, Mörike und Hauff in hohen Ehren stand? Nicht zuletzt lernt man in Weizsäckers Erinnerungen an das Elternhaus eine Fülle von Spielen aller Art kennen, die längst vergessen sind. Dazu kommen die mit Fleiß und Eifer bewahrten Rituale der familiären Feste, etwa zu Weihnachten. Eine große Rolle spielt die Hausmusik; sie muss von beachtlichem Niveau gewesen sein, denn gelegentlich ist der berühmte Pianist Edwin Fischer dabei, zu den Gästen gehören Ricarda Huch oder Ina Seidel, damals berühmte Autorinnen, aber auch der junge Werner Heisenberg. Ein Foto zeigt die drei jüngeren Geschwister als Trio, am Klavier die Schwester mit braven Jungmädchenzöpfen, Bruder Heinrich mit konzentriertem Jungensblick am Cello und der geigende Richard mit den mageren Knien des Zehnjährigen: ein Bild aus dem Innersten des deutschen Gemüts, fast zu schön, um wahr zu sein. Richard von Weizsäcker beeilt sich, den Eindruck ein wenig zu dämpfen und zu ironisieren: Seine nie erlahmende Musikliebe sei größer gewesen «als mein allzu rasch nachlassender Fleiß». Mit fünfzehn Jahren gibt er das Violinespiel auf, im Schulorchester «gab es zu viele durchschnittliche Geiger wie mich».
Eine heile Welt? Es ist nicht anzunehmen, dass die Volksweisheit, der zufolge unter jedem Dach ein kleines Ach wohnt, für die Weizsäckers nicht gegolten hat. Doch erstaunt es, dass die historischen Bruchlinien zwischen alter und neuer Zeit, die sich in den zwanziger und dreißiger Jahren durch die bürgerlichen Verhältnisse ziehen, diese Familie gar nicht berühren. Nirgendwo ist da zum Beispiel eine Spur eines Vater-Sohn-Konfliktes, ohne den das Erwachsenwerden in bürgerlichen Milieus damals, wenn man der zeitgenössischen Literatur und diversen Lebensgeschichten folgt, nicht denkbar schien, und das zeitgemäße Ausbrechen in die Jugendbewegung beschränkt sich auf die Mitgliedschaft von Bruder Heinrich in einer konservativen Gruppe der bündischen Jugend. Vergegenwärtigt man sich die Geschichte der Familie Hammerstein, die Hans Magnus Enzensberger unlängst erzählt hat, so drängen sich andere Möglichkeiten auf, die die damalige Zeit und vor allem Berlin bereithielten. Gewiss, das Abdriften in die Boheme und den Kommunismus betrifft in diesem biographischen Bericht vor allem die Töchter, die voll in die Wirren der zwanziger Jahre geraten; die Weizsäcker-Kinder sind dafür zu jung. Aber vergleichbar sind die Hammersteins und die Weizsäckers sehr wohl, der General und der Diplomat, die Familien kannten sich und verkehrten miteinander, und die aufregende Großstadt mit ihren Stürmen und Untiefen umgab beide. Doch für die Weizsäckers wird die Stadt nicht – wie für die Hammersteins – das «große Meer», in dem die Kinder vom sicheren Kurs eines bürgerlichen Daseins abzukommen drohen.
Dabei haben Stadt und Zeit ihren Anteil an der Entwicklung des Jungen, der langsam der Kindheit entwächst. Natürlich ist er zu jung, um viel von der turbulenten Metropole mitzubekommen, zumal das auch nicht die Welt der Eltern ist. Immerhin sieht der Junge den Vater gelegentlich im Frack, die Mutter im Abendkleid, fertig zum Ausgehen – eine Ahnung von der großen Stadt. Das kulturelle Berlin und seine Mythen streifen ihn wenigstens: eines Tages nimmt ein Freund der Familie ihn und seinen Bruder Heinrich mit in eine feierlich ausstaffierte Mansardenwohnung am Kurfürstendamm, wo er neben einen alten Herrn gesetzt wird. Später erfährt er, dass es der Dichter Stefan George war – die starke Hand, die dieser um den Nacken des Jungen legt, vermeint Richard von Weizsäcker «noch bis heute zu spüren». Deutlicher teilt sich ihm die soziale Lage mit, deren Verschärfung Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre überall sichtbar wird. Von seinem Platz im sogenannten Berliner Zimmer sieht das Kind, wie auf dem Hof die Sänger und Leierkastenmänner für ein paar Groschen oder etwas Essbares spielen. Die sozial engagierte Mutter nimmt ihn gelegentlich mit in den Arbeiterbezirk Neukölln, wo sie sich als Hilfsvormund um Problemfamilien kümmert. Auch die Familie selbst spürt die Kürzungen, die in der Spätzeit der Weimarer Republik den Beamten auferlegt werden. Die Behandlung eines komplizierten Armbruchs, den sich Richard zuzieht, bringt zeitweise sogar das Familienbudget in Kalamitäten.
Ist dieses Familienleben so von gestern, dass es eigentlich schon in Weizsäckers Kindheit überholt war, wie Jürgen Leinemann einmal im «Spiegel» befunden hat? Doch für Weizsäcker ist es offenbar – so der Historiker Horst Fuhrmann bei der Vorstellung von dessen «Erinnerungen»–, was für den mythologischen Antäus die Erde bedeutet, also die Kraftspenderin. Jedenfalls ist die Familie mit ihrer festen Binnenstruktur, mit Riten und Spielen, eine Bastion in den Umbrüchen der Epoche, und wenn sie einer Wagenburg gleicht, dann nicht einer, die gegen die Außenwelt verschließt, sondern – wie man an Richard von Weizsäcker und seinem Bruder sehen kann – für sie tauglich macht. Vielleicht ist ihre Existenz ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, mit der Ernst Bloch die auseinanderfallende Welt der Weimarer Republik charakterisiert? Oder zeigt ein solcher Familientypus, was für unterschiedliche Inseln der Lebensbewältigung in einer Zeit der Umbrüche möglich – und erfolgreich sind? Zu dieser Art bürgerlicher Lebensweise gehört damals allerdings auch die Zurückhaltung bei der sexuellen Aufklärung. Bei der Beseitigung der Erkenntnis- und Erziehungslücken in Bezug auf diese wichtigen Geheimnisse des Lebens ist dem immerhin schon achtzehnjährigen Richard – wie er amüsiert berichtet – eine kleine Gruppe von Berliner Ofensetzern behilflich, die er später im Arbeitsdienst kennenlernt.
Nicht zuletzt wird die Schule der Ort, an dem das Beben der Zeit zu spüren ist. Weizsäcker erinnert sich deutlich daran, wie die Elf- und Zwölfjährigen in den Pausen debattierten – über die permanenten Regierungskrisen und die in immer kürzeren Abständen stattfindenden Reichstagswahlen. Sie tauschen sich aus über die Berichte von den Straßenkämpfen, bei denen sich Tag für Tag weit hinten im Wedding oder in Friedrichshain Kommunisten und Nazis gegenseitig verprügeln: «Wir spürten, wie nervös und in einem uns nicht durchschaubaren Sinne gefährlich die Zeiten waren. Wir bekamen als Kinder ein noch unbegriffenes, aber elementares Verhältnis zur Politik.» Die Jungens sind wach – ohne dass sie viel von dem verstehen, was sich vollzieht–, denn das Bismarck-Gymnasium, in das Richard von Weizsäcker neunjährig eintritt, wird vor allem von Akademikerkindern besucht. Fast die Hälfte seiner Klasse ist jüdischer Herkunft, Weizsäcker erinnert sich, dass sie besonders eifrig an den Streitgesprächen teilnahmen.
Dagegen kann er sich antisemitischer Äußerungen nicht entsinnen. Selbst 1937, als er aus Bern für drei Monate zurückkommt, um in der alten Klasse das Abitur abzulegen, ist davon noch nichts zu spüren. Die meisten Lehrer bemühen sich gegenüber den jüdischen Mitschülern um Fairness. In dieser gutbürgerlichen Gegend ist das offenbar kein Einzelfall: Marcel Reich-Ranicki macht ein Jahr später an einem zwei Straßenecken entfernten Gymnasium Abitur und berichtet, dass die Lehrer sich überwiegend anständig verhielten und die Mitschüler die Juden in der Klasse respektierten. Der Preis dafür ist hoch: eine Gleichgültigkeit, die die Absonderung der deutschen Juden und ihre rapide zunehmende Auswanderung gar nicht ins Bewusstsein dringen lässt. Ähnlich zweifelnd betrachtet Richard von Weizsäcker im Rückblick das Verhältnis zu den jüdischen Mitschülern in seiner Klasse: Waren sie Freunde, blieben «aber doch eben andere»? Immerhin: Bis zum Abitur waren alle jüdischen Mitschüler noch dabei. Und alle in der Klasse standen sie «gegen die Welt da draußen eng zusammen».
Den Beginn des Dritten Reiches vergisst er übrigens nie, obwohl er erst zwölf Jahre alt ist. Den Anfang der Geschichtskatastrophe, die tief in sein Leben und das seiner Generation eingreift, behält er schon deshalb im Gedächtnis, weil er ihn als nervenkitzelnden Knalleffekt im Sportpalast erlebt – ein Onkel hat ihn dorthin zu einem Reit- und Fahrturnier eingeladen: Mitten in einer Konkurrenz «sprangen plötzlich von allen Seiten Zeitungsverkäufer durch die Reihen der Tribünen und brüllten die Überschrift ihres Extrablattes heraus: ‹Hitler berufen›». Dass «etwas ungeheuer Aufregendes» geschehen sei, teilt sich ihm gleichwohl mit. Nun wird die Phase seines Erwachsenwerdens hineingepresst in die kurze, dramatische Zeitspanne jener drei, vier Jahre, in denen das Dritte Reich mit Verführung und Gewalt, mit Druck nach innen und Aggressivität nach außen in seine totalitäre Dimension heranwächst. Über seiner Entwicklung in den hergebrachten Bahnen gesicherter Bürgerlichkeit, wohlbehütet von Familie, Schule und Bekanntenkreis, liegt der Schatten einer reglementierenden und zunehmend tyrannisch werdenden Macht, die dazu ansetzt, Deutschland und Europa zu zerstören. Als Richard von Weizsäcker zum jungen Mann geworden ist, sind die Knoten des Unheils geschürzt, die Sprengladungen gelegt, um die Welt in die Luft zu jagen.
Allerdings erlebt Weizsäcker diese gewaltige und gewalttätige Transformation aus einer besonderen Perspektive. Da der Vater Anfang 1933 erst an die Gesandtschaft in Oslo, dann im Spätsommer des gleichen Jahres nach Bern versetzt wird, ist die Familie dem unmittelbaren Zugriff der Nazis entzogen. Zwar lebt und fühlt man mit den Entwicklungen in Deutschland, doch Richard von Weizsäcker ist nicht gezwungen, die Frage täglich zu beantworten, wie man sich gegenüber dem neuen, aggressiven Staatswesen verhalten soll, ob man sich mit ihm arrangieren muss oder zu ihm in Distanz leben kann. Die Maschinerie der Aufmärsche und Appelle, mit denen die Nazis die Jugend in den Griff bekommen wollen, sieht man in Bern nur aus der Ferne.
In der Botschaft ist man nicht auf die Lektüre des «Völkischen Beobachters» und der anderen deutschen Zeitungen angewiesen, die unter dem Druck des Regimes stehen, sondern liest die Neue Zürcher Zeitung, die frei und unbeeinflusst über die Weltereignisse berichtet. Hier ist die bürgerliche Welt noch intakt, und die schweizerische Lebensweise verleiht ihr eine zusätzliche Solidität. Und während Richard von Weizsäckers Altersgenossen in Deutschland dem Zwiespalt ausgesetzt sind, den die Nazi-Ideologie und ihre Parteigänger in die Schulen tragen – obwohl sie sich damit nach vielen Berichten erstaunlich oft nicht durchsetzen–, erlebt er in der Literarschule des Berner Städtischen Gymnasiums eine anregende Schulzeit nach bewährter Art: hohe Anforderungen, Geselligkeit, viel Sport – der deutsche Gastschüler trägt bei der Kantonjugendmeisterschaft im 800-Meter-Lauf sogar einen zweiten Platz davon. Überhaupt ist das Klima in seiner Klasse freundschaftlich, und als ein Lehrer ihn mit spitzen Hinweisen auf die Verhältnisse in Deutschland herauszufordern versucht, stellen sich die Klassenkameraden vor ihn. Ihr Verhältnis ist so eng, dass sechzehn von ihnen ihn dreißig Jahre später in Berlin besuchen, als er dort Regierender Bürgermeister ist.
Und doch geht das Dilemma, in das die bürgerliche Welt durch das Dritte Reich gestürzt wird, an den Weizsäckers keineswegs vorüber. Auch sie erleben den Umbruch der Verhältnisse, obwohl das Leben in den gewohnten Bahnen weitergeht. Trotz der Machtergreifung, ja, auch nach der Etablierung des Führerstaates ist die gesellschaftliche Kontinuität nicht wirklich gebrochen. Die Beamtenschaft, die Justiz bestehen im Großen und Ganzen weiter, erst recht Wirtschaftseliten und Wehrmacht; Examen werden abgelegt und Beförderungen ausgesprochen, und selbst jene, die das Bedrohliche der Bewegung wahrnehmen, schwanken zwischen der Furcht vor einem herannahenden Unglück und der Erwartung, dass es so schlimm schon nicht kommen werde. Wird der Spuk nicht doch bald vorbei sein? Werden die Nazis sich als eine Dilettantentruppe herausstellen? Richard von Weizsäcker bleibt von diesen frühen Jahren des Dritten Reiches der Eindruck einer Atmosphäre, die «undurchsichtig» war. Im gebildeten Bürgertum «gab es noch immer kaum ein Gespür für die Bewegungen und Ressentiments in tieferen Schichten der Bewegung und ebenso wenig für die Hohlräume in der eigenen konservativen Denkweise». Und jene, die einen gewissen Begriff von dem haben, was sich vorbereitet, finden dennoch keine Einstellung gegenüber der unverhüllten Gewalt, mit der sich das Regime der Einrichtungen des Staates bemächtigt, die Öffentlichkeit okkupiert und massenhaft Rechtsbruch begeht. Weizsäckers Fazit ist bitter: «Viele der Ahnungsvollen waren seltsam waffenlos.»
Das bürgerliche Dilemma verkörpert sich in Ernst von Weizsäcker. Einerseits steht der Vater den Nazis skeptisch gegenüber. Der aggressive Stil der Außenpolitik bestürzt ihn, zumal er im Ausland zum Teil auf scharfe Ablehnung stößt – in Norwegen muss die deutsche Gesandtschaft polizeilich gegen Proteste geschützt werden, in der Schweiz gibt es immer wieder Reibereien mit der NSDAP-Auslandsorganisation, deren Leiter Wilhelm Gustloff nach seiner Ermordung zum nationalsozialistischen Märtyrer wird. Dazu kommen die alarmierenden Entwicklungen in Deutschland: der Reichstagsbrand, die Gewaltakte gegen jüdische Geschäfte am 1.April 1933 – Ernst von Weizsäcker erlebt sie in Berlin und ist erschüttert–, der sogenannte Röhm-Putsch, in dessen Folge Hitler die Führungsschicht der SA und eine Reihe





























