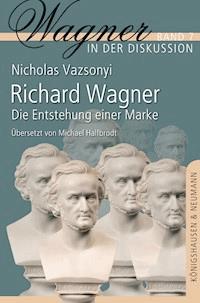
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Königshausen & Neumann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Wagner in der Diskussion
- Sprache: Deutsch
Vorwort – EINLEITUNG – IMAGE: Interesselosigkeit und Deutschsein – Marketing und die Avantgarde – Marktgerechtes Märtyrertum – Journalismus, Markt und Antisemitismus – Wagner: Entwurf einer Künstlerpersönlichkeit – Beethovens „Kuss“ – Tod und Verklärung – Der verlorene Sohn kehrt zurück – PUBLICITY: Die Dresdner Jahre – Die Asche des Tages – Webers Deutschtum – Die Rede – Der Spin – Der verlorene Sohn, Teil II – Wagners Neunte Symphonie – Wagner, der Held – Das Konzert – Nachwirkungen – Rückblickend – NISCHE UND MARKENBILDUNG: Wagner, der Rebell – Kunst und Politik – Präsentation (erst Worte, dann Musik) – Made in Germany – Wagner ® – Leitmotiv™ – Werbeagenten Herr Wagner persönlich – KONSUMENTEN UND KONSUM: Das Publikum der Zukunft – Tristan und Isolde – Musik als (Klang)Wellen – Tristan und Isolde – Das Medium ist die Botschaft – Verklärungen und Konsumentenzufriedenheit – Die Meistersinger von Nürnberg - Infomercial in drei Akten – Obsolet vs. brandneu? – Die Konkurrenz auf die Probe stellen – Produkteinführung – Kauft deutsch = kauft Wagner ® – ZENTRALE: Bayreuth als Ort der Sinnproduktion – Fundraising und Fanclubs – Vorschau auf kommende Attraktionen – Spin – Zusatzmärkte – EPILOG: DIE WAGNER-INDUSTRIE
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vazsonyi
—
Richard Wagner
wagnerin der diskussion
Band 7
Herausgegeben vonUdo Bermbach (Universität Hamburg),Dieter Borchmeyer (Universität Heidelberg),Hermann Danuser (Humboldt-Universität Berlin),Sven Friedrich (Richard-Wagner-Stiftung / Nationalarchiv Bayreuth), Hans R. Vaget (Smith College, Northampton MA, USA)
Nicholas Vazsonyi
Richard Wagner
Die Entstehung einer Marke
Übersetzt vonMichael Halfbrodt
Königshausen & Neumann
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg 2012
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
Umschlag: skh-softics / coverart
Bindung: Zinn – Die Buchbinder GmbH, Kleinlüder
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
ISBN 978-3-8260-4747-3
www.koenigshausen-neumann.de
www.buchhandel.de
www.buchkatalog.de
Inhalt
Vorwort
EINLEITUNG
IMAGE
Interesselosigkeit und Deutschsein
Marketing und die Avantgarde
Marktgerechtes Märtyrertum
Journalismus, Markt und Antisemitismus
Wagner: Entwurf einer Künstlerpersönlichkeit
Beethovens „Kuss“
Tod und Verklärung
Der verlorene Sohn kehrt zurück
PUBLICITY
Die Dresdner Jahre
Die Asche des Tages
Webers Deutschtum
Die Rede
Der Spin
Der verlorene Sohn, Teil II
Wagners Neunte Symphonie
Wagner, der Held
Das Konzert
Nachwirkungen
Rückblickend
NISCHE UND MARKENBILDUNG
Wagner, der Rebell
Kunst und Politik
Präsentation (erst Worte, dann Musik)
Made in Germany
Wagner®
Leitmotiv™
Werbeagenten
Herr Wagner persönlich
KONSUMENTEN UND KONSUM
Das Publikum der Zukunft
Tristan und Isolde
Musik als (Klang)Wellen
Tristan und Isolde – Das Medium ist die Botschaft
Verklärungen und Konsumentenzufriedenheit
Die Meistersinger von Nürnberg – Infomercial in drei Akten
Obsolet vs. brandneu?
Die Konkurrenz auf die Probe stellen
Produkteinführung
ZENTRALE
Bayreuth als Ort der Sinnproduktion
Fundraising und Fanclubs
Vorschau auf kommende Attraktionen
Spin
Zusatzmärkte
EPILOG: DIE WAGNER-INDUSTRIE
Literaturverzeichnis
Register
ABKÜRZUNGEN:
DHA
Heine, Heinrich, Historisch-Kritische Gesamtausgabe der Werke. Hg. Manfred Windfuhr, Düsseldorf 1973–97.
DS
Wagner, Richard, Dichtungen und Schriften. Jubiläumsausgabe. 10 Bde. Hg. Dieter Borchmeyer, Frankfurt am Main 1983.
ML
Wagner, Richard, Mein Leben. Hg. Martin Gregor-Dellin, München 1963.
NZfM Neue Zeitschrift für Musik.
SB
Wagner, Richard, Sämtliche Briefe. Hrsg. im Auftrage der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth von Gertrud Strobel, Werner Wolf et al. 18 Bde. Leipzig 1967-2000, Wiesbaden 1999-.
SSD
Wagner, Richard, Sämtliche Schriften und Dichtungen. Volksausgabe. 16 Bde. Leipzig o.J. [1911].
SW
Herder, Johann Gottfried, Sämtliche Werke. 33 Bde. Hg. Bernhard Suphan, Hildesheim 1994.
Vorwort
Dieses Buch erschien ursprünglich 2010 mit dem Titel Richard Wagner: Self-Promotion and the Making of a Brand. Für die grosszügige Unterstützung meiner gesamten Arbeiten zum Wagner Projekt bereits in den frühen Anfängen, möchte ich Mary Anne Fitzpatrick der Dekanin des College of Arts and Sciences der University of South Carolina danken. Vicky Cooper, Verlegerin bei Cambridge University Press hat sich ebenfalls früh positiv und engagiert eingesetzt, um das Buch zur Veröffentlichung zu bringen. Seither arbeite ich mit ihr an weiteren Wagner Projekten.
Für die deutsche Fassung danke ich zuallererst Michael Halfbrodt, der mit akribischer Genauigkeit nicht nur viele Fachausdrücke, sondern auch den weiteren Kontext komplexer Zusammenhänge feinsinning und, wie ich meine, elegant übertragen hat. Zudem hat er es verstanden, mich bei etwaigen Fragen stets in seine Arbeit miteinzubeziehen. Thomas Neumann von Königshausen & Neumann Verlag danke ich für die stets freundliche und zuvorkommende Gesprächsbereitschaft. Für die Aufnahme des Buches in die Reihe Wagner in der Diskussion bin ich Udo Bermbach, Dieter Borchmeyer, Hermann Danuser, Sven Friedrich, und Hans Vaget verpflichtet.
Dieses Projekt wäre jedoch ohne die grosszügige Unterstützung von Eva Rieger so nicht zustande gekommen. Ihre Freundschaft, die nunmehr seit zehn Jahren besteht und uns durch einige gemeinsame Besuche der Bayreuther Festspiele begleitet hat, ist ein grosses Geschenk. Sie hat diese Freundschaft in Form einer Spende der Marianne-Steegmann-Foundation für die Übersetzung des Buches tatkräftig und nachaltig bekundet.
Nicholas Vazsonyi
Columbia, USA, März 2012
EINLEITUNG
Richard Wagner (1813-1883) war der Begründer der Industrie, die heute seinen Namen trägt. Das klingt auf Anhieb nach einer wenig bemerkenswerten Aussage. Wir haben uns daran gewöhnt, dass jeder, der eine Karriere im öffentlichen Raum anstrebt, Werbung in eigener Sache betreibt oder Fachleute dafür engagiert. Im 19. Jahrhundert war das jedoch noch keineswegs selbstverständlich. Tatsächlich galt in manchen Berufen allzu offene Eigenwerbung als unangebrachtes Verhalten und war eher geeignet, ein Image zu beschädigen, als es zu verbessern.
Nun war Wagner zugegebenermaßen weder die erste Berühmtheit der Geschichte noch die einzige seiner Zeit, und die meisten der von ihm benutzten Techniken und Strategien der Selbstvermarktung waren weder ungewöhnlich noch einmalig. Und doch ist der Fall Wagner speziell. Denn erstens beteiligte sich Wagner, im Gegensatz zu den meisten der sogenannten „großen Meister“, die zu Waren wurden, nicht nur an seiner eigenen Vermarktung, sondern bereitete ihr den Weg. Zweitens begnügte er sich nicht mit der Erschaffung eines wiedererkennbaren öffentlichen Bildes seiner selbst, sondern präsentierte seine Werke als mit allen anderen unvergleichliche Schöpfungen. So unverwechselbar wären diese Werke, dass er für sie die Zugehörigkeit zu einer neuen Kategorie in Anspruch nahm. Er erfand sogar ein spezielles Vokabular, um sie zu beschreiben. Der Bau eines eigenen Theaters zu ihrer exklusiven Aufführung war bloß die sichtbarste Geste innerhalb eines größeren Unternehmens, seinen Werken den Stempel einer Marke aufzuprägen. Im Bereich der Kunst war nie zuvor etwas Vergleichbares unternommen worden. Und was, drittens, am wichtigsten ist: Er bekämpfte und attackierte genau jene Kräfte der Moderne, die überhaupt erst die Bedingungen für Selbstdarstellung, Starkult und Markenbildung geschaffen hatten. Das ist das zentrale Paradox der Wagnerindustrie, das zugleich die Allgegenwart und Unentrinnbarkeit des Marktes in der heutigen Zeit offenbart. Andreas Huyssen hat dieses Phänomen „den Strudel der Kommodifizierung“ genannt, und diese Bemerkung war speziell auf Wagner gemünzt.1
Trotz der weitreichenden Konsequenzen des Vorstehenden ist Wagners bleibende Bedeutung dennoch nur aus seinen kolossalen, unendlich faszinierenden und emotionsgewaltigen Werken erklärbar, die jeder Generation von neuem als anregend und relevant erscheinen. Gleichwohl agierte Wagner so, als wäre Qualität allein nicht ausreichend, als müsse man sich damit abfinden, dass „große Kunst“ nicht, oder zumindest nicht mehr, für sich selbst sprechen könne, angesichts der unübersichtlichen und umkämpften Märkte der entstehenden Massen-gesellschaft. Und so begann er um 1840 herum, noch nicht dreißigjährig, einen umfangreichen Korpus ergänzender Texte zu produzieren, die alle mehr oder weniger dazu bestimmt waren, seine Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu erhöhen, ein sorgfältig ausgearbeitetes Bild seiner selbst zu vermitteln und seine Werke einer Vielzahl unterschiedlicher Zielgruppen gegenüber zu erklären, zu rechtfertigen und zu bewerben. Doch dabei blieb er nicht stehen. Er bemühte sich, das Ansehen seiner unmittelbaren Konkurrenten zu ruinieren und veränderte, mit Hilfe seiner Anhänger, den Musikgeschmack für Generationen. Er beschrieb sich selbst auf eine Weise, dass wir noch heute, wenn wir über Wagner reden, seine Sprache übernehmen und seine Metaphorik benutzen. Manche seiner Schriften waren damals schon skandalös und sind es noch heute; die Reaktion auf sie ist bisweilen erschreckend. So beherrscht neben der Musik und dem Drama nach wie vor Wagner als Person, als öffentliche Gestalt, als Gegenstand des Diskurses, als historisches Ereignis mit all seinen Nachwirkungen die Aufmerksamkeit von Kulturkritikern, Historiker, Biographen und Journalisten, und zwar in einem Ausmaß, das nicht allein durch die Größe seines musikdramatischen Schaffens erklärbar ist.
Wie erklären wir uns Wagners Auftreten in der Öffentlichkeit? Mehrere seiner Zeitgenossen wiesen auf seinen scheinbar unstillbaren Mitteilungsdrang hin. Der französische Dichter Catulle Mendès hielt diesen Aspekt in seiner Beschreibung eines Besuchs beim Komponisten in Tribschen fest, zu dem er anmerkte, dass Wagner „redete und redete und redete … ein unaufhörlicher Schwall“.2 Manche Interpreten haben Wagners Unvermögen, mit dem Reden aufzuhören, als Zeichen einer Geisteskrankheit gedeutet, die sich teilweise bis in seine Bühnenwerke hinein äußere, eine These, die bereits zu Wagners Lebzeiten von dem Psychiater Theodor Puschmann beharrlich, wenn auch nicht ohne unfreiwillige Komik, vertreten wurde.3 Die klinische Diagnose Wagners als geschwätzige Persönlichkeit mag durchaus zutreffen, doch indem sie die psychologische Motivation für seine Schriften und andere Formen der Eigenwerbung von äußeren, sozialen, ökonomischen, kulturellen oder historischen Kontexten trennt, wird sie ihrem Inhalt nicht hinreichend gerecht.
Friedrich Nietzsche, der Erste, der Wagner umfassend würdigte, und vielleicht sein nach wie vor scharfsinnigster Kritiker, schlägt eine Brücke zwischen psychologischem Verständnis und historischem Kontext. In Bezug auf die Theatralik, die Wagners Kunst ebenso prägte wie sein Leben, nennt er ihn kurz und pointiert einen „unvergleichlichen Histrio“, jemand, der alles, einschließlich seiner selbst, „inszenierte“. Er deutet Wagner als psychische Krankheit (Wagner est une névrose), er habe die Musik selbst krank gemacht. Doch andererseits argumentiert Nietzsche, dass die Moderne selbst so beschaffen sei, nämlich dekadent, hysterisch, neurotisch, sodass „Massen-Erfolg“ nur durch Täuschung und Effekthascherei zu erzielen sei. Wagner ist der moderne „Künstler“ par excellence: „Man macht heute nur Geld mit kranker Musik; unsre großen Theater leben von Wagner“.4 Für Nietzsche ist Wagner wie Franz Liszt und Victor Hugo, Symptom einer traurigen Zeit.
Historisch gesehen war nahezu alles, was Wagner unternahm, Praktiken entlehnt oder nachempfunden, die sich bereits um 1800, d.h. eine Generation oder länger vor ihm, herauszubilden begonnen hatten. Der Gedanke öffentlicher Selbststilisierung und die Anfänge der Celebrity-Kultur treten etwa in den Figuren Lord Byrons und Johann Wolfgang von Goethes, um nur zwei Beispiele zu nennen, deutlich zutage. Ebenfalls um 1800 kam der Brauch auf, das Kunstwerk nicht nur theoretisch zu beschreiben, sondern sein Erscheinen durch das ästhetische Manifest vorwegzunehmen. Der Gedanke, der Künstler müsse „den Geschmack erzeugen, der es ermöglicht, ihn zu genießen“, wie es William Wordsworth formulierte, war eine unmittelbare Konsequenz aus dem, was der Philosoph Jürgen Habermas als den „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ im 18. Jahrhundert bezeichnete, der durch den Aufstieg des Journalismus und die Anfänge dessen, was später als Populärkultur verstanden werden sollte, beschleunigt wurde.5 Wordsworths Bestrebungen, wie, eine Generation früher in Deutschland, die von Karl Philipp Moritz und Friedrich Schiller, waren eine Reaktion auf den ökonomischen Erfolg der „Unterhaltungsliteratur“, wie sie im Deutschen heißt, während Wordsworth anschaulicher von „wüsten Romanen, kränklichen und törichten deutschen Tragödien und Unmengen nutzloser und überspannter Verserzählungen“ sprach.6 Der Buchhandel, der solche Werke vertrieb, wurde von einer exklusiven Gruppe von Künstlern verschmäht, die sich von der breiten Masse abzuheben versuchten, indem sie auf Gewinn verzichteten und eine ästhetisch anspruchsvollere Literatur schufen, die den Lesern eine größere geistige und intellektuelle Befriedigung verschaffte. Diese Autoren, die zum Teil für ein (noch) nicht existentes Publikum schrieben, verkörperten, lange bevor der Begriff in Gebrauch kam, eine „Avantgarde“-Mentalität. Im weiteren Sinne wehrten sie sich gegen das aufkommende Konsumverhalten, das bereits durch die neue Modeindustrie sowie das Phänomen des Markenartikels – Wedgwood-Töpferwaren sind vielleicht das früheste bekannte Beispiel – ausgelöst worden war. Der Soziologe Pierre Bourdieu untersuchte diese Gegenkultur zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in Paris um 1840, mit Charles Baudelaire und Gustave Flaubert als zentralen Exponenten.7 Bourdieus Hauptargument lautet, dass deren marktfeindliche Pose selbst eine Marketingstrategie war, ein weiteres Beispiel für Huyssens „Strudel“. Sowohl Bourdieu als auch Huyssen setzen eine Denktradition fort, die bereits in der marxistischen Kulturkritik Walter Benjamins – der ebenfalls von Baudelaire fasziniert war – und Theodor W. Adornos erkennbar ist. Letzterer verortete eben bei Wagner die Anfänge dessen, was er „Kulturindustrie“ nannte.8 Mit anderen Worten, alle dieser Denker vertreten die Meinung, dass sich Kunst und Künstler immer stärker auf den Konsumenten bezogen hätten.
Auch wenn es historisch verfrüht wäre, in diesem Fall von Konsumismus zu sprechen, haben einige Wirtschaftssoziologen wie Colin Campbell und vor ihm Neil McKendrick überzeugend dargelegt, dass Konsumverhalten bereits im späten 18. Jahrhundert auftrat, und zwar im Sinne des Erwerbs und Gebrauchs von Gütern zur Erfüllung momentaner und vorübergehender Wünsche, nicht zur Befriedigung dauerhafter Grundbedürfnisse.9 Konsum bezeichnet in diesem Zusammenhang das Streben nach Luxus und das Schwelgen in überflüssigen Dingen – eine alte Gewohnheit des Adels, aber neu für die stetig wachsenden Mittelschichten. In ähnlicher Weise ist für Donald Sassoon, dessen voluminöses Buch ebenfalls im Jahr 1800 einsetzt, „die Geschichte der Kultur“ die „Geschichte der Produktion für einen Markt“ zum Zwecke des „Kulturkonsums“.10
All die oben erwähnten Aspekte – öffentliche Selbststilisierung, Starkult, das ästhetische Manifest, Avantgarde, Mode, die Verbreitung des Journalismus, die Expansion der Märkte, der Markenartikel – sind bloß Facetten des tiefgreifenden Wandels, der England und den europäischen Kontinent erfasste und alle Bereiche des Lebens und der Kultur in Mitleidenschaft zog. Richard Wagner ist die herausragende Künstlergestalt des 19. Jahrhunderts, der diese Aspekte zu einem Kampf auf allen Ebenen – der ideologischen, theoretischen, rhetorischen und kreativen – verschmolz, um sich selbst eine eigene, unter seiner alleinigen Kontrolle stehende Nische innerhalb des Opernmarktes zu schaffen.
Das war eine Gratwanderung. Wie seine Vorläufer, die Romantiker, wandte sich Wagner vehement gegen die moderne Sicht des Kunstwerks als Ware zum Zwecke der Spekulation und des Profits. Auch er sollte ästhetische Manifeste verfassen, sollte versuchen, „den Geschmack zu erzeugen, der es ermöglicht, ihn zu genießen“, und verkünden, er komponiere für ein Publikum, das es noch nicht gebe. In all dem war er, davon bin ich überzeugt, vollkommen aufrichtig. Doch das ist nicht der springende Punkt. Einig der Ansprüche, die er geltend machte, sein inflationärer Sprachgebrauch, der Nachdruck, mit dem er diese Ansprüche vertrat und die Methoden, die er benutzte, um sie publik zu machen, entstammten genau jener Welt des Kommerzes, die er im gleichen Atemzug verdammte. Dieser Widerspruch sorgte schon damals für Stirnrunzeln. Einer seiner vielen Widersacher verglich seine Methoden mit denen eines „Marktschreiers“.11 Auch wenn er sich von der Sphäre gewinnträchtiger Kunst rhetorisch abgrenzte, riskierte er gleichwohl, von denen nicht ernst genommen zu werden, die nominell auf seine Seite der „großen Scheidelinie“ (Huyssen) standen.
Das Gespenst der Trivialisierung sitzt Wagner nach wie vor im Nacken und ist, wie ich glaube, dafür verantwortlich, dass es bis zum heutigen Tage kein Buch gibt, das seine Selbstvermarktung behandelt. Trotz der Unzahl von Werken über ihn, die bereits 1883, seinem Todesjahr, die 10.000 überschritten, haben es Wagners Kritiker vorgezogen, sein öffentliches Auftreten psychologisierend als Zeichen von Größenwahn abzutun.12 Anstatt sein Handeln als Ausdruck eines Persönlichkeitsdefekts zu werten, schlage ich vor, Wagners Bemühen, ein Image zu erzeugen und seine Werke als Paket zu präsentieren, ernst zu nehmen. In der Moderne waren die meisten Künstler gezwungen, sich selbst zu vermarkten. Vielleicht war Wagner darin einfach besser als alle anderen.
Die Scheu, anerkannte Komponisten unter Marktgesichtspunkten zu betrachten – ein Relikt der Empfindlichkeiten des 19. Jahrhunderts –, hat allerdings merklich nachgelassen. Ein kürzlich erschienenes Buch über Wagners Zeitgenossen Franz Liszt (1811-1886) ist insofern exemplarisch, als der Autor, Dana Gooley, sich bemüht, die Ansicht zu entkräften, Liszts „Konzerttourneen als Klaviervirtuose hätten vorwiegend der Selbstverherrlichung gedient“, und darauf hinweist, „dass immer noch eine Interpretation seines strategischen Vorgehens aussteht, das dieses nicht auf bloße Eitelkeit reduziert“.13 Liszts Geschichte steht sinnbildlich für die Risiken sich selbst vermarktender Künstler im 19. Jahrhundert. Niccoló Paganini (1782-1840) und Giacomo Meyerbeer (1791-1864) sind zwei weitere Beispiele dafür. Im Gegensatz zu dem Komponisten und Geigenvirtuosen Paganini, der bis zu seinem Tod als Medienereignis galt, dessen Status aber kaum über den eines Zirkusartisten hinausging, entzog sich Liszt dem Rummel, der seine öffentliche Auftritte begleitete, um zu komponieren und zu dirigieren, weil er ernst genommen werden wollte. Meyerbeer, ohne Frage der erfolgreichste Opernkomponist seiner Zeit, machte sich angreifbar durch seine kalkulierten Triumphe, die durch wohlwollende Vorberichte in der Presse und Claqueure im Theatersaal inszeniert wurden. Dass Meyerbeers Opern im späten 19. Jahrhunderts immer weniger gespielt wurden, hängt vielleicht direkt mit den unermüdlichen Attacken Wagners und seiner Verbündeten zusammen, was Wagner jedoch nicht daran hinderte, teilweise genau dieselben Methoden anzuwenden. Vielleicht war eine der größten Leistungen Wagners, dass er es schaffte, Reklame in eigener Sache zu betreiben und dennoch ernst genommen zu werden.
Meyerbeer, Paganini, Liszt und Wagner – sie alle reagierten auf ihre Zeit. Der Musikmarkt des 19. Jahrhunderts durchlief eine ähnliche Entwicklung wie der Buchmarkt im 18. Jahrhundert. Der Musikhistoriker William Weber hat die Entstehung des „modernen Musikbusiness“ nachgezeichnet und sorgfältig herausgearbeitet, warum es bereits im 19. Jahrhundert als „profitorientierte Massenkultur“ angesehen werden sollte. Während Publikation und Verkauf von Notendrucken einen „expandierenden Geschäftsbereich“ mit „cleveren Vermarktungsstrategien“ darstellten, dem Buchmarkt nicht unähnlich, bewegte sich die zweite Sparte der Musikindustrie – das öffentliche Konzertwesen – in gänzlich anderen Größenordnungen, besonders jene Aufführungen, die ganze Symphonieorchester erforderten, von großen Operninszenierungen gar nicht zu reden. Mit der Zunahme öffentlicher Konzerte ging die „kommerzielle Ausbeutung der Meister“ einher, d.h. der „großen toten Komponisten“, von Johann Sebastian Bach bis zum damals erst unlängst verstorbenen Ludwig van Beethoven.14 Diese Ausbeutung kam am deutlichsten in der erstaunlichen Veränderung der Konzertprogramme zum Ausdruck, die von überwiegend zeitgenössischen zu größtenteils „klassischen“ Stücken wechselten, eine Schwerpunktverlagerung, die noch heute die Spielpläne bestimmt. Somit mussten lebende Komponisten nicht nur untereinander, sondern auch mit ihren kanonisierten Kollegen konkurrieren.
Da sich Wagner das kostspieligste aller Musikgenres – die Oper – aussuchte, blieb er sein Leben lang ihren ökonomischen Zwängen verhaftet. Da aber seine literarischen Ambitionen nicht minder ausgeprägt waren, brachte er auf vielfältige Weise – sowohl ästhetisch als auch als Kritiker der Moderne – die Sensibilität des Autors ins Spiel. So vereinte er auf eine nach wie vor als widersprüchlich, wenn nicht paradox empfundene Weise die öffentliche und zwangsläufig weithin bekannte Rolle des prominenten Selbstdarstellers mit der des privaten, eher selbstbezogenen und nachdenklichen Autors, der die Welt medialer Manipulation meidet, um die Integrität seines Werkes zu bewahren, ein Image, das Wagner dann als solches wiederum ungeniert in die Öffentlichkeit trug. Das gleiche Paradox kennzeichnet die Werke selbst: auf der einen Seite dazu bestimmt, den Traum der Romantiker vom Gesamtkunstwerk, das den Menschen in seiner Ganzheit wiederherstellt, zu verwirklichen, werden sie auf der anderen Seite als exklusive Produkte vermarktet, die genau diesen Effekt erzielen sollen – wenn du die Welt heilen und dich gut dabei fühlen willst, dann kauf Wagner.
Wie ging Wagner bei der Umsetzung dieser Ansprüche vor und welche Techniken wandte er an, um sie so wirksam zu gestalten? Im Folgenden werden fünf sich überschneidende Tätigkeitsfelder gesondert betrachtet – Imagebildung, Public Relations, Erzeugung einer Nische und Markenpolitik, den Bühnenwerken immanentes Marketing, und Schaffung eines Zentrums innerhalb eines weltumspannenden Netzwerks. Jedem dieser Punkte ist ein Kapitel gewidmet, das jeweils auf eine spezifische Auswahl von Beispielen und Begebenheiten rekurriert. Um die strukturelle Einheit des Buches zu unterstreichen, sind diese Beispiele und Begebenheiten über die fünf Kapitel hinweg chronologisch angeordnet. Damit soll nicht suggeriert werden, dass ein Tätigkeitskomplex den anderen ablöste. Wagner war jeweils auf allen Feldern gleichzeitig aktiv, wenn er sie auch zu verschiedenen Zeiten seiner Karriere unterschiedlich gewichtete. Ungeachtet dieser chronologischen Anordnung handelt es sich auch nicht um ein biographisches Buch, und biographische Details werden nur erwähnt, wenn sie von besonderer Relevanz sind. Vielmehr geht es im Folgenden um eine genaue Textanalyse ausgewählter Werke Wagners: Essays, einige Briefe, seine Autobiographien, Artikel sowie zwei seiner Opern.
Diese Texte offenbaren, in welchem Ausmaß Wagner sein eigener Presseagent, sein eigener Manager, sein eigener PR-Berater war. Er selbst prägte sein Bild als führende Persönlichkeit des kulturellen Lebens, als schöpferisches Genie, als wahrer Deutscher, als Erfinder einer ganz neuen Form von Kunstprodukt. Die heutige Wagnerindustrie stützt sich nach wie vor auf die erstaunliche Vielfalt von Themen, die Wagner ersann, Bilder, die er entwarf, Konzepte, die er entwickelte, um die Exklusivität seiner Marke zur Geltung zu bringen und zu bewahren.
____________
1 Andreas Huyssen, After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Bloomington 1996, S. 42.
2 „il parlait, parlait, parlait! … un flot incessant!“. Catulle Mendès, Richard Wagner, Paris 1886, S. 14-15.
3 Theodor Puschmann, Richard Wagner: Eine psychiatrische Studie, Berlin 1873 (1872 erschienen).
4 Friedrich Nietzsche, Der Fall Wagner, hgg. v. Dieter Borchmeyer, Frankfurt am Main 1983, §5, §8 & §11.
5 William Wordsworth, „Essay, Supplementary to the Preface (1815)“, The Prose Works of William Wordsworth, 3 Bde., hgg. v. W.J.B. Owen und J.W. Smyser, Oxford 1974, III, S. 62-84, dort S. 80. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied 1962.
6 Wordsworth, „Preface to Lyrical Ballads (1800)“, Prose Works, I, S. 118-159, dort S. 128.
7 Pierre Bourdieu, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt am Main 1999.
8 Vgl. Walter Benjamin, Charles Baudelaire: Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, Frankfurt am Main 1974, sowie das „Baudelaire“-Kapitel in Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts, in Illuminationen, S. 170-184, dort S. 179-181. Ferner Theodor W. Adorno, Versuch über Wagner. Die musikalischen Monographien. Gesammelte Schriften Bd. 13, Frankfurt am Main 2003, S. 7-148.
9 Vgl. z.B. Colin Campbell, The Romantic Ethic and die Spirit of Modern Consumerism, Oxford 1987, S. 17-31 und 60-65.
10 Donald Sassoon, The Culture of the Europeans from 1800 to the Present, London 2006, xxi, xiii.
11 W.J.S.E. [Julius Schladebach], „Das Palmsonntagsconcert“, Abend-Zeitung (Dresden), 16. April 1846.
12 Vgl. zuletzt Boris Voigt, Richard Wagners autoritäre Inszenierungen. Versuch über die Ästhetik charismatischer Herrschaft, Hamburg 2003.
13 Dana Gooley, The Virtuoso Liszt, Cambridge 2004, S. 12-13.
14 William Weber, „Mass Culture and the Reshaping of European Musical Taste, 1770-1870“, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 8.1 (1977), S. 5-22, dort S. 6 und 15-16.
IMAGE
„Ich glaube an Gott, Mozart und Beethoven“.1 Mit diesen Worten beginnt „R…“ seine Beichte auf dem Sterbebett. „R…“, eine von Richard Wagner ersonnene literarische Figur, die Hauptperson seiner Novelle „Ein Ende in Paris“, ist ein armer, ausgewanderter deutscher Musiker, der in einer früheren Novelle „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ unternommen hat. Mit diesen beiden kurzen, 1840 und 1841 verfassten und erstveröffentlichten Prosastücken verschmilzt der 27-jährige Wagner zeitgenössische Ideen und Topoi mit tief verwurzelten Eigentümlichkeiten des deutschen Kulturdiskurses, um eine zugleich vertraute und neue Gestalt zu erschaffen. Der deutsche Musiker, arm aber rechtschaffen, der aus Liebe zur Musik und nicht zum Zweck des Gelderwerbs komponiert. Musik als transzendentale Kunstform. Die große Komponisten (natürlich Deutsche), die eine erlauchte Ahnenreihe bilden. Alle diese beziehungsreichen Ideen waren seinerzeit in Umlauf. Mit großem Geschick verdichtet Wagner sie zu einer einzigen Figur, die er auf dem Papier sterben lässt, um sie im Kern als die öffentliche Rolle wiederzubeleben, die Wagner für den Rest seiner Karriere annahm: Darin liegt das Novum. Richard Wagners öffentliches Image ist eine literarische Schöpfung. Obendrein eine von solcher Komplexität und Bedeutungsfülle, dass sie der sorgfältigen Aufschlüsselung bedarf, der sich der verbleibende Teil dieses Kapitels widmen wird.
Der Begriff „Image“ kann sowohl bildlich als auch gedanklich verstanden werden. Da Wagners Erwachsenenleben mit dem Aufkommen der Fotografie zusammenfällt, haben wir von seinem Aussehen sogar eine genauere Vorstellung als von dem seiner berühmten Vorläufer wie Mozart und Beethoven. Die zahllosen Reproduktionen sorgfältig arrangierter und wie Ikonen wirkender Wagner-Fotografien auf Postkarten, Konzertprogrammen, Plakaten, Buchumschlägen und Plattencovern prägen unser Bild des Komponisten nicht weniger als die allgegenwärtigen Mozart- und Beethoven-Porträts. Dennoch sind im Falle Wagners diese Fotografien nicht in der Lage, einige der nachhaltigsten Aspekte seines öffentlichen Erscheinungsbildes wiederzugeben: als „deutschester aller Komponisten“, Beethovens einzig legitimer Nachfolger, verkanntes und bedrängtes Opfer verleumderischer Machenschaften seitens einer feindseligen, von Juden beherrschten Presse, zu gut für Paris, Retter der europäischen Kunst, nur mit Freunden seiner Kunst – den Eingeweihten – kommunizierend und dennoch Schöpfer einer Kunst, die zum ganzen deutschen Volk spricht. Diese gedanklichen Komponenten von Wagners Image – zu vielschichtig, um durch Bilder allein befördert zu werden – wurden alle auf sprachlichem Wege erzeugt und, was noch wichtiger ist, von Wagner selbst. Darin unterscheidet sich der Fall Wagner von dem aller anderen Komponisten und Künstlerfiguren, Vorläufer und Zeitgenossen gleichermaßen, selbst von schriftstellerisch so produktiven wie Weber oder Berlioz. Wagner schrieb und schrieb, genug, um noch zu Lebzeiten zehn Bände zu füllen, die später auf sechzehn erweitert wurden. Seine gesammelten Briefe umfassen Dutzende weiterer Bände, das 1967 begonnene Projekt einer Gesamtausgabe ist immer noch nicht abgeschlossen. Zumeist einem psychischen Bedürfnis zugeschrieben, wurde dieser endlose Redefluss Wagners, in Wort und Schrift, wahlweise als „Mitteilungsdrang“ oder „Selbstdarstellungsvermögen“ interpretiert. Berichte von Zeitgenossen legen nahe, dass es sich tatsächlich um einen Grundzug seiner Persönlichkeit handelte. Allerdings deutet eine solche Geschwätzigkeit auch auf das Bedürfnis hin, einen Diskurs zu erzeugen und zu kontrollieren, das, was Robert Gutman in Bezug auf Wagner die Erschaffung „seines eignen Mythos“ nennt, doch handelt es sich genau genommen um einen viel komplizierteren Vorgang, der das eigentliche Thema dieser Untersuchung berührt.2
Wagners Musikdramen sind zweifelsohne ein Teil des von ihm geschaffenen „Mythos“ und somit zum vielleicht am stärksten überfrachteten künstlerischen Werk der Moderne geworden. Wagner war der wesentliche Urheber dieser Verbindung. Gleichwohl wäre es angemessener, das Resultat Wagner'scher Prosa weniger als „Mythos“ denn als komplexe und beunruhigend reizvolle Verschmelzung von Posen, Kunsttheorie, Sozialreportage und Ideologie zu beschreiben, das Ganze verflochten mit einer farbigen, anregend zu lesenden autobiographischen Erzählung. Viele Rezipienten seiner Werke haben sich bzw. wurden, damals wie heute, mit den dazugehörigen Ideen identifiziert, vor allem der Behauptung, dass seine Musikdramen exemplarischer Ausdruck des deutschen Wesens seien, eine Behauptung, hinter der das Gespenst des Antisemitismus lauert. Das machte die Freude, Wagner zu hören, nach dem Holocaust zu einem solch heiklen Unterfangen. Das chronische Problem mit Wagner in der Nachkriegszeit ist ein Negativbeispiel, das gleichwohl belegt, wie erstaunlich erfolgreich Wagner bei der Fixierung und Kontrolle des Diskurses über sein Werk war. In Wagnerstudien überwiegt, was ich „Permalegende“ nenne, die Wagner'sche Variante des Permafrostes: eine narrative Schicht von solch eisiger Kompaktheit, dass keine alternative Erzählung sie durchdringen kann. Wagners Version seiner Geschichte und seine Erklärung seines Werkes sind traditionell der Ausgangspunkt für jeden, der die Absicht hat, über ihn zu schreiben.
Wenn Gutman von „Mythos“ spricht, trifft das sicherlich einen Aspekt der Sache, dennoch steckt mehr dahinter. Dasselbe gilt für seine irrige Annahme, dass Wagner erst im Alter von zweiundfünfzig begonnen habe, sich selbst zu erfinden, nämlich 1865, als er seiner zweiten Frau, Cosima, seine Memoiren diktierte. Damit verfehlt er sein Ziel um ein Vierteljahrhundert und legt implizit nahe, dass es Wagner vorrangig darum gegangen sei, sein Bild für die Nachwelt zu bestimmen. Stattdessen war Wagner in erster Linie daran interessiert, sein Umfeld zu kontrollieren, seine Gegenwart. Doch abgesehen von seinem Wunsch, den er mit den meisten Menschen teilte, seine Wahrnehmung durch andere zu beeinflussen, ging das Kontrollbedürfnis bei Wagner mit konkreten, in hohem Maße praktischen Zielen einher. Für ihn als öffentliche Person und kreativer Künstler bedeutete Kontrolle die angemessene Aufführung seiner Werke, verbunden mit entsprechender Anerkennung und Akzeptanz durch ein Publikum: Erfolg auf dem Markt. In dieser Hinsicht unterschieden sich Wagners Wünsche nicht von denen jedes anderen modernen Komponisten oder Künstlers. Dennoch waren die Strategien, die er zur Herbeiführung, Sicherung und Wahrung seines Erfolgs einsetzte, in ihrer Gesamtheit nicht nur beispiellos, sondern verrieten auch ein bemerkenswertes, möglicherweise intuitives Gespür für den Markt, den er doch zu überwinden versuchte. Deshalb erscheinen mir Begriffe wie „Rolle“ und „Image“ besser geeignet als „Mythos“, um zu beschreiben, was Wagner zu erschaffen beabsichtigte, weil sie stärker auf den Selbstvermarktungsaspekt als auf die psychologischen oder literarischen Dimensionen seines Tuns verweisen.
Auch ohne allzu große Anleihen bei der trüben Wissenschaft psychoanalytischer Ferndiagnosen zu machen, ist kaum zu übersehen, welche Bedeutung für Wagner, als Mensch wie als Musiker, die gut zweieinhalb Jahre hatten, die er in Paris verbrachte, von September 1839 bis April 1842, nicht lange vor seinem dreißigsten Geburtstag. Gekennzeichnet durch Erfolglosigkeit, Enttäuschung und Kontrollverlust steht diese Zeit aber auch für einen – verglichen mit den Jahren zuvor – exponentiellen Anstieg der von ihm verfassten und veröffentlichten Schriften auf ein Niveau, das er bis zum Ende seines Lebens beibehalten sollte. Wagners Versuch, über das Schreiben Einfluss zu gewinnen und zu behalten, ist ebenso offensichtlich wie sein Schritt, die vorhandenen Medien virtuos zu nutzen, um sich selbst, seine Ideen und schließlich seine Werke zu vermarkten. Dabei dürfte ihm nichts ferner gelegen haben, als er seine Kapellmeisterstelle im provinziellen Riga aufgab, um zusammen mit seiner ersten Frau Minna in die Welthauptstadt der Oper zu reisen.
Die Pariser Musikindustrie und ihre Kritiker
Für einen Deutschen, und insbesondere einen deutschen Komponisten, war die Übersiedlung nach Paris mit einer Reihe von Problemen verbunden. Seit dem späten 17. Jahrhundert hatte die unangefochtene französische Kulturhegemonie, ausgehend vom Hof Ludwigs XIV. und seiner Nachfolger, die Vorstellungswelt der Deutschen beschäftigt und die frühe Suche nach einer deutschen Nationalidentität im 18. Jahrhundert in hohem Maße beflügelt. Ungeachtet der Tatsache, dass die Musik – und die Oper zumal – eine Domäne der Italiener war, stand der französische Königshof nach wie vor im Mittelpunkt der Opernwelt. Wohin sie auch blickten, ob nach Süden oder nach Westen, die Deutschen schienen keine Wahl zu haben, als andere nachzuahmen. Daher ihre zunehmende Hinwendung zur (opernfernen) Instrumentalmusik im späten 18. Jahrhundert und die Herausbildung eines entsprechenden diskursiven Instrumentariums, das von Projektionen nationaler Überlegenheit wimmelte.
Abgesehen von den Symbolen kultureller Vorherrschaft erfüllte Paris aufgrund seiner hoch entwickelten Infrastruktur und seiner institutionellen Traditionen für Opernkomponisten und Librettisten auch ganz praktische pekuniäre Bedürfnisse. Die berühmte Pariser Oper zahlte Tantiemen für jede Aufführung, während deutsche Opernhäuser nur eine einmalige Lizenzgebühr für Aufführungsrechte boten, unabhängig vom möglichen Erfolg des Stückes. Ein Erfolg in Paris bedeutete nicht nur eine Aufführungsgarantie in den deutschen Provinzen, sondern eröffnete zusätzliche Märkte, die die Verdienstmöglichkeiten für erfolgreiche Musiker beträchtlich erhöhten.3 Wagners Vorbilder waren der überaus wohlhabende deutsch-jüdische Komponist Giacomo Meyerbeer – ursprünglich Jacob Liebmann Beer – und der Librettist Eugène Scribe. Sie dominierten die Opernszene der 1840er Jahre in Paris, der Metropole, die der bedeutende Wagnerbiograph Ernest Newman als eine „Mischung aus Mekka und Klondyke“ beschreibt, eine kühne Metapher, die sich sowohl auf den seinerzeit noch relativ neuen Aufstieg der Musik in religiöse Sphären bezieht als auch auf die Gewinnaussichten, die ein Erfolg in der Musikwelt versprach.4
Geld und Gewinn waren Wagners primäre Motive, nach Paris zu gehen. War der unmittelbare Anlass seiner Flucht aus Riga noch der wachsende Druck seiner zahlreichen Gläubiger gewesen, so hoffte er in Paris lange darauf, seinen großen Durchbruch als Komponist zu schaffen, „Ruf und Geld [zu] gewinnen“ und „kein deutscher Philister mehr“ zu sein, Träume, die er schon 1834 seinem Freund Theodor Apel gegenüber offen äußerte.5 Zu dieser Zeit begann Erfolg für Wagner mit einer Verleugnung seines Deutschtums, das mit Philistertum gleichbedeutend war: eine Reaktion auf die Provinzialität der deutschen Kultur und ihren relativen Mangel an Kultiviertheit, verglichen mit der französischen. Wie sein Landsmann Giocomo Meyerbeer richtete er seinen Blick auf das kosmopolitische Paris, um eine „französische Oper für die Franzosen“ zu komponieren – nicht nur, um den bestehenden Geschmack zu bedienen und Markterwartungen zu erfüllen, sondern weil eine deutsche Oper als Genre erst in Ansätzen vorhanden war.
Ungeachtet seiner offenkundigen Bereitschaft sich anzupassen, erwies sich Wagners Aufenthalt in Paris als vollkommenes Desaster, weil seinen ständigen Bemühungen und sogar Meyerbeers Unterstützung zum Trotz keine seiner Opern je aufgeführt wurde. Der erhoffte Durchbruch blieb aus. Die verzweifelte finanzielle Misere, in die die Wagners folgerichtig gerieten, zieht sich durch den Briefwechsel dieser Jahre, sie wurde später in jeder von Wagners diversen Autobiographien beschrieben und bildete, dem Vernehmen nach, über Jahrzehnte ein Thema für Tischgespräche unter Kollegen, Freunden und Bewunderern.
Laut Ernest Newman scheiterte Wagner in Paris, weil er „vergaß, dass Kunst auch eine geschäftliche Seite hatte“, eine Begründung, die viele Wagnerbiographen sich zu eigen machten.6 Das klingt jedoch wenig überzeugend, da Wagner gerade aus geschäftlichen Gründen nach Paris gegangen war: „Geld war Wagners Ziel“.7 In Paris zu scheitern war der Normalfall, nicht weniger als für jene, die heutzutage am Broadway oder in Hollywood reüssieren wollen. Sich bei den Gründen für Wagners Misserfolg aufzuhalten, ist deshalb vielleicht weniger interessant, als seine Reaktion zu untersuchen.
Wagner instrumentalisierte sein Scheitern. Er präsentierte sich genau als jene Art von Künstler, der tatsächlich vergisst, „dass Kunst auch eine geschäftliche Seite hat“, ein Bild, das Newman vielleicht unwissentlich beförderte, indem er eine von Wagner selbst geschaffene Legende fortschrieb und beglaubigte. In Wirklichkeit erinnerte sich Wagner nicht nur an die geschäftliche Seite der Kunst, er war besessen von ihr, ein Faktum, das er so geschickt und gründlich kaschierte, dass nur das Bild des selbstlosen Künstlers übrig blieb. Finanzielles Desinteresse – im Gegensatz zu pekuniärer Not – war nur ein Aspekt der komplexen Rolle, die Wagner zwischen 1840 und 1842 in Paris zu erschaffen begann. Auch andere Dauerthemen, wie „Wagner-als-Opfer“, und sogar sein Antisemitismus, äußern sich erstmals in dieser Zeit. Und vor allem beginnt Wagners Selbststilisierung zum deutschesten aller Deutschen genau dort, wo echtes „Deutschtum“ nicht länger mit Spießbürgerlichkeit gekoppelt ist und wo letztlich die Provinz, in ihrer Rechtschaffenheit und Beschaulichkeit, zum Gegenentwurf der korrupten und dekadenten Metropole wird. Es wäre anmaßend, die Aufrichtigkeit von Wagners Gefühlen beurteilen zu wollen; stattdessen soll im Folgenden untersucht werden, auf welche Weise jede dieser rhetorischen Positionen auf bestehende kulturelle Diskurse zurückgriff und reagierte, und damit zur spezifischen Selbstpositionierung Wagners am Markt beitrug.
Wagners radikales Umdenken sowohl hinsichtlich seines Wunsches, „Geld zu gewinnen“, als auch, „kein Deutscher mehr“ zu sein, mag ein Reflex auf sein Unvermögen gewesen sein, Paris zu erobern, deutete jedoch auch auf das moralisch Fragwürdige der dortigen Verhältnisse hin. Während das Musikgeschäft in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts das riesige wirtschaftliche Potential einer akustischen Unterhaltung für die Massen zu offenbaren begann, beschrieben es manche Beobachter, wie der Komponist Hector Berlioz (1803-1869), hellsichtig und geringschätzig als „Industrie“.8 Berlioz, zehn Jahre älter als Wagner, hinterließ mit seinen innovativen musikalischen Ideen, besonders aber mit seinem Status als nonkonformistischer Künstler, einem tiefen Eindruck bei dem jungen Deutschen. In einem seinem Berichte für die Abend-Zeitung (Dresden) erklärt Wagner:
Wer seine [Berlioz’] Musik hören will, muß ganz eigens deshalb zu Berlioz gehen, denn nirgends sonst wird er etwas davon antreffen. Man hört Berlioz’ Kompositionen / nur in den Konzerten, von denen er selbst jährlich eins oder zwei gibt; diese bleiben seine ausschließliche Domäne; hier läßt er seine Werke von einem Orchester spielen, das er sich ganz besonders gebildet; und vor einem Publikum, das er in einem zehnjährigen Feldzuge sich erobert hat.9
Es ist verblüffend festzustellen, wie eng sich Wagner später an das Berlioz’sche Vorbild öffentlicher Selbstdarstellung halten sollte: die Abkehr vom konventionellen Markt, die Idee der Exklusivität, des Ikonoklasmus, sogar der Wallfahrt; das eigens gebildete Orchester, der besondere Aufführungsort, der Kampf um ein Publikum und gebührende Anerkennung. Das Versagen, in der Industrie Fuß zu fassen, wird zu heroischer Unabhängigkeit uminterpretiert. Das Berlioz unterstellte Unvermögen, aus seinem Werk Profit zu schlagen – mit dem sich Wagner identifizieren konnte –, wird zu einer seiner Haupttugenden erklärt, nämlich, „daß er nicht fürs Geld schreibt“.10 Zwar hat die jüngere Berlioz-Forschung den Mythos des chronischen Außenseiters und mittellosen Komponisten in Frage zu stellen begonnen.11 Doch aus irgendeinem Grund war es für Wagner vorteilhaft, das Bild des verkrachten, verkannten, brotlosen Künstlers zu pflegen und zu verbreiten. Dieser Konnex zwischen Kunst und Geld stellt eine Kritik der profitorientierten Musikindustrie dar, die Berlioz’ und somit Wagners moralische Größe als Künstler definiert.
Allerdings beschränkte sich die Kritik der Musik„industrie“ nicht auf Komponisten. Der deutsch-jüdische Dichter, Denker, Gesellschaftschronist und Journalist Heinrich Heine (1797-1856), der damals ebenfalls in Paris lebte, war der eloquenteste Kritiker der neuen Unterhaltungskultur. Er bezeichnete den produktiven Eugène Scribe als „Librettofabrikanten“, mit anderen Worten als
de[n] Mann des Geldes, des klingenden Realismus, der sich nie versteigt in die Romantik einer unfruchtbaren Wolkenwelt, und sich festklammert an der irdischen Wirklichkeit der Vernunftheurat, des industriellen Bürgerthums und der Tantième.12
Heine und Wagner standen während dieser Zeit in engem Kontakt. Letzterer bekannte sich sogar explizit dazu, Heines populären Stil in seinem Artikeln nachzuahmen.13 Somit kann Wagners zeitgleicher Bezug auf Opernhäuser als „kunstindustrielle Anstalten“ als Ausdruck eines fortlaufenden Gesprächs unter Gleichgesinnten verstanden werden.14 Heine war besonders kritisch gegenüber dem Klavier eingestellt, einer mechanischen Apparatur, die „von dem Sieg des Maschinenwesens über den Geist“ zeuge und rügte Klaviervirtuosen und mittelständische Fräulein gleichermaßen dafür, ein Instrument zu spielen, das „all unser Denken und Fühlen“ töte.15 Der Virtuose half dabei, den lukrativen Markt für Hausmusik anzukurbeln, von dem William Weber sagte, er sei „äußerst geschäftstüchtig und oft raffiniert in seinem Verkaufspraktiken, wahrscheinlich nicht weniger als jeder andere Handelszweig“.16 Diese Virtuosen – am bekanntesten vielleicht der Geiger Niccolò Paganini – verbanden beispielloses technisches Können mit cleverer Selbstinszenierung und charismatischem Auftreten, und sorgten für eine Sensation, wo immer sie spielten; sie betörten und verführten die Zuhörermassen und reizten Amateure zur Nachahmung. Die Virtuosen waren perfekte Selbstvermarkter: Ihr „Erfolg hing davon ab, dass die Journalisten für sie warben und die Presse gut über sie schrieb“, während sie im Gegenzug „die Feuilletonisten mit Stoff“ versorgten.17 Mit anderen Worten, „der Virtuose und der Journalist profitierten voneinander“, als wesentliche Akteure der neuen medienabhängigen und sensationssüchtigen Unterhaltungsbranche.18 So ist es sicherlich ein wenig scheinheilig, wenn Heine dem Pianisten Franz Liszt vorwirft, seine Konzerte würden eine „Lisztomanie“ erzeugen, sie wären keine Kunst mehr, sondern „Verrücktheit, wie sie unerhört in den Annalen der Furore“, d.h., sie würden eine Wirkung erzielen, die, laut Albrecht Betz, derjenigen heutiger Rockkonzerte „strukturell“ verwandt sei.19 Heine durchschaut die Manipulation: „niemand auf dieser Welt [weiß] seine Successe, oder vielmehr die mise en scène derselben so gut zu organisieren … wie unser Franz Liszt“.20 Liszt sei der „Generalintendant seiner Berühmtheit“, als Selbstdarsteller allenfalls noch von Meyerbeer übertroffen.21 Inspiriert durch Liszt und Meyerbeer, die er um ihre Reklamemaschinen beneidete, sollte Wagner später ähnliche Techniken perfektionieren, die insofern raffinierter waren, als sie in einer Rhetorik „reiner Kunst“ daherkamen.
Fairerweise muss gesagt werden, dass Liszt eigentlich das falsche Ziel war und Heine, der als Journalist davon abhing, dass Leute wie Liszt ihm Stoff zum Schreiben lieferten, sich unaufrichtig verhielt. Liszt, der gefeiertste Klaviervirtuose seiner Zeit, den manche für einen Scharlatan vom Schlage Paganinis hielten, war gleichwohl dem Gedanken des seriösen Musikers als Schöpfergenie verpflichtet. In einer langen, bemerkenswerten Artikelserie über die „Lage der Künstler und ihrer Stellung in der Gesellschaft“, die 1835 in der Gazette musicale de Paris erschien, beklagte er sich, dass sich seit den Tagen, als Mozart mit den Dienstboten essen musste, nicht viel verändert habe.22 Unter dem Einfluss saintsimonistischer Ideen erklärte er in dem Artikel, dass die Künstler, obwohl inzwischen mit einer „großen religiösen und gesellschaftlichen Mission“ versehen, sich immer noch mit einem geringen sozialen Status abzufinden hätten.23 Am Beispiel seiner selbst veranschaulichte Liszt seine postrevolutionär erweiterte Definition von Adel – als einen der Geburt, des Vermögens und des Talents. Er formulierte den feudalen Wahlspruch: „noblesse oblige“ in „génie oblige!“ um, was auf die Behauptung hinauslief, dass der begabte Künstler dem Aristokraten ebenbürtig sei.24 Liszt verhielt sich entsprechend, seine aristokratische Geringschätzung des Geldes deutete an, das Kunst – um ihren Adelsstatus zu wahren – nicht durch kommerzielle Erwägungen beschmutzt werden dürfe. Daher die amüsante Anekdote, dass die Fürstin Metternich, als sie Liszt einmal nach einer Konzertreise fragte: „Haben Sie ein gutes Geschäft gemacht?“, die Antwort erhielt: „Fürstin, ich mache Musik, keine Geschäfte“.25
Interesselosigkeit und Deutschsein
Die Haltung, die Liszt Geld und Geschäftsgeist gegenüber zum Ausdruck brachte, wurde von einem Teil der Künstlerschaft ganz Europas geteilt. Die starke Ausdehnung des Massenmarktes drohte, die Kunst in eine bloße, den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterworfene Ware zu verwandeln. Bereits im 18. Jahrhundert hatten sich manche Schriftsteller und Denker, besonders in Deutschland, dem Zwang widersetzt, verkäufliche Werke zu produzieren. Im Gegenzug benötigten sie eine Rechtfertigungsstrategie für die Unverkäuflichkeit ihrer Werke.26 Jedenfalls vertraten sie die Auffassung, dass wahre und echte Kunst nicht zum Zweck der Gewinnerzielung erschaffen würde. Im Umkehrschluss wurde die Popularität, mithin Einträglichkeit von Kunst zum sicheren Zeichen ihrer Minderwertigkeit erklärt, da sich ihre Entstehung einem ökonomischen Kalkül verdanke. Diese rhetorische Position, von Immanuel Kant theoretisch am überzeugendsten formuliert, brachte seriöse, interesselose Kunst in die Nähe der Religion sowie ihrer institutionalisierten Form, der Kirche – scheinbar den einzigen, von den ökonomischen Imperativen des modernen Marktes noch unberührt gebliebenen Einrichtung. Eine Verbindung zwischen Kunst und Religion herzustellen, war nicht schwer, waren doch manche Kunstsparten wie Bildhauerei, Malerei und Musik lange von der Kirche zur Verbreitung ihrer Botschaft verwendet worden, ebenso wie die Kunst dem Verlangen des Adels gedient hatte, seinen Reichtum und seine Kultiviertheit zur Schau zu stellen. Mit dem Aufstieg des säkularen, bürgerlichen Staates und dem gleichzeitigen Niedergang religiöser und aristokratischer Institutionen als Folge der Aufklärung und der Französischen Revolution erklärten sich auch die Künstler für unabhängig von ihren ehemaligen Herrn und erteilten der dienende Funktion der Kunst eine Absage. Gleichwohl versuchten sie, wie Franz Liszt, die spirituelle und aristokratische Aura des Kunstwerks zu erhalten. Diese Prinzipien, allerdings subtiler formuliert, bildeten den Kern der romantischen Bewegungen, von England bis Deutschland.
Richard Wagner übernahm dieses gesamteuropäischen Kunstdiskurs, rückte ihn dicht an deutsche Charaktereigenschaften heran und verwandelte die romantische Kunsteinstellung in den Ausdruck eines nationalen Wesens, mit dem er anschließend seine persönliche Identität verknüpfte. Bereits der Titel eines seiner Essays, der in August Lewalds Zeitschrift Europa veröffentlichten Pariser Fatalitäten für Deutsche (1841), zeugt von Wagners wiedergewonnenem Nationalstolz. Anscheinend musste man erst ins Ausland gehen und mit dem (den) „Anderen“ in Berührung kommen, um den eigenen Patriotismus wiederzuentdecken: „Sie [die Deutschen] lernen in Paris ihre Muttersprache von neuem schätzen…. Ihr oft schwach gewordener patriotischer Sinn wird hier von neuem gestärkt”.27 Zehn Jahre später wiederholt Wagner diesen Gedanken in seiner autobiographischen Mittheilung an meine Freunde, wobei ihm die ursprünglich allgemein gehaltene Aussage zu einem persönlichen Bekenntnis gerät: „Es war das Gefühl der Heimathlosigkeit in Paris, das mir die Sehnsucht nach der deutschen Heimath erweckte”.28 Wagner, der sich offenkundig seines Deutschseins nicht länger schämt, instrumentalisiert seine Herkunft, indem er eine moralische Überlegenheit seiner Nation reklamiert, die zwangsläufig auch für ihn gilt: „Die vortrefflichsten, echtesten Deutschen sind die Armen“.29 Dass sich in der französischen Gesellschaft, und zumal in Paris, der korrupten Metropole, alles ums Geld dreht, prädestiniert die Deutschen zum Scheitern: „[I]m ganzen ist es das Ennuyanteste, in Paris Deutscher zu sein“.30 Deutsche in Paris sind Opfer, ihre unvermeidliche Armut zeugt von Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit, die wiederum zu Ausweisen wahren Deutschtums werden: „Armut ist das größte Laster in Paris“, folglich ist „ein Deutscher und ein dummer, schlechter – nämlich ehrlicher, armer – Mensch zu einem und demselben Begriffe geworden“.31
Im Rahmen von Wagners journalistischer Tätigkeit in Paris fungiert von vornherein das Verhältnis von Geld und Kunst als Leitmotiv seiner Beurteilung ästhetischer Qualität und moralischer Tugend: „Man möge somit urtheilen, welche gefährliche Tugend in Paris Ehrlichkeit sei”.32 Geld wird zum Unterscheidungsmerkmal zwischen Berlioz und Liszt. Obwohl in ästhetischer Hinsicht „Brüder“ – aufgrund ihrer gemeinsamen Bewunderung Beethovens –, sind sie moralische Antipoden: „Doch ist einiger Unterschied unter ihnen zu machen, vor allem der, daß Liszt Geld gewinnt, ohne Kosten zu haben, während Berlioz Kosten hat und nichts gewinnt”.33 Wagner verurteilt Liszt als unmoralischen Geschäftemacher, als Virtuosen, der Verrat begeht, indem er „die Rolle eines Narren“ spielt.34 Berlioz ist (wie Wagner) ein Verlierer im Bereich dessen, was Wagner, ein Jahrhundert vor Theodor W. Adorno und der Frankfurter Schule, als „Kunstindustrie“ anprangert, wo „Verlieren“ einen moralischen Sieg bedeutet.35
Wenn Wagner, hier wie anderswo, künstlerische Interesselosigkeit zu einer geradezu genetisch bedingten Nationaltugend erklärt, so entspringt dies nicht seiner eigenen Erfindung. Vielmehr verknüpft er damit tief in der christlichdeutschen Tradition verankerte Diskurse. Die Verbindung von Christentum und Deutschtum, die im Mittelalter über den sogenannten „Reichsmythos“ hergestellt wurde, basierte auf dem Anspruch, dass das Heilige Römische Reich Deutscher Nation rechtmäßiger Nachfolger des Römisches Reiches und damit Beschützer der Christenheit sei. Desinteresse am Geld schien der germanischen wie der christlichen Tradition gemeinsam zu sein. Die biblische Mahnung: „Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme“36, verklärt den Armen und verdammt den Wohlhabenden. Sie bezeugt auch das gespannte Verhältnis des Christentums zum Geld und erklärt vielleicht teilweise den Antisemitismus des Mittelalters und der Neuzeit, weil der Geldverleih in den Händen der Juden lag, die häufig des Wuchers beschuldigt wurden. Unabhängig davon wertet Tacitus in Germania (98 u.Z.) die Tatsache, dass Gold und Silber bei den germanischen Stämmen unbekannt waren, als Zeichen ihrer intakten Verfassung und kontrastiert sie kritisch mit der Dekadenz und Korruptheit der Römer. Diese beiden Diskursstränge verschmolzen mit der Wiederentdeckung von Tacitus’ Text im Jahr 1455 und Martin Luthers Protest gegen den päpstlichen Ablasshandel von 1517. Luther lebte vor, was er predigte. Er kritisierte Drucker, die aus dem Buchverkauf Gewinn schlugen, und präsentierte sich selbst als Muster an Uneigennützigkeit. In seiner „Warnung an die Drucker“ verkündete er großmütig: „Denn ich habs umb sonst empfangen, umb sonst hab ichs gegeben, und begere auch dafur nichts, Christus mein Herr hat mirs viel hundert tausentfeltig vergolten”.37 Luthers Status als exemplarischer Deutscher schien Tacitus’ Bemerkungen über die Tugendhaftigkeit der Germanen zu bestätigen, Bemerkungen, die im 18. Jahrhundert in dem vermehrten Bemühen um die (Re-)Konstruktion einer deutschen Nationalidentität entscheidende Bedeutung erlangten. Luthers Status als vorbildlicher Autor, der aus seinem kreativen Werk keinen Profit zu schlagen versucht, war nicht minder einflussreich.
Wagner kombinierte schlicht zwei bestehende Diskurse: den einen, der Uneigennützigkeit zur spezifisch deutschen Eigenschaft erklärte, mit der europaweit verbreiteten These, dass echte Kunst nur aus dem Geist der Interesselosigkeit entstehen könne. Später sollte er Deutschsein definieren als „die Sache, die man treibt, um ihrer selbst … willen treiben; wogegen das Nützlichkeitswesen … sich als undeutsch herausstellte“.38 Nur Deutsche schaffen echte Kunst: „der Italiener ist Sänger, der Franzose Virtuos, der Deutsche – Musiker.“39 Wagner stellt klar:
Der Deutsche hat ein Recht, ausschließlich mit »Musiker« bezeichnet zu werden, – denn von ihm kann man sagen, er liebt die Musik ihrer selbst willen, – nicht als Mittel zu entzücken, Geld und Ansehen zu erlangen, sondern, weil sie eine göttliche, schöne Kunst ist, die er anbetet, und die, wenn er sich ihr ergiebt, sein Ein und Alles wird.40
Franzosen und Italiener verwandeln die Kunst aus persönlichem Gewinnstreben in eine Ware. Die Deutschen tun das nicht. Strukturell erinnert das Argument an Luthers viel frühere Kritik an der Kirche, gegen deren finanzielle Missbräuche er in seinen berühmten 95 Thesen protestierte. Lange vor der offiziellen Gründung des Nationalstaates wurde hier bereits der Streit zu einem zwischen geographisch getrennten Kulturen. Das päpstliche Rom wäre der unchristliche Ort von Ausschweifung, Diebstahl und Dekadenz. Von dort aus würden die Bewohner deutscher Lande beraubt und betrogen, um kostspielige Bauprojekte und ganz allgemein einen extravaganten Lebensstil zu finanzieren. Die Luther’sche Reform zielte darauf ab, die Gläubigen wieder in eine unmittelbare Beziehung zu Gott zu bringen und ihnen zu ermöglichen, ihn um seiner selbst willen anzubeten. Luthers beispiellose Übersetzung der Bibel in ein allen verständliches Deutsch vermittelt den Eindruck, dass die „Gläubigen“, an die er sich vorrangig wandte, seine deutschen Landsleute waren.
Die Vorstellung, dass auch nicht-religiöse Kunst die Kraft zur Verwandlung und Transzendenz habe – und deshalb mit religiöser Ehrfurcht zu behandeln sei –, geht auf die Thesen mehrerer Denker zurück. Der bekannteste von ihnen ist vielleicht Friedrich Schiller, der seine Sicht der Kunst als Mittel moralischer Erbauung in seiner bahnbrechenden Schrift Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reyhe von Briefen (1795) darlegte. Die nicht durch die Grenzen der Sprache gebundene Instrumentalmusik galt als höchste Kunstform, deren Potenzial noch steigerbar schien, sobald die einst privilegierte Stellung des Interpreten auf den Komponisten übergegangen41 und damit dessen Schöpfung – das „musikalische Werk“42 – in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt wäre. Wagner war nicht der Einzige, der solche genuin ästhetischen Sachverhalte mit dem aufkommenden nationalistischen Diskurs verband. Schon vor 1800 assoziierten deutschsprachige Musikkritiker deutsche Musik mit Männlichkeit und französisch-italienische Musik mit Weiblichkeit, wobei die deutsche Bevorzugung der Instrumentalmusik den komplexeren und höher entwickelten Verstand dieser Nation im Vergleich zur vermeintlichen Oberflächlichkeit französischer und italienischer Vokalmusik widerspiegele.43 Da solche Zuschreibungen lediglich vorhandene Annahmen über nationale Charaktereigenschaften bestätigten, untermauerten sie den Anspruch der deutschen Kultur auf universelle Bedeutung und Gültigkeit44 und beförderten (zwangsläufig deutsche) Instrumentalmusik in den Rang einer „universellen“ Sprache.45
Was Wagner von seinen Vorläufern und Kollegen unterschied, war seine Fähigkeit, seine Rolle und letztlich auch seine Werke mit der Sache der Nation zu identifizieren. Als hätte er sich in die noch nicht existente deutsche Nationalflagge gehüllt und ein „Made in Germany“-Etikett auf seine Kompositionen geklebt. Wie authentisch sein Heimweh und der daraus resultierende Patriotismus auch gewesen sein mögen, es war allemal ein geniales Marketingmanöver angesichts des allgemeinen Anstiegs patriotischer Gefühle in Deutschland während des 19. Jahrhunderts und ganz besonders in der Zeit der sogenannten Rheinkrise von 1840-1841.
Marketing und die Avantgarde
Wagner beklagte sich zeit seines Lebens darüber, dass er, um während seiner Pariser Jahre finanziell über die Runden zu kommen, „gezwungen“ war, Zeitungsartikel und Kurzgeschichten zu schreiben. Dieser Aspekt seiner chronischen Selbststilisierung zum Opfer ist von seinen Biographen tradiert worden. Einer der ersten, Carl Friedrich Glasenapp, bezeichnete Wagners journalistische Tätigkeit als „Frondienst“, ein tendenziöses Wort, das an feudale Leibeigenschaft denken lässt.46 Tatsächlich schrieb Wagner gerne und tat es noch, als er finanziell längst nicht mehr darauf angewiesen war. Was ihn allerdings nicht hinderte, sich weiter zu beklagen. Zehn Jahre später, in seiner Mittheilung an meine Freunde, sprach er erneut von der Notwendigkeit des Schreibens und der „Pein“, die ihm dieses bereitete.47 Auch wenn Wagner mehr als die meisten seiner Kollegen zu Papier brachte, war das Schreiben unter Künstlern längst nicht mehr unüblich.
Bereits eine Generation früher hatten Schriftsteller begonnen, sich der Bedeutung bewusst zu werden, ihrem kreativen Werk Erläuterungen und theoretische Rechtfertigungen an die Seite zu stellen, um einen „Geschmack“ zu erzeugen, wie Wordsworth es ausdrückte, mit anderen Worten, ein Publikum – einen Markt – für ihr oft schwieriges oder zumindest ungewöhnliches Werk. Abgesehen von Wagner selbst war unter seinen Zeitgenossen Robert Schumann (1810-1856) der produktivste Schriftsteller-Komponist. Als Gründer und erster Chefredakteur der Neuen Zeitschrift für Musik (im Folgenden NZfM), der renommierten, noch heute bestehenden Musikzeitschrift, die 1834 erstmals erschien, stand Schumanns Einfluss als Musikkritiker seinem kompositorischen Werk in nichts nach. Schumann verfolgte zahlreiche Ziele: eine Kunstform zu erneuern, deren Entwicklung seit Beethovens Tod im Jahr 1827 offenkundig ins Stocken geraten war; einen ästhetischen Konservativismus zu begegnen, der sich in der sterilen Verehrung der Klassiker ausdrückte, und dem Opportunismus populärer Komponisten wie Meyerbeer entgegenzutreten. Vor allem ging es Schumann darum, das, was er und seinesgleichen „Philistertum“ nannten, in all seinen Formen zu bekämpfen: die bürgerlichen Konsumenten, die Musik als Statussymbol benutzten, ebenso wie die Virtuosen, die sich der Musik bedienten, um die Bedürfnisse der Mittelschicht nach Unterhaltung und Zerstreuung zu befriedigen. Zu Mitstreitern in diesem von ihm als einsamen Kampf konzipierten Unternehmen erkor sich Schumann einen imaginären Freundeskreis von Widerstandskämpfern, den sogenannten „Davidsbund“, die vordersten Verteidiger wahrer Kunst – Kunst um der Kunst willen, nicht für den Profit oder zur Erreichung irgendeines anderen Ziels. Im Namen dieser Kunstfiguren schrieb Schumann eine Reihe von Artikeln in seiner Zeitschrift und porträtierte seine Gruppe musikalisch in den Davidsbündlertänzen und Carnaval, dessen musikalische „mignons“ einzelner Bundmitglieder in einem schwungvoll-martialischem Finale mit dem passenden Titel „Marche des Davidsbündler contre les Philistins“ gipfeln. Um mit Matei Calinescu zu sprechen, ist Schumanns „Kunst um der Kunst willen erster Ausdruck einer Rebellion der ästhetischen Moderne gegen die Moderne des Spießbürgers“.48 Im Einklang mit seinen Überzeugungen scheint es Schumann mit seinen unkonventionellen frühen Klavierstücken geradezu auf den kommerziellen Misserfolg angelegt zu haben.49 Es entbehrt vielleicht nicht der Ironie, dass diese Kompositionen heute das Herzstück des Schumannrepertoires bilden.
Für Wagner darf Schumann als Vorbild nicht übersehen werden, auch wenn dies allzu oft geschieht. Abgesehen von der Tatsache, dass Schumann einige von Wagners Pariser Schriften in der NZfM publizierte, ist es, wie Robert Gutman aufzeigt, kein Zufall, dass Wagner Hans Sachs’ Lehrling „David“ nannte, die Figur, die den Philister Beckmesser in der zentralen Prügelszene des zweiten Aktes mit Schlägen traktiert, dem dramatischen Grundeinfall, aus dem Die Meistersinger von Nürnberg ursprünglich entstand.50 Schumann leitete die Epoche ein, „wo die Künstler selbst ihre Kunst schriftstellerisch zu vertreten unternahmen, in einer Weise, daß dies Regel zu werden anfing, während es früher Ausnahme gewesen war“, eine Leistung, die bereits zur damaligen Zeit erkannt wurde, wie dieser Kommentar von Franz Brendel, Schumanns Nachfolger als Chefredakteur der NZfM, anlässlich der Jubiläumsfeier zum 25jährigen Bestehen der Zeitschrift 1859, bezeugt.51 Auch wenn sich Wagner über die Jahre hinweg immer wieder beschwerte, Texte statt Musik schreiben zu müssen, so war dies durch Schumanns Beispiel zu einer respektablen, geradezu normalen Angelegenheit für Komponisten geworden. Dennoch bestand insofern ein Unterschied zwischen beiden, als Schumann im Allgemeinen über Musik und dann für gewöhnlich über andere Komponisten und Interpreten schrieb, Wagner hingegen fast ausnahmslos über sich selbst.
Dennoch zieht sich kein geringer Widerspruch durch Schumanns Werk und die von ihm gegründete Zeitschrift. Angetreten, die zukünftige Richtung „seriöser“ Musik zu bestimmen, war die NZfM gleichwohl ein genuin unternehmerisches Projekt, das den Markt beobachtete, mit dem festen Vorsatz, eine Nachfrage für nichtkommerzielle Musik und die von ihr geförderten Komponisten zu schaffen. Und Schumann war keineswegs der Einzige, der die Verweigerung des Marktes ins Zentrum seiner Marketingstrategie stellte.
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat dieses Phänomen an Schriftstellern untersucht, die um 1840 herum in Paris tätig waren, insbesondere dem Dichter Charles Baudelaire (1821-1867) und dem Romancier Gustave Flaubert (1821-1880), die Begründer einer Bewegung, die auf den „Industrialismus [reagierte, der] in die Literatur selbst eingedrungen [war], nachdem er die Presse umgewandelt hatte“.52 Ausgehend von der Vorstellung des autonomen Künstlers, der sich von allen Kräften – Adel, Kirche, Politik, Ökonomie, Gesellschaft – emanzipiert hat, die traditionell oder aktuell Form und Inhalt des Kunstwerks bestimmen, setzte sich Baudelaire an die Spitze des Widerstandes gegen die industrielle Moderne mit den Mitteln der ästhetischen Moderne. Doch Bourdieu zeigt auf, was Walter Benjamin vor ihm schon angedeutet hatte: das Gebot einer „reinen“ Kunst, die sich dem Markt verweigert und die bürgerliche Kultur und Moral pauschal verwirft, war von Anfang an problematisch. Baudelaires flâneur ist der einsame Bummler, der am Rande der Gesellschaft steht, angeblich, um zu schauen, „und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu finden“.53 Ebenso paradox war der neue, nonkonformistische Lebensstil der „Boheme“, die diesen Widerstand zur öffentlichen Attraktion machte. Der schäbig gekleidete, häufig amoralische „Hungerkünstler“ wurde bald zu einer banalen literarischen Figur, auf die Bühne gebracht von Henry Murger in seinen Scènes de la vie de bohème (1853), unsterblich gemacht durch Giacomo Puccinis Opernadaption La Bohème (1896), während er über Benjamin Einzug hielt in die Theorie. In Paris wurden ganze Stadtviertel wie Montmartre oder das Quartier Latin mit dem bohemistischen Lebensstil identifiziert, ein Brauch, der später auch auf andere Städte übergriff. Mit der Zeit wurde die „Boheme-Attitüde“ selbst zu einer Institution, einem Klischee, das seinen eigenen Konformismus erzwang, inklusive der Zurschaustellung einer gewissen politischen Oppositionshaltung gegen das Establishment. Bourdieus Behauptung, dass es so etwas wie einen „Rechtsintellektuellen“ nicht gebe, enthüllt vielleicht ungewollt, wie vorhersehbar die Pose des „Linksintellektuellen“ ist.





























