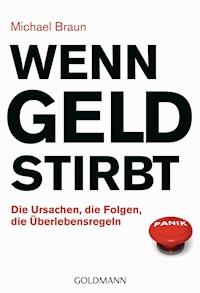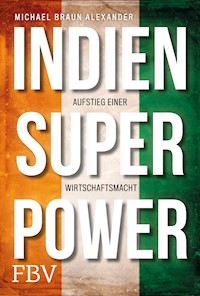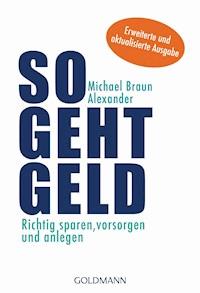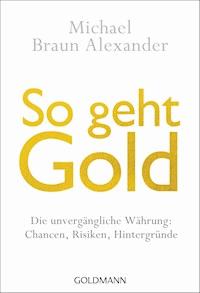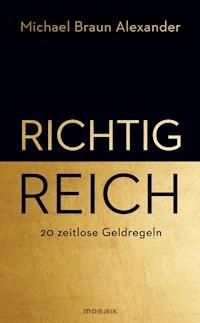
10,99 €
Mehr erfahren.
Wie finde ich zum finanziellen Glück? Reichtum ist nicht alles, und doch kann er vieles erleichtern. Den Wunsch nach Wohlstand und Absicherung teilen viele, doch den Weg dorthin kennen nur wenige. Finanzexperte Michael Braun Alexander erklärt, wie Sie die lange Reise in den materiellen Wohlstand ohne Größenwahn und falsche Hoffnungen angehen können. Denn wer weiß, wonach er suchen muss, braucht weder buchhalterische Erbsenzählerei noch hehre Spekulation. Nachahmen ausdrücklich erwünscht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Wie finde ich zu finanziellem Glück? Reichtum ist nicht alles, und doch kann er vieles erleichtern. Den Wunsch nach Wohlstand und Absicherung teilen viele, doch den Weg dorthin kennen nur wenige. Finanzexperte Michael Braun Alexander erklärt, wie Sie die lange – und zutiefst befriedigende – Reise in materielles Wohlbefinden ohne Größenwahn und falsche Hoffnungen angehen können.
Autor
Der Journalist Michael Braun Alexander, geboren 1968, studierte Wirtschaftswissenschaften, Politik und Philosophie in Oxford, Bologna und Washington und war Chefredakteur einer der größten Finanzzeitschriften in Deutschland.
Außerdem von Michael Braun Alexander im Programm
So geht Gold (auch als E-Book erhältlich)So geht Geld (auch als E-Book erhältlich)Wenn Geld stirbt (nur als E-Book erhältlich)
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Originalausgabe September 2018
Mosaik Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: *zeichenpool
Redaktion: Dunja Reulein
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JE ∙ Herstellung: IH
ISBN 978-3-641-21301-5V001www.mosaik-verlag.de
Für die fabelhaften Neffen und Nichten Angelique, Bevin, Caleb, Callon, Kyle, Lee, Lindsay-O’Neill, Maria, Rizaan, Rushdeen, Shamima, Shirnae, Vanessa & Xavier
Kapitel 1Geld ist ein Garten Warum man sich um Hab und Gut kümmern muss
Bäume und Pflanzen sehen irgendwie immer
genauso aus wie die Leute, bei denen sie wachsen.
– Zora Neale Hurston1
Wäre Geld ein Garten, sähe das finanzielle Lebensumfeld vieler Sparer in Deutschland ungefähr so aus: hinter dem Haus ein grau zubetoniertes Areal, ziemlich weitläufig. Am Zaun hat jemand ein altes Auto mit geborstenen Scheiben abgestellt und vergessen, die Reifen platt, die Felgen verrostet. Am hinteren Ende des Gartens steht auf einer kleinen ungepflegten Rasenfläche ein alter kümmerlicher Apfelbaum, der sich im Herbst ein paar Äpfel aus den Ästen presst. Das Obst wird nicht geerntet, sondern fällt zu Boden, wo es liegen bleibt und verfault.
Die Leute, denen dieser Garten gehört – wenn man dieses unwirtliche Gelände denn einen »Garten« nennen möchte –, leben im Haus davor. Wenn sie, was erstaunlich oft vorkommt, aus den hinteren Fenstern schauen, schütteln sie resigniert den Kopf: der Garten missraten und hässlich, eine Wüstenei. Wie ungerecht; man weiß doch, in was für prächtigen Parks andere so leben.
Dann fassen sie, das kommt öfter vor, einen Plan: Es muss sich etwas ändern. Im nächsten Winter soll der alte Apfelbaum weg. Das Laub ist im Herbst zu lästig.
Die Entdeckung des Paradieses
Die neue Lust aufs Land kam ungefähr im Jahr 2005 so richtig in Fahrt. Damals ging im deutschsprachigen Raum eine neue Zeitschrift an den Start, Landlust, deren Titel zugleich Motto war. Das Magazin war nicht nur erfolgreich, sondern ein Phänomen. Während die Mehrzahl der im deutschen Sprachraum verlegten Publikationen seit der Jahrtausendwende an Auflage verlor, begründete Landlust ein neues publizistisches Segment und wurde zu einer der spektakulärsten Neueinführungen in diesem Jahrtausend. Binnen weniger Jahre erreichte das Heft eine Auflage von mehr als einer Million: eine Sensation.
Die große Mehrzahl der Landlust-Fans ist weiblich (72 Prozent) und typischerweise 40 bis 60 Jahre alt, steht also in der Mitte des Lebens. Die meisten von ihnen leben keineswegs in der Stadt (was eine gewisse Sehnsucht nach Natur erklären könnte), sondern in der Provinz, im Eigenheim übrigens, was darauf hindeutet, dass es ihnen finanziell recht gut geht. Fünf von sechs Landlustigen haben einen Garten2, ihr privates Naturrefugium, ihr »Paradies«.
Genau das ist ein Garten. Das altpersische Wort Paradies, vielen aus dem Alten Testament vertraut – die Episode mit Adam und Eva am Anfang der biblischen Menschheitsgeschichte –, bedeutet nichts anderes als »Garten«, ein abgegrenztes, geschütztes Terrain. Aus dem Altpersischen gelangte der Begriff über das Griechische in viele weitere Sprachen, darunter auch das Deutsche.3 Das Paradies ist keineswegs grenzenlos und unendlich, sondern von einer Mauer oder einem Zaun umgeben. Es ist entgegen einiger christlicher Überlieferungen und Interpretationen auch nicht zwangsläufig ein Ort unvorstellbarer Freuden und ewiger gottgegebener Sorglosig- und Glückseligkeit. Das Paradies ist kein Schlaraffenland, sondern ein Garten: ein Ort des Wachstums.
Seit dem Erscheinen von Landlust sind zahlreiche Nachahmertitel an den Start gegangen, die das Landleben – oder das, was Städter sich darunter vorstellen – thematisch aufgegriffen und das gesellschaftliche Phänomen der neuen Naturverbundenheit verstärkt haben. Mehr Lust an Natur, egal ob wild oder gezähmt, war nie. Der eigene Garten gilt vielen als Idyll und Ideal, als wohltuende, bereichernde Entschleunigung des Lebens. Es dürfte allein in Deutschland um die 15 Millionen Haus- und Schrebergärten geben. Hinzu kommen Zehntausende öffentliche Parks und Grünanlagen.4 Dass ein Garten Arbeit macht, bevor er nett aussieht und genossen werden kann, dass dank der Launen von Natur und Wetter vieles schief- und eingehen kann, ist allen Paradiesfreunden klar. Dieses Detail hat die Lust aufs eigene Grün am Haus – natürlich selbst bearbeitet und bewirtschaftet – nie trüben können.
Garten wie Geld müssen gehegt und gepflegt werden
Die Kultivierung eines Gartens hat viel mit Geldanlage gemeinsam. Bei beiden geht es um Wachstum. Unser Geld ist wie ein Garten für uns, und wir sind seine Gärtner.5
Das wird manchen erstaunen, ist der Begriff »Garten« bei vielen Zeitgenossen doch mit idyllischen Assoziationen verknüpft, der Terminus »Geldanlage« dagegen mit unerquicklichen. Der Garten gilt vielen als Hort des Glücks, das Geld als Grund zu Sorge. Die Geldanlage hat ein Imageproblem. Eigentlich verheißen beide, Garten wie Geld, ihren Besitzern Befriedigung und glückliche Stunden, heute und in Zukunft. Aber die Freuden des Gartens verspürt die große Mehrheit intuitiv, während die Beschäftigung mit Geld, Vermögensanlage und Kapital von vielen als unerfreulich und belastend wahrgenommen wird: eine Qual.
Das ist bedauerlich, denn es gibt zwischen Geld und Garten frappierende Parallelen. Einen Garten sollte man erst anlegen, wenn bildlich gesprochen der Kühlschrank gefüllt und die Wohnung im Winter beheizt ist – also erst dann, wenn man den Lebensunterhalt für sich und seine Angehörigen gesichert hat und man sich die Ausgaben für Planung, Anpflanzung und Bewirtschaftung leisten kann. Ähnlich ist es bei der Geldanlage: Sie ist außerordentlich folgenreich für den Rest des Lebens, sollte aber erst dann zum Thema werden, wenn die Grundausgaben des Lebens gesichert sind und, wichtig, der berühmte Notgroschen für unerwartete Ausgaben angespart wurde, also ein Finanzpuffer für den unvorhersehbaren Notfall.6
Beide, Geldanlage wie Garten, machen Arbeit. Wer einen Garten hat, wird säen und Unkraut jäten, den Rasen mähen, die Rosen schneiden, Leitern schleppen, Blattläusen und anderen Schädlingen den Kampf ansagen, Rasenmäher und andere Geräte reparieren oder in die Werkstatt bringen, Laub harken, düngen, umgraben, gießen, vertikutieren, kompostieren und zahllose weitere Aufgaben erledigen. Genauso ist es beim Geld. Bevor man »ernten« und sich an seinen Ersparnissen und deren Erträgen – und später vielleicht gar an einem veritablen Vermögen – erfreuen kann, muss man sich kümmern. Das macht Mühe, kostet Zeit und Aufmerksamkeit, und beide sind heute für viele Menschen ausgesprochen rare und hohe Güter, mit denen sie entsprechend geizen. Wer seine Blumenbeete nicht jätet und den Rasen nicht mäht, wird feststellen, dass sein Garten binnen weniger feuchtwarmer Sommertage zuwuchern kann. Nicht anders ergeht es denjenigen, die ihre persönlichen Finanzen vernachlässigen, sei es aus Unlust, Unwissen oder Unfähigkeit. Sie werden früher oder später merken, dass in ihren Geldangelegenheiten Chaos und Willkür herrschen, dass, bildlich gesprochen, Unkraut ihren Kapitalgarten erobert hat oder – wie im Auftakt dieses Kapitels beschrieben – Beton dominiert. Dass eine Grünanlage aussagekräftig ist, ahnte schon die afro-amerikanische Schriftstellerin Zora Neale Hurston, als sie vor mehr als 70 Jahren schrieb, dass »Bäume und Pflanzen irgendwie immer genauso aussehen wie die Leute, bei denen sie wachsen«. Ein Garten aus Beton lässt entsprechend peinliche Rückschlüsse auf die Befindlichkeit und Befähigung des Gärtners zu.
Selbstverständlich wandelt sich jeder Garten unentwegt, er sieht stets ein wenig anders aus, abhängig von der Jahreszeit, vom Wetter, vom Licht und von der Pflege, die man ihm angedeihen lässt (oder gerade nicht). Genauso verhält es sich mit Geld. Ein Vermögen, egal wie klein oder groß, sieht jeden Tag – sogar, sofern börsennotierte Wertpapiere Teil davon sind, jede Sekunde – ein wenig anders aus. Der Kapitalgarten entwickelt gewissermaßen ein Eigenleben und hat ein dynamisches Wesen, abhängig von den Einkünften und Ausgaben des Eigentümers, vom Auf und Ab an den Finanzmärkten und von der Pflege, die man ihm angedeihen lässt – also von den Maßnahmen, die man gelegentlich ergreift, um die Ersparnisse auf Kurs zu halten. Ein blühender oder erntereifer Garten ist etwas Wunderbares. Ein prosperierendes Vermögen auch.
Auf die Größe kommt’s nicht an
Die Größe ist dabei nicht entscheidend. Manch einer mag das Glück haben, einen mehrere Hektar großen Privatpark zu besitzen, eine sprichwörtlich blühende Landschaft, die nur ihm und seiner Familie gehört. Fein. Ein anderer besitzt vielleicht ein Reihenhaus mit Vorgarten, in dem Blumen, Sträucher und andere Zierpflanzen wachsen und Platz genug für ein Carport, einen Sandkasten und eine Schaukel für die Kinder ist. Ein Dritter hat einen Balkon, ein Vierter nur einen kleinen Küchenkräutergarten auf einer Fensterbank. Vielleicht beschränkt sich sein »Garten« sogar auf einen einzelnen Topf Basilikum oder einen einsamen, halb vergessenen Kaktus vorm Badezimmerfenster. Und wer nicht einmal einen Blumentopf hat, der kann sich ohne Aufwand irgendwo ein Saatkorn organisieren – etwa einen Sonnenblumenkern oder Paprikasamen – und es in einen Topf Erde stecken, der damit zum Garten wird. Einem winzig kleinen, stimmt. Aber »die Größe eines Gartens hängt nicht von der Zahl der Quadratmeter ab«, wie Jörg Albrecht, Wissenschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, es ausdrückt, »sondern von seinem Besitzer und wie er ihn pflegt.«7 Das trifft es. Jeder noch so große Garten hat irgendwann einmal winzig klein angefangen. Auch Geld wächst und gedeiht von allein, aus kleinen, kleinsten Anfängen. Aber das Saatkorn in die Erde stecken und nach dem Rechten sehen muss der zuständige Gärtner, müssen Sie. Wir alle sind Gärtner oder können es wenigstens sein, wenn wir in diese schöpferische Rolle schlüpfen wollen, auch wenn das nicht jedem klar ist.
Wer in sich geht und feststellt, dass er in der Abteilung Vegetation näher am einzelnen Basilikumtopf als am hochherrschaftlichen Landschaftspark einzuordnen ist, muss nicht verzweifeln. Die Größe eines Gartens ist die eine Sache und viel unwichtiger, als man meinen könnte; die andere sind die Prinzipien, nach denen man seine Flora bewirtschaftet – schließlich braucht jeder Garten, egal ob enorm oder nicht, Hege und Pflege sowie eine gute Portion Disziplin und Geduld. Es gibt, wie jeder weiß, herrliche Minigärten und ausgesucht hässliche Maxiparks, und man sollte nie vergessen, dass der üppig blühende Balkon einer kleinen Stadtwohnung im Allgemeinen größere Freude bereitet – den Besitzern wie den Nachbarn – als ein verkommener, vernachlässigter Schlosspark von zehn Hektar. Ein kleiner Gemüsegarten hinterm Haus kann ergiebiger sein als die größte Länderei, wenn sie brachliegt und nicht bewirtschaftet wird. Selbst im Kleinen wachsen und gedeihen Pflanzen aufs Herrlichste.
Nicht anders ist es beim Geld. Ein Vermögen kann 5000 oder fünf Milliarden Euro schwer sein – was die Prinzipien der Geldpflege angeht, ist die Höhe des Anlagekapitals zweitrangig. (Völlig zu vernachlässigen allerdings nicht, weil bei kleinen Anlagesummen die Gebühren einen proportional größeren Anteil auffressen können und manche Anlageinstrumente unzugänglich bleiben.) Es gibt kleinste Ersparnisse und Milliardenvermögen, ein riesiges Spektrum der Vermögensverteilung, und wir alle, ob arm oder reich, sind irgendwo auf diesem Spektrum zu finden. Wie groß das eigene Vermögen ist, ist zwangsläufig eine wichtige Kennzahl, aber nicht die entscheidende. Viel wichtiger ist bei der Geldanlage das weise Gärtnern, das erst dazu führt, dass es im Garten des Geldes keimt, wächst und gedeiht. Der Grundgedanke auch hier: Man sät und pflanzt, damit etwas Neues daraus erwächst, idealerweise etwas Erfreuliches, ohne allzu viele unangenehme Überraschungen.
Beim Garten leuchtet dieses Muster den meisten ein: Sie huldigen der Landlust und versuchen, es draußen möglichst schön zu haben. Ihr Geld dagegen lassen viele brachliegen – eine private Wüste.
Ohne Plan geht’s nicht
Planlosigkeit macht jeden Garten und jedes Vermögen zunichte. Zugegeben: Ein verwilderter Garten kann einen rauen Charme entwickeln und Auge und Nase schmeicheln. Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel, schnell wird aus rauem Charme Verwahrlosung. Wer einen Garten anlegen will, sollte sich frühzeitig Gedanken über seine Gestaltung machen. Soll es eine Rasenfläche, Büsche und Hecken geben? Obstbäume und -sträucher, einen Kräuter- und Küchengarten? Oder hätte man lieber ein parkartiges Gelände – genügend Fläche vorausgesetzt – mit eines Tages ehrwürdig gealtertem Baumbestand und vielleicht einem Teich, in dem die Frösche quaken? Sollen bei geeignetem Klima Kokospalmen, Bananenstauden und Mangobäume gepflanzt werden – oder doch eher, wie in unserer gemäßigt-kühlen Klimazone, Rosen, Stachelbeerbüsche, Kastanien, Heide, Efeu? Der angehende Gärtner muss sich fragen: Was passt zu mir, zum Klima, zur Lage des Gartens, zum Erdreich?
Dabei ergibt es durchaus Sinn, von vielem etwas zu haben, wenn es sich platzmäßig unterbringen lässt: Blumenrabatten und Grünflächen, Bäume und Büsche, Hecken als Windschutz, Gemüsebeete, ein Kräutergärtchen vielleicht. Aber bitte mit Sinn für Ordnung und Dimensionen und einer Spur gesundem Menschenverstand, schließlich eignet sich nicht jeder schmale Streifen Erdreich zwischen Garagenauffahrt und Hauswand für einen Märchenwald. (Beim Geld, wir werden später darauf zurückkommen, nennt sich dieses konzeptionelle Planen eines Gartens – ein »Mischen« oder »Aufteilen« des Geländes – asset allocation, wörtlich die »Verteilung des Vermögens«.)
Ein Übermaß an Spontaneität ist dabei eine schlechte Idee. Wer mal eben so, weil er gerade Lust und Laune verspürt, hier und da ein bisschen was in den Boden steckt oder sät, wird am Ende mit größter Wahrscheinlichkeit keinen prächtigen Garten haben. Und wer jede Woche in sein Grün geht und die Hälfte der Vegetation aus dem Erdreich reißt, um etwas Neues, Originelleres, Frischeres anzupflanzen, weil er den Geschmack am Vorherigen verloren hat, der wird langfristig viel zerstören und wenig erschaffen. So funktioniert Gärtnern nicht, und so funktioniert Geldanlage nicht. Heute mal schnell ein paar Anteile an irgendeinem Fonds kaufen, weil in der Zeitung steht, dass die Börse schon wieder neue Höchstkurse erklommen hat oder ein schlechtes Gewissen nagt? Morgen schnell ein paar Aktien ins Depot, über die sich irgendeine Publikation in einem Zehnzeiler positiv geäußert hat? In der nächsten Woche dann alles in einem Anfall von Hysterie wieder verkaufen, weil der Markt einen Dämpfer erleidet und unsicherer zu werden scheint? Bitte sehr, das kann man so machen, muss man aber nicht. Wer so »investiert« – die Anführungsstriche sind Pflicht –, der ist ein planloser, naiver Spekulant.
Die planlose Mehrheit
Leider ist an dieser Stelle festzuhalten, dass ein Großteil der Bundesbürger, was ihre Finanzen angeht, es mit der Planerei nicht so hat. Vor allem sind sie der Börse – insbesondere der Aktienbörse – überdrüssig, halten sie für unseriös und »spekulativ«. Das ist bedauerlich, enthüllen solche Aussagen in der Regel doch mehr über die Natur des Skeptikers als über die der Börse. Eine Börse ist ein Handelsplatz, ein Markt für Wertpapiere und Finanzinstrumente, nicht mehr, nicht weniger. Wie man sich auf einem Markt im Kräftespiel von Angebot und Nachfrage, im Auf und Ab der Preise, verhält, ist jedem selbst überlassen. Viele derjenigen, die um Aktien grundsätzlich einen Bogen machen, weil sie angeblich unsicher seien, sind oft genau diejenigen, die mangels wahrgenommener Alternativen ihre zweite, dritte oder vierte Immobilie kaufen – zu Preisen, die sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt und verdreifacht haben und die man als teuer bezeichnen könnte und damit als relativ unsicher. Millionen Sparer haben weiterhin einen Großteil ihres Geldes auf Tages- und Festgeldkonten liegen, wo es dank negativer Zinsen (unter Berücksichtigung der Inflation) Tag für Tag an Kaufkraft verliert. Bildlich gesprochen, gleicht das Anlageverhalten dieser Leute dem eingangs erwähnten Gärtnergenie, das das ihm anvertraute Terrain unter einer Betonplatte verschwinden lässt, weil ihm aus Trägheit und fehlender Kreativität nichts Besseres einfällt.
Aber eine Betonplatte hinterm Haus, die hat auch ihre Vorzüge. Sie ist pflegeleicht; schließlich macht sie keine Arbeit, und man muss weder jäten noch Laub harken. Beton ist zukunftssicher, nachhaltig, hält ewig, unangenehme Überraschungen ausgeschlossen. Die Sache mit der Hässlichkeit wiederum: tja. Aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Wunderbarerweise darf jeder mit jener Art von Garten leben, die er bevorzugt. Auch Beton hat im Vergleich mit einer Buchsbaumhecke für Kenner vielleicht ästhetische Vorzüge, wer weiß das schon? Wer sein Vermögen indes per Tages- und Festgeldkonten in das Äquivalent einer Betonplatte verwandelt, wird es dahinsiechen sehen. Das ist zwar dämlich, aber selbstverständlich erlaubt. Jeder, wie er will.
Diejenigen hingegen, die Beton im Garten und Minizinsen im Vermögen suboptimal finden, können und sollten in die Freuden der Planung einsteigen. Einen Baum oder Busch, Obst, Gemüse oder Blumen zu pflanzen erfordert die Bereitschaft, Zeit aufzuwenden, zu recherchieren, sich die Hände schmutzig zu machen, irgendwann zwangsläufig ins Schwitzen zu kommen und etwas Geld für Pflanzen aus der Baumschule, Setzlinge, Blumenzwiebeln, Saatgut und Werkzeug auszugeben. Wer einen Baum oder Strauch anpflanzen will, muss sich vorher ein paar Gedanken machen, sonst wird das Projekt misslingen. Für jedes Lebewesen, auch und erst recht für eine Pflanze (die schließlich nicht weglaufen kann), muss die Mischung aus Erdreich, Licht, Klima und Umgebung passen. Wer hinter seinem Einfamilienhaus in der Lüneburger Heide partout die Jacaranda blühen sehen und Granatäpfel ernten will, muss viel Ausdauer mitbringen. Wer sich andererseits in Norddeutschland an einem Apfelbaum oder einer Buche erfreuen könnte, der denkt pragmatisch und in die richtige Richtung – allein schon weil diese Baumarten, anders als Jacaranda, Kokospalme oder Olivenbaum, nicht frostempfindlich sind. Jede Klimazone hat ihren idealen Garten, jeder Garten sein ideales Klima, das gilt selbst in den Wüsten und Polarzonen der Erde. Wer ein Paradies anlegen will, braucht Zeit und die richtigen Zutaten, und er muss die Gegebenheiten – das Erdreich, die klimatischen Bedingungen, die Lichtverhältnisse, die potenziellen Schädlinge – berücksichtigen.
Ähnlich vielfältig ist die Geldanlage, bei der die finanziellen Mittel, die Familien- und Lebensplanung, der Zeithorizont, die persönliche Risikoneigung und vieles andere eine Rolle spielen und bei der zahlreiche verschiedene Instrumente zum Einsatz kommen können. Wer als Anleger die Ausbildung seiner Kinder mit hochriskanten Derivaten sicherstellen oder binnen eines Jahres »garantiert« 100 Prozent machen will, wird früher oder später merken, dass die Sache so nicht funktioniert. Ohne ein Mindestmaß an Planung, Vorbereitung und Nachdenken wird es nichts. Wer sein Gartenprojekt gedankenlos angeht, wird das ernten, was er sät. Beim Geld ist es nicht anders.
Feindbild Börse
Ein Großteil der Menschen in unserem Land ist überzeugt, dass die Börse im Allgemeinen und Aktien im Besonderen Teufelszeug seien, dass der Finanzmarkt einem Kasino ähnele, in dem man langfristig nur verlieren könne, getreu dem Motto: »Die Bank gewinnt immer.« Übertragen auf unser Bild vom Garten bedeutet das, dass sie gezielt jene Vegetation ausschließen, die langfristig am eindrucksvollsten wächst und gedeiht.
Das einmal jährlich erstellte Vermögensbarometer des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) stellte in seiner 2016er-Ausgabe fest, dass nur zwölf Prozent der Deutschen unternehmerische Direktbeteiligungen für »am besten für den Vermögensaufbau geeignet« halten – und das in einem De-facto-Nullzinsumfeld. 2014, als die Zinsen bereits nahe der Nulllinie lagen, waren noch 23 Prozent zu mehr Risiko und einem größeren Aktienfokus beim Vermögensaufbau bereit, 2015 immerhin noch 14 Prozent.8 Die Risiko- und Aktienbereitschaft der Deutschen geht also deutlich zurück, und das von ohnehin recht niedrigem Ausgangsniveau. Bildlich gesprochen, ist Beton im Garten gefragter denn je. Das ist ein verstörender Trend, der auf lange Sicht die Kapitalgärten in unserem Land nicht aufhübschen wird. Er legt nahe, dass viele Bundesbürger verwirrt oder gar töricht sind, wenn es um ihre finanziellen Methoden geht. Aktien sollen ein Glücksspiel sein, eine – der an dieser Stelle oft gehörte Ausdruck – »Spekulation für Zocker«? Wenn das stimmen würde, wäre auch das Anlegen eines Gartens oder das Kochen eines ambitionierten mehrgängigen Menüs ein Glücksspiel, und das würden vermutlich die wenigsten so sehen. Vielmehr geht es bei all diesen Projekten um ein gesundes, umsichtiges Maß an Planung und Vorbereitung, um die richtigen Zutaten, um den Willen zu etwas harter Arbeit und die Bereitschaft, Zeit zu investieren und sich schlau zu machen. Disziplin und gesunder Menschenverstand also, nicht Glücksspiel. Geldanlage findet nicht im Kasino statt.
Sicher: Man weiß in seinem Garten nie, wie in zwei Jahren das Wetter sein wird, ob eines Tages ein Unwetter übers Land zieht, ein Hagelsturm, eine Windhose, ob ein Blitz einschlägt oder renitente Wildsäue mit ihrer Brut durch die Beete pflügen. Aber auf jeden Sturm folgt erfahrungsgemäß früher oder später immer Sonnenschein und umgekehrt – und niemand würde, da es nun einmal ungemütliches Wetter gibt, auf das Anlegen eines möglichst idyllischen und ertragreichen Gartens verzichten und sämtliche Planungen aufgeben. Beim Geld hingegen soll man auf Aktien und aktienbasierte Anlagen verzichten, weil es eines Tages »Sturm« geben könnte (und irgendwann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geben wird)? Absurd.
Man stelle sich einen Gartenbesitzer vor, der sämtliche Pflanzen samt Wurzelwerk aus dem Boden reißt und sein Land mit Asphalt zudeckt, weil es hässliche Wetterphänomene wie Stürme und Hagel gibt, der erklärt: »Nein, Schluss, aus – ich will nie wieder einen Garten haben!« Im nächsten Frühjahr wird er dann feststellen, dass es mit dem ollen Asphalt bei ihm hinterm Haus doch recht öde und trist aussieht, während ein paar Zäune und Straßen weiter die Landschaften wieder prächtig blühen.
Die Tugend des Gärtners und Anlegers: Geduld
Leider wird niemand als großer Gärtner geboren; jeder muss sich selbst den sprichwörtlichen grünen Daumen erarbeiten. Genauso wenig kommt man als genialer Anleger auf die Welt. Man muss etwas dafür tun, offen sein und sich das Thema erschließen. Es ist bei aller Genialität und Einsatzbereitschaft nahezu ausgeschlossen, dass man mit Anfang 20 ein guter oder auch nur passabler Investor ist. Fehler gehören auf dem Weg zum brauchbaren Anleger dazu, die Summe aller Fehler nennt man dann Erfahrung und eines Tages – nach vielen Jahrzehnten – vielleicht so etwas wie Weisheit. Es wäre naiv, illusorisch und größenwahnsinnig, von heute auf morgen einen prächtigen Garten oder ein gewaltiges Vermögen schaffen zu wollen. Mit einem Zeithorizont von zehn, 20 oder 30 Jahren aber – das ist eine vernünftige Perspektive – kann es unter Berücksichtigung von ein paar Regeln, um die es in diesem Buch gehen soll, anständig funktionieren. Garten und Geldanlage sind Langzeitprojekte. Das bringt es mit sich, dass ziemlich egal ist, wie es morgen zufällig hinterm Haus oder im Depot aussieht. (Gut, ging in der Nacht ein Unwetter nieder, wird das keinen Gärtner erfreuen. Aber in der größeren Ordnung der Dinge ist es bedeutungslos, weil irgendwann wieder – wahrscheinlich sehr bald – die Sonne scheint. So ist es immer gewesen. So wird es immer sein.) Das Ziel besteht für Gärtner und Geldanleger gleichermaßen darin, dass es in fünf Jahren oder in mehreren Jahrzehnten nett aussieht, beispielsweise beim geplanten Eintritt in den altersbedingten Ruhestand. Ob es heute zufällig gerade ein Unwetter gibt oder nicht? Nebensache.
Vermögensaufbau braucht Zeit
Wer das Alte Testament gut kennt, ist wahrscheinlich auch mit diesem Satz des Predigers Salomo vertraut: »Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit.«9 Im Garten und bei der Geldanlage gilt, dass alles nicht nur seine Zeit hat, sondern auch Zeit braucht. Die Zeit und Respekt vor der Zeit – Geduld nämlich – sind die wichtigsten Verbündeten derjenigen, die ihr Vermögen wachsen und gedeihen sehen wollen. Wer möglichst schnell in einem üppigen Garten sitzen will, wird feststellen, dass er Pflanzen zwar stimulieren kann (zum Beispiel mit gutem Erdreich und Dünger), aber nicht kontrollieren. Wer mit Aktien oder sonstigen Geldanlagen besonders schnell zu Krösus werden will – was in der Regel bedeutet: exorbitante Risiken eingeht –, der wird zu spüren bekommen, wie schnell man Geld verlieren kann. Zwar lesen und hören wir ab und an von pfiffigen Leuten, die mit dem richtigen Deal am richtigen Ort zur richtigen Zeit in kurzer Zeit ein Vermögen gemacht haben. So etwas kommt vor. Aber auf jeden Glücksritter, der binnen kurzer Zeit Erfolg hat – oft zufällig, es geht bei diesem Begriff nicht nur um Rittertum, sondern auch um Glück –, kommen Hunderte Unglücksritter, die nicht durch die Medien mäandern, die in der Versenkung verschwinden und von denen man mangels sensationellen Erfolgs nie wieder hört. Und manch ein Glücksritter, der bei seiner Finanzdisposition tatsächlich mit dem Segen Fortunas agierte und Geld machte, ist beim nächsten Mal übermütig und hat Pech und einen herben Verlust.
Wer einen Garten anlegt, tut dies nicht für einen Sommer. Manch einer wird einen Baum – vielleicht eine Eiche oder einen Walnussbaum – sogar mit der Absicht pflanzen, dass eines Tages seine Enkel und Urenkel im Schatten mächtiger Äste sitzen mögen. Ein prächtiger, üppiger Park wächst nicht in einer Woche heran, völlig klar, sondern braucht 50 Jahre und mehr, und bei guter Pflege und mit etwas Fügung wird er Jahrhunderte überstehen. Auch Aktien sind im Idealfall eine Entscheidung für ein ganzes Leben (oder zumindest für viele Jahre), nicht anders als eine Ehe, die Zeugung eines Kindes oder das Anschaffen eines Hundes.
Einen guten, gelingenden Garten muss man nicht in jedem Frühjahr neu anlegen und gestalten. Einmal gepflanzt, wächst er von alleine, ohne dass es eines aktionistischen menschlichen Koordinators bedarf. Im Gegenteil: Es wäre sogar verheerend, alle zwei Monate den Garten neu zu ordnen. Wer sich ständig fragt, was er als Nächstes umpflügen sollte und was er Tolles neu säen könnte, dem mangelt es schlicht an Geduld, und er wird mit großer Wahrscheinlichkeit kein privates Refugium hinbekommen. Einen Garten als Beschäftigungstherapie zu sehen mag im Einzelfall Befriedigung verschaffen, aber Hyperaktivität ist der Schönheit des Gartens nicht förderlich. Kein Gärtner würde sein Grün von Grund auf alle zwei Monate neu gestalten und heute Rosen pflanzen, morgen Blumenkohl und nächste Woche versuchsweise eine Ananasstaude. Warum sollte man bei der Geldanlage derart hektisch und erratisch vorgehen?
Säen und Ernten – der Zinseszins
Jede Jahreszeit hat ihre Vorzüge, und es wäre ohne Sinn und Verstand, sich gegen diesen Zyklus der Natur stemmen zu wollen. Wer im November in Mitteleuropa Dahlien aussät, mag gute Absichten haben, wird aber weder sich selbst noch seinen Dahlien einen Gefallen tun. Freilanderdbeeren sind in unseren Gefilden vor Weihnachten nun einmal nicht zu ernten, ebenso wenig wie Spargel im September oder Birnen im März.
Auch die Finanzmärkte haben ihre Zyklen, nicht anders als die Natur. Wer sie missachtet, geht ein beträchtliches Risiko ein, oft ohne es zu merken. Es ist vergleichsweise einfach, Geld zu managen; die Kunst besteht darin, Risiko zu managen. Wer beispielsweise erst nach fünf oder mehr fulminanten Börsenjahren euphorisch auf den Zug aufspringt, ist wie ein Gärtner, der von März bis Juli auf der Couch lag und im Hochsommer endlich das Saatgut aus dem Keller holt, wenn er bemerkt hat, wie prächtig das Obst in den Gärten seiner Nachbarn steht. Es gibt eine Zeit des Säens, eine Zeit der Pflege, eine Zeit des Erntens. Wer zu spät kommt, den bestrafen die Zeitläufe.
Entscheidend für Anleger und Sparer ist der Zeitpunkt der Aussaat, der Beginn allen Wachstums. Wer möglichst früh zu sparen anfängt, hat die Zeit auf seiner Seite – für immer. Dies gilt umso mehr, wenn er möglichst früh möglichst viel Geld beiseitelegt. Dies liegt vor allem am Zinseszinseffekt, der »stärksten Kraft im Universum«, wie Albert Einstein es einmal ausgedrückt haben soll. In Tabelle 1 erkennt man dies beispielhaft. Wer heute Ersparnisse von 1000 Euro besitzt und sie zu 0,4 Prozent verzinsen lässt (was Anfang 2018 ungefähr der aktuellen Verzinsung auf besseren Tagesgeldkonten entsprach), der hat nach 30 Jahren 1127 Euro – und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit massiv Geld verloren, weil erstens die Inflation im langjährigen Durchschnitt deutlich über 0,4 Prozent im Jahr liegt und zweitens auf Kapitalerträge auch noch Steuern zu bezahlen sind. Wird sein Erspartes dagegen zu vier Prozent verzinst – eine Rendite, die mit vielen Aktien zurzeit mühelos schon über die Dividendenzahlungen realisierbar ist –, besitzt er nach 30 Jahren rechnerisch 3243 Euro. Auch an denen nagen Inflation und Kapitalertragsteuern, die hier nicht berücksichtigt sind. Aber das Vermögen hat sich in dieser sehr vereinfachten Rechnung nominal immerhin mehr als verdreifacht.
Tabelle 1: Oh, du schöner Zinseszins
Nach Jahren
bei 0,4 % Rendite p. a.
bei 4 % Rendite p. a.
bei 12 % Rendite p. a.
bei 12 % Rendite p. a.
bei 5 % Rendite p. a.
bei 12 % Rendite p. a.
zzgl. 1000 € Sparleistung p. a.
zzgl. 800 € Sparleistung im Monat
zgl. 800 € Sparleistung im Monat
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1
1.004
1.040
1.120
2.120
10.650
10.720
2
1.008
1.082
1.254
3.374
20.783
21.606
3
1.012
1.125
1.405
4.779
31.422
33.799
4
1.016
1.170
1.574
6.353
42.593
47.455
5
1.020
1.217
1.762
8.115
54.322
62.750
6
1.024
1.265
1.974
10.089
66.638
79.880
7
1.028
1.316
2.211
12.300
79.570
99.065
8
1.032
1.369
2.476
14.776
93.149
120.553
9
1.037
1.423
2.773
17.549
107.406
144.619
10
1.041
1.480
3.106
20.655
122.377
171.574
11
1.045
1.539
3.479
24.133
138.095
201.763
12
1.049
1.601
3.896
28.029
154.600
235.574
13
1.053
1.665
4.363
32.393
171.930
273.443
14
1.057
1.732
4.887
37.280
190.127
315.856
15
1.062
1.801
5.474
42.753
209.233
363.359
16
1.066
1.873
6.130
48.884
229.295
416.562
17
1.070
1.948
6.866
55.750
250.360
476.149
18
1.075
2.026
7.690
63.440
272.478
542.887
19
1.079
2.107
8.613
72.052
295.701
617.634
20
1.083
2.191
9.646
81.699
320.086
701.350
21
1.087
2.279
10.804
92.503
345.691
795.112
22
1.092
2.370
12.100
104.603
372.575
900.125
23
1.096
2.465
13.552
118.155
400.804
1.017.740
24
1.101
2.563
15.179
133.334
430.444
1.149.469
25
1.105
2.666
17.000
150.334
461.567
1.297.005
26
1.109
2.772
19.040
169.374
494.245
1.462.246
27
1.114
2.883
21.325
190.699
528.557
1.647.315
28
1.118
2.999
23.884
214.583
564.585
1.854.593
29
1.123
3.119
26.750
241.333
602.414
2.086.744
30
1.127
3.243
29.960
271.293
642.135
2.346.754
31
1.132
3.373
33.555
304.848
683.842
2.637.964
32
1.136
3.508
37.582
342.429
727.634
2.964.120
33
1.141
3.648
42.092
384.521
773.615
3.329.414
34
1.145
3.794
47.143
431.663
821.896
3.738.544
35
1.150
3.946
52.800
484.463
872.591
4.196.769
36
1.155
4.104
59.136
543.599
925.821
4.709.981
37
1.159
4.268
66.232
609.831
981.712
5.284.779
38
1.164
4.439
74.180
684.010
1.040.397
5.928.553
39
1.168
4.616
83.081
767.091
1.102.017
6.649.579
40
1.173
4.801
93.051
860.142
1.166.718
7.457.129
41
1.178
4.993
104.217
964.359
1.234.654
8.361.584
42
1.183
5.193
116.723
1.081.083
1.305.986
9.374.574
43
1.187
5.400
130.730
1.211.813
1.380.886
10.509.123
44
1.192
5.617
146.418
1.358.230
1.459.530
11.779.818
45
1.197
5.841
163.988
1.522.218
1.542.107
13.202.996
46
1.202
6.075
183.666
1.705.884
1.628.812
14.796.955
47
1.206
6.318
205.706
1.911.590
1.719.852
16.582.190
48
1.211
6.571
230.391
2.141.981
1.815.445
18.581.653
49
1.216
6.833
258.038
2.400.018
1.915.817
20.821.051
50
1.221
7.107
289.002
2.689.020
2.021.208
23.329.177
Nehmen wir eine Verzinsung von ambitionierten zwölf Prozent im Jahr an, wobei hier lediglich das phänomenal dynamische Prinzip des Zinseszinses verdeutlicht werden soll, sodass Inflation und Steuern rechnerisch unberücksichtigt bleiben. Natürlich schaffen die meisten Anleger eine Rendite von im Schnitt zwölf Prozent im Jahr auch nicht annähernd, einige aber doch – und sogar noch weit mehr. (Warren Buffett, Chef der US-Investmentholding Berkshire Hathaway10, hat seit 1965, als er die Leitung der damaligen Textilfirma übernahm, den Buchwert des Unternehmens beispielsweise im Schnitt um jährlich 19 Prozent gesteigert.11) In nur zehn Jahren sind bei dieser zwölfprozentigen Rendite aus 1000 Euro 3106 Euro geworden. Gar nicht so schlecht, sollte man meinen. Nach 30 Jahren ist der kleine Sparbetrag von 1000 Euro dann auf die beträchtliche Summe von 29960 Euro angewachsen – eine Verdreißigfachung also, und das mit einer einmaligen Sparleistung von anfangs 1000 Euro. Nach 50 Jahren – wer heute unter 30 oder selbst unter 40 ist, darf durchaus in solchen Zeitdimensionen denken – wäre er bei 289000 Euro angelangt.
Noch sensationeller wirkt sich der Zinseszins aus, wenn wir annehmen, dass unser Beispielsparer nicht nur einmalig 1000 Euro auf die Seite legt, sondern dies in jedem Kalenderjahr aufs Neue tut. (Eine Sparleistung von 1000 Euro im Jahr entspricht 83,33 Euro im Monat, also einer Summe, die für die meisten problemlos zu schaffen ist.) Sofern die Jahresrendite bei zwölf Prozent liegt, stehen nach zehn Jahren 20655 Euro zu Buche, nach 30 Jahren 271293 Euro und nach 50 Jahren knapp 2,7 Millionen. All dies wohlgemerkt bei einer Sparleistung von weniger als drei Euro am Tag. Hier zeigt sich beispielhaft, welch zentrale Rolle die Zeit bei der Geldanlage spielt und damit das Alter, in dem man damit anfängt. Als junger Mensch erreicht man mit wenig Sparen viel; als älterer erreicht man selbst mit hohen Sparraten oft nur noch wenig. So braucht auch ein herrlicher Garten Zeit und Geduld. Wer eines Tages im Schatten eines majestätischen Baumes sitzen und Tee trinken will, der tut gut daran, diesen Baum möglichst früh in seinem Leben zu pflanzen. Danach muss er, sofern keine Katastrophen passieren, vor allem Geduld aufbringen und abwarten. Die Natur erledigt freundlicherweise einen Großteil des Rests in Eigenregie.
ZEITLOSE GELDREGEL
Die Dynamik des Zinseszinses ist die entscheidende Schubkraft beim Vermögensaufbau. Im Lauf der Zeit wirkt der Zinseszinseffekt immer stärker. Deshalb: Fangen Sie möglichst früh an, sich um Ihr Geld zu kümmern.
Stürme und andere Katastrophen
Sicher: Weder in der Natur noch an den Finanzmärkten geht es so harmonisch und unaufgeregt zu wie in diesen hübschen Hochrechnungen. In Wirklichkeit wächst ein Vermögen nie mit entspannender Stetigkeit, sondern erratisch, mit steilen Aufs und hässlichen Abs. Die Realität ist um einiges dramatischer und anstrengender, als theoretische Zinseszinsrechnungen signalisieren.
Jeder Park, jeder Garten, jeder Balkon ist anfällig für schlechtes Wetter und den ewigen Zyklus der Jahreszeiten. Wer gärtnernd unterwegs ist, muss beim Bewirtschaften eine gewisse Umsicht walten lassen. Er sollte einen Blick auf die Wettervorhersage haben, auf nahende Gewitter, Hagelstürme, Hitzewellen, auf die Gefahr von Schnee, Eis und Dauerfrost. Droht Gefahr an der Wetterfront, sollte er seinen Garten sichern und ihn so weit als möglich sturm-, hitze- oder winterfest machen. Einen Apfelbaum kann (und sollte) man in der Regel nicht verpflanzen; der muss ein Unwetter, wenn es denn kommt, irgendwie aus eigener Kraft überstehen. Aber frostanfällige Pflanzen wie Geranien, Dahlien oder Oleander können untergestellt und die Beete geschützt werden, und während hochsommerlich heißer Wochen heißt es eben: gießen, gießen, gießen, manchmal mehr als einmal am Tag.
Ganz zu vermeiden sind Malheurs nicht. Kein Garten ist nur Quell der Lebensfreude, sondern er kann gefährlich, mitunter lebensgefährlich sein. »Jährlich zählt man in Deutschland zweihunderttausend Unfälle bei der Gartenarbeit«, meldete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vor einiger Zeit in ihrer Kolumne zum Thema, »und das sind nur die, von denen die Krankenkassen erfahren. Hinzu kommen unzählige Kratzer, Blessuren, blaue Flecken, Stich- und Schnittverletzungen, die kein Arzt zu Gesicht bekommt.«12 Es liegt in der Natur der Sache. Der Gärtner kann bei der Kirschernte von der Leiter fallen, die Finger in eine Maschine bekommen, sich beim Verbrennen von Laub eine Brandwunde oder Rauchvergiftung zuziehen oder von Insekten gestochen oder gebissen werden – und in anderen Klimazonen gar von Skorpionen und Giftschlangen tödlicher Art.
Hinzu kommen die natürlichen Feinde des Gärtners, die selbstverständlich ebenfalls Teil des großen Ganzen (und des Gartens) sind: Blattläuse, Mehltau, wucherndes Unkraut, saatpickende Vögel, Maulwürfe, Wildschweine, wühlende Hunde. Umsicht also, lautet die Devise bei der Gartenarbeit, »Augen auf!« und »safety first«.
Nicht anders beim Geld. Da jeder von uns es Tag für Tag benutzt, ist das Unfallpotenzial noch deutlich höher als im grünen Bereich. Unfälle passieren beim Sparen und Versichern und Anlegen. Doch während kein Gärtner aufhören würde, Rosen zu züchten, nur weil er sich an einem Dorn gepiekst hat oder er der Blattläuse nicht Herr wird, sind viele Geldanleger Sensibelchen: Einmal einen Unfall erlebt, einmal eine kostspielig-naive Fehlentscheidung getroffen, und sie kommen zu mehr oder weniger absurden Schlussfolgerungen wie zum Beispiel: »Aktien sind nichts für mich, ich hatte damals welche von der Telekom.« Oder: »Ich mache Festgeld, da kann ich wenigstens nichts verlieren.«
Solche Sätze sind aus übler Erfahrung geboren und nachvollziehbar, aber sie sind dennoch unsinnig und falsch. Wer in Sachen Finanzen einen Fehler gemacht hat (also Geld verloren), sollte nicht den Komplettrückzug antreten, sondern seine Fehlentscheidung kritisch untersuchen und daraus für die Zukunft lernen. Kein Geld ist so gut investiert wie Lehrgeld: Aus Schaden wird man idealerweise klug, auch und erst recht, wenn man ein sensationelles finanzielles Fiasko hingelegt hat. »Man erkauft sich seine Erfahrungen«, schrieb der amerikanische Entertainment-Pionier und schwerreiche Magnat Phineas Taylor Barnum, »idealerweise allerdings nicht zu einem zu hohen Preis.«13
Es geht ums große Ganze
Auf die Größe kommt es weder beim Garten noch beim Geld an, wie eingangs dieses Kapitels aufgezeigt. Wohl aber aufs große Ganze, auf die Gesamtperspektive. Entscheidend ist die Pracht des Gartens in seiner Gesamtheit, nicht die Herrlichkeit des einzelnen Grashalms – wobei jedes einzelne Gras oder Kraut selbstverständlich ein Quell der Freude sein kann. Buffett, einer der erfolgreichsten Anleger der vergangenen Jahrzehnte und heute mit 88 Jahren weiterhin Chef von Berkshire Hathaway mit Sitz in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska, hat dieses Prinzip für sein Unternehmen ähnlich beschrieben. »Auf das Wachstum des Berkshire-Waldes, darauf kommt es an. Es wäre idiotisch, wenn wir uns zu sehr auf einen einzelnen Baum konzentrieren würden.«14
Kapitel 2Reicht’s? Vom Glück und Unglück des Geldes
Das Glück des Menschen hängt nicht so sehr
von großen, seltenen Glücksfällen ab, sondern
von kleinen, alltäglichen Annehmlichkeiten.
– Benjamin Franklin15
Reich ist nicht, wer vieles hat, und schon gar nicht derjenige, der alles hat. Reichtum kommt von »reichen« im Sinne von »genug haben«, nicht von »im Überfluss leben«. Reichtum hat mit Genügsamkeit zu tun, nicht mit Dekadenz und Saus und Braus.
Sind Sie reich? Bin ich es, der Autor dieser Zeilen? Sind es Ihre Freunde, Kollegen, Nachbarn? Man sollte meinen, dass dies denkbar einfache Fragen sind, aber das stimmt nicht. Es gibt in Sachen Reichtum keine Objektivität, lediglich das subjektive Empfinden des Einzelnen, ein Bauchgefühl. Es kommt immer auf den Standpunkt und die Sichtweise an und damit nicht zuletzt auf das Umfeld und die Maßstäbe, die man bei der Bewertung materieller Lebensverhältnisse ansetzt. Eigentlich ist die Sache simpel: Reich ist man dann, wenn man sich so fühlt. Leider fühlen sich die meisten von uns aber nicht reich, selbst dann nicht, wenn sie es in den Augen der meisten anderen definitiv sind. Reich sind immer die anderen: diejenigen, die mehr als wir selbst haben oder jedenfalls zu haben scheinen. (Was übrigens auch für weitere gesellschaftliche Gruppen gilt: »Spießer« sind immer nur die anderen, »Touristen« auch … und so weiter.)
Viele Menschen verstünden überhaupt nicht, was Reichtum sei, schrieb der Buchautor Bodo Schäfer in seinem Bestseller Der Weg zur finanziellen Freiheit vor zwei Jahrzehnten, weil sie ein hohes Einkommen mit Reichtum gleichsetzten. Ein Missverständnis, meinte Schäfer zu Recht: »Gutes Geld zu verdienen bedeutet nicht Reichtum. In der Regel wird unser Lebensstandard mit unserem Einkommen wachsen. Wir ›brauchen‹ einfach mehr. Merkwürdigerweise brauchen wir immer genauso viel, wie wir verdienen.«16
Dennoch meinen viele, sie seien reich, wenn sie regelmäßig ein überdurchschnittliches Gehalt überwiesen bekommen. Keine Frage: Ein üppiges monatliches Einkommen, vielleicht ergänzt um eine schöne Bonuszahlung oder Tantiemen zum Jahresende, ist eine feine Sache und erleichtert die Anhäufung von Vermögen beträchtlich. Es ist allerdings nicht mit finanzieller Unabhängigkeit gleichzusetzen. Man kann ein spektakulär hohes monatliches Gehalt beziehen und von Monat zu Monat ärmer werden; man kann mit einem niedrigen Einkommen von Monat zu Monat reicher werden. Wer zur ersten Gruppe zählt, ist ein Tor. Wer zur zweiten gehört, macht etwas Wichtiges richtig.
Die einkommensbasierte Denkweise beruht auf einem Missverständnis: »Ich gebe ziemlich genau das aus, was monatlich reinkommt – warum auch nicht, im nächsten Monat kommt ja wieder frisches Geld aufs Konto!?« Diese Annahme, das Einkommen würde auch künftig fließen, ist angenehm und bequem. »Reichtum« bedeutet das nicht. Wer reich ist, ist materiell nicht (oder jedenfalls deutlich weniger) von seinem Arbeitseinkommen und seinem Arbeitgeber abhängig. Er erzielt Einkommen aus Vermögenswerten – und zwar genug, um davon zu leben. Die Einstellung eines wohlhabenden Menschen klingt eher so: »Ich gebe Geld für alles aus, was ich brauche, und der Rest des Geldes arbeitet für mich.«
Wenn selbst Arme reich sind
In Deutschland (und in vielen anderen Ländern) haben heute so gut wie alle, Arme wie Reiche, einen Lebensstandard, von dem vor weniger als 100 Jahren nicht einmal die Spitzen der Gesellschaft zu träumen wagten. Autos oder andere Transportmittel in jedem Haushalt. Fließend Wasser in allen Wohnungen. Fließend heißes Wasser auch noch. Sanitäre Anlagen. Waschmaschine. Geschirrspüler. Mikrowelle und E-Herd. Zentralheizung. Radio, Fernsehen, Internet, Smartphones. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Flug- und Fernreisen nicht ein Mal als Höhepunkt des Lebens, sondern regelmäßig, bei vielen mehrmals im Jahr – problemlos möglich, weil ein Großteil der Angestellten im Lauf von 52 Kalenderwochen sechs bezahlte Urlaubswochen hat. Eine medizinische Versorgung, die unsere Lebenserwartung drastisch erhöht und viele einstmals lebensgefährliche Erkrankungen zu kaum mehr als lästigen Belanglosigkeiten gemacht hat. Penizillin zum Beispiel ist erst seit den 1940er-Jahren verfügbar, davor starben Millionen Menschen an Entzündungen, mitunter nach kleinen oder kleinsten Verletzungen.
»Die Armen kommen in den Genuss dessen, was sich zuvor die Reichen nicht leisten konnten«, schrieb der amerikanische Unternehmer Andrew Carnegie, einer der wohlhabendsten Menschen seiner Zeit, im ausgehenden 19. Jahrhundert. »Was einst Luxus war, ist lebensnotwendig geworden. Der Tagelöhner genießt heute mehr Komfort als vor ein paar Generationen der Landwirt. Der Landwirt lebt in größerem Luxus als einst der Großgrundbesitzer, er kleidet sich besser, wohnt besser. Der Großgrundbesitzer hat kostbarere Bücher und Gemälde und lebt stilvoller als damals der König.«17 Das Phänomen, das der Industrielle und Philanthrop Carnegie bereits vor fünf Generationen beschrieb, ist bis heute nachvollziehbar. Dennoch steht im 21. Jahrhundert niemand von uns morgens auf und stellt zu Tagesbeginn erst einmal verzückt fest, dass es ihm in materieller Hinsicht besser geht als einst Wilhelm Zwo, Ludwig XIV., Jakob Fugger, den Medicis und dem Kaiser von China – dass seine modernen Lebensverhältnisse schlicht eine Wucht sind.
Viel wichtiger als absoluter Wohlstand ist der relative Wohlstand, also wie wir im Vergleich mit unserem Umfeld finanziell und materiell aufgestellt sind. Mitte der 1970er-Jahre sorgte dieses Phänomen als Easterlin-Paradox für Aufsehen, das sich so zusammenfassen lässt: »Innerhalb von Ländern sind vermögendere Menschen im Schnitt glücklicher als ärmere. Aber im Länder- und Zeitvergleich besteht allenfalls eine schwache Beziehung zwischen höheren Einkommen und Zufriedenheit.«18 Ein absolut hohes Einkommen macht nicht zwangsläufig zufrieden; ein relativ hohes aber schon.
Die Vermessung des Glücks
Zufriedenheit und das Mysterium menschlichen Glücks werden zunehmend zu einem Forschungsgebiet. Das ist insofern ungewöhnlich, als diese Kriterien mit mathematischer Genauigkeit kaum messbar zu sein scheinen. Das »Glück misst sich nie den Puls«, wie Adam Smith, ein wesentlicher Mitbegründer der klassischen Wirtschaftswissenschaften, im 18. Jahrhundert schrieb. Das Glück – subjektiv empfundenes Glück – ist nicht mittels Zählens des Pulsschlags oder des Aufaddierens von Währungseinheiten oder anderer Variablen zu ermitteln. Doch neue Ansätze der Quantifizierung liefern auf diesem Gebiet regelmäßig interessante Ergebnisse.
Die vor allem in den USA wirkende Ökonomin Carol Graham, eine der führenden Glücksforscherinnen der Welt, hat in ihren Schriften dargelegt, dass Reichtum sich in den seltensten Fällen auf Zufriedenheit reimt.19 Einfache Tagelöhner und Arbeiter in armen Ländern sind oft um einiges glücklicher als Millionäre in reichen Ländern – womit gemeint ist, dass sie sich glücklicher fühlen (worauf es in einem Menschenleben ankommt). Die Journalistin Amy Larocca von der amerikanischen Zeitschrift New York stellte in einem ausführlichen Bericht über die »Wellness-Epidemie« jüngst eine relevante Frage, die diese Diskrepanz aufgreift: »Warum fühlen sich so viele privilegierte Leute so krank?«20 Ihnen geht es nach objektiven Kriterien ausgesprochen gut, in materieller Hinsicht besser als fast allen ihren Zeitgenossen und Vorfahren. Glück und Wohlbefinden indes? Die sucht man vergeblich. Viele Reiche scheinen in einer Flut von Problemen und Problemchen zu schwimmen, die viele andere als Luxussorgen beschreiben würden, getreu dem Prinzip: Wer keine Sorgen hat, der macht sich eben welche. Viele Reiche sind leidend, auf hohem Niveau. Auch das sind natürlich echte, echt empfundene Leiden. Selbst Hans Christian Andersens märchenhafte Etepetete-Prinzessin auf der Erbse bildete sich ihre unbequeme Nachtruhe nicht ein, sondern war schlicht ein sensibles Geschöpf.
Der Realitätsverlust in dieser Gruppe der Wohlsituierten nimmt mitunter jedoch alberne Züge an. Eine Dame mit Vornamen »Emma«, Managerin des Butlerteams im altehrwürdigen, außerordentlich hochpreisigen Plaza Hotel am New Yorker Central Park, berichtete dem Nachrichtendienst Bloomberg vor Kurzem von den Unbilden, die manche Menschen schicksalhaft ertragen müssen. Emma wurde beispielsweise zu einem Gast des Hauses gerufen, einer Dame, die hemmungslos weinte, »als ob ihr Mann gestorben und sie gerade auf die Leiche gestoßen wäre«. Nicht schön, so was. Als Emma die Frau schließlich beruhigt hatte, stellte sich der wahre Anlass für die abgrundtiefe Traurigkeit heraus: In der Suite, die die Dame bewohnte, waren die Kleenextücher ausgegangen, und ihr Töchterlein hatte sich die Nase mit Toilettenpapier putzen müssen.21 Das ist natürlich tough, so was.
Der ägyptische Milliardär Naguib Sawiris, der sein Vermögen unter anderem mit Telekomunternehmen machte, wurde von der heutigen kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland einmal gefragt, wie viel Geld man so zum Leben brauche. Sawiris’ Antwort: »Um auch den Kleinkram abzudecken, das Flugzeug, das Boot, braucht man eine Milliarde [US-Dollar]. Ich will damit sagen, das ist meine Zahl für das Minimum, das ich beim Untergang brauche – falls ich denn untergehe.«22 Sawiris sprach also vom Existenzminimum.
Man weiß bei diesen zwei Beispielen nicht, ob man lachen oder weinen soll. Nicht immer ist die Grenze zwischen Luxus und Wahnsinn eindeutig. Aber auch dies sind, ob finanziell durchschnittlich aufgestellte Menschen das nun grotesk finden oder nicht, auf ihre Art legitime Lebenswirklichkeiten. Man gewöhnt sich an alles, auch an fast grenzenlosen Reichtum. Was Geld und Wohlstand angeht, gibt es viele verschiedene Realitäten.
Die Relativitätstheorie des Reichtums
Die Relativität des Reichtums kann einem die Freude an Wohlstand und Leben zutiefst vermasseln. Wer beispielsweise ein liquides Vermögen von 500000 Euro besitzt und nur mit Menschen zu tun hat, die deutlich weniger oder fast gar nichts haben, der wird sich zwangsläufig einigermaßen gesegnet und glückselig fühlen. Dieses Gefälle ist, wie zahlreiche Studien belegen, der entscheidende Faktor für unsere Selbsteinschätzung in Sachen happiness.
Wer hingegen eine halbe Million besitzt, aber in seinem Umfeld ausschließlich von Multimillionären umgeben ist, wird sich früher oder später lausig und klein fühlen, als Versager und armes Würstchen. Aufgrund solcher Relationen kann es sein, dass sich ein Dollar-Multimillionär in den USA, der in Manhattan oder im Silicon Valley lebt, in finanzieller Hinsicht ärmer fühlt als ein einfacher Crorepati in Indien. (Ein Crorepati, in Indien traditionell der stehende Begriff für einen schwerreichen Menschen, vergleichbar mit dem westlichen »Millionär«, besitzt zehn Millionen Rupien, umgerechnet etwa 130000 Euro.23) »Das subjektive Glücksgefühl jenseits von echter materieller Not [ist] ziemlich unabhängig […] vom objektiv erreichten Lebensstandard«, schrieb Thilo Sarrazin, ehemals Finanzsenator des Bundeslands Berlin und Exvorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. »Sehr wohl Einfluss auf das Wohlbefinden hat aber die relative Position in der Einkommenspyramide, und zwar nicht abstrakt, sondern in Bezug auf die eigene soziale Gruppe.«24
Dies gilt nicht nur im Hinblick auf den statischen Ist-Zustand, sondern noch mehr auf die dynamische Entwicklung im Lauf der Zeit. Man denke an eine Lebenslage, in der man selbst länger finanziell kaum von der Stelle kommt, Kollegen oder Freunde hingegen zügig vermögend zu werden scheinen (oder jedenfalls reicher als man selbst) und in finanzieller Hinsicht von dannen ziehen. »Nichts ist so verstörend für das eigene Wohlergehen und Urteilsvermögen, wie einen Freund reich werden zu sehen«, schrieben die Wirtschaftshistoriker Charles Kindleberger und Robert Aliber.25 Eigentlich sollte man sich als anständiger Mensch mit Freunden, Bekannten und Kollegen, die materiellen Erfolg haben, freuen, ihnen den Aufstieg von Herzen gönnen. Stattdessen steigt unanständigerweise Neid hoch: Warum die, warum nicht ich? Es lässt uns kalt, wenn US-Schauspielerinnen wie Angelina Jolie oder Kristen Stewart Gagen von zwölf oder gar 20 Millionen Dollar für einen Film bekommen, der in sechs Wochen im Kasten ist; das Einkommen eines Weltstars bleibt abstrakt. Es lässt uns jedoch überhaupt nicht kalt, wenn ein alter Klassenkamerad von uns eine Million im Jahr verdient, wir aber nicht. Die Allgemeinheit – also die Gesellschaft, in der wir leben, unsere Landsleute – ist uns in Sachen Geld weitgehend egal, und die Menschen in anderen Ländern sind es erst recht. Stattdessen neigen wir dazu, uns mit denjenigen in unserem Umfeld zu vergleichen, unseren Freunden und Verwandten, Kollegen, Nachbarn, der Peergroup. Menschen tendieren dazu, sich mit Freunden aus der eigenen Einkommens- und Vermögensschicht abzugeben. Stellen sie fest, dass sie plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, selbstverschuldet oder nicht, deutlich ärmer oder reicher sind als ihre Peergroup, werden sie weniger Lust verspüren, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das ist moralisch zweifelhaft, aber ein valider Erfahrungswert. Kommt ein Freund zu plötzlichem Reichtum, ist er möglicherweise bald nicht mehr unser Freund. Kommen wir selbst als Einziger zu plötzlichem Reichtum, orientieren wir uns unbewusst oft ebenfalls neu.
Insofern spielt nicht nur die Höhe unseres Vermögens beim subjektiv empfundenen Lebensglück eine Rolle, sondern eine Fülle weiterer Faktoren. Wie reich waren wir in der Vergangenheit? Wie vermögend sind die Menschen in unserem Umfeld? Wohin geht die Reise für uns und für die anderen? Wenn alle unsere Nachbarn zehn Millionen besitzen, wir aber nur ein einziges Milliönchen, können wir uns klein und armselig fühlen, auch wenn wir absolut wohlhabend und sogar Millionär sind.
Idiotisch natürlich. Aber so sind wir Menschen gestrickt.
Mythos Altersarmut
Der Begriff der Altersarmut, der seit Jahren häufig in Medien und in der öffentlichen Diskussion auftaucht26, ist irreführend, weil diese vermeintliche »Armut« ebenfalls relativer Natur ist. Natürlich sind viele ältere Menschen in unserer Gesellschaft nicht reich; aber viele Reiche sind relativ alt, wie Untersuchungen zeigen. »[D]ie wirtschaftliche Position der Rentner hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert«, schreibt die Süddeutsche Zeitung unter Bezugnahme auf eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft und diagnostiziert folglich keine Altersarmut, sondern das genaue Gegenteil: »Altersreichtum.« »In den 80er-Jahren befand sich noch jeder Dritte über 65 unter jenem Fünftel der Deutschen, die am wenigsten verdienen. Inzwischen trifft das auf weniger als 20 Prozent der Rentner zu […]. So nahm das Einkommen der 65- bis 74-Jährigen in Westdeutschland seit Mitte der 1980er-Jahre um 50 Prozent zu – real, also nach Abzug der Inflation. Dieser Anstieg war etwa doppelt so hoch wie der bei den Deutschen, die unter 45 Jahre alt sind.«27 Der als Zukunftsforscher bekannte Horst Opaschowski legte eine weitere Untersuchung vor, deren Ergebnisse von vielen Medien aufgegriffen wurden. Danach fühlen sich 51 Prozent der über 65-Jährigen »wohlhabend«, während lediglich 15 Prozent sich selbst am unteren Rand der Wohlstandsskala einordnen würden.28 Armut im Alter ist weiterhin für viele Menschen Realität, auch in Deutschland. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich ein Großteil der Senioren in finanzieller Hinsicht bestens aufgestellt sieht.
Überraschend ist dies nicht. Zum einen haben ältere Menschen im Idealfall ein Leben lang gespart und jahrzehntelang von der Dynamik des Zinseszinseffekts profitiert – zu einer Zeit, in der es noch so etwas wie Zinsen gab. Zum anderen setzt die Bundesrepublik Deutschland bei der gesetzlichen Altersversorgung seit Langem auf ein Umlageverfahren. Die relativ Jungen (die heute noch arbeiten und Rentenbeiträge abführen) zahlen für die relativ Alten (die im Ruhestand sind und Rente beziehen). Dieses System wird früher oder später an seine Grenzen kommen, wenn die Zahl der Jungen sinkt und gleichzeitig die der zu versorgenden Senioren steigt. Bis auf Weiteres sichert es Millionen Menschen im Altersruhestand jedoch erfolgreich ab. Vieles deutet darauf hin, dass »Altersarmut« ein in den Medien inflationär gebrauchtes Reizwort ist, während Begriffe wie »Jugendarmut« und »Generationengerechtigkeit« vernachlässigt erscheinen.
Zwei Wege zum Wohlstand
Vereinfacht gesagt, gibt es zwei Wege, die zum Reichtum führen. Der eine wird bequemerweise von anderen gebahnt. Den anderen, anstrengenderen muss man selbst finden und beschreiten. Kombinationen sind möglich und nicht untypisch in einem normalen Lebenslauf. Beide Pfade sind in der nicht allzu weit zurückliegenden Vergangenheit Thema von weltweit erfolgreichen, inspirierenden Büchern gewesen:
• Das mutmaßlich erfolgreichste Wirtschaftsbuch im (selbstverständlich noch jungen) 21. Jahrhundert trägt den ambitionierten Titel Das Kapital im 21. Jahrhundert, geschrieben vom Franzosen Thomas Piketty, ein publizistischer Überraschungserfolg. Dieser Bestseller ist für alle, die aus eigener Kraft eines Tages reich sein wollen, ein zutiefst ernüchterndes Werk. Der Königsweg zum Reichtum, so eine implizite Kernaussage Pikettys, geht über Erbschaft und Schenkung, über das Prinzip: Wer hat, dem wird gegeben. Da der Wohlstand der Familie, in die man geboren wird und die einen eines Tages mit Vermögenswerten und Erbschaften materiell versorgen kann, Glückssache ist, ist diese Route gen Reichtum kaum planbar. Wer in der Geburtslotterie ein Gewinnerlos zieht, hat einfach Glück gehabt, ohne etwas dafür geleistet zu haben.29 »Die global zunehmende Rolle von Erbschaften wird zweifellos ein wichtiger Aspekt im 21. Jahrhundert sein«, so Piketty.30 Schön für jene, die erben. Ein frustrierender Neidherd für alle, die es nicht tun.
• Einen anderen, nicht weniger überzeugenden Ansatz verfolgten die Amerikaner Thomas Stanley und William Danko in ihrem vor gut 20 Jahren erschienenen Buch Der Millionär gleich nebenan31. »Wie wird man vermögend?«, fragen die Autoren anfangs, um im Folgenden die Antwort zu geben: »Es ist selten Glück oder eine Erbschaft oder ein Hochschulabschluss oder auch nur Intelligenz, die Menschen beim Anhäufen von Vermögen helfen. Häufiger ist Reichtum die Folge eines Lebensstils, der sich durch harte Arbeit, Durchhaltevermögen, Planung und – am allerwichtigsten – Selbstdisziplin auszeichnet.«32
Zwei auf den ersten Blick grundverschiedene Ansätze, um die Bildung von Reichtum zu erklären, die sich zu widersprechen scheinen. Welcher ist der richtige?
Beide; jedenfalls ist keiner falsch.
Piketty hat in seinem Magnum opus wichtige Aspekte der gesellschaftlichen Vermögensdynamik im 21. Jahrhundert beschrieben, die in der Tendenz allesamt das klischeehafte Prinzip, wonach »die Reichen immer reicher werden«, bestätigen. Seine Studie, unterfüttert mit umfangreichem Zahlenmaterial und Statistiken33, stellt internationale Vergleiche an. Es sticht hervor, dass die von ihm aufgezeigte Dynamik in den USA besonders markant ist, also in einer Volkswirtschaft mit seit Jahrzehnten relativ niedrigen Spitzensätzen bei der Einkommensteuer und darüber hinaus einer niedrigen Besteuerung von Kapitaleinkommen. Für US-Topverdiener ist das Reicherwerden dank dieser fiskalischen Rahmenbedingungen ein geradezu unvermeidlicher Prozess. Geld macht Geld, und eine Generation reicht es an die nächste weiter.
Das sollte diejenigen, die nie geerbt haben und ziemlich genau wissen, dass sie dies auch niemals in nennenswertem Umfang tun werden, nicht frustrieren. Auch ihnen steht, wie Stanley und Danko aufzeigen, der Weg zum Vermögen offen, wenn sie ihn denn einschlagen wollen. Wer vernünftige Verhaltensweisen an den Tag legt, den richtigen Lebensstil wählt, hart arbeitet und diszipliniert wirtschaftet, wird auch ohne Glücksspiel und ererbtes Kapital reich werden. Es wird länger dauern, okay. Doch die Mehrung des Vermögens lässt sich, sofern man einige Grundregeln befolgt, schwer vermeiden.
Die Definition des Reichtums
Die meisten Deutschen, denen man die Frage »Sind Sie reich?« stellt, reagieren losgelöst von ihren wahren Lebensverhältnissen mit Zurückhaltung. Das gilt erst recht, wenn diese Leute nach gängigen Maßstäben sensationell reich sind, weil es mit zunehmendem Reichtum als immer schwieriger empfunden wird, offen darüber zu sprechen. Man fürchtet die Missgunst der Mitmenschheit. Eine typische Reaktion auf die Frage lautet, ebenfalls unabhängig von den realen Lebensumständen: »Danke, mir geht es gut, ich habe keine Sorgen – aber ›reich‹? Nein, das bin ich nicht.« Reich sind andere. Schließlich könnte man selbst, egal, wie viel man schon hat, noch so viel mehr besitzen. Es gibt immer Luft nach oben.
Die Bild-Zeitung, nach Auflage die größte Tageszeitung im deutschen Sprachraum, ging Mitte 2017 der Frage nach, »wann man eigentlich reich ist«. Grundlage dieses Berichts war eine Studie des in Nürnberg ansässigen Marktforschungsunternehmens GfK für die RWB Group, eine Anlagegesellschaft mit Schwerpunkt im Private-Equity-Segment.34