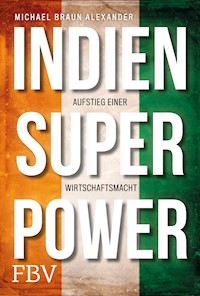
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In Kürze wird es mehr Einwohner zählen als jedes andere Land in der Geschichte: Indien. Allein im Metropolraum Delhi leben inzwischen mehr Menschen als in sämtlichen deutschen Großstädten zusammengenommen – und in einigen Jahrzehnten könnten es mehr als 50 Millionen sein. An den beiden Leitbörsen in Mumbai sind mehr Unternehmen notiert als in New York. Indiens IT-Sektor spielt weltweit eine Schlüsselrolle, selbst in Silicon Valley, dem Tempomacher unserer Epoche. Und nirgends wird mehr »Whisky« produziert (und getrunken) als südlich des Himalajas. Ein Land der Superlative – schon heute. Zugleich hat Indien ein Image-Problem. Trotz eines dynamischen, vor 30 Jahren eingeleiteten Wirtschaftsaufschwungs steht die größte Demokratie der Welt weiterhin im Schatten Chinas – und wird von Medien und Gesellschaft der »westlichen« Welt weitgehend ignoriert oder in grotesker Überzeichnung als Hort von Armut, Gewalt, Umweltzerstörung und religiösem Fanatismus wahrgenommen. In diesen Klischees steckt ein wahrer, relevanter Kern; sie decken aber nur einen winzigen Teil der Indien-Story im 21. Jahrhundert ab. Indien ist aktuell die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es wird in absehbarer Zeit den Status einer Superpower mit den USA und China teilen. Der Wirtschaftsjournalist Michael Braun Alexander zeichnet ein kritisch-konstruktives, facettenreiches, überraschendes und kurzweiliges Bild des aufstrebenden Milliardenvolks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Braun Alexander
INDIEN SUPERPOWER
Aufstieg einer Wirtschaftsmacht
Michael Braun Alexander
INDIEN SUPERPOWER
Aufstieg einer Wirtschaftsmacht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe, 1. Auflage 2020
© 2020 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Daniel Bussenius
Korrektorat: Matthias Höhne
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer, München
Umschlagabbildung: Shutterstock/Suto Norbert Zsolt
Satz: Bernadette Grohmann, Röser MEDIA GmbH
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-95972-136-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-245-2
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-246-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Über den Autor
Michael Braun Alexander, aus der Nähe von Hamburg stammend, ist Journalist und Schriftsteller. Er war unter anderem als Auslandskorrespondent in Mumbai und New York, als Kolumnist sowie als Chefredakteur eines der größten deutschen Wirtschaftsmagazine tätig. Indien Superpower: Aufstieg einer Wirtschaftsmacht ist sein zwölftes Buch.
Für Constanze von Wallenberg
Methodologies vary, but several calculations place humanity’s centre of gravity, the geographical midpoint of the world’s population, in or near the far north of India [...], and then I am reminded that I, like nearly everyone I know, am from the provinces, from the periphery of the map when the map is weighed by individual lives.
MARK VANHOENACKER1
It will be curious to see something of the India that is changing.
E. M. FORSTER2
Inhalt
Abkürzungen
Vorwort Ich war dann mal weg …
Kapitel 1 Indien, eine neue Wirtschaftsmacht
Kapitel 2Who’s perfect? Indiens Image
Kapitel 3 Von Kaschmir bis Kolkata und Kerala: das Land, ein Kontinent
Kapitel 4 Exkurs: eine Kurzgeschichte Indiens
Kapitel 5 Unabhängigkeit und Partition: der Subkontinent nach 1947
Kapitel 6 1991: die wirtschaftspolitische Wende – Indiens Neustart
Kapitel 7 Modifizierung und Modernisierung: Indien heute
Kapitel 8 Die Unternehmenslandschaft: Masse, Klasse, Schurken, Superstars
Kapitel 9 Indien im 21. Jahrhundert: ein Denkmal
Über den Autor
Hinweis zum Buch
Anmerkungen
Abbildungsnachweis
Abkürzungen
ILVKA: Indien ist ein Land vieler kurzweiliger Abkürzungen. Man begegnet ihnen überall: in den Medien, im Umgang mit Behörden und Unternehmen, auf Formularen, im Gespräch, im Internet. Wer zum ersten Mal eine indische Zeitung aufschlägt, sieht sich typischerweise einem kaum entzifferbaren und für Nicht-Eingeweihte nahezu unverständlichen Buchstabensalat gegenüber. Hier anekdotenhaft drei Schlagzeilen aus der Times of India, einer der größten englischsprachigen Tageszeitungen der Welt, aus dem Jahr 2018:
Bofors: ASGs urge SC to hear CBI’s plea with pending one3
PIL says MPs, MLAs must not practise law, SC seeks AG help4
Karti gets HC nod to travel abroad, ED arrests his CA5
Aha. Selbst des Englischen Kundige, die vielleicht regelmäßig souverän das Wall Street Journal, die Financial Times oder die Wochenzeitschrift The Economist lesen, können mit einem solchen Kürzeljargon nichts anfangen. Zum Auftakt dieses Buches daher eine Auswahl von Abkürzungen und geläufigen Ausdrücken, die in Indien in Politik, Wirtschaft und Publikationen häufig benutzt werden – und ab und an auch in diesem Buch:
AAP
Aam Aadmi Party (»Partei des einfachen Mannes«)
AITC
All India Trinamool Congress (führende Partei in Westbengalen)
AP
Andhra Pradesh (Bundesstaat im Südosten)
BEST
Brihanmumbai Electricity Supply and Transport (Stromversorger und ÖPNV-Betreiber in Mumbai)
BJP
Bharatiya Janata Party (»Indische Volkspartei«, Regierungspartei in Delhi)
BKC
Bandra Kurla Complex (Geschäftsviertel in Zentral-Mumbai)
BMC
Brihanmumbai Municipal Corporation (früher Bombay Municipal Corporation, Mumbais Stadtverwaltung)
BRI
Belt and Road Initiative (Chinas globaler Infrastrukturplan)
BSE
Bombay Stock Exchange (eine der beiden Börsen von Mumbai)
CBI
Central Bureau of Investigation (Indiens Bundespolizei, etwa vergleichbar mit dem amerikanischen FBI)
CCI
Competition Commission of India (Kartellbehörde)
CEC
Chief Election Commissioner (oberster Wahlleiter)
CIL
Coal India Limited (Bergbaukonzern)
CM
Chief Minister (Regierungschef eines Teilstaats, ungefähr mit dem Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslands vergleichbar)
CPEC
China-Pakistan Economic Corridor (wirtschaftliche Entwicklungszone)
CPI
Communist Party of India (nicht zu verwechseln mit der CPI (M))
CPI (M)
Communist Party of India – Marxist (marxistische Partei, nicht zu verwechseln mit der CPI)
Crore
zehn Millionen (ausgesprochen »kror«, geschrieben 1,00,00,000)
FDI
Foreign Direct Investment (Investitionen ausländischer Unternehmen in Indien)
FII
Foreign Institutional Investors (institutionelle Investoren aus dem Ausland, zum Beispiel Fonds- und andere Anlagegesellschaften)
FMCG
Fast-Moving Consumer Goods (Konsumgüter)
FRRO
Foreigners’ Regional Registration Office (Ausländerbehörde)
GDP
Gross Domestic Product (Bruttoinlandsprodukt)
GST
Goods and Services Tax (indische Mehrwert-/Umsatzsteuer seit 2017)
HDFC
Housing Development Finance Corporation, eine Hypothekenbank (HDFC) sowie eine der größten Privatbanken Indiens (HDFC Bank)
HPCL
Hindustan Petroleum Corporation Limited (Rohstoffkonzern)
HUL
Hindustan Unilever (Konsumgüterunternehmen, kontrolliert von Unilever)
IBC
Insolvency and Bankruptcy Code (Insolvenzrecht)
ICICI
ICICI Bank, benannt nach der Industrial Credit and Investment Corporation of India (große Privatbank)
ICS
Indian Civil Service
IIM
Indian Institutes of Management (Wirtschaftshochschulen)
IMF
International Monetary Fund (Internationaler Währungsfonds, IWF)
INC
Indian National Congress (Indischer Nationalkongress, führende Mitte-Links-Partei)
INR
Indische Rupie(n)
IOCL
Indian Oil Corporation Limited (Rohstoffkonzern)
IOR
Indian Ocean Region (der Indische Ozean im geopolitischen Sinne)
IRFC
Indian Railway Finance Corporation
ISI
Inter-Services Intelligence (pakistanischer Geheimdienst)
ISRO
Indian Space Research Organisation (Weltraumbehörde mit Hauptsitz in Bangalore)
IST
Indian Standard Time (Zeitzone)
ITC
India Tobacco Company, ursprünglich Imperial Tobacco Company (indischer Mischkonzern)
J&K
Jammu und Kaschmir (nördlicher Landesteil Indiens, politisch umstritten)
JLR
Jaguar Land Rover (zu Tata Motors gehörender Autokonzern mit britischen Wurzeln)
JN
Jawaharlal Nehru (erster Regierungschef der Republik Indien)
JNPT
Jawaharlal Nehru Port Terminal (bei Mumbai, Indiens wichtigster Seehafen)
JNU
Jawaharlal Nehru University (Hochschule in Neu-Delhi)
KYC
Know Your Customer (Leitprinzip bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen in Indien, bürokratisches Monster)
Lakh
100.000 (ausgesprochen »lack«, geschrieben 1,00,000)
LoC
Line of Control (De-facto-Grenzverlauf zwischen Indien und Pakistan in Kaschmir)
L&T
Larsen & Toubro (indischer Baukonzern)
LTCG
Long-Term Capital Gains (gebräuchlich als LTCG tax, Kapitalertragssteuer)
LTTE
Liberation Tigers of Tamil Eelam (tamilische Unabhängigkeitsbewegung)
MEA
Ministry of External Affairs (Außenministerium in Neu-Delhi)
MG
Mohandas »Mahatma« Gandhi
MoF
Ministry of Finance (Finanzministerium in Neu-Delhi)
MP
Madhya Pradesh (Bundesstaat »Zentralindien«)
NASSCOM
National Association of Software and Services Companies (IT-Branchenverband)
NBFC
Non-Banking Financial Company (bankenunabhängiger Finanzdienstleister, »Schattenbank«)
NCR
National Capital Region (die Hauptstadt Delhi und Umland, vgl. NCT)
NCT
National Capital Territory (Territorium der Hauptstadt Delhi, vgl. NCR)
NDA
National Democratic Alliance (Regierungskoalition unter Führung der BJP, vgl. UPA)
NHPS
National Health Protection Scheme (»Modicare«, staatliche Krankenversicherung)
NPA
Non-Performing Asset (Problemkredit)
NPCIL
Nuclear Power Corporation of India Limited (staatlicher Atomkonzern)
NRI
Non-resident Indian (im Ausland lebender Inder)
NSE
National Stock Exchange (die größere der beiden Börsen in Mumbai)
NYSE
New York Stock Exchange (Börse in New York)
OBC
»Other Backward Class« (»andere benachteiligte Gesellschaftsschicht«)
ONGC
Oil and Natural Gas Corporation (staatlich kontrolliertes Rohstoffunternehmen)
PM
Prime Minister (Premierminister, Ministerpräsident)
PNB
Punjab National Bank (große staatlich kontrollierte Bank mit Sitz in Delhi)
PSU
Public Sector Undertaking (staatlich kontrolliertes Unternehmen, oft börsennotiert)
Raj
die britische Kolonialherrschaft von 1858 bis 1947
RBI
Reserve Bank of India (Indiens Notenbank mit Hauptsitz in Mumbai)
RIL
Reliance Industries (Konglomerat in Mumbai)
RSS
Rashtriya Swayamsevak Sangh (»Nationale Freiwilligenorganisation«, hindunationalistische Jugendorganisation)
SAARC
South Asian Association for Regional Cooperation
SBI
State Bank of India (größte staatlich kontrollierte Bank in Indien)
SC
Scheduled Caste (gesellschaftlich benachteiligte Kaste)
SC
Supreme Court of India (Oberstes Gericht)
SEBI
Securities and Exchange Board of India (Börsenaufsicht)
ST
Scheduled Tribe (gesellschaftlich benachteiligte Volksgruppe, vgl. SC und OBC)
TCS
Tata Consultancy Services (führendes IT-Unternehmen)
TDP
Telugu Desam Party (Regionalpartei in Südostindien)
TGB
Tata Global Beverages (Getränkekonzern mit Sitz in Kolkata)
TRAI
Telecom Regulatory Authority of India (Telekom-Regulierungsbehörde)
UP
Uttar Pradesh (bevölkerungsreichster Bundesstaat, Nordindien, früher »United Provinces«)
UPA
United Progressive Alliance (Mitte-Links-Koalition in Neu-Delhi unter Führung der Kongresspartei, politischer Gegner der NDA)
UT
Union Territory (Bundesterritorium, direkt der Bundesregierung in Neu-Delhi unterstellt)
Oft sieht man in Indien auch das Kürzel PTO: please turn over, bitte umblättern.
VORWORT
Ich war dann mal weg …
... und zog Anfang 2014 nach Mumbai. Das wäre kaum der Rede wert, wenn sich nicht der eine oder andere fragen würde, wie es wohl dazu kam. Wieso zieht der einfach mal so nach Indien? Spinnt der?
Lassen wir Karl Lagerfeld zu Wort kommen. Der (wie ich) aus dem Hamburger Umland stammende Couturier war ein erfrischend meinungsstarker, eloquenter Mann. Er formulierte einmal die Maxime, wonach man sich in seinem Leben ab und an, so alle paar Jahre, neu erfinden müsse, ansonsten gehe es bald abwärts mit einem, nicht nur mit dem Äußerlichen, sondern vor allem, noch unangenehmer, in der inneren, oberen Abteilung. (Lagerfeld drückte sich anders und eleganter aus; in meiner Erinnerung war dies der Kern seines Bonmots.) Eine solche Veränderung bedeutet Risiko; sie ist lästig, unbequem; geht etwas schief, blamiert man sich. Aber bekanntlich gehen diejenigen das größte Risiko ein, die sich nie neu aufstellen, bei denen deshalb nie etwas schiefgehen kann, die ein Leben lang auf der Stelle treten und schleichend schlicht im Kopf werden, oft ohne es zu merken.
Also: Ich war Mitte 40, glücklich verpartnert, mit einem zutiefst befriedigenden Beruf. Ich hatte in Deutschland als selbstständiger Journalist und Buchautor mehr als genug zu tun (und konnte, nicht selbstverständlich, prima davon leben). Von der berüchtigten Mid-life-Crisis keine Spur. Und ich lebte seit mehr als zehn Jahren in Berlin, der übercoolen deutschen Hauptstadt, von deren Fabelhaftigkeit die ganze Welt seit Jahren geradezu besoffen ist.
Nur langweilte ich mich. Nicht jeden Tag. Aber immer öfter. Ein Ortswechsel und eine gezielte Horizonterweiterung schienen verlockend, um dem Leben eine Extradimension zu geben, eine Lagerfeld’sche Neuerfindung anzugehen. Und ich hatte glückliche Umstände, jenen Freiraum, den der Autor und Co-Berliner Wladimir Kaminer so beschrieb: »Die größte Freiheit ist die Möglichkeit abzuhauen.«6 Also haute ich ab.
Die wunderbare Leichtigkeit des Schreibens
Natürlich zog ich nicht nach Mumbai, um Ferien zu machen, mich zu erholen oder gar »mich selbst zu finden«. Praktischerweise liegt es in der Natur meines Berufs, des Schreibens, dass man ihn in aller Welt ausüben kann, sofern man einen Laptop und einen Internetzugang hat – also heute so gut wie überall. Hinzu kam, dass Journalismus und Medien seit der Jahrtausendwende einen dramatischen, sich stetig beschleunigenden Umbruch durchliefen, so wie andere Branchen auch. Der Siegeszug des Internets erschütterte die Geschäftsmodelle von Verlagen und Redaktionen, ließ Auflagen und Anzeigenerlöse, die ins Digitale abwanderten, sinken. Ein Stellenabbau war bei vielen die Folge, nicht einmalig, sondern immer wieder. Für angestellte Journalisten war dies hässlich – viele verloren ihre Jobs –, aber natürlich auch für selbstständige Autoren, die Freien. Sie stehen in der Hackordnung auf dem medialen Hühnerhof weit unten – seien wir ehrlich: ganz unten. Auch für hartgesottene Arbeitgeber ist es nicht so einfach, fest angestellte Mitarbeiter zu entlassen, und billig ist es auch nicht. Bei Freien ist das denkbar einfach; man ruft sie einfach nicht mehr an und senkt so die variablen Redaktionskosten. Insofern lässt sich bei ihnen besonders mühelos sparen, und es kostet keine Abfindung.
Nun ist Wandel nichts Neues. Man muss und sollte ihm in allen Lebenslagen, um nicht auf der Strecke zu bleiben, mit offenen Armen entgegengehen. Der Beruf des freiberuflichen Autors hat manche Nachteile. Man muss sich sein Geschäft erarbeiten, akquirieren, seine Kunden (also Redaktionen und Verlage) zufriedenstellen und bei Laune halten – und natürlich einen guten Job machen, und zwar jedes Mal wieder. Es gibt, klar, gewisse Abhängigkeiten und Sachzwänge. Zugleich lebt ein freier Publizist im Luxus: Er muss keinen Chef um Erlaubnis fragen, kann im Wesentlichen tun und lassen, was er will, sofern er sich eine gewisse Flexibilität bewahrt und seine Finanzen nicht aus den Augen verliert. Beispiel Indien: Um in Mumbai, Delhi oder sonst wo südlich des Himalajas als Journalist arbeiten zu können, braucht es erstaunlich wenig. Erstens: ein Flugticket, One-Way reicht, man will ja bleiben. Zweitens: ein Journalistenvisum (um 100 Euro, mehr dazu unten). Drittens: Laptop und Internetzugang. Das ist die Grundausstattung, und das ist auch schon alles. Zusammen nicht viel mehr als 1000 Euro, wobei zwei Drittel auf den Laptop entfallen, und den braucht man sowieso, unabhängig vom Arbeitsort.
Damit ist man, sofern man einen halbwegs funktionierenden Kopf mitbringt und schreiben kann, in Indien ein gefragter Mann. Denn eine Folge der Sparmaßnahmen in deutschen Verlagen ist die massive Ausdünnung des teuren internationalen Korrespondentennetzes, das praktisch jeder große Titel ungefähr bis Ende des 20. Jahrhunderts unterhielt. Vor dem Siegeszug des Internets konnten Verlagshäuser und seriöse Printtitel sich dieses Netzwerk leisten; danach wurde das Geld knapp und knapper. Heute ist es selbst bei Spitzentiteln durchaus üblich, Auslandskorrespondenten ein weites Feld beackern zu lassen. Man leistet sich beispielsweise, sinnvoll natürlich und für die Leserschaft ein Gewinn, einen Afrikakorrespondenten. Nun ist Afrika – in der Fläche Deutschland mal 85 – alles andere als klein, ein Kontinent eben. Praktisch bedeutet das, dass ein Afrikakorrespondent sein Büro in Nairobi, Johannesburg oder Kapstadt hat und von dort aus einen Erdteil mit mehr als 50 Staaten und zahllosen Kulturen und Sprachen abdeckt. Oder ein Verlagshaus beschäftigt einen Korrespondenten, der von Singapur aus über alles schreibt, was sich im geografischen Dreieck zwischen Pakistan, Mauritius und Australien an Berichtenswertem ereignet (also auch in Indien). Das ist selbstverständlich besser, als überhaupt keinen Korrespondenten im südlichen Asien zu haben, aber nicht optimal. Die Entfernung zwischen Singapur und Neu-Delhi (4150 Kilometer Luftlinie) entspricht ungefähr der zwischen Berlin und Timbuktu (4230 Kilometer), und die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlich-kulturellen Differenzen haben ähnliche Dimensionen. Man stelle sich vor, der einzige Europakorrespondent einer indischen Zeitung solle von Paris, Stockholm oder Rom aus den gesamten europäischen Kontinent mit seinen rund 50 Staaten abdecken: Island, die Kanaren, Weißrussland, Albanien und alles dazwischen. Das ist möglich, aber in der Praxis nicht einfach.
Der Niedergang des Korrespondententums birgt allerdings Chancen. Wer als Freier im Ausland Marktlücken sucht – in diesem Fall geografische Lücken –, wird fündig werden. Das gilt auch für Indien, das wie viele andere Erdteile und Länder in den Medien wenig Berücksichtigung findet und, falls doch, nur selten mithilfe fest angestellter Korrespondenten. Die deutschsprachigen Printjournalisten in Vollzeit, die neben den Vertretern der (subventionierten) öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten aktuell in Indien wirken, lassen sich an einer Hand abzählen. (Ehrlich gesagt fallen mir gerade – Stand: Ende 2019 – nur zwei ein.) Eine Marktlücke. Ich sprach bei Redaktionen vor, mit denen ich bis dahin zu tun gehabt hatte. Und siehe da: Ich rannte offene Türen ein.
Warum Indien, nicht China?
Nun ist die Landkarte, sofern man der deutschen Hauptstadt überdrüssig geworden ist, groß. Man könnte schließlich sonst wohin gehen. Warum ausgerechnet Indien?
Es lag zum einen an der Sprache. Ich kann zwar kein Hindi (oder Marathi, Bengalisch und so weiter), aber passables Englisch, weil ich in Großbritannien und in den USA gelebt habe und bei mir zu Hause seit nunmehr drei Jahrzehnten ohnehin Englisch gesprochen wird. Zum anderen bin ich dank meiner Ausbildung – englische Universität, Teilvolontariat in einem Londoner Korrespondentenbüro – eine Spur anglophil und mit der Geschichte des Empire vertrauter als etwa mit derjenigen Chinas. Drittens gab es in China, dessen globale politische und wirtschaftliche Bedeutung auch Redaktionen im deutschen Sprachraum erkannt hatten, Korrespondenten, die im Gegensatz zu mir Ahnung von China hatten und Mandarin beherrschten. Indien dagegen war journalistisch jahrzehntelang vernachlässigt worden, und über die dortige Unternehmenslandschaft und die Finanzmärkte wurde praktisch überhaupt nicht berichtet. Für einen Wirtschafts- und Börsenjournalisten wie mich eine ideale Ausgangsposition.
Es kam hinzu, dass ich das Land mehrmals besucht hatte und mit den Gegebenheiten einigermaßen vertraut war. Mein erster Aufenthalt hatte 2007 stattgefunden, Goa, insofern ein glücklicher Auftakt, als die Westküstenregion ein Urlaubsparadies ist, touristisch erschlossen und historisch interessant – also harmlos und benutzerfreundlich. In den folgenden Jahren reiste ich wiederholt nach Indien; es war nicht einmal geplant, sondern ergab sich einfach. 2010 kam ich zum ersten Mal nach Mumbai, das vier Jahre später für mich dann eine so wichtige Rolle spielen sollte.
Dennoch: Ich war, als ich im Februar 2014 meinen Koffer packte und nach Mumbai flog und zog, zwangsläufig unvorbereitet. Ich war zuversichtlich, keinen Kulturschock zu erleiden, aber natürlich war ich naiv. Wobei Naivität und Unbedarftheit manchmal hilfreich sind im Leben, damit man vor lauter Zaudern und Zögern nicht erstarrt, damit man ab und an den sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser wagt, die Neuerfindung à la Lagerfeld.
Prima Klima
Das Timing war selten bescheuert. Mein Leben als Expatriate in Mumbai begann mit einem Schock, nämlich einem Klimaschock. Wer im Februar an die indische Westküste zieht, wird feststellen, dass es vom ersten Augenblick an warm ist und von Tag zu Tag heißer. Brütender. Unerträglicher. Der indische Sommer währt etwa von April bis Juni. Er ist eine körperliche Strapaze, aber auch eine Herausforderung fürs Gemüt, weil die Hitze in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit auf Dauer mürbe macht. In E. M. Forsters Roman A Passage to India wendet sich sein Protagonist Aziz an die soeben (ungefähr im Februar) in Indien angekommene Mrs. Moore mit den Worten: »Please may I ask you a question now? Why do you come to India at this time of year, just as the cold weather is ending?«7 Tja. Gute Frage. Die alte, sympathische Dame wusste es offenbar nicht besser, das dumme Huhn. So ein dummes Huhn war ich auch.
Die von Tag zu Tag zunehmende Sommerhitze war allerdings horizonterweiternd. Sie führte zu einer Wiederentdeckung von Utensilien und Kleidungsstücken, die für mich bis dahin praktisch keine Rolle gespielt hatten, die ich für obsolet gehalten hatte. Wer dauerschwitzt, wird zum Beispiel schnell die Nützlichkeit eines Stofftaschentuchs wiederentdecken, das ja keineswegs nur zum Nasenputz dienen kann, sondern auch zum Aufmoppen überflüssigen Körperschweißes. Oder das gute alte Unterhemd – unendlich praktisch, weil es Nässe aufsaugt und ein Oberhemd auch bei Lufttemperaturen weit oberhalb der 30-Grad-Marke recht lange trocken hält.
Es dauerte außerdem nicht lange, bis ich praktisch immer, tagsüber und nachts, Ohrstöpsel in Griffweite hatte. Ja, Indien ist ein lautes Land. Nicht immer, aber oft. Und der Lärm ist unberechenbar. Es kann praktisch jederzeit und unerwartet ohrenbetäubend werden. Man hat es beispielsweise ans Gate in einem indischen Flughafenterminal geschafft und vertieft sich gerade in Buch oder Zeitung – und wenige Schritte hinter einem gehen drei Presslufthämmer los, weil just zu jenem Zeitpunkt irgendeine Baustelle in Betrieb genommen wird. Da ist der Straßenverkehr. Da sind Millionen Kinder mit ihren Düdeldümaschinen, inzwischen allgegenwärtig und typischerweise auf Maximallautstärke eingestellt, damit die Eltern wissen, wo ihre Kinder spielen. Da sind die Erwachsenen mit ihren Smartphones. Und zu allem Überfluss werden in Indien jährlich mehr als zehn Millionen Hochzeiten gefeiert,8 mit Pauken und Trompeten und Lebensfreude und viel, viel, viel Bäng, Bäng, Bäng nebst Getröte, stundenlang. Die meisten finden im Winter statt, etwa im Zeitraum November bis Februar, weil die Temperaturen dann angenehm sind und es in weiten Teilen des Landes kaum regnet, jeweils mit Hunderten oder auch Tausenden Gästen.
Und dann: Monsun, die Regenzeit. Um deren Bedeutung zu verstehen, muss man berücksichtigen, dass »es in Indien drei Jahreszeiten gibt, während andere Länder vier haben«, wie Babur, der erste Großmogul, notierte.9 Im Wetterzyklus von Mumbai »ist der Monsun das einzige Ereignis«, schreibt Suketu Mehta, Autor des 2004 veröffentlichten Bestsellers Maximum City.10 Wenn Sie so alt sind wie ich (oder etwas älter), erinnern Sie sich vielleicht an den Schlager Am Tag, als der Regenkam aus den späten 1950er-Jahren, komponiert von Gilbert Bécaud und gesungen von der in Ägypten geborenen Dalida. Noch heute erinnere ich den Text des Ohrwurms, der in meiner Kindheit oft im Radio gespielt wurde: »Am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heiß erfleht ...« Das ist kitschig, subtil schlüpfrig und hat außerdem nichts mit Indien zu tun, weil der Song eigentlich als musikalische Untermalung eines deutschen Fernsehkrimis diente. Egal. Der Text ist so unpassend nicht. »Doch eines Tags von Süden her, da zogen Wolken über das Meer ...« Ja. So ist es nun grad.
Der Tag, an dem der Regen kommt, liegt in Mumbai irgendwann im Juni, wenn Stadt und Land nach den langen Sommermonaten ausgedörrt sind.11 Wenn dann bei den ersten weichen, schweren Tropfen im Sand und auf den Straßen alles, Groß und Klein, innehält, auf die Straße läuft und in den Himmel blickt: beseelt von der Bestätigung, dass die Große Uhr unserer Existenz noch tickt, dass die Jahreszeiten ihrem Zyklus folgen wie seit Urzeiten; wenn im Großreinemachen Staub und Schmutz von Blättern und Palmwedeln und Dächern und Asphalt gewischt werden und ein bisschen auch aus unserem Gemüt; wenn überall, von einem Tag auf den anderen, Grün in tropischsaftiger Pracht ausbricht und man spürt und denkt: Hurra, wir leben!; und wenn es dann nach fünf Tagen eigentlich schon wieder reicht mit dem ganzen Nass, wenn alles flutet und zu schimmeln anfängt, wenn die Straßen zu Schlammpisten werden und die ältesten Bäume, wie sie das in jedem Jahr tun, umkippen ... – ach, es ist eine wunderbar existenzielle Erfahrung, dieser Tag, wenn der Regen kommt. Der Monsun erreichte Mumbai zweimal am 11. Juni, meinem Geburtstag, Geschenk des Himmels.
Die Sprache
Nicht weniger peinlich als der Zeitpunkt meiner Ankunft war die Sache mit der Sprache. Ich war natürlich offen für alles und mit beträchtlichem Lernwillen gesegnet. Als junger Mensch hatte ich das Glück gehabt, ziemlich viele Sprachen studieren zu können, darunter auch solche mit eigener Schrift wie Altgriechisch und Russisch. Insofern hatte ich, als ich nach Mumbai kam, das Großprojekt »Hindi« weit oben auf meiner To-do-Liste stehen und war guten Willens. Nur dass in Mumbai, mir war das beschämenderweise vorher nicht so wirklich klar gewesen, natürlich vor allem Marathi gesprochen wird – und daneben zwar Hindi, aber auch Englisch, Gujarati, Arabisch, Konkani und vieles anderes. Mit der Folge, dass ich das Hindiprojekt hintanstellte. (Erst später, als ich viel Zeit in Delhi verbrachte, ging es dann los.)
Es zeigte sich aber, dass Sprache – womit ich hier meine: wortbasierte Kommunikation – überschätzt wird. Wenn man einmal in Ruhe darüber nachdenkt, wird schnell klar, dass es einfach ist, mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren, ohne viele Worte zu machen. Blicke, Gesten, Mimik, Intonation – all das transportiert eine Fülle an Information, wobei dem headbobble, der hohen Kunst des Kopfschüttelns, in Indien besondere Bedeutung zukommt. Mit einem gekonnten head bobble kann man so gut wie alles »sagen« – ganz ohne etwas zu sagen. Um das geflügelte Wort des österreichischen Schriftstellers Karl Kraus zu zitieren: »In keiner Sprache kann man sich so schwer verständigen wie in der Sprache.« Stimmt. In Indien kann man im Großen und Ganzen prima und aufs Freundschaftlichste kommunizieren, ohne Worte zu machen. Mit Köpfchen.
Seniorentag
Noch eine neue Erfahrung: Ich war auf einmal ein alter Mann. In Deutschland mag man mit Mitte 40 im »mittleren« Lebensalter angekommen sein, jedenfalls bei halbwegs guter Gesundheit und der statistisch üblichen Lebenserwartung. Bei Männern sprechen manche gar euphemistisch vom »besten Alter«. In Indien dagegen war ich mit 45 auch nicht mehr annähernd im besten Alter, sondern alt. Und für viele: uralt, vergreist, so gut wie senil. Es war frappierend, als old man oder uncle bezeichnet zu werden. (Das uncle, wörtlich »Onkel«, bezeichnet einen älteren Mann, insbesondere für Kinder, aber nicht zwangsläufig einen Verwandten. Das feminine Pendant ist auntie, »Tantchen«.)
Das ist nur logisch. Die Hälfte der fast 1,4 Milliarden Inder ist noch keine Mitte 20, altersmäßig also weit entfernt von einem Mittvierziger oder noch Älteren. Auf dem Subkontinent gilt, ebenso wie in großen Teilen Afrikas: Wer jenseits Mitte 30 ist, gehört zum ältesten Drittel oder gar Viertel der Bevölkerung. Wer es bis nahe an die 50 geschafft hat, wird damit geradezu zu etwas Besonderem. Nicht zu einem Kuriosum natürlich, aber doch zu einem Wesen, das lange dabei ist und sich womöglich noch, du liebes bisschen, an Indira Gandhi erinnert – eine Figur aus weit entrückter Vorzeit.
Für jemanden aus dem westlichen Kulturkreis, in dem Jugendlichkeit als Ideal gilt, ist das gewöhnungsbedürftig und anfangs milde irritierend: wie jetzt, ich? Senior? Aber dann merkt man, dass diese Spontanalterung zugleich erfreulich und irgendwie liebreizend ist. In der indischen Gesellschaft gibt es bis heute – in Deutschland war es vor einem Jahrhundert kaum anders – einen Grundrespekt vor Altvorderen, vor dem Lebensalter an sich. Schließlich könnte es doch sein, dass die Älteren ab und an etwas Interessanteres oder gar Weiseres zu sagen haben als Neunzehnjährige, soeben erst den Irrungen und Wirrungen der Pubertät entkommen. Es gilt: Je reifer man wird, umso mehr wird man respektiert. Die ältesten Generationen sind keine Last, sondern eine Art lebendes Kulturgut. So ist es Brauch, und dieser traditionelle Ansatz, in weiten Teilen Asiens und Afrikas üblich, hat einen großen Vorzug. In Gesellschaften, die Jugendlichkeit favorisieren oder gar einem »Jugendwahn« huldigen, verlieren früher oder später zwangsläufig alle – aus dem einfachen Grund, dass nun einmal alle altern. In Gesellschaften, die das Alter respektieren, gewinnen dagegen zwangsläufig alle mit der Zeit, die nicht gegen sie arbeitet, sondern für sie. Ich persönlich ziehe den indischen Modus Vivendi dem westlichen vor.
Mein schönstes Erlebnis als alter Mann hatte ich in den dramatischen Wochen der Demonetisierung Ende 2016 (Kapitel 7: »Modifizierung und Modernisierung«). Ich hatte damals praktisch kein Bargeld, so wie die allermeisten Inder auch nicht. Es war der Höhepunkt des Durchwurschtelns in meinem Leben, und selbstverständlich hatte ich größtes Interesse daran, irgendwie an Cash zu kommen, nämlich an ein paar der neu gedruckten Rupien-Noten. (Die standen mir zu, weil ich in Indien gemeldet war und dort ein Konto führte.) Nur waren sämtliche Banken im Land wochenlang hoffnungslos überlaufen, und es war praktisch unmöglich, an Bares zu kommen.
Nach mehreren Wochen kam ich in meiner Nachbarschaft am Rande von Neu-Delhis Geschäftsviertel Connaught Place an einer Bank vorbei, einer Filiale der damaligen State Bank of Bikaner & Jaipur. (Bikaner und Jaipur sind zwei Städte im indischen Bundesstaat Rajasthan.) Im Vorbeigehen sah ich, dass die Niederlassung voller Kunden war, das Gedränge und Geschiebe aber deutlich weniger turbulent als in den Wochen zuvor. Ich ging also in die Bank und fragte am Informationsschalter nahe am Eingang eine junge Angestellte im Sari, was denn los sei, warum es so ungewöhnlich ruhig sei und ob ich möglicherweise Bargeld bekommen könnte, obgleich kein Kunde der Bank. Eine hoffnungslos blöde Frage, schien mir in dem Moment. Ich hatte nichts zu verlieren.
»Kommen Sie«, sagte die junge Frau zu meiner Überraschung, legte mir die Hand stützend in den Rücken und führte mich an ein Schreibpult vor den Schaltern. Dort ließ sie mich ein Formular mit meinen Daten ausfüllen. Wenige Sekunden später bekam ich am Schalter tatsächlich Bargeld ausgehändigt: zwei der neuen pinkfarbenen Banknoten à 2000 Rupien. Ich war sprachlos: ein Wunder. »It’s senior-citizens day«, sagte sie zur Erklärung, deswegen sei es so leer. Es war Seniorentag. Nur richtig alte Leute bekamen an diesem Tag Geld ausgezahlt.
Schöner wohnen
Natürlich brauchte ich in Mumbai ein Dach über dem Kopf. Irgendwie. Um mir den Einstieg zu erleichtern und mir drei Tage für die erste Orientierung und die Bewältigung des Jetlags zu geben – der Zeitunterschied zu Mitteleuropa beträgt während der Sommerzeit dreieinhalb, im Winter viereinhalb Stunden –, buchte ich mich in das Taj-Hotel am Gateway of India ein, das ich von einem früheren Besuch kannte. Das kostete mich um 150 Euro die Nacht und war luxuriös und angenehm. Der Swimmingpool im Hinterhof des Hotels (ursprünglich, vor mehr als 100 Jahren, die Zufahrt) ist einer meiner persönlichen Lieblingsorte weltweit. Aber natürlich konnte das auf Dauer nicht so weitergehen, aus finanziellen und praktischen Gründen. Einige Nächte logierte ich anschließend also ein paar Häuserblocks weiter im ziemlich heruntergekommenen Sea Palace Hotel, dessen Name rein symbolischer Natur war. Dort schrieb ich meinen ersten Zeitungsbericht aus Indien.
Es folgten fünf Wochen im traditionsreichen Royal Bombay Yacht Club in Colaba, einer anglophilen, elitären Veranstaltung. Ein Zufallstreffer und Glücksfall zugleich. Ich war zu jener Zeit Mitglied eines Universitätsclubs in London, der wiederum Partnerschaften mit anderen Clubs in aller Welt unterhielt, darunter aus historischen Gründen (das Empire) auch mit mehreren in Indien. So stellte mir der altehrwürdige Royal Bombay Yacht Club für mehr als einen Monat ein Zimmer zur Verfügung. Eigentlich war es eine Suite: um die 90 Quadratmeter in einem Obergeschoss, Fliesen auf dem Boden, knarzende Ventilatoren aus den 1940er-Jahren an der Decke, abgewohntes Mobiliar. Vor der breiten, hohen Fensterfront raschelten Palmwedel im Wind, darunter fuhren rote Stadtbusse und hupende Taxis, und dahinter lagen, ein Tipptopp-Ausblick, das Gateway of India und das Arabische Meer mit den bunten Fähren, die zur berühmten Tempelinsel Elephanta übersetzen. Über das Gateway, Mumbais Wahrzeichen, schrieb ein Autor der Frankfurter Allgemeinen jüngst, dass es »in der Millionenstadt Bombay [...] als Hintergrund für ein Selfie kaum zu übertreffen [ist]. Ein Motiv, das es mit der Freiheitsstatue in New York oder dem Eiffelturm in Paris aufnehmen kann.«12 Das ist übertrieben, weil das Gateway of India viel kleiner ist. Aber meine Unterkunft im ersten Monat in Mumbai war schlicht eine Sensation. Es war, als würde man als Inder nach Berlin ziehen, zum Auftakt wochenlang in einem historischen Baudenkmal wohnen und vom Fenster aus einen Traumblick aufs Brandenburger Tor haben. (Und das für wenig Geld, etwa 55 Euro die Nacht mit Frühstück.) Der Yacht Club hatte einen Diningroom, einen Fitnessraum, einen Garten, und gegen eine kleine Gebühr wurde die Wäsche gemacht – ein Kapitel in meinem Leben, das ich nicht missen möchte. Doch in den Anfangswochen im Club ging es natürlich nicht um Entspannung oder gar Urlaub. Ich hatte von Anfang an reichlich zu tun und musste gleichzeitig eine dauerhafte Bleibe finden, irgendwie irgendwo einen Mietvertrag bekommen. Und wer meint, dass Wohnen in Mumbai wenig kostet, weiß nicht, was Sache ist.
Richtig ist, dass in Indien aus europäischer Sicht vieles außerordentlich niedrigpreisig ist. Ein Beispiel sind die für mich aus beruflichen Gründen wichtigen Medienpublikationen – etwa Tageszeitungen, von denen ich normalerweise drei lese, sowie Zeitschriften und Bücher. Die Finanzzeitung Mint zum Beispiel, ein Pendant zu Handelsblatt oder Financial Times, kostete Anfang 2018 nur 6 Rupien, keine 10 Euro-cent. Für den Preis eines einzelnen Handelsblatts in Deutschland gab es also fast einen Monat lang Mint in Indien. Eine Rückfahrt vom Churchgate-Bahnhof in Süd-Mumbai nach Santacruz im Norden, unweit des Flughafens, dauert ungefähr eine Stunde im Vorortzug und kostete Anfang 2018 umgerechnet etwa 25 Cent. Eine Fahrt im gelb-schwarzen Rumpeltaxi von Colaba nach Fort, die Altstadt von Bombay, kostete 26 Rupien, 35 Cent (allerdings ohne Klimaanlage; dann war es etwas teurer). Für ein Prepaidtaxi (ebenfalls ohne A/C) vom Flughafen in Nord-Mumbai nach Colaba, eine etwa einstündige Fahrt, waren ungefähr 670 Rupien fällig, 8 Euro. 5 Rupien kostete ein Ei in Delhi, 12 Rupien ein vada pao, Mumbais vegetarischer Straßensnack, gewissermaßen die Currywurst der Stadt. Der Apotheker in Mumbai berechnete für 140 generische Aspirin-Tabletten, also no-names aus indischer Produktion, 43 Rupien. Ein einfacher Flug von Mumbai nach Delhi (knapp zwei Stunden) oder nach Kolkata (gut zwei Stunden) war mit etwas Akribie meist für umgerechnet 50 Euro zu haben – und mit Terrierhaftigkeit und Glück für deutlich weniger. So weit, so billig.
Zugleich ist vieles in Indien erstaunlich teuer, für Inder wie Europäer. Zum Beispiel Milch. In keinem Land der Welt gibt es mehr Kühe und Büffel; Indien ist der größte Milchproduzent weltweit.13 Doch ein Liter H-Milch von Amul,14 einer Molkereigenossenschaft aus Gujarat mit in fast ganz Indien allgegenwärtigen Produkten, kostete Anfang 2018 regulär 63 Rupien. Das waren damals 80 Cent. Milch war deutlich teurer als in Deutschland – nicht nur in der relativen Betrachtung (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Einkommensverhältnisse), sondern auch absolut.
Vor allem aber ist Wohnen kostspielig, insbesondere in Mumbai und Delhi. In beiden Städten sind die Mieten und Immobilienpreise in guten Wohngegenden mit jenen in Westeuropa vergleichbar. Oder sie liegen darüber. Schon 2004 schrieb Suketu Mehta: »Ich komme aus New York und bin in Bombay bettelarm. Der Standardsatz für eine nette Wohnung in jenem Teil von South Bombay, in dem ich aufwuchs, liegt bei 3000 Dollar im Monat – zuzüglich 200.000 Dollar Kaution, unverzinst und rückzahlbar in Rupien. Dies nachdem die Immobilienpreise um 40 Prozent gefallen sind.«15 Das ist übertrieben, und darüber, was eine »nette Wohnung« ist, gehen die Meinungen auseinander. Aber die Tendenz gibt es wieder. Spitzenlagen in Süd-Mumbai sind zum Beispiel Pedder Road, Altamount Road, Carmichael Road, Cuffe Parade und Malabar Hill. Mitte 2014 wechselte in Malabar Hill ein 50 Jahre altes Eigenheim für ungefähr 45 Millionen Euro den Besitzer. Es handelte sich, zugegeben, nicht um ein normales Einfamilienhaus, sondern um einen bungalowartigen Stadtpalast namens Meherangir mit 17 Zimmern, ungefähr 1600 Quadratmetern Wohnfläche und erstklassiger Provenienz. Hier wohnte einst der 1966 verstorbene Physiker Homi Bhabha, Spiritus Rector des indischen Atomprogramms und bis heute im ganzen Land bekannt und verehrt. Indes: der Quadratmeterpreis lag bei mehr als 28.000 Euro, trotz der ungeheuren Größe des Objekts. Wohnraum in Delhi ist etwas niedrigpreisiger als in Mumbai, was der Tatsache geschuldet ist, dass Delhi eine Flächenstadt ist, Mumbai dagegen eine Halbinsel, die kaum in die Breite wachsen kann. Allerdings erzielen auch frei stehende Bungalows in Neu-Delhi, wenn sie denn überhaupt auf den Markt kommen, Spitzenpreise.
Man konnte und kann in Mumbai für 20.000 oder 30.000 Rupien im Monat problemlos eine kleine, einfache Wohnung oder ein WGZimmer mieten, allerdings nicht in guter (also halbwegs zentraler) Lage. Typisch war zu jener Zeit – jedenfalls für viele berufstätige Ausländer – eine Größenordnung von 1 Lakh Rupien im Monat, 100.000 Rupien also, damals gut 1200 Euro. (Diplomaten residieren üblicherweise in Wohnungen, die ein Vielfaches kosten.) Der Haken war ein anderer. Aus Gründen, die sich meiner Logik entziehen, waren damals in Mumbai Elf-Monats-Mietverträge die Regel. Elf, nicht zwölf. Typischerweise waren bei Abschluss eines Vertrags sechs Monatsmieten im Voraus zu bezahlen. Hinzu kamen sechs Monatsmieten Kaution und die Courtage für den Makler, meist eine weitere Monatsmiete. In der Summe also ungefähr 20.000 Euro, zahlbar vorzugsweise in bar und ohne Rechnung oder Quittung. Erstens ist das eine Menge Geld für einen Mietvertrag. Zweitens bleibt offen, ob man die Kaution jemals wiedersieht – allein schon, weil jeder Vermieter weiß, dass sein Mieter Ausländer ist, in aller Wahrscheinlichkeit irgendwann in sein Heimatland zurückkehrt und mit den rechtlichen und sonstigen Gepflogenheiten in Maharashtra nicht vertraut ist. Mit anderen Worten: leichte Beute. Drittens stellt sich die Frage, wie man so einen Betrag, sofern man ihn überhaupt flüssig hat, nach Indien transferiert. Denn vor das indische Girokonto hat der indische Staat das Kontoeröffnungsverfahren gestellt, das in meinem Fall mehrere Monate dauern sollte – Monate, in denen ich irgendwo wohnen musste.
Am Ende des Prozesses landete ich mithilfe einer Maklerin in einer Dachgeschosswohnung in einem gut 100 Jahre alten, charmanten Stadthaus in Colaba. Im Sommer war sie außerordentlich heiß; im Monsun tropfte Wasser durch die Decke; Tauben gingen ein und aus (und starben verdächtig oft unter einem alten Tisch mit Marmorplatte, ein Mysterium). Aber es gab ein großes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein kleines Arbeitszimmer, eine Küche, zwei kleine Bäder (beide arg heruntergekommen) und eine Dachterrasse mit Blick über die Dächer der Südstadt. In etwa 400 Metern Entfernung ragte die Bombay-Gothic-Kuppel des Taj-Hotels in den Himmel, und im Osten, zwei Gehminuten entfernt, glitzerte das Arabische Meer, auf dem in diesiger Ferne Frachter den Hafen von Mumbai ansteuerten.
Ich zahlte lediglich eine Kaution in Höhe einer Monatsmiete (in bar, ohne Quittung – und bekam das Geld später wieder). Ich zahlte die Miete nicht für elf Monate im Voraus, sondern nur für einen. Und die Vermieter wurden meine besten Freunde in Indien.
Kurz: Es war fabelhaft.
Risiken und Nebenwirkungen
Der berüchtigte Delhi belly (Magen-Darm) ereilte mich ein einziges Mal, und zwar während eines Besuchs in Hyderabad mehrere Jahre vor meinem Umzug nach Mumbai. Nachdem ich inzwischen Tausende Liter Leitungswasser in Mumbai, Delhi, Kolkata und an vielen anderen Orten des Landes getrunken und so ziemlich alles gegessen habe, halte ich mich für einigermaßen alltagstauglich. Das Filtern von Leitungswasser ist in Indien in vielen Haushalten Standard. Es gibt dafür ein Extragerät, das neben dem Wasserhahn in der Küche fest in der Wand verankert ist. Für Kaffee, Tee und Mahlzeiten wird Wasser ohnehin abgekocht. Außerdem muss man pragmatisch sein. In Indien leben mehrere Hundert Millionen Kinder, von denen ein beträchtlicher Teil keinen Zugang zu sauberem Wasser hat – weder zum Trinken noch zum Waschen. Und wir Gäste aus dem Ausland sollen unsere Zähne, wie viele Reiseführer empfehlen, mit Mineralwasser putzen? Als Nächstes duschen wir dann in Delhi und Mumbai mit Evian oder San Pellegrino? Okay, jeder, wie er will.
Aber ist Indien nicht, wie ich oft gefragt werde, schrecklich unsicher und gefährlich? In meiner – natürlich subjektiven – Erfahrung nicht. Ich selbst habe mich in Mumbai, Delhi und anderenorts immer deutlich sicherer gefühlt als in Berlin (wo ich diese Zeilen schreibe), jedenfalls nach den Wochen der Eingewöhnung. Das hat nichts mit Polizeipräsenz oder einem besonders ausgeprägten Recht-und-Ordnung-Ansatz im öffentlichen Raum in Indien zu tun. Vielmehr sind fast überall Menschen, Hunderte, Tausende, Myriaden, Millionen. Angesichts der großen Bevölkerungszahl kann eine Gesellschaft in Megastädten überhaupt nur funktionieren, wenn fast jeder sich an Spielregeln hält, halbwegs gesittet und umgänglich auftritt und sich mit wachem Geist in der Öffentlichkeit bewegt (allein aufgrund der Verkehrssituation wäre Dösigkeit lebensgefährlich). Damit gehen Achtsamkeit und eine gewisse Grundverantwortung für andere einher. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, was passieren würde, wenn ich auf offener Straße in Mumbai oder in der U-Bahn in Delhi bedroht, ausgeraubt oder verprügelt werden würde ... du liebe Güte, der arme Mann! (Es würde sich typischerweise nicht um eine Frau handeln, auch wenn das im Prinzip nicht ausgeschlossen ist.) Überall sind Leute, aufmerksame Leute, und ich bin mir nicht sicher, dass ein Straßenräuber so einen Vorfall, der von anderen beobachtet wird, ohne Blessuren überstehen würde. Auch ein derart rabiates Vorgehen wäre natürlich problematisch, denn wäre für die Ahndung von Verbrechen nicht die Polizei zuständig ...? Richtig. Aber Aufmerksamkeit und die damit verbundene Zivilcourage anderer sorgen eben auch für ein Gefühl der Sicherheit in der Menge, sogar der Geborgenheit.
Kehre ich dagegen nach Berlin zurück, brauche ich in der Regel einige Tage, um mich in U- und S-Bahnen wieder einigermaßen sicher zu fühlen. Es gibt meines Erachtens in der deutschen Hauptstadt – wie auch in anderen Städten natürlich – eine derart große Zahl an Menschen, die in der Öffentlichkeit Alkohol trinken oder gar betrunken sind oder unter Drogen stehen, die unhöflich, aggressiv oder gewalttätig auftreten, dass ich mich wieder eingewöhnen muss. Was würde passieren, wenn mich in Deutschland ein Unbekannter in der U-Bahn anpöbelt oder angreift? Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir – anders als in Indien – nicht sicher, dass sich jemand dafür interessieren, mir helfen würde. Wie der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer einmal textete: Wie eine träge Herde Kühe schaun wir kurz auf und grasen dann gemütlich weiter.16 Das ist in Indien nicht der Fall. Die Zwischenmenschlichkeit funktioniert anders.
Das größte Risiko in Indien ist in meiner Wahrnehmung nicht die Kriminalität, sondern der Straßenverkehr. Grob geschätzt zählt Indien mindestens 400 Verkehrstote am Tag,17 17 in der Stunde, eine erschütternde Zahl – wobei angesichts der extrem großen Bevölkerung der Hinweis wichtig ist, dass der Verkehr in Ländern wie Thailand oder Vietnam im Verhältnis zur dortigen Einwohnerzahl noch weit tödlicher ist als in Indien.18 Ein Beispiel für die hochgefährliche Straßensituation ist der Yamuna-Expressway, die 2012 eröffnete Autobahn zwischen den Großstädten Delhi und Agra. Der Expressway ist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern befahrbar. Es handelt sich also um eine Schnellstraße, und hohes Tempo ist erstens für viele Autofahrer in Indien ungewohnt und zweitens vielen abgefahrenen Reifen und Altfahrzeugen eigentlich nicht zumutbar. Die Unfallgefahr ist immens. Allein 2017 kamen auf dieser kurzen Straße, keine 170 Kilometer lang, 164 Menschen bei Unfällen ums Leben, seit 2012 mehr als 700. Tausende weitere wurden verletzt.19 Um die Relationen zu verdeutlichen: Auf Indien entfällt ungefähr ein Sechstel der Menschheit. Weltweit kommen bei Auto- und anderen Verkehrsunfällen weit mehr als eine Million Personen im Jahr ums Leben. Indiens Anteil dürfte über dem Durchschnitt liegen, in einer Größenordnung zwischen 150.000 und 300.000.20 Allein die zahllosen Schlaglöcher auf Indiens Straßen sollen für mehr als 3000 Verkehrstote im Jahr verantwortlich sein.21
Menschliches, allzu Menschliches
Indien ist ein außergewöhnlich soziales, kommunikationsfreudiges Land. Man lebt inmitten von Menschen (und Tieren) in einem im Großen und Ganzen gut funktionierenden Sozialwesen; in einem Kosmos, den ich als »Fülle des Lebens« bezeichnen möchte. Selbst wenn es pathetisch anmutet: Genauso kam und kommt es mir vor, wenn ich indischen Boden betrete und eintauche in die Gesellschaft. »Ich fühle mich wie ein Schwamm, den man in einen Ozean zurückgeworfen hat, dessen Existenz er vergessen hatte.« So formulierte es E. M. Forster, der einst vom Maharadscha von Dewas in Zentralindien als eine Art Oberstaatssekretär engagiert wurde (»als Ministerpräsident oder irgend so was«22). Diese vor rund 100 Jahren beschriebene Gefühlsregung – das Wiederfinden etwas Verlorengegangenen, zutiefst Menschlichen – teile ich. Selbst Mumbai und Delhi sind trotz ihrer unüberschaubaren Dimensionen keine anonymen Großstädte für mich, sondern weniger anonym als Berlin, das nur rund ein Sechstel so viele Menschen zählt. Wenn ich nach einigen Monaten im Ausland in meine Wohnung in Charlottenburg zurückkehre, spricht mich keiner der Nachbarn an, obwohl ich zu vielen ein gutes, freundschaftliches Verhältnis habe. Sie haben meist überhaupt nicht bemerkt, dass ich mehrere Monate weg war. Schlage ich dagegen zum Winteranfang – ungefähr im November – in meinem »Kiez« in Mumbai oder Delhi auf, dann sind die ersten Stunden und Tage ein Spektakel. Es wird gegrüßt und getratscht und gelacht und Chai getrunken, mit Nachbarn und Freunden, Security-Männern, mit Taxifahrern, Krämern. Die Fülle des Lebens eben: das, was unsere in der größeren Ordnung der Dinge bedeutungslose, kurze Existenz als Mensch so wunderbar macht.
Diese Vertrautheit bringt eine gewisse Vertraulichkeit mit sich – bis hin zu Aufdringlichkeit. Alles, was man auf der Straße tut, wird wahrgenommen, erinnert, auf Abruf für die nächste passende Gelegenheit gespeichert. »Nichts ist privat in Indien«, wie Forster schrieb.23 Das gilt selbst im eigenen Haushalt, der in Indien keine Blase der Zurückgezogenheit darstellt, keinen Kokon, sondern der durchlässig ist, in dem stetes Kommen und Gehen herrscht. Wahrscheinlich wird es das halbe Viertel wissen, wenn man schmutzige Leibwäsche trägt, versehentlich einmal unhöflich ist, zu viel trinkt, zu fromm ist oder zu wenig. Das gilt andererseits auch, wenn man sich bemüht, ein halbwegs anständiger Mensch zu sein. Man hat schnell einen Ruf. So oder so.
Diese Durchlässigkeit hat ihren Grund. Ein wohlhabender Haushalt in Indien – das gilt a priori für jeden »europäischen« oder »westlichen« Haushalt – umfasst mehrere oder gar viele Personen, auch ein Single-Haushalt (ein im indischen Kontext milde absurder Begriff). Man hat helpers: »Personal« – ein Wort, bei dem viele Deutsche schaudern, weil es für sie elitär-dünkelhaft klingt und schlechte Assoziationen weckt. (Selbstverständlich war es auch in Deutschland vor wenig mehr als 100 Jahren in bürgerlichen Kreisen normal, Personal zu haben, zumindest eine Magd und oft, je nach Größe der Familie und des Hauses, ein halbes Dutzend Angestellte und mehr.) In gut situierten Familien in Indiens Städten gehört noch heute eine Köchin oder ein Koch zum Haushalt, entweder in fester Stellung oder als freie Kraft, die nach Bedarf aufschlägt. Es gibt Haushaltshilfen, die sich ausschließlich um das Reinemachen kümmern, also um Fegen, Wischen, Bäder, Dreck aller Art. Wer auf sich hält, hat einen Wagen (oder mehrere) sowie einen Fahrer (oder entsprechend mehrere) – wobei diese Herren sich nicht nur um das Fahren an sich kümmern, sondern auch um das Instandhalten, Waschen und Aufpassen aufs Auto. Wer einen Garten hat, braucht Gärtner. Andere wiederum sind für die Security zuständig. Um Wäsche und Bügelei kümmert sich ein Dhobiwalla (der »Wäschemann«) oder auch eine maid – oder aber man regelt es, sofern der Haushalt über eine Waschmaschine verfügt, noch wieder anders. Bei Bedarf werden Elektriker, sonstige Handwerker, Gaswallas oder Boten engagiert. Man beschäftigt einen Schneider für alles, was genäht oder geflickt werden muss. Und so weiter.
Mein eigener Haushalt in Mumbai war im Vergleich übersichtlich. Eine reifere Dame, V., kümmerte sich anfangs um Küche und Haushalt. Insbesondere der Einkauf war und ist in großen Teilen des Landes aufwendig, weil es bis heute nur wenige Supermärkte gibt. Das Einholen von Vorräten ist ein größeres Projekt, weil man für Obst hierhin muss und für Gemüse dorthin, für die Eier zum Eiermann, für ein Huhn zum Hühnerschlachter und für Fisch zum Fischmarkt, aber bitte frühmorgens, weil sonst der Fisch aufgrund der Hitze schlecht wird. Die Organisation von Verpflegung und Ernährung ist also nicht ganz so mühelos wie in einem städtischen bundesdeutschen Biomarkt, bei Aldi, Lidl oder Rewe. Ich hatte weder Auto noch Fahrer. Eine Putzhilfe, der Dhobi und Handwerker schauten je nach Bedarf vorbei. Im Haus waren allerdings praktisch immer die Herren von der Security präsent – keineswegs von mir engagiert, sondern von der Hausverwaltung und für das gesamte Gebäude zuständig, nicht nur für mein Einzelschicksal.
All dies klingt für manche Leser in Mitteleuropa sicher dekadent, großkotzig, unsympathisch. Auch ich empfand das so, bevor ich nach Indien zog. Wie abgehoben: eine eigene Köchin! Man stellt sich das vielleicht so vor, dass man à la Downton Abbey morgens ausgeschlafen im Pyjama im Bett liegt, bei einer Tasse Darjeeling, pochiertem Ei und einem Toast mit Butter und Marmelade über den anstehenden Tag sinniert und die Küchenchefin informiert, ob man des Abends Besuch erwartet und vorzugsweise Langusten oder Garnelen oder sonst etwas Köstliches zu speisen gedenkt, gefolgt vielleicht von einem herrlichen Hühnercurry mit allem Pipapo, französischem Camembert und zum Abschluss einer Bavaroise mit Walderdbeeren von den Bergwiesen des Himalajas – all dies mit korrespondierenden Weinen, passend gekühlt bitte. Um 20.30 Uhr dann.
Blödsinn natürlich. Wie vieles in Indien ist die Sache mit den helpers komplizierter und vielschichtiger, und das merkt und lernt man erst mit der Zeit, wenn man sich einigermaßen eingelebt hat und weiß, wo vorne und wo hinten ist. Der schottische Schriftsteller Alexander McCall Smith, im südlichen Afrika geboren, hat in einem seiner Romane die Befindlichkeiten treffend formuliert und die Moral des Phänomens erklärt. »Von absolut jedem, der in Botswana Arbeit hatte«, schreibt er, »wurde erwartet, dass er jemanden als Haushaltshilfe einstellt. Das hatte nichts Extravagantes an sich; es war mehr eine Form des Teilens. Wenn du eine Arbeit hattest, hattest du Geld, und Geld musste kursieren.«24 Das trifft es auch in Indien. Die Landesbevölkerung wächst täglich um mehr als 40.000 Menschen, und alle brauchen einen Job, ein Auskommen, etwas zu tun.
Was würde passieren, wenn ich selbst in Mumbai oder Delhi täglich meine Wohnung fegen, komplett selbst kochen und die Wäsche machen würde? (Was ich natürlich praktisch jeden Tag in gewissem Umfang tue, aber diskret, sodass es niemand groß mitbekommt.) Wenn ich also aus programmatischen Erwägungen weder maid noch Köchin noch Dhobi oder sonst irgendjemanden engagieren würde, wenn ich also aus Sicht vieler Deutscher, die heute ungefähr im »bürgerlichen« Milieu der Mittelschicht anzutreffen sind, anständig leben und niemanden »ausnutzen« würde? Eine Menge. Erstens würden es im Laufe kurzer Zeit alle Nachbarn, die es wissen wollten, wissen. Zweitens würde man mich für milde gestört halten – ungefähr so, wie wir in einer deutschen Großstadt einen Nachbarn einordnen würden, der sich auf dem Balkon ein Huhn hält, um die Kosten für das Frühstücksei zu sparen. Nicht verboten, so etwas (glaube ich); aber doch verhaltensauffällig. Drittens würden mich viele für entsetzlich geizig halten, weil sie sich mein Vorgehen anders gar nicht erklären könnten – schließlich gelte ich als Europäer als extrem reich (und bin es natürlich auch, allein schon, weil ich das Flugzeug nach Indien bezahlen konnte). Und viertens würden mich viele für unerträglich egoistisch halten. Die Denke ginge ungefähr so: »Da ist der Typ aus Deutschland jetzt schon wohlhabend und lebt allein in einer Riesenwohnung und spricht zig Sprachen und schreibt Zeitungsartikel und Bücher und reist ständig und trinkt sündhaft teuren Kaffee von Starbucks – und da muss er auch noch einem anderen, der nichts kann als Fegen oder Wäsche oder Aufpassen, die Arbeit wegnehmen und das Einkommen, das seine ganze Familie ernährt!?« Das ist aus meiner Sicht nachvollziehbar. When in Rome ..., wie die Rede geht.
Die Hilfe im Haushalt – wenngleich in meinem Fall in einem lockeren Arbeitsverhältnis, das wir in Deutschland Teilzeit nennen würden – hat Vorzüge, keine Frage. Der größte für mich: nicht jeden Tag stundenlang mit dem Einholen von Lebensmitteln zu tun zu haben, bei Hitze, bei Regen. Leider ist dies kein Freifahrtschein in ein Luxusleben jenseits aller Sorge, auch wenn dies auf Außenstehende auf den ersten Blick so wirkt. Die Sorgen und Probleme verschwinden keineswegs; sie verlagern sich. Die Dame V. beispielsweise, eine tolle Frau, hatte als Köchin einiges an Fähigkeiten (sie kochte Maharashtra-Cuisine). Ein schillerndes kulinarisches Talent war sie dann aber auch wieder nicht. Es machte mir Freude, sie in der Küche zu wissen, und wir wurschtelten uns beide irgendwie mit Händen und Füßen – ich kein Marathi, sie kein Englisch – durch und kriegten alles geregelt, und sie hatte ein Auge auf die Wohnung. Aber an das schöne Wort »Perle« mochte ich dann doch nicht denken, weil ihr Wirken zeitlich über zwei Stunden am Tag kaum hinausging und wir anschließend von OP-Hygieneverhältnissen definitiv weit entfernt waren. Oder der Wäschemann mit seinem dicken Filzer. Er kam regelmäßig vorbei, um die Wäsche zu holen; führte Buch über jedes einzelne Teil; brachte alles pünktlich, sauber, gebügelt und gefaltet zurück; war bei der Abrechnung ehrlich. Es passte alles. Um nichts durcheinanderzukriegen, hatte der Dhobi sich allerdings einen kleinen Trick überlegt: Er malte auf jedes meiner Kleidungsstücke mit einem nicht abwaschbaren schwarzen Marker einen Buchstaben, meist ein großes dickes »F« oder ein »T«, damit nichts durcheinandergeriet. Bis heute trage ich also Unterhosen, auf denen vorn über dem Eingriff auf der Außenseite gut lesbar »F« und »T« steht. Ebenso auf den Stofftaschentüchern. Auf den Handtüchern. Auf der Bettwäsche. Sagen wir mal so: Der wasserfeste Filzer war eine nicht so tolle Idee.
Kaputt
Things Fall Apart lautet der Titel eines Literaturklassikers des nigerianischen Autors Chinua Achebe.25 Ich habe in Indien oft an diese Worte gedacht. Alles scheint kaputtzugehen. Die unternehmerische Kühnheit, Papiertaschentücher in den Handel zu bringen, die sich beim Erstkontakt mit Flüssigkeit (Stirnschweiß, Erkältungsnase) in grauen Matsch verwandeln, muss man erst einmal aufbringen. Teebeutel, die sich in Wasser auflösen? Na ja. Küchen- und Toilettenpapier in Indien ist perforiert; doch es reißt entweder nirgends oder überall im Zickzack ab, aber nie da, wo es soll. Über das Öffnen von Joghurtund Dahi26-Bechern könnte man einen gar nicht so uninteressanten Roman schreiben. Die Minen so gut wie aller Bleistifte aus indischer Produktion, die ich gekauft und benutzt habe, zerbröseln bei Kontakt mit Papier oder anderen Oberflächen zu einer Art Grafitstaub und sind ähnlich problemlos anzuspitzen wie Radiergummis. Viele einfache Haushaltskerzen aus dem Laden werden bei 35 Grad, einer normalen Temperatur in Mumbai, weich und folgen den Gesetzen der Schwerkraft – so schnell, dass man ihnen fast dabei zusehen wollte, hätte man Geduld und Zeit. Glühbirnen brennen binnen Tagen durch. Kaugummi ist im indischen Sommer gefährlich, weil es schmilzt, wenn man es einfach irgendwo liegen lässt – also unausgepackt und ungekaut liegen lässt. Es wird zu einer extrem klebrigen Paste: eine Riesensauerei. Messer schneiden nicht und nichts; selbst eine Tomate wird von manch fabrikneuer Klinge zerdrückt, nicht geritzt. Flaschenöffner zerbrechen an Kronkorken. Eier werden noch immer großteils in Plastik- oder Papierbeuteln verkauft – entsprechend sieht es aus, wenn man nach Hause kommt. All dies wäre geradezu tragisch, wenn es nicht auch unterhaltsam wäre.
Ein spannender Sonderfall ist die Stromversorgung, eine mitunter kribbelige Angelegenheit. Da die indische Gesellschaft nationale Superlative mag, sei hier erwähnt, dass der größte Stromausfall der Geschichte sich in Indien ereignete, und zwar am 31. Juli 2012. (Um die 600 Millionen Menschen saßen im Dunkeln.) Das Elektrizitätsnetz wurde seitdem erheblich ausgebaut und verbessert. Während noch vor ein paar Jahren Stromausfälle an der Tagesordnung waren, selbst in der Hauptstadt Delhi (wenngleich nur für Sekunden oder allenfalls Minuten, jedenfalls in meinem zentral gelegenen Viertel), kommt dies heute deutlich seltener vor. Das gesamte Leitungs- und Kabelsystem ist allerdings weiterhin marode. Es gibt Milliarden Steckdosen und Stecker im Land, aber das eine passt überraschend selten ins andere, selbst wenn es an und für sich die richtige Gestalt hat (also kein ausländisches Modell ist). Mich hat immer wieder erstaunt, wie oft Stromkabel spontan zu brennen anfangen können – allein in meiner Wohnung passierte dies zweimal im Laufe eines Jahres: ein Kokeln und Schmelzen und Züngeln blauer Flammen und Funken. Was insbesondere während des Monsuns aufgrund der allgegenwärtigen Nässe unangenehm und riskant ist. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele Stromschläge der heftigen Sorte ich in Indien erlitten habe, insbesondere an Lichtschaltern und im Badezimmer. An einem erinnerungswürdigen Tag bekam ich mehrere Male Ganzkörperstromstöße unter der Dusche, die mich für mehrere Stunden in einen Zustand des Dauerzitterns überführten. (Keine bleibenden Schäden, soweit bekannt.)
Kafka in Indien: Behörden
Kaputt ist in vieler Hinsicht auch die indische Verwaltung: der Behördenapparat, der noch heute monströse Züge trägt. Auf dem Amt in Indien gelten Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit nicht als Standardtugenden. Zwei Beispiele aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz:
• Erstens: Mit einem gewissen Stolz kann ich berichten, dass ich in der Republik Indien erfolgreich meine Einkommensteuererklärung abgegeben habe. Dies war für mich ein bisschen eine ominöse Idée fixe, vor allem im Vorfeld, weil ich das Schlimmste befürchtete – nicht an ausstehenden Zahlungen, sondern an vertrackten Situationen. Es stellte sich heraus, dass die Angelegenheit dank der Hilfe eines patenten Steuerberaters und seines Teams eher unkompliziert war. Allerdings: Das indische Fiskaljahr beginnt am 1. April und endet am 31. März. Eine einzige Steuererklärung dort bringt also gleich zwei Steuererklärungen in Deutschland (die in meinem Fall weiterhin notwendig waren) durcheinander, und nicht zu knapp. Doch wer Steuern zahlen will – also muss –, der braucht ein Bankkonto, und vor die Eröffnung eines normalen, langweiligen Girokontos in Indien hat der Gott der kleinen Dinge KYC gestellt: know your customer. Dieses gesetzlich verankerte Prinzip gilt für Banken und verpflichtet sie, ihre Kunden (die customers) komplett und so weit als möglich zu durchleuchten. Bei mir dauerte die Kontoeröffnung alles in allem mehrere Monate. Der für mich zuständige Bankberater besuchte mich zur Vorbereitung der Kontoeröffnung mehrfach zu Hause; wir telefonierten viele Male; ein Stapel Formulare war auszufüllen. Es war eine Strapaze. Raghuram Rajan, der Ex-Gouverneur der indischen Zentralbank, hat KYC als eine »Straßensperre« bezeichnet, »selbst für etwas so Einfaches wie ein normales Sparkonto. [...] Heute verhindern stringente KYC-Normen den Zugang zu vieler Menschen zum Bankensystem und führen bei anderen unnötigerweise zu Schikanen.«27 Mir graut vor dem Gedanken, mein Bankkonto eines Tages auflösen zu müssen. Es dürfte ähnlich lange dauern. Wahrscheinlich werde ich es nie wieder los.
• Zweitens: Es liegt eine gewisse Tragik darin, in diesem Leben Spezialist für Indien-Visa werden zu müssen. Wer heute – also 2020 – als Besucher nach Indien reist, meist als Tourist oder geschäftlich, hat allerdings kaum Gelegenheit, die Abgründe indischen Verwaltungswahnsinns auszuloten. Urlauber bekommen in der Regel problemlos in wenigen Tagen ein E-Visum (eine Reiseerlaubnis), online zu beantragen und relativ niedrigpreisig – ein Prozedere, das so oder ähnlich auch andere Staaten eingeführt haben, etwa Sri Lanka.
Ausländische Journalisten fallen in eine eigene Kategorie. Sie sind »politisch«, und ihr Visumsverfahren ist bis heute von Schikane geprägt – und leider oftmals von bürokratischer Inkompetenz. Von mir verlangt die Republik Indien bis heute, schriftlich und mit umfangreicher Dokumentation für jede einzelne Einreise, einen Visumsantrag. Dieser Antrag erfordert mehrfaches persönliches Erscheinen bei den zuständigen Konsulareinrichtungen in Berlin. Das Journalistenvisum, das die Republik Indien dann erteilt, erlaubt in der Regel nur eine einmalige Einreise und ist nach Ausstellungsdatum (nicht ab Einreisedatum) drei Monate lang gültig. Ich könnte also zum Beispiel, wenn mir danach wäre, Indien verlassen, indem ich von Delhi oder Mumbai nach Kathmandu oder Bangkok fliege, müsste von dort aber nach Deutschland zurückkehren und in Berlin ein frisches Journalistenvisum beantragen, persönlich natürlich. Das Visum kostet bei jedem Durchgang alles in allem 100 bis 120 Euro (und natürlich Zeit und Nerven). Es wäre den indischen Behörden durchaus möglich, eine Mehrfacheinreise in den Pass eintragen zu lassen, vielleicht sogar, kühner Gedanke, ein Mehrjahresvisum. Sie tun dies aber nicht, aus programmatischen Gründen. Wie mir eine Berliner Mitarbeiterin des Konsulardiensts sagte: »Warum sollte Indien Sie gut behandeln? Sie [gemeint war der Berufsstand der Journalisten] schreiben schlecht über Indien – warum sollten die es Ihnen einfach machen!?« Dieses Missverständnis im Hinblick auf Medien ist auf dem Subkontinent weitverbreitet, 70 Jahre Demokratie hin oder her. Man kann sich als Journalist des Eindrucks nicht erwehren, dass die Repräsentanten der Republik Indien schreckliche Angst vor Journalisten haben, auf die sie mit Schikane, Verschleppung und übersteigertem Verwaltungsstarrsinn reagieren. Ich persönlich habe – teils beruflich, teils privat – Visumsverfahren mit den Behörden zahlreicher Staaten hinter mir, die nicht eben als geschmeidig gelten: China, die USA, Kongo-Brazzaville, Guinea, um einige zu nennen. Indien spielt, was den Formalitätenzirkus angeht, in einer eigenen Liga.
Je nachdem, wie lange sich ein Ausländer in Indien aufhält, ist – ergänzend zum Visum – eine offizielle Anmeldung auf dem indischen Ausländeramt innerhalb bestimmter Fristen erforderlich, dem Foreigners’ Regional Registration Office (FRRO). Niederlassungen des FRRO gibt es in Großstädten. In meiner Erfahrung handelt es sich beim FRRO für den Neuankömmling in Indien, unerfahren, nervös, vielleicht kulturgeschockt, um eine Kammer des Schreckens. Man weiß nicht, was passiert; warum es passiert; und vor allem: wann es passiert, ob rechtzeitig oder nicht. Denn auch diese indische Behörde ist nicht mit Überpünktlichkeit gesegnet, getreu dem Motto: »Warum sollte ich das heute schon erledigen, wenn Ihr Visum erst in fünf Tagen abläuft?«
Mein Partikularschicksal: Am Tag X lief um Mitternacht mein Journalistenvisum aus. Ich wäre von diesem Moment an also formal ohne Aufenthaltsrecht gewesen – eine unappetitliche Situation, wenn man mit der Rigidität der indischen Verwaltung vertraut ist. Für die Verlängerung war das FRRO in Mumbai zuständig, das ich anfangs – so macht man es in Deutschland – rechtzeitig und mehrfach kontaktierte, um die Modalitäten, das Prozedere und so weiter zu erfragen. Leider ohne Erfolg. Es lief darauf hinaus, am Vortag von X, meinem vorletzten rechtlich einwandfreien Tag im Land, mit allen erforderlichen Dokumenten im FRRO zu erscheinen, einige Stunden zu warten und Stempel und Zettel zu erhalten. Damit wäre alles wieder gut. Nur dass niemand weiß, ob die Papiere ausreichen, akzeptiert werden und man den Stempel auch kriegt. Falls nicht – oder falls man sich auf dem Weg zur FRRO den Knöchel verstaucht –, wird die Sache knifflig. Dann laufen Fristen ab und man wird illegal. Das ist dann blöd.
Während meines Besuchs beim FRRO in Mumbai erlitt eine Französin auf dem Stuhl neben mir in einem der Wartezimmer einen Nervenzusammenbruch. Es war nicht schön. Ungefähr 40 westlich aussehende Besucher saßen in Sicht- und Hörweite und kauten mit Pässen und Papieren in Griffweite ihre Fingernägel ab. (Wenn ich die Notlage der Touristin richtig verstand, befand sie sich auf der Rückreise von Kerala in ihr Heimatland, wahrscheinlich mit einer Maschine nach Paris. Auf dem Flughafen von Mumbai hatte man ihr aus formalen Gründen die Ausreise verweigert und sie aufgefordert, nach Kerala zurückzukehren, dort einen Stempel einzuholen, anschließend nach Mumbai zu kommen und dort ein weiteres Mal das Ausländerbüro aufzusuchen. So eine Komplikation ist nicht für jeden europäischen Touristen eine erbauliche Perspektive.) Für mich persönlich kann ich sagen, dass der Morgen, an dem ich zum ersten Mal am FRRO in Mumbai aufschlug, der unangenehmste von allen war. Das Problem ist nicht nur, dass die Verfahren dort kompliziert sind und zahllose beglaubigte Dokumente erfordern, sondern auch, dass schlicht sehr viel davon abhängt. Geht irgendetwas schief, hat man ein großes Problem und muss im Prinzip innerhalb von wenigen Stunden Indien verlassen.
Natürlich darf man an dieser Stelle nicht unterschlagen, dass es für indische Staatsbürger – selbst Touristen – in der Regel noch schwieriger, aufwendiger und kostspieliger ist, ein Visum oder Papiere für einen Aufenthaltstitel in Deutschland (und damit das Schengen-Gebiet) zu erhalten. Auch die Ausländerämter der Bundesrepublik Deutschland haben nicht den Ruf, Paradiesbehörden zu sein. EU-Bürger können relativ mühelos – nämlich ohne Visum oder per Visum bei Ankunft – mehr als 150 Länder bereisen, Inhaber eines indischen Passes nur 51.28





























