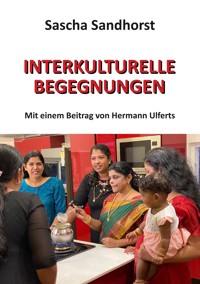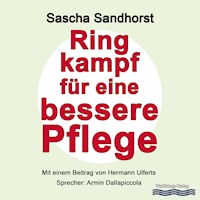5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Pflegeberuf ist einer der wichtigsten überhaupt. Pflegekräfte leisten in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie auch im ambulanten Bereich unschätzbare Dienste. Umso bedenklicher ist der schlechte Stand dieser Berufsgruppe hierzulande. Mangelnde Anerkennung, schlechte Bezahlung und schwierige Arbeitsbedingungen machen die Pflege unattraktiv, was nicht nur zu Nachwuchsproblemen führt, sondern sogar zunehmend Pflegekräfte in den Berufswechsel treibt. Sascha Sandhorst vermittelt in diesem Buch einen groben Überblick über die aktuelle Lage, die dringendsten Probleme und Lösungsansätze. Er möchte die Pflegekräfte dazu ermuntern, sich für die eigenen Interessen und die der gesamten Berufsgruppe einzusetzen, auch ehrenamtlich und politisch. Dazu berichtet er aus seinem eigenen politischen Engagement, unter anderem in der Pflegekammer Niedersachsen. Die Pflege muss für ihre Interessen selber eintreten, das wird gerade unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie wieder deutlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sascha Sandhorst
Ringkampf für eine bessere Pflege
Mit einem Beitrag von Hermann Ulferts
Copyright: © 2021 Sascha Sandhorst
Lektorat: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Umschlag & Satz: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-29351-9 (Paperback)
978-3-347-29352-6 (Hardcover)
978-3-347-29353-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort von Doris Ulferts
Prolog
Mangelnde Wertschätzung in der Pflege
Bewertung der Pflege aus Sicht verschiedener Marktteilnehmer..
Pflege während der Covid-19 Pandemie
Hermann Ulferts: Pflege erfolgreich leben
Lösungsansatz: Wie setze ich Verbesserungen in der Pflege um :
Meine Tätigkeit in der Pflegekammer Niedersachsen
Schachmatt in der Pflege
Wie muss eine gute Pflege für die Zukunft gestaltet werden?
Schlusswort
Vorwort von Doris Ulferts
Februar 2021
Ich kenne Sascha Sandhorst jetzt schon etliche Jahre. Als er noch in Ostfriesland wohnte, guckte er oft mit meinem Mann die Fußballbundesligaspiele und ich bekam immer ihre Diskussionen über die Pflege mit und über Wege, wie man sie verbessern könnte. Ich konnte auch mitreden, weil ich meine Schwiegereltern über Jahre gepflegt habe und drei Jahre in der ambulanten Pflege tätig war. Leider war das keine gute Erfahrung – der Zeitdruck, die schlechte Bezahlung, keine Zeit für die Betroffenen … ich konnte das zuletzt nicht mehr mit meinen Gewissen vereinbaren und habe gekündigt. Ich bewundere Saschas Ehrgeiz, seine Ausdauer und seine Hartnäckigkeit, immer bestrebt, die Pflege zu verbessern. Die Werte und die Würde der Menschen anzuerkennen, das ist sein Ziel.
Ringkampf für eine bessere Pflege ist mitten in der Pandemie aktuell wie nie. Darin beschreibt Sascha, wie er in der Pflege allen Widerständen und Niederlagen zu Trotz seinen Weg geht. Ich wünsche mir, dass dieses Buch dazu beiträgt die Pflege zu verbessern – für die Patienten, aber auch für die Pflegenden.
Dorothea Ulferts
Prolog
Mit diesem Buch möchte ich den Versuch starten, meinen Lesern und allen an der Pflege interessierten Personen – sowohl pflegenden Angehörigen und Betroffenen als auch den Pflegepersonen selbst – einen Einblick in das aktuelle Pflegegeschehen zu gewähren. Der Titel des Buches – Ringkampf für eine bessere Pflege – stellt schon recht deutlich heraus, dass im Traumberuf Pflege längst nicht alles in bester Ordnung ist und Verbesserungen, wie die zentralen Forderungen nach mehr Geld, mehr Personal und einer besseren Vereinbarung von Familie und Beruf, nicht ohne Weiteres zu bewältigen sind. Es bedeutet vielmehr die tagtägliche Auseinandersetzung mit den Problemen in der täglichen Pflegearbeit sowie das Ringen und den Einsatz für Verbesserungen. Im Vordergrund steht hierbei, dass die Pflege selbst erkennt, was für diesen Beruf wichtig ist: Was muss jetzt getan werden, damit der Pflegeberuf attraktiver wird, eine größere Anerkennung in unserer Gesellschaft erfährt und alle Pflegepersonen ihren Beruf wieder mit voller Leidenschaft und Hingabe ausfüllen können, sodass wir letztendlich alle etwas davon haben?
Ich bin überzeugt davon, dass sich eine gute Pflege und Betreuung am Betroffenen positiv im Hinblick auf die Anerkennung und Wertschätzung in unserer Gesellschaft auswirkt. Das lässt sich ganz einfach ausdrücken: Geht es der Pflegeperson gut, so geht es auch dem Bewohner bzw. dem Patienten gut. Im Kontext dieser Homogenität profitiert natürlich auch der Arbeitgeber. Es gilt die Frage zu beantworten, welche Initiativen erforderlich sind und an welcher Stelle ein Problem gezielt eingebracht werden kann, um eine Verbesserung der Situation in der Pflege und nicht zuletzt auch für die Pflegepersonen selbst zu erreichen. Mit dieser Frage beschäftige ich mich in diesem Buch intensiv, hauptsächlich mit der Prämisse, den Pflegepersonen einige Gedanken mit auf den Weg zu geben, die sie nutzen können, um ihre Ziele zu erreichen.
Vielleicht erinnern Sie sich gerade in diesem Augenblick an die eine oder andere Situation an Ihrem Arbeitsplatz, die Sie nicht zufriedenstellt, Sie belastet und Verbesserungspotenzial hat. Möglicherweise rumort es auch bei Ihnen und es beginnt genau in diesem Moment ein Ringkampf für eine bessere Pflege. Eine allgemein verbindliche Lösung kann es nicht geben.
Wer sich dazu entschlossen hat, sich für Verbesserungen im Pflegeberuf einzusetzen, und etwas bewirken möchte, dem spreche ich hiermit viel Mut zu und möchte dazu ermuntern, dies auch zu tun. Denn jeder Einsatz macht sich bezahlt, sei es für den betroffenen erkrankten Menschen, sei es für einen selbst oder für Kolleginnen und Kollegen. Natürlich warne ich gerade zu Anfang auch vor zu hohen Erwartungen, gerade was die übergeordneten pflegepolitischen Themen angeht. Das liegt zum einem darin begründet, dass viele Punkte, wie z. B. die Höhe der Bezahlung, die Personalbesetzung und die Arbeitszeitregelung, gesetzlich fest geregelt sind und erst mal aufgedröselt werden müssen, um eingreifen zu können.
Auf der anderen Seite kommt der überwiegende Anteil der Pflegepersonen, die ihren tagtäglichen Dienst in der Pflege am Bett verrichtet, nicht zuletzt auch aufgrund ihres breit gefächerten Aufgabenkatalogs gar nicht erst auf den Gedanken, sich mit Gesetzen und Gesetzesinitiativen auseinanderzusetzen, weil keine Zeitressourcen dafür vorhanden sind und weil sie auch zu weit vom tagtäglichen pflegepolitischen Geschehen in der Gesundheitsbranche entfernt sind. Die Auseinandersetzung mit der Pflegepolitik zählt eher nicht zur täglichen Arbeit einer Pflegeperson, denn zumeist ist das – selbst wenn sie es wollte – nach einem anstrengenden Schichtdienst gar nicht mehr möglich. Nach dem wohlverdienten Feierabend warten in der Regel erst mal die familiären Verpflichtungen – Partner und Kinder fordern ihre Rechte ein. – In der Pflege arbeiten mit rund 85 Prozent überwiegend Frauen. Gerade alleinerziehende Mütter (aber auch Männer) haben es im Hinblick auf die häufig wechselnden Schichtdienste und das unumgängliche Einspringen in der Pflege besonders schwer, Familie und Beruf in Einklang zu bringen: Den Tag zu meistern, ist an jeden Tag eine neue Herausforderung. Kann man es einer Pflegekraft verdenken, wenn sie sich aus diesen nicht für eine Verbesserung der Situation einsetzen kann und möchte, weil ihr hierzu ganz einfach Zeit, Kraft und Energie fehlen? Wohl nicht. Das gehört eigentlich mit zu den Dingen, die geändert werden müssen.
Als gelernter Altenpfleger mit insgesamt nun schon neunundzwanzigjähriger Berufserfahrung in der Alten- und Krankenpflege habe ich mich eines schönen Tages dazu entschlossen, mich für eine Verbesserung der Situation in der Pflege einzusetzen und starkzumachen. Anlass gab es genug. Mehrere Faktoren spielen hierbei eine Rolle: Zum einem war ich, wie ich es auch schon im Buch Altenpflege mit Herz detailliert beschrieben habe, selbst betroffen: Als Angestellter zweier Altenpflegeeinrichtungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten bin ich nach über zwanzigjähriger Tätigkeit in ein neues berufliches Umfeld, den Krankenpflegebereich gewechselt.
Über ein befristetes Arbeitsverhältnis hatte ich von 2014 bis 2018 in der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich und Norden als Altenpflegefachkraft gearbeitet und wurde in verschiedenen Bereichen eingesetzt, u. a. auf der geriatrischen Station am Standort Aurich sowie der Kardiologie- und Palliativstation am Standort Norden – mitten in einer lebhaften und bewegenden Zeit, in der das Projekt Zentralklinik Georgsheil stark vorangetrieben wurde.
Das Zentralklinikum im Ortsteil Georgsheil der Gemeinde Südbrookmerland im Landkreis Aurich, soll gebaut werden, weil die drei Krankenhäuser Aurich, Emden und Norden stark defizitär wirtschaften und eine Zentralklinik als Lösung betrachtet wird. Der Baubeginn ist für das Jahr 2023 anvisiert. Hierzu wurde die Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH gegründet. Im Jahr 2017 wurde dann ein erster Bürgerentscheid durchgeführt. Gegner des Zentralklinikums organisierten sich als Aktionsbündnis Klinikerhalt. Am 11. Juni 2017 fand die Abstimmung statt. In Emden sprachen sich 61,9 Prozent dafür aus, dass das Hans-Susemihl-Krankenhaus mit den derzeitigen Fachabteilungen sowie seinen medizinischen Versorgungszentren erhalten bleibt. Im Landkreis Aurich stimmten 54,4 Prozent gegen die Formulierung Sollen die bestehenden Ubbo-Emmius-Kliniken an den Standorten Aurich und Norden erhalten bleiben? Die Ablehnung in Emden reichte aus, um das Projekt zunächst zu verhindern.
Am Wahlabend habe ich an einem Treffen am Großen Meer teilgenommen, auf dem die aktuellen Auszählungsergebnisse live über einen Bildschirm bekannt gegeben wurden. An dieser Veranstaltung nahmen viele BefürworterInnen des Zentralklinikums, vor allem Angestellte der Ubbo-Emmius-Klinik teil. Hierzu zählten auch Vertreter der Trägergesellschaft, der Geschäftsführung, Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di … letztendlich waren alle zugegen, die sich sehr hart und aufopferungsvoll für den Bau des Zentralklinikums eingesetzt hatten. Die Enttäuschung über das Wahlergebnis aus Emden war sehr groß. Das Projekt Zentralklinikum hatte zu dieser Zeit bei vielen Bürgerinnen und Bürgern offensichtlich noch keine ausreichende Anerkennung und Zustimmung gefunden. Natürlich spielte das Thema auch im Arbeitsalltag der Mitarbeiter eine zentrale Rolle und war allgegenwärtig. Die Zukunft war zu diesem Zeitpunkt ungewiss und viele MitarbeiterInnen machten sich auch Sorgen darüber, wie es zukünftig mit der Krankenhauspolitik im Landkreis Aurich und in der Stadt Emden weitergehen würde. Letztendlich war die Sorge um die defizitäre finanzielle Lage groß und verstärkte sich zusätzlich dadurch, dass sich MitarbeiterInnen immer häufiger die Frage stellten, ob ihr Arbeitsplatz sicher war und ob es zu betriebsbedingten Kündigungen von Arbeitsverhältnissen kommen würde oder befristete Arbeitsverhältnisse nicht mehr verlängert würden. Die Sorgen der MitarbeiterInnen waren nach dem Abstimmungsergebnis ja nicht ganz unbegründet, denn im Rahmen der Umsetzung des Baus wurde ausgehandelt, dass die Einrichtungen in kommunaler Hand bleiben würden und die Kündigung von Arbeitsplatzverhältnissen über viele Jahre ausgeschlossen wäre. – Das war nun leider vom Tisch. Letztendlich war zu diesem Zeitpunkt aber schon abzusehen, dass das Ergebnis den Bau nicht verhindern konnte, sondern das Ganze nur verschoben wurde. In der Stadt Emden kam es dann am 26. Mai 2019 zu einem weiteren Bürgerentscheid, in dem sich 54 Prozent dafür aussprachen, dass Emden unter Beibehaltung einer Rund-umdie-Uhr-Notfallversorgung gemeinsam mit dem Landkreis Aurich eine neue kommunale Klinik im Raum Georgsheil bauen kann.
Das Projekt Zentralklinik nahm inzwischen einen großen Platz in meinem Tagesablauf ein, allein schon aus dem Grund, weil ich mich als Mitglied in der ver.di-Gruppe des Krankenhauses engagiert habe und im SPD-Ortsverein Norden und im Stadtverband Norden aktiv tätig war. In den Gesprächen ging es natürlich im Wesentlichen um eine gute Absicherung von tarifgebundenen Arbeitsplätzen und eine zukunftssichere medizinische Versorgung. Das Thema war inzwischen auch in der Politik sehr präsent. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass der Sprecher der Geschäftsführung der Klinik-Trägergesellschaft auf Einladung einen Vortrag in unserem SPD-Ortsverein in Norden zum geplanten Zentralklinikum gehalten hat. Im Rahmen des Sanierungskonzepts der defizitär wirtschaftenden Einrichtung wurden 22 auslaufende Mitarbeiterverträge nicht verlängert. Gerade in einer Zeit von Personalknappheit und der Tatsache, dass Pflegepersonal händeringend gesucht wurde, ist das eine Entscheidung gewesen, die auch in der Öffentlichkeit gar nicht gut aufgenommen wurde. Nach meinem genaueren Hinterfragen wurde die Entscheidung dann damit begründet, dass es Personalknappheit augenblicklich nur in spezifischen Bereichen wie Intensivpflege, Notfallversorgung, Kinderstationen und Hebammen gab.
Es lag mir besonders am Herzen, mich für eine hochwertige und zukunftssichere medizinische Versorgung in Ostfriesland einzusetzen. So begab ich mich für das Projekt Zentralklinikum auf Wahlkampftour und besuchte mehrere Pflegeeinrichtungen im Landkreis Aurich und auch die Insel Norderney, um für das Zentralklinikum zu werben. In meinen Vorträgen, an denen meistens 20–40 interessierte ZuhörerInnen teilnahmen, stellte ich dann die Vor- und Nachteile eines Neubaus heraus und kam letztendlich immer wieder zu dem Schluss, dass die Vorteile weitaus überwogen. Ich wurde überall sehr positiv aufgenommen und empfangen und habe festgestellt, dass die Einrichtungen gut vorbereitet waren: Die Wahl wurde angekündigt, Wahlmöglichkeiten geschaffen und Informationsschreiben zur Durchführung der Wahl verschickt. In vielen Gesprächen mit den HeimbewohnerInnen habe ich dann gemerkt, dass ein großes Interesse am Austausch zum Thema Zentralklinikum vorhanden war; der Informationsbedarf war noch nicht gedeckt. Viele ZuhörerInnen waren nicht umfänglich über die vielen Vorteile eines Zentralklinikums informiert und vor allem auch unsicher.
Die Unsicherheit aus Sorge um den Verlust der eigenen medizinischen Versorgung vor Ort verstärkte sich dadurch, dass in diesem Zusammenhang natürlich auch die Aktivisten für den Erhalt der drei Standorte in der Öffentlichkeit mobilisiert hatten und ebenfalls in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern getreten waren. Grundsätzlich lässt sich natürlich einfacher mit der Fragestellung argumentieren: Möchten Sie Ihr Krankenhaus vor Ort behalten? Im Dialog mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der einzelnen Pflegeeinrichtungen habe ich schnell gemerkt, dass die Akzeptanz eines Zentralklinikums nicht sehr groß war. Einige ältere Menschen waren darüber besorgt und befürchteten, dass sie für den Fall, dass die drei alten Standorte vor Ort wegfallen würden, längere Anfahrtswege in Kauf nehmen müssten: Wie komme ich zum Krankenhaus hin, wenn ich meine Angehörigen besuchen möchte, und wird es am neuen ländlicheren Standort überhaupt gute Busverbindungen geben? Ich kann die Sorgen der älteren und gebrechlichen Menschen sehr gut nachempfinden, wenn Mobilität und Fortbewegung eingeschränkt sind. Ein Bewohner gab zu bedenken, dass es zu lange Anfahrtswege mit dem Rettungswagen ins neue Krankenhaus geben würde. Einige Sorgen konnte ich in diesem Zusammenhang aber abmildern: Die Rettungswagen für die Notfallrettung sind heutzutage bezüglich ihrer medizinisch-technischen Ausrüstung hochmodern ausgestattet. Sie verfügen über alle Medikamente und Gerätschaften, zur Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen, bis zum Erreichen des Krankenhauses. Kleine Eingriffe können ebenfalls schon unterwegs durchgeführt werden. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Anfahrtszeiten können und müssen eingehalten werden. Schon während des Einsatzes auf dem Weg ins Krankenhaus, kann dort angerufen und erörtert werden, wo genau am besten hingefahren werden muss, um schnell zu behandeln. Das spart Zeit.
Ein Neubau war außerdem langfristig sowieso unausweichlich, denn schon allein wegen der gesetzlichen Auflagen und Anforderungen müssen die Krankenhausstrukturen in Deutschland zentralisiert werden, mit Schwerpunktbildung und Spezialisierung. Die Zahl der Krankenhäuser sinkt daher weiter. Das hat u. a. auch mit dem Krankenhausstrukturgesetz zu tun, das seit 2016 gilt und mit dem u. a. eine Überversorgung mit Krankenhäusern insbesondere in Ballungszentren abgebaut werden soll. Gerade die kleinen Krankenhäuser sind besonders betroffen: Abteilungen müssen schließen, da sie die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr erfüllen können. Das trifft zu, wenn z. B. in einer chirurgischen Abteilung, wo Knieoperationen durchgeführt werden, die vom Bund vorgegebenen gesetzlichen Mindestmengen von 50 Operationen pro Jahr nicht erreicht werden können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob ein kleines Krankenhaus es sich generell leisten kann, eine Notfalloperationsabteilung am Wochenende aufrecht zu erhalten, wenn z. B. gerade mal fünf Operationen im Monat durchgeführt werden. Operationsabteilungen in modernen und größeren Krankenhäusern sind heute meistens so organisiert, dass sie sich in langen Doppelschläuchen, wie in einem Steckbaukastensystem darstellen: Wenn eine Abteilung nicht ausgelastet ist, wird sie geschlossen und das vorhandene Personal gezielt auf andere Bereiche verteilt. Es gilt von vornherein zu vermeiden, dauerhaft große Verluste zu erwirtschaften.
Sicherlich ist auch der Ärztemangel im ländlichen Bereich ein Problem. Zum einem können die Ärzte vielfach nicht in einem kleinen Krankenhaus ausgebildet werden, da die gesetzlichen Anforderungen dort nicht erfüllt werden können, und zum anderen wandern die Ärzte in größere Krankenhäuser ab, um sich weiterzuentwickeln und sich zu spezialisieren. Wenn in einem Krankenhaus laufend Abteilungen schließen müssen, dann gibt es irgendwann auch ein Versorgungsrisiko durch die Qualitätsvorgaben und die Sicherung einer modernen Gesundheitsversorgung kann nicht mehr aufrecht erhalten werden. Letztendlich muss man sich dann mit der Frage auseinandersetzen, ob der Versorgungsauftrag des Krankenhauses überhaupt erfüllt werden kann.
Gerade in meiner reiferen Berufszeit und mit zunehmender Berufserfahrung, war es mir immer ein hohes Anliegen, mich über meine Berufstätigkeit als Pflegefachperson hinaus für andere Kolleginnen und Kollegen einzusetzen und mich zu engagieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich jeder Einsatz lohnt und irgendwann auch seine Früchte tragen wird – sei es in der beruflichen Arbeit oder bei sozialem Engagement im ehrenamtlichen Bereich wie z. B. einem Sportverein, der örtlichen Kirchengemeinde oder auch in Form einer guten Nachbarschaftshilfe. Die ehrenamtliche Arbeit ist ein Thema für sich und kann problemlos eigene Bücher füllen. Fakt ist, dass die Politik die ehrenamtliche Arbeit inzwischen als ein eigenes Tätigkeitsfeld ansieht und erkannt hat, dass viele soziale Einrichtungen ohne die zahlreich ehrenamtlich tätigen Menschen nicht aufrecht erhalten werden können. Der größte Anteil der pflegerischen Arbeit in Deutschland wird z. B. von Angehörigen geleistet und nicht von der professionellen Pflege. Die ehrenamtliche Arbeit genießt in der Öffentlichkeit zwar ein hohes Ansehen, jedoch wird sie – trotz vieler guter Initiativen in den Städten und Gemeinden wie Vergünstigungen zu den Eintritten in Freizeiteinrichtungen, Kinos und Schwimmbäder etc. – nicht ausreichend honoriert. Die Politik ist hier gefordert. Aus meiner Sicht müssen ehrenamtlich Tätige für ihre Arbeit gestaffelt und je nach Intensität ihres Einsatzes eine Anerkennung auf ihre Rentenanwartschaft erhalten. Hier muss noch viel getan werden. Zum internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2020 hat die SPD Niedersachsen auf facebook einen Beitrag gepostet, mit einer Danksagung an die vielen Menschen in Niedersachsen, die sich für den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft einsetzen. Aus dem Grund kündigte die SPD an, dass sie sich für die Stärkung des Ehrenamts einsetzen wolle. In einer eingerichteten Enquete-Kommission erarbeitet die SPD-Fraktion Niedersachsen gerade mit Expertinnen und Experten Maßnahmen, die das Ehrenamt stärken und schützen sollen. So sollen im Haushaltsjahr 2021 zur Stärkung des Ehrenamts, der Kultur und sozialer Einrichtungen 6,2 Millionen Euro eingeplant werden (SPD Niedersachsen, facebook; 05.12.2020).
Zeit meines Lebens habe ich mich ehrenamtlich engagiert. Bewusst habe ich meine ehrenamtliche Tätigkeit nicht ausschließlich und allein auf die Pflege am Bett ausgerichtet. Der Spaß daran stand für mich im Vordergrund. Ich habe mein ehrenamtliches Engagement vor allem auch als Abwechslung und Ausgleich zu meinem Beruf gesehen. Schon weit im Voraus und bis ins kleinste Detail habe ich geplant, für welche Tätigkeit und welches Projekt ich mich engagieren wollte. Welche Ziele sollten erreicht werden und welcher Nutzen sollte für die Allgemeinheit dabei herausspringen? Ich kann Ihnen bei dieser Gelegenheit nur wärmstens empfehlen, schon frühzeitig in Ihren Planungen genau festzulegen, mit welchen Zeitumfang Sie sich ehrenamtlich einbringen möchten. Klären Sie ab, ob sich Ihr Engagement mit Ihren sonstigen Verpflichtungen vereinbaren lässt. Geben Sie stets auf sich acht und lassen Sie nicht zu, dass Ihr soziales Engagement überhandnimmt. Ab und an wird es unerlässlich sein, auch mal Nein zu sagen, auch wenn es schwerfällt. Sie vermeiden damit Konflikte, zum Beispiel mit Ihrem Arbeitgeber. Ich halte es für sinnvoll, den Arbeitgeber frühzeitig über die geplante ehrenamtliche Tätigkeit zu informieren und ihn mit einzubeziehen. Meine Erfahrung ist, dass viele Arbeitgeber das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter sehr positiv aufnehmen, weil das auch zu einem Imagegewinn des Betriebes führen kann. Als lizenzierter Trainer (DFB- Fußballtrainer-B-Lizenz) und jahrelanger Fußballspieler war z. B. mein Interesse am Fußballsport sehr groß. So kam es dann dazu, dass ich ein Team für den Hallenfußball Supercup in Hage zusammengestellt und angemeldet habe. – Der Supercup ist in der Region ein jährliches Highlight. Das Fußballteam setzte sich aus Mitarbeitern der drei Krankenhäuser Aurich, Norden und Emden sowie den beiden Pflegeeinrichtungen Helenenstift Hage und Johann-Christian-Reil-Haus in Norden zusammen. Das Team spielte in der Gruppe der Betriebssportmannschaften mit und erreichte einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz. Gegen den späteren Turniersieger lagen wir bis zwei Minuten vor Spielschluss in Führung und kassierten dann aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit das entscheidende Ausgleichstor. Die Vizemeisterschaft wurde mit einem Pokal geehrt. Der ausgezeichnete Teamgeist der zusammengewürfelten Truppe übertrug die Freude und den Spaß am Fußball bis auf die Zuschauerränge. Das war ein guter Werbeeffekt für das Zentralklinikum in Georgsheil. Der geplante Neubau war zu dieser Zeit im Altkreis Norden wie gesagt nicht bei allen beliebt, da er mit der Auflösung des Krankenhauses in Norden verbunden war. Die Art und Weise sowie die Hingabe und mannschaftlicher Geschlossenheit, mit der das Team auf dem Hallenbodenparkett in ihren Spielen auftrat, zeigte jedoch deutlich, dass sich Mitarbeiter aus den drei verschiedenen Krankenhausstandorten gemeinsam für ein sportliches Ziel einsetzen und Erfolg haben konnten. Der Auftritt des Teams hatte tatsächlich eine nachhaltige Wirkung in der Öffentlichkeit. Das war sehr deutlich zu spüren und lag nicht zuletzt daran, dass das Team mit einigen Spielern besetzt war, die sich im Ort schon einen Namen erarbeitet hatten und bekannt waren.
Eine wunderbare Aktion meiner ehrenamtlichen Arbeit war auch die Ausrichtung eines Teenachmittags für SeniorInnen in der alten Teestube in der Westgaster Mühle in Norden. Das Treffen kam aufgrund einer Spendenaktion während meiner Buchvorstellung von Altenpflege mit Herz zustande. Die Gruppe setzte sich aus 27 SeniorInnen verschiedener Pflegeeinrichtungen und aus Privathaushalten im Altkreis Norden zusammen. Der damalige Gastgeber und Betreiber der Teestube, der 91-jährige Gerd Campen, verwöhnte uns mit seiner gut aufgelegten Helferin mit vielen Leckerbissen. Wiard Boomgaren sorgte mit einem speziellen Musikprogramm aus den 50er- und 60er-Jahren für musikalische Unterhaltung und brachte die SeniorInnen mit lustigen und humorvollen Anekdoten zum Lachen, Schunkeln und Mitsingen. Hermann Ulferts las eine plattdeutsche Kurzgeschichte vor.
Ich möchte meine Erfahrungen, die ich während meiner langjährigen Tätigkeit in den verschiedenen Bereichen der Pflege erworben habe, in die Öffentlichkeit transferieren. Es geht mir darum, andere Menschen am Pflegegeschehen teilhaben zu lassen, gerade auch, weil häufig in den ländlicheren Gegenden die Pflege immer noch ein Thema ist, über das öffentlich zu wenig gesprochen wird. Die Erkrankung Demenz ist z. B. immer noch Tabuthema. Inzwischen lässt sich aber feststellen, dass die Sorgen und Probleme in der Pflege auch in der Politik angekommen sind, worauf später noch genauer eingegangen wird. Ich hatte mich in diesem Zusammenhang jedenfalls dazu entschlossen, eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Demenzerkrankte Menschen benötigen Begleitung und Pflege im Forum der Kreisvolkshochschule Norden durchzuführen. Zu der Veranstaltung kamen rund 50 Gäste aus Pflege und Politik. Aufgrund der Konstellation und des Interesses beim Publikum, kam das Thema Pflegepolitik nicht zu kurz und es wurde gezielt angesprochen und erläutert, warum die jüngsten Pflegereformen wahrlich ein Kraftakt der Politik gewesen sind. Gerade das zweite Pflegestärkungsgesetz hat viele Neuerungen mit sich gebracht, wie den Pflegebedürftigkeitsbegriff, die Begutachtungsmethode durch den MDK sowie die Einstufung in fünf Pflegegrade statt der bisherigen Pflegestufen. Die These: Politik beeinflusst Pflege lässt sich anhand dieses Beispiels gut herausstellen.
Im Vordergrund des Abends stand die Auseinandersetzung mit der Frage, woran man die ersten Anzeichen von Demenz im häuslichen Umfeld erkennt und warum die Krankheit häufig zu lange verschwiegen wird, besonders im ländlichen Raum. Wie gehen wir offen damit um, wenn die Mutter zu Hause ihre eigene Wohnung nicht mehr erkennt, sich in dieser verlorenen fühlt und immer wieder zur selben Schublade läuft, diese öffnet und nach etwas sucht, was nicht da ist? Betroffene sind in diesem Zusammenhang in besonders großer Sorge und erhöhten Belastungen ausgesetzt. Viele Angehörige kommen in die Situation, die schwere Entscheidung zu treffen, Mutter oder Vater in die Aufsicht einer Pflegeeinrichtung abzugeben, und sind damit oft überfordert: Ist es noch zu früh? Gibt es Alternativen? Ist das dem Patienten überhaupt zumutbar? Die Entscheidung ist um einiges schwerer, wenn die erkrankte Person ihr häusliches Umfeld nicht verlassen möchte, was ja nachvollziehbar ist. Da gibt es natürlich keine pauschale Antwort, aber zur Orientierung: Wenn Mutter/Vater sich nicht mehr in der eigenen Küche zurechtfindet, sollte man sich Gedanken darüber machen, welche Form der Unterstützung und Hilfe geeignet ist und abgerufen werden kann, um das weitere Leben optimal einzurichten. Das muss nicht zwangsläufig gleich in einer Pflegeeinrichtung sein. In Deutschland gilt der Grundsatz: ambulant vor stationär. So ist es von der Politik gewünscht und die Gesetze und Reformvorhaben werden diesbezüglich auch so vorbereitet und in Kraft gesetzt.
Unser Gesundheitssystem ist längst nicht so schlecht, wie es häufig dargestellt wird. Viele Menschen wissen gar nicht, welche Leistungen über die Pflegeversicherung abgerufen werden können. Allein schon im Rahmen der Pflegestärkungsgesetze sind eine Reihe von Verbesserungen für demenzerkrankte Menschen und pflegende Angehörige mit wesentlich erhöhten Leistungsbeträgen umgesetzt worden. Beratung und Unterstützung zum Aufbau eines passenden Hilfeangebots und der Finanzierung gibt es an verschiedenen Stellen. Zum einen kann man sich hierzu natürlich direkt an die Anbieter vor Ort wenden, erste Anlaufstelle für eine Pflegeberatung sollten jedoch die Krankenkassen bzw. Pflegekassen sein. Des Weiteren können auch Beratungsgespräche mit den zuständigen Pflegestützpunkten vor Ort vereinbart werden. Sicherlich gibt es auch weitere Angebote und Beratungsstellen in den einzelnen Landkreisen und Städte, wie z. B. das sogenannte Seniorenservicebüro vor Ort.
Die Gäste ließen sich vom Thema der Veranstaltung inspirieren. Die bekannten Norder Musiker Wiard Boomgaren und Torsten Hevemeyer sorgten für Stimmung und musikalische Abwechslung. Musik und Demenz – das passt zusammen, denn über den Zugang Musik kann man demenzerkrankte Menschen häufig noch bis zum Schluss erreichen.
Hermann Ulferts, der seit dem Jahre 2006 berentete und langjährige Stationsleiter einer kommunalen Pflegeeinrichtung im Landkreis Aurich, las seine eigens geschriebene plattdeutsche Kurzgeschichte Uns Oll Bummert und erzählte aus seinem beruflichen Pflegealltag um 1973. Auf Hermann Ulferts können wir uns in diesem Buch ganz besonders freuen: Mit seinem Beitrag im Kapitel Pflege erfolgreich leben nimmt er die LeserInnen mit auf eine jahrzehntelange Reise und berichtet aus seinen Erlebnissen im Pflegealltag. Hermann Ulferts hat während seiner Berufstätigkeit nicht nach Schema F gepflegt, vielmehr hat er die Pflege in seinem Arbeitsumfeld mitgestaltet und entwickelt. Stets hat er die Sichtweise des Pflegebedürftigen in einem ganzheitlichen Ansatz mit eingeführt und den Menschen als Individuum gesehen. Hermann Ulferts brachte den Pflegebedürftigen und jedem Einzelnen seiner Mitarbeiter ein hohes Maß an menschlicher Wertschätzung entgegen und führte seine Stationen auf vorbildlicher Art und Weise, so wie man es sich als Bewohner, Patient oder Mitarbeiter nicht besser wünschen kann. Hermann Ulferts war seiner Zeit immer einen Schritt voraus.
Eine besondere Bedeutung kommt der Pflege während der Covid-19-Pandemie zu. Ich selbst bin seit März 2020 auf einer Isolierstation beschäftigt, auf der Covid-19-Patienten liebevoll gepflegt, betreut und begleitet werden, und bin den Patienten dort ganz nah.