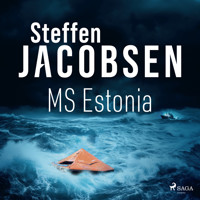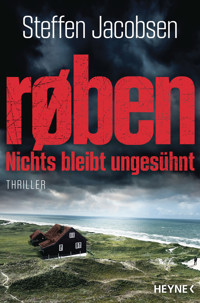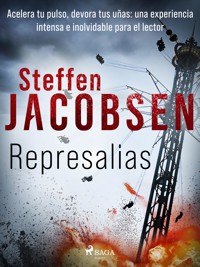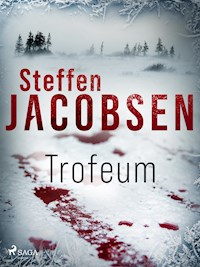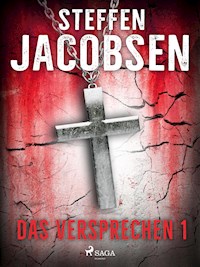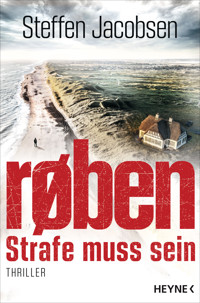
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Jakob Nordsted und Tanya Nielsen
- Sprache: Deutsch
Der erste Fall für Jakob Nordsted und Tanya Nielsen
Kriminalinspektor Jakob Nordsted wird in der dänischen Hafenstadt Holbæk mit zwei ungewöhnlichen Mordfällen konfrontiert. Beide wurden direkt hintereinander verübt, Vorgehen und Mordwaffen sind völlig unterschiedlich. Er weiß, dass die beiden Fälle zusammenhängen, das sagt dem erfahrenen Militärmann sein Gespür. Ihm zur Seite gestellt wird die junge Tanya Nielsen. Der raue Nordsted ist zunächst gar nicht begeistert von der unerfahrenen Kollegin, normalerweise ermittelt er allein. Doch Tanya ist hart im Nehmen und lässt sich von Nordsted, um den sich zahlreiche Gerüchte ranken, nicht einschüchtern. Außerdem hat sie eine ungewöhnliche Fähigkeit, die sich in den Ermittlungen als besonders hilfreich erweist. Gemeinsam gehen sie der Sache auf den Grund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DASBUCH
Holbæk, Dänemark: In der verschlafenen Hafenstadt werden kurz hintereinander zwei grausame Morde verübt: Die pensionierte Buchhändlerin Anne Holst wird in ihrem Haus erstochen – mit einer Waffe aus ihrer eigenen Sammlung. Dann verbrennt der Arzt Hendrik Engdal qualvoll in seiner Garage – gefesselt im eigenen Auto. Jakob Nordsted übernimmt die Ermittlungen. Der knallharte Ex-Militärmann ist so mysteriös wie die beiden Mordfälle: Zahlreiche Mythen ranken sich um den hoch dotierten Kriminalkommissar, der einmal Hauptmann der Königlichen Leibgarde war und mit sämtlichen militärischen Auszeichnungen geehrt wurde, die man sich in Dänemark verdienen kann. Ihm zugeteilt wird die junge Tanya Nielsen, wovon der abgebrühte Nordsted nicht besonders angetan ist. Aber die zähe und engagierte Tanya lässt sich nicht abschrecken. Und die Uhr tickt, bald geschieht ein weiterer Mordversuch. Das ungleiche Duo muss sich zusammenraufen, um weitere Opfer zu verhindern.
DERAUTOR
Steffen Jacobsen, 1956 geboren, hat lange als Chirurg gearbeitet, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in Hornbæk. Seine Bücher wurden unter anderem in den USA, England und Italien veröffentlicht. Bei Heyne sind seine Thrillerreihe um die Kommissarin Lene Jensen und den Ermittler Michael Sander sowie sein historischer Thriller Schach mit dem Tod erschienen.
Steffen Jacobsen
røben
Strafe muss sein
THRILLER
Aus dem Dänischen von Maike Dörries
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Die Originalausgabe PROXY erschien erstmals 2020 bei Lindhardt og Ringhof, Kopenhagen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 07/2023
Copyright © 2020 by Steffen Jacobsen
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Hanne Hammer
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock.com (Bjorn Beheydt) und AdobeStock (Lars Meinel)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28702-3V001
www.heyne.de
Alles hat seine Zeit
Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit,
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;
töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit.
Prediger 3, 2 – 3
Holbæk, 15. September
Anne Holst schaute von ihrem Buch auf. Die Türglocke schellte melodisch. Gleich darauf klopfte es dreimal kurz hintereinander. Ein ungeduldiger Besucher, der sie zu Hause vermutete; ihr Rad lehnte neben dem Windfang an der Mauer, und das Auto stand im Carport. Zwischen ihren Augenbrauen bildete sich eine Falte. Sie konnte es gar nicht leiden, wenn man sie in ihrer Freizeit störte, und schielte zu der filigranen Rokokouhr auf der Anrichte hin, die zwischen den hohen Bücherregalen stand. Zu jeder vollen Stunde tänzelte eine Porzellanballerina in einem akkuraten Halbkreis vor der Uhrscheibe entlang und verschwand dann wieder durch eine kleine Luke ins Uhrwerk.
Ihre stets pünktliche Nordic-Walking-Gruppe würde erst in einer halben Stunde klingeln, vielleicht war es ja der Paketdienst. Sie hatte im Internet sechs teure Garnrollen bestellt, um das Weihnachtsgeschenk für ihre Nichte rechtzeitig stricken zu können, einen färöischen Wollpullover. Anne Holst legte ein gehäkeltes Lesezeichen in ihr Buch, trank den Becher mit dem inzwischen kalten Tee aus, legte die Lesebrille auf den Esstisch und erhob sich seufzend.
Sie lächelte vor sich hin. Ihr verstorbener geliebter Mann Niels hatte immer gesagt, dass sie sogar einen Meteoreinschlag überhören würde, wenn sie in ein Buch vertieft war.
»Ich komme ja«, rief sie.
Sie lief durch das Wohnzimmer in den Flur. Die pensionierte, schlanke Buchhalterin war schon einundsiebzig, bewegte sich aber noch wie eine junge Frau.
Anne öffnete die Tür und kniff die Augen zusammen ob des klaren Septemberlichts. Ein Schwarm Graugänse zog in einer V-Formation über den bleichen Himmel gen Süden. Die Gestalt im Windfang stand unbeweglich da. Der Reißverschluss des knielangen Parkas war bis unters Kinn hochgezogen, die Kapuze warf einen schwarzen Schatten über die obere Gesichtshälfte.
Es vergingen ein paar stumme Sekunden, ehe Annes Willkommenslächeln verblasste und sie einen Schritt nach hinten machte.
Der Gast schob die Kapuze zurück.
»Aber …«
Annes freie Hand griff nach der Goldkette mit dem Kreuzanhänger, ihre andere lag noch auf dem Türknauf.
»Darf ich reinkommen?«, fragte ihr Gegenüber mit tränenerstickter Stimme. »Anne? Darf ich? Du bist die Einzige, die mir jetzt noch helfen kann. Es tut mir so leid.«
Anne holte tief Luft und riss sich zusammen. Sie hatte mit ihrem Mann, dem Ingenieur, in den gottverlassensten Regionen Afrikas und Asiens gelebt und schon ganz andere Situationen gemeistert, also würde sie auch die hier hinbekommen.
Sie nickte, nahm die Hand von der Klinke und ließ den Besucher eintreten. Ehe sie die Tür schloss, schaute sie beklommen den friedlichen, menschenleeren Villenweg hinunter.
»Komm schon rein«, murmelte sie. »Mein Gott, ich versteh nur nicht …«
Stumm standen sie einander im Wohnzimmer gegenüber.
Anne warf einen nervösen Blick auf ihre Armbanduhr und versuchte, ihre wirren Gedanken zu sortieren.
Ihr Gegenüber zog die Kapuze herunter und lächelte.
»Erwartest du jemanden?«
Jetzt war von der Verzweiflung nichts mehr zu hören.
»Ich? Nein, nur meine Nordic-Walking-Gruppe. Aber die kommen erst in einer halben Stunde.«
»Ihr walkt zusammen? Das ist doch wunderbar, oder? Zu walken, meine ich.«
»Ja, das ist es.«
»Du hattest recht, Anne.«
»Hatte ich das? Aber …«
»Ja.«
Die ganze Situation war so surreal. Sie starrte verkrampft die Wände ihres Wohnzimmers an, die ihre und Niels’ Lebensgeschichte erzählten: groteske längliche Holzmasken aus Benin, tödliche antike Waffen aus Südafrika – Knobkieries, diverse Speere und Kampfwaffen. Alle waren mit Erinnerungen an ihr früheres Leben verknüpft.
Sie stützte sich an einem Sessel mit hoher Rückenlehne ab. Ihr Mund war staubtrocken.
Der unerwartete Besuch schlenderte lässig durch das Wohnzimmer und weiter in den offenen Essbereich mit dem großen Mahagonitisch, an dem zehn Stühle standen, obgleich Anne nur noch selten Gäste hatte. Abendeinladungen und Lachen gehörten der Vergangenheit an. Niels hatte zu seinen Lebzeiten gerne Gäste im Haus gehabt und war ein vollendeter, herzlicher und gemütlicher Gastgeber gewesen. Es gab immer einen neuen selbst gebrannten Kräuterschnaps, der probiert werden wollte, frisch gebrautes Bier aus dem Schuppen. Von allem immer nur das Beste. Sein rundes, strahlendes Gesicht, die Augen mit den Lachfalten. Der grau melierte Vollbart und der unerschöpfliche Schatz absurder und komischer Anekdoten aus Afrika und Asien. Er war der selbstverständliche Mittelpunkt jeder Gesellschaft gewesen.
Der Gast drehte das Buch auf dem Esstisch um und studierte den Umschlag.
Seine Augen verengten sich. Anne schwankte.
»Geht es darin um mich?«
»Natürlich nicht«, murmelte Anne.
»Ganz sicher?«
»Ganz sicher. Aber … Ich verstehe das hier nicht. Solltest du nicht mit deinem Arzt reden?«
»Das habe ich mir auch schon überlegt. Ihr scheint euch ja vollkommen einig zu sein, stimmt’s?« Ihr Gegenüber lächelte sie freundlich an. »Ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst. Es ist, als würde einem alles entgleiten, als würde es niemals aufhören, egal wie sehr man sich das wünscht. Ist es nicht so?«
»Ja. Das trifft es wohl einigermaßen.«
Anne schloss die Augen.
Als sie sie wieder aufschlug, war ihr Gast aus ihrem Blickfeld verschwunden.
Sie drehte sich um und stand ihm wieder gegenüber.
Irgendetwas stimmte nicht, dachte Anne. Etwas fehlte. Die vertrauten Muster waren gestört. Etwas im Wohnzimmer war anders. Die Wand über dem Sofa?
Aber kein Mensch konnte sich so schnell und lautlos bewegen.
Sie schaute zu Boden, als der Stoß sie traf und der weiß glühende Schmerz wie ein neugeborener Stern in ihr explodierte.
Die Klinge durchstieß Annes Zwerchfell und den Herzbeutel, die rechte Herzhälfte und die große Lungenschlagader. Das Herz blieb ruckartig stehen, die linke Herzhälfte krampfte sich in wenigen starken Spasmen zusammen, die das letzte Blut aus dem Brustkorb in ihre Bauchhöhle pumpten. Blutleer und bar jeden Widerstands zitterte das Herz kurz. Flimmerte. Stand still.
Das Gehirn schaltete ab.
»Niels«, flüsterte sie.
Sie sah ihren Gast an, der seine behandschuhten Hände vor das Gesicht gehoben hatte, sie aber durch die gespreizten Finger hindurch mit einem Blick voller Schrecken und Triumph beobachtete.
So eine hasserfüllte Kraft in den Armen, war Annes letzter bewusster Gedanke.
Dann gaben ihre Knie nach. Sie war tot.
Kriminalkommissar Jakob Nordsted fuhr vier Grundstücke vor Anne Holsts Haus langsam mit dem Jaguar an den Bordstein.
Er schaltete den Motor ab, stieg aus und betrachtete zufrieden seinen fabrikneuen XE Portfolio. Strich liebkosend mit den Fingerkuppen über das kühle Dach, bevor er die Tür zuschlug. Es klang, als würde ein Schweizer Tresor ins Schloss fallen. Nordsted lächelte genussvoll beim Anblick des zimtfarbenen Windsorleders, mit dem Innenraum, Armaturenbrett und Lenkrad ausgekleidet waren, aktivierte die Verriegelung und steckte den Schlüssel in die Tasche seiner dicken Seemannsjacke.
Mit einem feindseligen Seufzer schaute er den ordentlichen Villenweg mit seinen monoton weiß und gelb gestrichenen Einfamilienhäusern hinunter, den breiten Bürgersteigen, den Kinderfahrrädern und abgedeckten Weber-Grills, den verwaisten Carports und der kleinen Gruppe frierender, siebzigjähriger Nordic-Walkerinnen, die von zwei Polizistinnen mit blonden Pferdeschwänzen verhört wurden.
Das Viertel schien für kleine Kinder ebenso ideal wie für verletzliche alte Menschen, als wäre es in den Siebzigern von Physiotherapeuten entworfen und gebaut worden. Er machte ein paar Schritte, dann drehte er sich wieder zu seinem Auto um, als wollte er sich versichern, dass es in diesem Jammertal, in dem die Menschen sich gegenseitig umbrachten, auch noch Gutes, Schönes, Zivilisiertes, hervorragend Konstruiertes und Edles gab. Er ging in einem großen Bogen um die blassen Nordic-Walkerinnen herum und ignorierte die fragenden Blicke der Polizistinnen.
Vor dem eingeschossigen gelben Einfamilienhaus mit den Staudenbeeten und der Feldsteinmauer standen ein Leichenwagen der Feuerwehr, zwei weiße unbeschriftete Kastenwagen der Kriminaltechnischen Abteilung und zwei Streifenwagen der örtlichen Polizei von Westseeland. Vermutlich die gesamten verfügbaren Einsatzkräfte, dachte Jakob: Nach all den Reformen und Zentralisierungen, die effektiv das Vertrauen der Bürger in die zunehmend unsichtbarere, bürokratisierte und immer unzugänglichere Polizei angefressen hatten, war das wohl alles, was noch übrig geblieben war.
Jakob hob die Hand und grüßte zwei breitschultrige Feuerwehrleute, die rauchend auf dem Bürgersteig standen. Sobald die Techniker mit der ersten Untersuchung des Tatorts durch waren, würden die zwei wortkargen Männer die Verstorbene für weitere Untersuchungen ins Rechtsmedizinische Institut nach Kopenhagen bringen. Ein Job, um den er die beiden nicht beneidete.
Er ging den ungepflegten Gartenweg entlang, auf dem Fallobst und Blätter lagen, vorbei an einem blitzsauberen violetten VWUP im Carport. Beim Anblick der Fensterläden aus Holzimitat, die dem Haus vermutlich so etwas wie Mittelmeerflair verleihen sollten, runzelte er missbilligend die Stirn.
Durch die Scheiben sah Nordsted, wie ein weiß gekleideter Kriminaltechniker die Fenster mit schwarzen Abdeckungen für den Luminoltest verkleidete. Er schien den Kommissar nicht zu bemerken, der weiter um das Haus herum in den hinteren Garten ging. Im Vorbeigehen pflückte er eine Birne von einem Spalier und biss hinein, was er augenblicklich bereute, die Birne war überreif und mehlig. Er warf sie in einem hohen Bogen in den Garten zurück, wo eine Ringeltaube von den oberen Ästen einer Kiefer aufflatterte.
Irgendwann hatte er aufgehört zu zählen, in wie vielen Häusern wie diesem er schon gewesen war: diesen Hüllen eines Lebens, zerstört durch einen Mörder, der das Lebensband durchtrennt hatte und deswegen aufgespürt und zur Rechenschaft gezogen werden musste.
So verlangte es das Gesetz.
In dem Viertel war es bis auf die krächzenden Funksprüche der Polizei still. Als dämpfte der Mord alle Geräusche. Als hielte die Stadt den Atem an. Als wäre der freundliche, kleine Ort am Fjord von einem zerstörerischen meteorologischen Phänomen heimgesucht worden.
Der Abteilungsleiter der Kriminaltechnischen Abteilung, Hans Schmidt, stand in Anne Holsts makellos sauberer Küche und beaufsichtigte zwei jüngere Techniker, die damit beschäftigt waren, Fingerabdrücke auf dem Küchentisch unter dem Fenster zum hinteren Garten zu sichern und den Siphon unter der Spüle auseinanderzunehmen, um mögliche Haare, Schuppen oder Fasern aus dem Ablauf sicherzustellen. Man wusste ja nie, ob der Mörder nicht der ordentliche Typ war, der sich die Hände wusch, nachdem er einen Menschen umgebracht hatte. Schmidt glaubte nicht daran.
Der Techniker mit dem Pinsel und dem Fingerabdruckpulver richtete sich auf und zeigte aus dem Fenster.
»Wer ist das?«
Schmidt sah zu der Gestalt in dem langen, schmalen Garten hin. Der große breitschultrige Mann mit den grauen, kurz geschnittenen Haaren und den in den Jackentaschen vergrabenen Händen stand unbeweglich mit dem Rücken zum Haus.
»Jakob Nordsted«, murmelte Schmidt.
Bei Schmidts Worten faltete sich der andere Techniker aus seiner verkrampften Haltung unter der Spüle auseinander und stand auf.
»Der Nordstedt? Jesus, ich dachte …«
»Du hast gar nichts gedacht. Und Gott sei Dank gibt es nur den einen.«
Der jüngste Techniker, der, wie Schmidt bereits wusste, ihn an dem Tag ablösen würde, wenn er sich nur noch um seine Frau, Kulturreisen und die Lachsfischerei zu kümmern brauchte, trat einen Schritt auf die Küchentür zu, wurde aber von seinem Chef gebremst.
»Wo, bitte, willst du hin?«
»Ich will ihm nur sagen, wo er langgehen muss, damit er nicht durchs Wohnzimmer latscht.«
Schmidt lächelte spöttisch hinter seiner Gesichtsmaske.
»Vergiss es. Jakob denkt nach. Jakob spürt nach. Voodoo. Außerdem weiß er längst, dass du hier stehst und ihn beobachtest.«
»Quatsch, wie soll das denn gehen? Hat er etwa Augen im Hinterkopf?«
»So ist es. Er war Soldat, und zwar keiner von denen, die hinterm Schreibtisch sitzen oder Soldatenmemoiren schreiben, ohne jemals einen Schuss gehört zu haben. Er war selbst da draußen.«
»Voodoo?«, fragte der andere.
Schmidt zuckte die Schultern.
»Nenn es, wie du willst, aber komm ja nicht auf die Idee, ihn dabei zu stören. Da ist der Abfluss, kümmere dich darum.«
Hans Schmidt nahm Jakob an der Tür in Empfang und überreichte ihm ein Paar blaue Schuhüberzieher.
Schmidt war der Beste in seinem Fach und einer der wenigen, dessen Meinung Jakob respektierte. Er folgte dem Kriminaltechniker ins Wohnzimmer, wo Anne Holst in der vollkommenen Entspannung des Todes auf dem grauen Teppich lag, mit einem Ausdruck letzten großen Erstaunens auf dem Gesicht. Ihre Haut war kalkweiß, die Bauchhöhle aufgebläht. Gestalten in weißen Schutzanzügen schwebten durch das abgedunkelte Haus wie Gespenster. Die Verdunklung war komplett, nachdem einer von Schmidts jungen Kollegen den letzten blickdichten Stoffschirm vor dem letzten Fenster angebracht hatte.
»Keiner rührt sich vom Fleck«, kommandierte Schmidt, worauf zwei Mann begannen, Teppiche, Wände, Möbel und alle Oberflächen im Wohnzimmer mit Luminollösung zu besprühen. Luminol verband sich mit dem Eisen in selbst mikroskopisch kleinen Blutspritzern, sogar auf Oberflächen, die mit allen gängigen Putzmitteln gereinigt worden waren. Unter einer bestimmten Lichtquelle fluoreszierten die Blutpartikel. Aus der Anordnung der Blutspritzer, ihrer Entfernung voneinander und dem Trocknungsgrad konnte der Tathergang rekonstruiert werden.
Theoretisch.
Die Blutlache, die sich wie eine lange Zunge von der Sofaecke aus in den Raum erstreckte, leuchtete bläulich in der Dunkelheit.
Das war alles. Kein einziger Tropfen irgendwo sonst. Kein Fußabdruck.
»Okay, entfernt die Scheißverdunklung wieder, damit wir was sehen können!«, rief Schmidt gereizt.
Er drehte sich mit vor der Brust verschränkten Armen zu Jakob um.
»Einen Versuch war’s wert«, murmelte der tröstend.
Schmidt nickte energisch. »Natürlich.«
Der Kriminalkommissar sah ihn an. »Könntest du bitte den Mundschutz abnehmen, Hans? Ich gehe mal davon aus, dass die Gute nicht von Ebola dahingerafft wurde?«
Schmidt zog die Kapuze vom Kopf und nahm die Maske ab, unter der ein beeindruckender, äußerst gepflegter Schnurrbart zum Vorschein kam. Der Abteilungsleiter war weitsichtig, und die dicken Brillengläser gaben seinem Blick einen verschwommenen, zerstreuten Ausdruck.
Aber Schmidt war alles andere als zerstreut, wie Jakob wusste.
Sein Blick wanderte zu Schmidts lautlos arbeitenden, weiß gekleideten DNA-Jägern. Dann studierte er die südliche Zimmerwand, an der eine Auswahl authentischer Ethnografika aus Afrika hing.
Die penibel aufgeräumten Zimmer mit den vielen Büchern ließen auf eine Bewohnerin schließen, die die Gesellschaft ihrer Bücher der anderer Menschen vorgezogen hatte.
Jakob zeigte auf eine Stelle an der Wand. Dort deutete ein blasser Abdruck darauf hin, dass hier eine Stichwaffe mit kurzem Schaft gehangen hatte. Er sah Schmidt an.
Der Techniker nickte. »Eine nette Kollektion exotischer Mordwerkzeuge hatte sie hier hängen. Sieh dir das an.«
Sie gingen neben der Tatwaffe in die Hocke, die in einem durchsichtigen Beweismittelbeutel auf dem Boden lag.
Schmidt räusperte sich. »Nach einer ersten Beurteilung durch den Polizeiarzt ist die Tatwaffe direkt unterhalb des Brustbeins eingedrungen, dann weiter durchs Zwerchfell und den Herzbeutel hindurch direkt ins Herz. Sie ist innerhalb weniger Sekunden verblutet, der größte Teil des Blutes ist in die Bauchhöhle gelaufen. Darum ist auch verhältnismäßig wenig davon zu sehen. Sie ist an der Stelle umgefallen, an der sie erstochen wurde.«
»Gibt es Abwehrspuren an Händen oder Unterarmen?«, fragte Jakob.
»Nein. Sie hat mit nichts Bösem gerechnet.«
»Dann muss sie den Täter gekannt haben«, schlussfolgerte Jakob. »Wie üblich.«
»Vermutlich. Sie hat dem Betreffenden selbst die Tür geöffnet. Schloss und Türrahmen sind intakt, die Tür ist selbstschließend.«
Sie erhoben sich.
»Ein südafrikanischer Assegai«, murmelte Schmidt. »Grundgütiger, so was ist mir in meiner Karriere noch nicht untergekommen.«
»Das ist kein Assegai. Das ist ein Iklwa-Speer. Eine kurze Stichwaffe, die von dem mächtigen Zulu-König Shaka persönlich für den Nahkampf entwickelt wurde. Der Name beschreibt das schmatzende Geräusch beim Herausziehen des Speers aus dem Körper des getöteten Feindes. Sehr effektiv.«
Hans Schmidt wunderte sich schon lange nicht mehr über Jakob Nordsteds enzyklopädisches Wissen und bezweifelte keine Sekunde die Korrektheit der Informationen.
»Ein Ilkwa. Na gut.«
»Iklwa«, berichtigte Jakob geistesabwesend. »Und wer ist die Tote?«
Schmidt machte eine alles umfassende Geste Richtung Zimmer und Eingangsbereich.
»So nah am Durchschnitt der dänischen Statistik wie irgend möglich für ihre Altersklasse. Einundsiebzig Jahre alt. Buchliebhaberin. Nordic-Walkerin. Pensionierte Buchhalterin. Seit drei Jahren Witwe. Ihr Mann war Elektroingenieur, das Paar hat jahrelang in Afrika gelebt und gearbeitet. Danach in Kambodscha, Nepal und Bhutan. Das ist bislang die einzige Abweichung. Im Übrigen war sie ausgebildete Kraniosakraltherapeutin. Ob das auch eine Abweichung darstellt, kann ich noch nicht sagen.«
»Therapeutin, okay.« Jakob sprach das Wort wie eine hässliche Hautkrankheit aus. »Das ist wohl eher alltäglich. Wir sind inzwischen doch eine Nation aus Behandelnden und Behandelten.«
»Aber du bist doch selbst behan…«, setzte Schmidt an, verstummte jedoch augenblicklich, als er den warnenden Ausdruck im Gesicht des Kriminalkommissars sah.
Jakob schaute auf seine Uhr. »Seid ihr fertig mit ihr? Die Feuerwehrmänner frieren sich da draußen den Arsch ab. Todeszeitpunkt?«
Schmidt schielte zu einem digitalen Display auf dem Boden hin, das über ein weißes Kabel mit einer Temperatursonde im Rektum der Toten verbunden war. Die blinkenden roten Ziffern zeigten 25,7 Grad Celsius.
»Ausgehend von Kern- und Raumtemperatur würde ich sagen, vor ungefähr drei Stunden.«
»Was ist mit der Nordic-Walking-Truppe vor dem Haus?«
»Pünktlich wie die Uhr der Domkirche. Sie waren mit Anne Holst verabredet, um zum Maglesø zu laufen mit anschließendem Stullenpicknick beim Observatorium in Brorfelde. Eine von ihnen hat gesehen, dass die Haustür angelehnt war, und ist reingegangen. Sie liegt jetzt mit einem gehörigen Schock im Krankenhaus.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Jakob. »Die haben sich ihre Wanderung bestimmt anders vorgestellt.«
»Sie sind alle ziemlich gut in Form, wie es aussieht«, sagte Schmidt. »Dünn wie Windhunde.«
»Fußspuren auf dem Gartenweg?«
»Von einem halben Dutzend aufgeregt hin und her laufender Pensionäre.«
»Na, großartig. Well, follow me, my dear Watson«, murmelte Jakob und ging voran ins Esszimmer.
Er blieb am Esstisch stehen und betrachtete die leere Tasse und die hässliche Teekanne, in der ein paar Teebeutel hingen. Ein schmerzliches Zucken lief über sein Gesicht. Er stammte aus einer erzkonservativen Familie, für die Teebeutel in Teekannen gebrauchten Kondomen gleichkamen.
Und wieder checkte er seine rostfreie Rolex, was Schmidt nicht verborgen blieb. »Wartest du auf jemanden?«
»Auf irgendeine Kommissaranwärterin, die auf ihrer Rotationsrunde drei Monate in der Abteilung für personengefährdende Kriminalität verbringen soll. Natasha heißt sie, glaube ich. Hat so gut wie keine Praxiserfahrung. Wieso zum Teufel trifft es eigentlich immer mich? Bin ich ein Tier aus dem Zoo?«
Schmidt nickte betrübt. »Eher aus dem naturhistorischen Museum. Bei mir landen sie auch, Jakob. Wir sind halt Dinosaurier und sie die Klassenausflügler, die einen Blick auf eine ausgestorbene Spezies werfen sollen.«
»Ich finde das jedenfalls scheißnervig. Es mag schwer zu glauben sein, aber meine pädagogischen Fähigkeiten bewegen sich auf einem äußerst niedrigen Niveau.«
»Was für eine Überraschung?«, erwiderte Schmidt.
Etwa fünfzig Meter von Anne Holsts Haus entfernt, fiel Tanya in der Gruppe von Frauen und Kindern, die auf dem Bürgersteig der Wohnstraße zusammengeströmt waren, ein junger Mann auf. Alle verhielten sich erstaunlich ruhig. Ein paar Smartphones blitzten auf. Gerade war der Leichenwagen der Feuerwehr an ihr vorbeigefahren, ein umgebauter Krankenwagen, den man nach dem Transport problemlos mit dem Hochdruckreiniger desinfizieren konnte. Ausrüstung, Sirenen und Blaulichter waren entfernt worden.
Natürlich erregte ein Tatort wie dieser Aufmerksamkeit. Es war mehr die beunruhigende Intensität, die von dem jungen Mann ausging, der an eine Mönchskutte erinnernde, hochgeschlossene Parka, das leichenblasse, ausdruckslose Gesicht und die stechend blauen Augen unter der Kapuze, die Tanya veranlassten, das Tempo zu drosseln und sich nach ihm umzudrehen.
Tanya besaß die begnadete Gabe der selbstvergessenen Konzentration im Überfluss, was nicht immer praktisch war. Wie jetzt. Außerdem war sie eine unheilbar miese Autofahrerin, die fünfmal durch die interne Fahrprüfung der Polizei gefallen war, bis ein Prüfer aus reiner Verzweiflung und Mitleid seine Unterschrift auf den Schein gesetzt hatte.
»Shit …!«
Adrenalin schoss bei dem Knall, der auf der rechten Seite ihres ramponierten Fiats zu hören war, durch ihren Körper.
»So eine Scheiße!«
Sie parkte am Straßenrand, überprüfte in dem zerbrochenen Spiegel des Sonnenschutzes blitzschnell ihren fast unsichtbaren Lippenstift und die Mascara, bevor sie ausstieg.
Tanya schloss diskret die Autotür und sah sich um. Offenbar hatte niemand ihr kleines Missgeschick bemerkt. Sie atmete erleichtert auf, dann sah sie sich den nagelneuen Jaguar hinter ihrem Fiat genauer an.
»Fuck …«
Sie zog kurz in Erwägung, schleunigst einen anderen Parkplatz zu suchen, aber ihr Anstand ließ sie dann doch ein Blatt aus ihrem Notizbuch reißen, ihre Handynummer darauf schreiben und ihn unter den rechten Scheibenwischer klemmen.
Dann marschierte sie zügig auf den Tatort zu und bemerkte verärgert, wie schnell ihr Atem ging. Sie schaute zum ungefähr zwanzigsten Mal an diesem Tag an sich herunter. Nach dem Duschen heute Morgen hatte sie sich mehr Mühe mit ihrer Garderobe gegeben als sonst. Schließlich traf man nicht jeden Tag eine lebende Legende wie Nordsted. Am Ende hatte sie sich für einen unauffälligen dunklen Hosenanzug mit schwarzen ECCO-Schuhen entschieden, eine schlichte weiße Bluse, ein Minimum an Make-up und einen praktischen Pferdeschwanz.
Das Ganze sollte Frische, Dynamik und lernwillige Demut ausstrahlen.
Hoffte sie.
Sie hatte sich bestmöglich vorbereitet, unter anderem mithilfe einer guten Freundin aus der Personalabteilung der Rigspoliti, die sie so lange genervt hatte, bis sie Tanya Einblick in ausgewählte Passagen aus Jakob Nordsteds umfangreicher Personalakte gewährt hatte. Vieles war unter Verschluss und der Rest Ehrfurcht gebietend. Jakob Nordsted war mit gerade mal achtundzwanzig Jahren zum Hauptmann der Königlichen Leibgarde ernannt worden. Er war an gefährlichen Missionen in den Krisengebieten in Bosnien, Kosovo und Afghanistan beteiligt gewesen und hatte so ziemlich jede Auszeichnung und jeden Militärorden eingeheimst, den die Armee zu vergeben hatte. Bis seine vielversprechende Karriere aus unbekannten Gründen ein jähes Ende gefunden hatte.
Ein Jahr nach seinem Abschied hatte er sich bei der Polizei beworben und das Kunststück wiederholt, die traditionell massiven Barrieren des Staatsdienstes in Rekordzeit zu überwinden. Zuerst als Polizeioberrat beim Spezialeinsatzkommando der dänischen Nationalpolizei, für das er wegen seiner militärischen Vorgeschichte als »besonders geeignet« befunden worden war. Er hatte die wertvolle Zusammenarbeit mit dem Froschmann- und dem Jägerkorps etabliert.
Danach war es wieder zu einer dieser Veränderungen gekommen, über die alle spekulierten, aber niemand etwas Genaues wusste. Nordsted hatte von einem Tag auf den anderen das Spezialeinsatzkommando verlassen und sich von seiner gleichaltrigen Zahnarztgattin scheiden lassen, mit der er einen inzwischen vierzehnjährigen Sohn hatte. Ein halbes Jahr Urlaub hatte er bewilligt bekommen, den er angeblich im Alkoholrausch irgendwo in Südostasien verbracht hatte, bis der legendäre Leiter des Dezernats für personengefährdende Kriminalität, Poul Wilhelmsen, nach Vietnam gereist war, Nordsted angeblich in Gesellschaft eines Prostituierten-Zwillingspärchens in einem versifften Hotelzimmer in Ho-Chi-Minh-Stadt aufgespürt und ihn in eine Entzugsklinik geschickt hatte.
Nach seiner Wiederauferstehung hatte Jakob Nordsted auf dramatische Weise die Morde an fünf jungen ukrainischen Frauen im Großraum Kopenhagen aufgeklärt, die in einem Zeitraum von vierzehn Monaten verübt worden waren. Man hatte die Frauen über ein seriöses Datingportal mit einer großzügigen Reisekasse und teuren Geschenken nach Dänemark gelockt. Sie waren zwischen 24 und 27 Jahre alt, langbeinig, gepflegt, gut ausgebildet, kinderlos, hübsch und blond. Alle waren am Flughafen Kastrup in ein Taxi gestiegen und am späten Abend an einer Küstenbahnstation abgesetzt worden. Danach verloren sich ihre Spuren – bis ihre misshandelten Leichen Wochen später im Öresund wieder aufgetaucht waren.
Die Verhaftung der Täter und die folgenden Geständnisse hatten weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Bei den Mördern handelte es sich um zwei Brüder mittleren Alters, die zur absoluten Spitze des dänischen Pantheons zählten. Der eine war Staatssekretär, der andere Direktor des Nationalmuseums, außerdem waren sie zwanghafte Psychopathen, Sadisten, Athleten und herausragende Jäger. Nordsted war auf eigene Faust und gegen alle Befehle seiner Vorgesetzten in die riesige Villa im schicken Botschaftsviertel Kopenhagens eingedrungen, wo er das sechste Opfer im Keller an ein Bettgestell gefesselt gefunden hatte, fast zu Tode gefoltert und misshandelt. Er konnte dem älteren Bruder noch den Kiefer und einen Oberschenkelknochen brechen, ehe er von dem jüngeren Bruder mit einem Jagdgewehr angeschossen wurde.
Drei Wochen lang schwebte Nordsted auf der Intensivstation zwischen Leben und Tod. Man hatte ihm vorübergehend einen künstlichen Darmausgang gelegt, dreißig Blutkonserven hatte er bekommen.
Der Parnass war noch immer dabei, sich neu zu sortieren. Die Brüder hatten zu seinen Stützen gehört. Tanya unterbrach ihren Gedankenspaziergang und starrte die Straße hinunter. Der junge Mann in dem schwarzen Parka mit dem intensiven Blick und dem blassen Gesicht war verschwunden, als hätte er nie dort gestanden.
Jakob saß mitten im Wohnzimmer auf einem Lederpuff, während Schmidt mit einem Lasermessgerät Winkel und Abstände ausmaß, als die Haustür aufging. Licht fiel in den Eingangsbereich, gleich darauf war ein Krachen zu hören, als draußen etwas Zerbrechliches zu Boden ging.
»Scheiße, verdammt! Sorry!«
Die Stimme gehörte eindeutig einer Frau.
»Ich glaube, dein Date ist da«, sagte Schmidt.
Jakob nickte finster.
Er betrachtete die mittelgroße Frau, die nun in der Türöffnung zum Wohnzimmer auftauchte. Ebenmäßige Gesichtszüge, schlank, kräftiges hellbraunes Haar in einem Pferdeschwanz. Grauenhafte Schuhe. Volle Lippen und schöne Zähne. Ende zwanzig.
Er ignorierte ihr freundliches Lächeln, das daraufhin erlosch, und betrachtete stattdessen fasziniert ihre tropfenförmigen Nasenlöcher, die sich unbewusst öffneten und schlossen wie bei einem Jagdhund. Dann zündete er sich mit seinem Dunhill-Feuerzeug eine Davidoff-Zigarette an und betrachtete den Teppich zwischen seinen Wüstenboots, die in blauen Überziehern steckten.
Tanya hätte den Mann am liebsten angeschnauzt, dass er an einem Tatort gefälligst nicht zu rauchen hatte, aber die Worte blieben ihr im Hals stecken.
Der ältere, graubärtige Kriminaltechniker lächelte sie freundlich an und reichte ihr die Hand.
»Hans Schmidt. Und Sie sind … Natasha …?«
»Tanya.«
»Was ist da eben passiert?«
Sie wurde rot.
»Ein Wandteller oder so was. Ich hoffe mal nichts Unersetzliches.«
Sie hüpfte ein wenig auf der Stelle, als sie die Überzieher über die Schuhe zog, die Schmidt ihr gegeben hatte. Sie betrachtete Nordsted über die Schulter des Technikers. Die Beschreibungen des Kriminalkommissars wichen stark voneinander ab, konnten aber grob in zwei Lager eingeteilt werden: Die jüngeren Polizisten hielten ihn für ein ausgebranntes Arschloch, das eigentlich wegen posttraumatischer Belastungsstörung in Frührente gehen sollte, die älteren Kollegen waren etwas differenzierter und vorsichtiger in ihrem Urteil. Tanya vermutete, dass sie sehr viel mehr über Jakob Nordsted wussten, als sie einem Neuling wie ihr auf die Nase binden würden. Die meisten waren sich jedoch einig, dass der Mann ein störrischer, einsamer Wolf war – natürlich. Schwierig bis unmöglich in der Zusammenarbeit. Aber es gab auch sporadische Berichte von Nächstenliebe: dass Nordsted für Opfer von Verbrechen und deren Angehörige zu jeder Tages- und Nachtzeit zu erreichen war, dass er Höllenqualen litt, wenn Ermittlungen im Sand verliefen. Er hielt tagelang durch, wenn andere längst zusammenbrachen, und er hatte … so etwas wie Visionen. Er sah Dinge und kam zu Schlussfolgerungen, auf die man nach menschlichem Ermessen nicht kommen konnte, außer man war selbst der Täter. Nach der Verhaftung der beiden prominenten Brüder konnten weder sein bester Freund und Vorgesetzter Poul Wilhelmsen noch die Psychologen sich erklären, woher der Kommissar gewusst hatte, dass die Brüder ihre bestialischen Fantasien ausgerechnet in jener Villa im Gammel Vartov Vej im Ryvangsviertel auslebten. Rein geografisch betrachtet war die Villa die Radnabe der Ziele, die die Taxifahrer und ihre Navis angegeben hatten. Aber es gab weder Papierdokumente noch handfeste Beweise, die die Brüder mit der Villa in Verbindung brachten. Nordsted und andere Ermittler waren unzählige Male durch das Viertel gefahren, bis Nordsted eines Abends vor ein paar beleuchteten Kellerfenstern in die Eisen gegangen war.
»Hier ist es«, hatte er zu seinem Kollegen gesagt. »Du bleibst im Wagen und forderst Verstärkung an.«
So die Überlieferung.
Eine halbe Stunde später war Nordsted, lebensgefährlich verletzt und fast verblutet, auf dem Weg ins Traumazentrum des Rigshospitals gewesen.
Der Mann erhob sich von seinem Sitzpuff und begrüßte sie. Seine Hand war trocken wie Mehl. Er musterte sie ernst mit seinen großen blauen Augen.
»Hallo. Ich heiße Tanya.«
»Gibt es auch einen Nachnamen?«
»Sorry. Nielsen.«
Seine Aufmerksamkeit schweifte ab.
In diesem Moment tendierte sie eindeutig zu der Meinung der jüngeren Kollegen.
Der Kriminaltechniker legte eine Hand auf ihren Arm.
»Nata … ich meine Tanya, kommen Sie doch mit mir mit. Überlassen wir den Hauptkommissar eine Weile seiner zweifelsohne inspirierenden und fruchtbaren Meditation.«
»Okay.«
Ihre Nasenflügel begannen wieder zu vibrieren.«
»Vertragen Sie keinen Blutgeruch?«, fragte Nordsted. »Dann sollten Sie Ihre Berufswahl noch mal überdenken.«
Tanya schüttelte den Kopf und lächelte tapfer. »Nein, nein, es ist nur so, dass ich …«
»Was?«
»Nichts.«
Der Griff des Kriminaltechnikers um ihren Arm wurde fester, und sie ließ sich dankbar durch das Haus mit den fremdartigen Gerüchen führen.
Als sie außer Hörweite waren, entzog Tanya ihm den Arm und fragte: »Ist der immer so?«
»Wie ›so‹?«
»Herablassend. Schroff. Unfreundlich.«
Schmidt zuckte die Schultern.
»Meistens. Das Leben war nicht immer nett zu unserem guten Kommissar. Es braucht ein wenig Zeit, sich an ihn zu gewöhnen.«
»Wie lange? In Ihrem Fall?«
»Jahre.«
Tanya öffnete die Tür zu einem großen Badezimmer und blieb mit halb geschlossenen Augen auf der Schwelle stehen; ein ganzes Duftpotpourri schlug ihr entgegen.
Schmidt beobachtete sie fasziniert.
»Sind Sie so was wie ein menschlicher Drogenhund?«, fragte er. »Finden Sie auch Trüffel?«
Tanya öffnete die Augen und drehte sich zu dem Kriminaltechniker um.
»Hyperosmie nennt man das. Das Letzte, was ich mir gewünscht hätte. Wenn ich sie bloß wieder los wäre.«
»Hyperosmie? Noch nie gehört. Wird man damit geboren?«
Tanya schüttelte den Kopf. »Sie ist in Verbindung mit einer Schwangerschaft aufgetreten. Normalerweise verschwindet sie nach der Geburt wieder, aber …«
»Sie haben das Kind nicht gekriegt«, schlussfolgerte Schmidt vorsichtig.
»Ja. Wir haben uns für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden.« Dann hellte Tanyas Gesicht sich auf. »Aber sie hat auch gewisse Vorteile. Wussten Sie, dass die spontane Anziehung oder Ablehnung eines anderen Menschen zu neunzig Prozent darauf basiert, ob man den Duft des Betreffenden mag oder nicht? Das läuft völlig unbewusst ab.«
»Nein, wusste ich nicht. Dann hat Nordsted einen unangenehmen Körpergeruch? Ist mir noch nie aufgefallen.«
»Gar nicht«, sagte sie hitziger als beabsichtigt. »Im Gegenteil«, fügte sie nachdenklich hinzu. »Sie müssen mir versprechen, ihm das niemals zu sagen. Ich würde vor Scham im Boden versinken.«
Schmidt hielt sich den Finger vor den Mund. »Ich schweige wie ein Grab. Dann überlasse ich Sie mal Ihren Duftstudien.«
Er ließ sie im Badezimmer allein, wölbte verstohlen die Hände vor dem Mund und atmete hinein.
Dann schüttelte er über sich selbst den Kopf. »Zwei komplette Spinner an einem Fall, das kann ja heiter werden.«
Als Tanya nach ihrer Exkursion in Anne Holsts Bad und Schlafzimmer zurück in die Wohnräume kam, ohne die Ursache für die seltsame Unruhe in ihrer Brust gefunden zu haben, stand Nordsted in dem über Eck angelegten Wohnzimmer, das zum Garten hinausging. Er hatte die großen Hände hinter dem Rücken verschränkt und wippte auf den Fußballen, während er die Bücherregale der Witwe studierte.
In der Küche war Schmidt in ein Gespräch mit einem der Techniker vertieft.
Nordsted zog ein schweres Buch aus einem Regal, überflog das Inhaltsverzeichnis und summte unmelodisch vor sich hin. Tanya stellte sich neben ihn und ahmte unbewusst seine Körperhaltung nach, während sie einen unauffälligen Blick auf das Buch in Nordsteds Hand warf: Unusual and Rare Psychological Disorders. Mane & Dixon.
»Was halten Sie davon?«, fragte er.
»Ähm … Sie muss sehr gut Englisch gekonnt haben?«
»Selbstredend. Was weiter?«
Tanya fühlte sich plötzlich wie in einer Prüfung.
Sie nahm ihm das Buch aus den Händen und hielt es sich unter die Nase.
»Riecht neu.«
»Korrekt. Aber einige wenige Kapitel scheinen schon mehrfach gelesen worden zu sein. Sehen Sie die Bruchnaht am Rücken?«
Tanya ließ das Buch aufklappen.
»Narzisstische Persönlichkeitsstörung«, las sie leise.
»Der moderne Irrsinn«, sagte Nordsted.
Tanya zeigte auf die Bücher, die direkt neben dem Buch standen.
»Davon gibt es noch mehr, scheint sich also nicht nur um ein flüchtiges Interesse zu handeln.«
Sie nahm den Schatten eines Lächelns wahr.
Graue Bartstoppeln schabten unter seiner Handfläche.
»Eine Zwangsstörung?«
Er sah sie an und tippte sich mit dem Zeigefinger an den rechten Nasenflügel, bevor er ihr ein zusammengefaltetes weißes Taschentuch reichte.
»Sie bluten.«
Sie drückte die Nasenflügel mit dem Taschentuch zusammen.
»Fock … ’tscholdigong …
»Alles gut, es ist nur so, dass hier aus kriminaltechnischer Sicht schon genug Blut ist. Wir wollen Hans doch nicht noch mehr schlaflose Nächte bereiten, als er ohnehin schon hat. Er hat mir gesagt, dass Ihre Nase in gewisser Weise ihr dominantes Organ ist?«
Sie sah ihn unglücklich an. »Das ist einfach so, ich kann nichts dagegen tun.«
»Schon gut.« Nordsted las laut von den Buchrücken ab: »Parental Psychiatric Disorders, Neurobiology of the Brain, Lost in the Mirror: An Inside Look at Borderline Personality Disorders.« Er schnaubte. »Die könnten doch wenigstens die Titel etwas variieren, oder? Sie scheint von Geisteskranken besessen gewesen zu sein. Oder ist das eine Tautologie?«
»Ja.«
Tanya sah ihn gespannt an. »Die sind alle erst vor Kurzem gekauft. Was folgern Sie daraus?«
Nordsted hob überrascht den Kopf.
Er ist es nicht gewohnt, nach seiner Meinung gefragt zu werden, dachte sie.
»Ich? Nichts. Ein Interesse. Wie Orchideen, Runen oder Salzwasseraquarien.«
»Aber das muss doch was zu bedeuten haben!«
Nordsted sah sich um, als hoffte er, dass Schmidt aufkreuzte, um ihn von der Gesellschaft dieser Amateurin zu befreien. Dann zuckte er mit den Schultern.
»An jedem Tatort gibt es unzählige physische Phänomene mit unzähligen inhärenten Verbindungen und Permutationen … Alles kann alles bedeuten oder nichts. Und bis in die Unendlichkeit interpretiert werden.«
»Auch eine aktuelle Studie über Geistesgestörte, unmittelbar bevor man selbst ermordet wird? Wie oft ist Ihnen das schon untergekommen?«
Sie nahm das Taschentuch von der Nase und sah sich die scharlachroten Flecken an. Die Blutung hatte offensichtlich aufgehört.
»Eine Studie in Scharlachrot«, murmelte Nordsted mit einem Seitenblick auf das Taschentuch.
»Pardon?«
»Nichts.«
»Ich werde es waschen und bügeln«, sagte sie.
»Behalten Sie es.«
»Aber …«
»Hören Sie zu, Natasha. Der Tag wird verdammt lang werden, wenn ich alles wiederholen muss, okay?«
»Tanya«, sagte sie gereizt.
»Also gut, dann eben Tanya. Wie Sie zweifelsohne auf der Polizeischule gelernt haben, kennen fünfundneunzig Prozent aller Mordopfer ihren Täter. Also: Wie stehen Sie zu Herausforderungen?«
Er schlug die Hände mit einem überraschenden Knall zusammen, woraufhin jemand in der Küche etwas fallen ließ.
»Ich bin dabei«, antwortete sie.
»Gut, dann hacken Sie das Handy und den Computer der Toten. Ich kenn mich mit so was nicht aus, aber Sie sind jung, das ist in ihrer DNA verankert, es sei denn, Sie sind in der Sahara aufgewachsen. Aber das sind Sie nicht, oder?«
»Absolut nicht.«
»Bitten Sie die Nerds in Glostrup um Unterstützung.«
»Das schaff ich auch allein. Ich war zwei Jahre beim Nachrichtendienst, da haben wir im Großen und Ganzen nichts anderes gemacht.«
»Fantastisch. Bauen Sie mir ein Hologramm von Anne Holst und ihren geheimen Leidenschaften. Was wir hier sehen, ist schlicht und ergreifend zu öde und durchschnittlich, um wahr zu sein. Nein, noch besser: ein Porträt, eine Statue …«
»Was Dreidimensionales?«, murmelte sie trocken.
»Exakt. Was hat sie im Internet gekauft und warum. Was waren ihre Interessen, wen konnte sie leiden und wen nicht, wen hat sie auf ihrer kraniosakralen Pritsche behandelt, Facebookfreunde, Romanzen auf geriatrischen Datingportalen, was auch immer. Ich garantiere Ihnen, der Mörder ist irgendwo da drinnen zu finden.«
Tanya spürte, wie eine warme Welle der Begeisterung und Erregung durch ihren ganzen Körper strömte. Genau das war es, was sie an der Polizeiarbeit liebte. Dafür hatte sie sich hier beworben. Es war wie eine Fanfare am Morgen, eine im Wind flatternde Fahne.
»Glauben Sie das wirklich?«, fragte sie eifrig.
Nordsted lächelte ironisch. »Überhaupt nicht. Wir suchen hinter allem immer nach dem glasklaren, messerscharfen und nachvollziehbaren Motiv. Aber das hier ist anders. Vermutlich ist hier nichts außer gähnender Leere. Vielleicht hat sein Hund ihn aufgefordert, sie zu töten. Oder der Mörder hat sich einfach gelangweilt, während er auf die nächste Staffel einer Netflix-Serie gewartet hat.«
Sie hätte ihn am liebsten geschlagen.
»Sie schaffen es wirklich, einen zu motivieren«, sagte sie bitter.
Nordsted seufzte, ohne sie anzusehen. »Tanya, ich habe Sie nicht um Hilfe in diesem Fall gebeten. Ich bin nicht hier, weil ich mir nichts sehnlicher wünsche, als hier zu sein, sondern weil ich zufällig Dienst hatte. Sie sind hier, weil Sie hier sein müssen, bevor Sie weiter auf Ihrer zweifelsohne glänzenden Karriereleiter aufsteigen werden. Um ein paar Erfahrungen und Anekdoten reicher, mit denen Sie Ihre Freundinnen unterhalten können.«
Sie schnitt eine Grimasse und hätte am liebsten mit dem Fuß aufgestampft. »Das ist nicht wahr. Ja, ich bin hier, um etwas zu lernen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass Sie mir nichts beizubringen haben. Und ich bin hier, weil es mir etwas bedeutet.«
Schmidt stieß zu ihnen. Er schaute von einem zur anderen. Die Stille war wie elektrisch aufgeladen.
»Wie läuft’s?«, fragte er.
»Fantastisch«, sagte sie. »Der Herr Kriminalkommissar meint, dass Anne Holst ermordet wurde, weil ein Hund plötzlich sprechen konnte.«
»Origineller Gedanke«, erwiderte Schmidt. »Der Kommissar zieht Sie nur auf, Tanya. Haben Sie, wenn ich das so formulieren darf, Witterung von irgendwas aufgenommen?«
Das musste man den beiden Männern lassen: Sie waren an ihr interessiert. Fast, als wäre sie ein Mensch.
Tanya holte tief und trotzig Luft. »Ich hätte da eine Frage …« Sie stockte.
»Raus damit«, sagte Schmidt aufmunternd.
»Ihre Techniker sind alle Männer, oder? Mit den Schutzanzügen, Kapuzen und Masken kann ich das nicht so genau erkennen.«
Schmidt überlegte. »Heute sind tatsächlich nur Männer im Team, ja.«
»Okay. Was ist es dann, das hier nicht …?«
Schmidt und Nordsted sahen sich fragend an.
»Möchten Sie das vielleicht etwas vertiefen?«, fragte Nordsted.
»Hier drinnen ist ein Duft, der vermutlich nicht zum Haus gehört. Ein Duft, der nicht zu Anne Holst gehört, er wäre viel zu jugendlich für sie. Ein Deodorant. Ein Parfüm.«
»Mann oder Frau?«
»Schwer zu sagen. Vielleicht sowohl als auch. Wie Calvin Kleins One. Das benutzen Frauen und Männer.«
»Fantastisch«, murmelte Nordsted. »Wir suchen also nach einem Mann oder einer Frau? Danke für den Beitrag, Tanya.«
Sie dachte, dass Nordsted als Hauptmann der Leibgarde in Afghanistan beim Erstellen der Aktionspläne und der Festlegung der Ziele immer die intelligenteste Person im Zelt gewesen war. Später war er ohne Zweifel der klügste Kopf in der Einsatzzentrale der taktischen Spezialeinheit gewesen, als Dänemark vom Terror bedroht wurde. Nordsted war einer dieser verschlossenen Menschen, die immer haarscharf mit einem Lächeln oder einem Bonmot an der Destruktion intellektuell Unterlegener vorbeischrappten. Seine Kompanie war ihrem Hauptmann wahrscheinlich, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, in die Hölle und zurück gefolgt. Wie Odysseus’ Heer.
»Ich würde den Duft wiedererkennen«, sagte sie hartnäckig.
»Hoffen wir’s«, sagte Nordsted skeptisch. »Das wäre dann die schnellste Mordermittlung in der dänischen Kriminalgeschichte, wenn Sie in fünf Minuten auf der Hauptstraße den Täter erschnüffeln.«
Zur gleichen Zeit verließ Dr. Henrik Engdal vier Kilometer von Anne Holsts Haus entfernt die herrschaftliche Familienvilla durch die Hintertür, während er sich in seine Windjacke zwängte. Er räumte ein Laufrad der Kinder vom Gartenweg und lehnte es gegen die Hecke. In der halbdunklen Garage öffnete er die Tür seines Audi A4, schob sich auf den Fahrersitz und überflog die ellenlange Einkaufsliste, die seine hochschwangere Frau ihm mitgegeben hatte.
In einer Stunde begann die Abendsprechstunde in der Klinik, die er sich mit drei anderen praktischen Ärzten und einer Physiotherapeutin teilte. Aber den Einkauf sollte er problemlos noch vorher schaffen.
Er drückte den Startknopf und hob den Kopf, als er hinter sich ein Geräusch hörte. Er warf einen Blick in den Rückspiegel und drehte sich auf dem Sitz herum, als es schlagartig dunkel wurde.
Als Dr. Engdal wieder zu sich kam, wollte er sich an den heftig schmerzenden Hinterkopf fassen, konnte aber die Hände nicht vom Lenkrad nehmen.
Den Kopf konnte er auch nicht bewegen.
Er stöhnte, würgte und erbrach sich auf seine Oberschenkel. Der Gestank seines Mageninhalts füllte den Innenraum des Wagens.
»Auuuu …«
Der Kopf. Der Hals. Alles schmerzte. Es gelang ihm mit Mühe, bis in die Lunge zu atmen.
Dann hörte er eine Stimme dicht an seinem Ohr. Leise, aber klar und deutlich.
»Dr. Engdal? Hören Sie mich?«
Er krächzte etwas Unverständliches.
»Kämpfen Sie nicht dagegen an. Das macht es nur schlimmer. Sehen Sie auf Ihre Hände. Schauen Sie!«
Der schmale Lichtkegel einer Stablampe fiel auf sein Handgelenk, und er sah, dass seine Hände mit Drahtseil und Handschellen an das Lenkrad gekettet waren. Die Finger waren bereits blau und geschwollen.
»Mein Hals …«
Eine behandschuhte Hand am Ende eines schwarzen Ärmels bewegte sich an ihm vorbei und kippte den Rückspiegel nach unten.
Der Lichtkegel.
»Da!«
Der Hals war auf die gleiche Weise wie die Handgelenke an die Nackenstütze gekettet.
Er versuchte, Speichel hinunterzuschlucken, was nahezu unmöglich war.
Die Hand drehte den Zündschlüssel halb um, worauf alle Fenster automatisch herunterfuhren.
»Sehen Sie hin!«
Der Rückspiegel rahmte das Gesicht des Fremden ein, und der Arzt stöhnte überrascht.
»Sie?«
Er kniff die Augen zu und öffnete sie wieder, was so ziemlich das Einzige war, was er in seiner hilflosen Position tun konnte. Das Gesicht im Spiegel bewegte sich keinen Millimeter. In den Augenwinkeln bildeten sich Lachfalten.
»Sie haben doch sonst keine Probleme, sich klar auszudrücken«, kam es frotzelnd vom Rücksitz. »Und, wie fühlt es sich an, so wehrlos zu sein?«
»Was … zum Teufel … Was zum Teufel wollen Sie? Was soll das Ganze?«
Seine Empörung verdrängte für einen kurzen Augenblick den gleißenden Schmerz am Hinterkopf.
»Ich will, dass Sie mir in die Augen sehen, und dann möchte ich aus Ihrem Mund hören, dass Sie mir die nötige Hilfe verweigert haben. Das ist es, was ich will, mehr nicht.«
Die Lachfalten waren ausradiert, die Pupillen groß und schwarz im Spiegel.
»Denken Sie, dass Sie das für mich tun können?«
»Und dann lassen Sie mich gehen?«
»Ja.«
»Meine Frau ist schwanger …«
»Mit Nummer vier. Ich weiß. Familie ist etwas Schönes, nicht wahr?«
Henrik Engdal schwieg.
»Ist es nicht so?« Der Tonfall war scharf und hart.
»Doch, ja.«