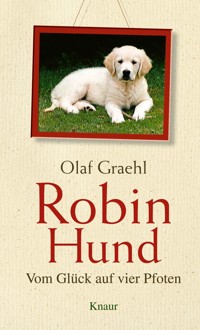
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum.« Carl Zuckmayer Goldenes Fell, bedingungslose Treue und eine leidenschaftliche Begeisterung für alles, was nach Wasser aussieht: Robin, der Golden Retriever, weiß, wie er die Menschen um die Pfote wickelt. Olaf Graehl, der Mann am anderen Ende der Leine, erzählt von den vielen skurrilen, dramatischen und berührenden Momenten mit Robin, von seiner Weisheit und vom Glück, das man nur mit einem Hund erleben kann. Robin Hund von Olaf Graehl: im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Olaf Graehl
Robin Hund
Vom Glück auf vier Pfoten
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Für meine Enkel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Epilog
Für meine Enkel
Lucie, Marilu, Enzo und Ellen,
Robins eifrigste Freunde
1.
Das einzige Mal im Leben
Katzen, sagt man, hätten sieben Leben. Sieben Mal könnten sie bei ihren wilden Jagd- und Liebesabenteuern dem Tod auf die Schippe geraten – und wieder abspringen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, und ich würde mich als Katze lieber nicht darauf verlassen.
Ich hatte einen Hund, einen Golden Retriever mit Namen Robin Hund (ja, stimmt schon, Hund, nicht Hood), der mit mir alt geworden ist. Von dem weiß ich, dass er vier Leben hatte, mindestens. Dreimal war er nahe dran, uns zu verlassen, aber er blieb. Und wenn der geliebte Hund dreimal stirbt, na ja, fast stirbt, und dann zum Glück doch nicht, gibt man sich gern der trügerischen Hoffnung hin, es werde ihm auch beim nächsten und übernächsten Mal nicht so ernst sein damit. So hat es der Robin fertiggebracht, dass ich auch die letzten Jahre unbeschwert mit ihm leben konnte, ohne bei jeder wunden Stelle im Fell und jedem Tag mit trockener Nase schon Angst vor dem Ende haben zu müssen.
Der Robin war mir ein treuer Gefährte durch sechzehn Jahre meines Lebens. Er ließ die guten Tage besser und die schlechten erträglich werden; er hat mit mir die Hügel und den See bei meinem Haus erkundet; ist mit mir sommers wie winters in die Berge gestiegen, besonders gern dort, wo Schnee lag; hat pflichteifrig mit mir Burgruinen erforscht (wobei er weniger dem Trutzigen seine Aufmerksamkeit schenkte als dem Putzigen, das heute dort in kleinen Löchern wohnt); er lag geduldig stundenlange Fahrten auf dem Rücksitz im Auto, wenn ich in Dänemark das Meer oder in der Provence nach dem Lavendel sehen wollte …
Solch schöne Jahre vergehen schnell, und das Ende der eingespielten Partnerschaft mit einem Hund kommt immer zu früh. »Als Gott die Welt erschuf, muss er wohl unerforschliche Gründe gehabt haben, dem Hunde eine etwa fünfmal kürzere Lebensdauer zuzumessen als seinem Herrn«, klagte der berühmte Gänsevater und Hundefan Konrad Lorenz. Ich kenne durchaus vernünftige Leute, die es mit Blick auf das Ende nicht wagen, einen Anfang zu machen mit einem Hund. Sie übersehen freilich, mit welcher Fülle von tagtäglichen Freuden und Erfahrungen, über ein ganzes Hundeleben hin, dieser letzte Schmerz tausendfach aufgewogen wird.
Das erste seiner vier Leben verbrauchte der Robin unter einem Auto. Meine Frau hatte eine Besucherin vor der Haustür verabschiedet, und wie es so geht, gab es auch da noch dieses und jenes zu besprechen. Als die Dame schließlich ihren kleinen Renault rückwärts aus der Hofeinfahrt steuerte, wollte das Auto auf einmal nicht mehr recht weiter. Jemand anderes wäre jetzt vielleicht erst recht aufs Gas gestiegen. Glücklicherweise aber verließ die Dame ihr Auto und schaute nach. Hinten gab es kein Hindernis, nichts. Also bückte sie sich und guckte unter den Wagen. Ihr Entsetzensschrei fuhr uns durch alle Glieder und war fast so schlimm wie das, was sie dort gesehen hatte: Platt wie ein Eisbärenfell vor dem Kamin lag der Robin eingequetscht zwischen dem Unterboden des Renault und dem Pflaster, die Pfoten breit nach vorn gestreckt, selbst sein Kopf schien flacher zu sein als sonst. Offenbar hatte er die offene Haustür zu einem Ausflug ins Freie genutzt und sich, wie er das gern tat, wenn er mitgenommen werden wollte, hinter das Auto gelegt. Als sich die Abfahrt unserer Besucherin hinzog, war er wohl eingeschlafen. Und weil der Robin damals schon nichts mehr hören konnte, hatte ihn auch das Motorengeräusch nicht geweckt.
Aber er lebte, und auch Blut war, zumindest beim ersten Hinschauen, nicht zu entdecken. Zum Glück im Unglück hatte ihn das Auto anscheinend nicht überrollt, sondern zwischen den Rädern mit der Bodenplatte in seine jetzige Form gepresst. Mit einer reichlichen Tonne Auto im Genick brachte er nicht einmal einen Ton heraus. Aber wie öfter schon, wenn er allein nicht mehr weiterwusste, in einem reißenden Bach etwa oder am steilen Abhang, schauten mich jetzt wieder seine schwarzen Augen an und sagten unhörbar, aber ganz deutlich: »Mach doch was, hol mich hier raus!«
Na klar, aber wie? Das Auto wegfahren war zu gefährlich. All die Ecken und Kanten umweltbewusster Abgasverarbeitung dort unten hätten sich in Robins Fell festhaken können. Und dann wäre doch noch Blut geflossen. Also ein Versuch mit dem Wagenheber?
»Nein, das hab ich doch nicht gewollt«, jammerte noch immer, nicht sehr hilfreich, die aufgeregte Dame und wusste nicht, wo sich das Teil in ihrem Wagen aufhielt. Der meine passte zum Glück auch und stemmte den Renault auf einer Seite hoch. Sobald der Robin die Entlastung spürte, kam Bewegung in das flache Fell, und bevor wir ihm noch weiterhelfen konnten, kroch er, oh Wunder, von ganz allein, und jetzt wieder mit normalem Kopf und Körper, unter dem Auto hervor.
Ich würde Ihnen jetzt gern erzählen, wie er begeistert an mir, seinem Retter, hochgesprungen ist, mir die Hand geleckt und mit dankbarem Augenaufschlag die Pfote hingehalten hat und so weiter, die ganze Lassie-Masche eben. Aber das soll ja ein Bericht werden und kein Roman. Also: Nichts dergleichen geschah. Anscheinend hielt Robin alle Anwesenden, mich eingeschlossen, irgendwie für sein Unglück verantwortlich, marschierte leicht hinkend und ohne uns eines weiteren Blickes zu würdigen ins Haus zurück, nahm ein paar kräftige Schlabberer aus dem Wassernapf und ließ sich auf die Schlafdecke fallen. Wir waren ihm auch so dankbar für seine Auferstehung.
Dem für Hunde/Bezirk Südbayern zuständigen Sensenmann, bairisch auch: »Boandlkramer«, hatte man, stelle ich mir vor, wegen dieses Misserfolges höheren Orts heftig den Kopf, genauer: den Knochenschädel, gewaschen. Man weiß ja, wie das heutzutage so läuft: Von Gehaltskürzung, gar Outsourcing, Jobverlust und dergleichen könnte da die Rede gewesen sein. Deshalb fühlte er sich wohl gedrängt, schon einige Monate später einen zweiten Versuch zu unternehmen. Und um diesmal ganz sicherzugehen, trieb er als Erstes meinen armen Hund im Kreis herum. Das ging dann so: Der Robin stand morgens von seiner Schlafdecke auf und drehte seinen Kopf so weit es ging nach links. Dort gab es nur die Wand der Diele, aber der Robin starrte sie an, als sähe er sie nach den zwölf Jahren in unserem Haus zum ersten Mal. Als er davon endlich genug hatte, machte er sich wie gewohnt auf zum morgendlichen Kontrollgang im Garten. Sein Kopf blieb festgezurrt auf der linken Seite. Versuchen Sie mal, in dieser Haltung durch eine Tür zu kommen! Dem Robin gelang das erst nach einer Reihe schmerzhafter Fehlversuche an den Wänden rechts und links vom Ausgang.
Im Garten, auf der großen Wiese, wurde die Sache dann noch schlimmer. Der Robin taumelte über den Rasen, als käme er vom Oktoberfest. Um das Vogelbad, seine bevorzugte Wasserstelle, zu erreichen, nahm er einen Weg, der in etwa dem Bauplan für eine Wendeltreppe entsprach. Dann kreiselte er weiter in die entlegenste Ecke des Gartens, hinter das Phloxbeet. Dort brach er zusammen. Lang hingestreckt, den schiefen Kopf auf der linken Pfote, lag er unter der noch kahlen Hecke und wollte sich nicht mehr bewegen. Es war Anfang April, die Regenschauer mit Schnee vermischt, also nicht gerade das passende Wetter für ein Nickerchen im Freien. Irgendetwas musste ich tun, um ihn dort heraus, und wieder auf die Pfoten zu bekommen. Erster Versuch: Hund hochheben und auf die Beine stellen. Aber da unten waren keine Beine, nur die weichen Fellwülste eines Kuscheltiers. Also zweiter Versuch mit der ganzen Palette seiner Lieblingskekse. Vergebens, keine Reaktion. Ich wedelte mit der Leine, was sonst laut und aufgeregt als Aufforderung zu einem Spaziergang begrüßt wurde. Half auch nichts, der Robin rührte sich nicht. Als er dann noch das Morgenfutter verweigerte, bei einem Golden Retriever bekanntlich der größte anzunehmende Störfall, ging bei uns die Alarmanlage los.
Noch gibt es nur wenige Tiernotärzte mit Rettungswagen und Blaulicht. Bei uns dafür eine weithin geschätzte Tierklinik in der Kreisstadt, die Tag und Nacht, auch sonn- und feiertags, ärztliche Hilfeleistungen jeder erforderlichen Art bereithält. Über all die Robinjahre hin war sie uns ein schützender Begleiter, sozusagen das Drahtseil neben dem Klettersteig. Wenn Hunde sich einen Nagel oder ähnlich scharfes Gefahrengut in die Pfote treten, dann sicher an Weihnachten oder einem anderen arbeitsfreien Tag.
Also 37 Kilo Robin ins Auto gestemmt und auf zu den Tierheilern. Das Gefühl der Erleichterung und der Hoffnung auf die richtige Diagnose und Medizin, wie bei früheren Ausflügen dieser Art, wollte sich diesmal nicht einstellen. Außer dem Hund schleppte ich auch noch den bedrückenden Gedanken mit mir herum, dass dies Robins letzter Weg sein, dass statt der heilenden Arznei die allerletzte Spritze auf ihn warten könnte. Dann würde er Haus und Garten – und wir ihn – nie wiedersehen. Der Robin selbst war so todmüde, dass seine sonst so sprechenden Augen keine Hilfe für meine Mutlosigkeit wussten.
In der Klinik marschierte der Robin tapfer mit schrägem Kopf, aber auf eigenen Beinen, in Richtung Behandlungszimmer und prallte erst einmal an die Wand neben der Tür. Als langjährige und prompt zahlende Patienten bekamen wir Chefbehandlung. Der wuchtige Arzt mit dem Rittergesicht und Händen für behandlungsresistente Bernhardiner zeigte sich von unserer dramatischen Kopfnummer nur mäßig beeindruckt. »Das gibt’s schon mal bei älteren Hunden«, lautete die prompte Diagnose. »Da ist etwas im Gleichgewichtsorgan durcheinandergekommen, und den Hunden wird’s dann schwindlig und übel. Das kann manchmal gefährlich werden. Aber wenn wir Glück haben, bekommen wir das in acht Tagen weg.« Ein Spritzencocktail wurde aufgezogen (geschüttelt, nicht gerührt), dem dann in der nächsten Woche ein paar weitere folgten. Zwei Tage lang gab es keine Anzeichen einer Besserung, und unsere Sorgen wurden immer größer. Dann kam Robins Kopf nach und nach in die Ausgangslage zurück, und sein Spiralgang näherte sich der Geraden. Wie es sich für einen Golden Retriever gehört, hatte er bald wieder den ganzen Tag Hunger.
In der Tierarztrechnung stand später als Diagnose »Vestibulärsyndrom«, und ich konnte in der bei den Menschenärzten so beliebten grünen Bibel nachlesen: »Sympt.: akut einsetzender Drehschwindel … Übelkeit, Erbrechen …«. Na bitte.
Nach diesem weiteren Misserfolg waren dem Boandlkramer wohl die Ideen ausgegangen. Oder es hatte dann doch den angedrohten Personalwechsel gegeben. Die nächste Attacke ließ fast ein Jahr auf sich warten. Und sie kam aus einer völlig neuen Ecke, aus heiterem Himmel, wie man so sagt, auch wenn es an diesem Tag im März dort oben mehr grau als blau zuging. Der Robin war da fast dreizehn Jahre alt.
Im Rahmen seiner mir aufgedrängten Anti-Aging-Vorsorge hatte er an diesem feuchtkalten Nachmittag einen längeren Spaziergang gewählt. Ziel: die noch fast touristenfreie Standpromenade. Dort war um diese Jahreszeit, und der Robin hatte das sicher berücksichtigt, fast immer mit anderen Hunden zu rechnen. So auch dieses Mal. Und da die anderen Besitzer ebenfalls Tierfreunde waren und den Leinenzwang ignorierten, kamen bald, den Strand hinauf und hinunter, fröhliche Haschmichspiele in Gang, wie sie nicht nur bei Hunden verschiedenen Geschlechts so beliebt sind. Des Frühlings holder, belebender Blick hatte zu dieser Zeit unseren See noch nicht gestreift, noch versteckte er sich unter einer dünnen, weißen Eisdecke.
Der Robin hatte sich ausgerechnet zwei junge Hündinnen, schlanke, schnelle Mischlingsdamen, als Spielgruppe ausgesucht. Irgendwie peinlich, wie er da, als gesetzter älterer Herr, den spielenden Mädchen nachdackelte, Geheimrat Robin mit den Levetzow-Mädchen. (Ja, ist mir schon klar, das gehört sich nicht, Goethe und der Hund in einen Topf … Aber das in die Jahre gekommene Genie hat sich damals bei der Ulrike von L. auch nicht gerade, na ja, goethemäßig benommen.)
Richtig schlimm wurde es, und da blieb mir zum ersten Mal fast das Herz stehen, als die beiden Mädels ihre Rennstrecken auf das Eis verlegten. Das hielt zunächst für ein, zwei Runden. Dann, etwa dreißig Meter vom Ufer entfernt, brachen sie ein. Da war der Robin auch schon auf dem See, mein hektisches Schreien und Pfeifen drang nicht durch seine tauben Ohren. Dafür hörte ich gleich darauf das Knirschen von brechendem Eis, und schon strampelte der Robin zusammen mit den verlockenden Damen im eiskalten Wasser. Was jetzt?
»Hilf mir, hol mich hier raus!«, wieder einmal. Und diesmal wusste ich wirklich nicht, wie ich das anstellen sollte. Bin ich denn ein Eisbrecher? Die Nummer mit dem Wagenheber war da ja wohl eher eine Anfängerübung gewesen.
Am Ufer versammelten sich bereits die ersten Unfallgucker. Handys wurden gezückt und eifrig bedient, aber ohne Erfolg. War ja wohl auch kein Fall für die Polizei. In unserem kleinen Ort gibt es eine gutgerüstete freiwillige Feuerwehrtruppe, aber die hätte man erst mit Sirenengeheul von ihren Arbeitsplätzen aufscheuchen müssen. Und bis dahin wäre für den Robin in seiner eisigen Falle das Ende längst gekommen.
Die beiden jungen Hündinnen hatten sich inzwischen, leicht und beweglich wie sie waren, auf dickeres Eis und von dort ans sichere Ufer gerettet. Nur der Robin paddelte weiter in dem Wasserloch. Immer wieder versuchte auch er, mit seinen Vorderpfoten auf das Eis zu kommen. Wenn er es einmal schaffte, brach es gleich wieder unter ihm weg. Und er wurde müde, seine Bewegungen langsamer. Spätestens jetzt war klar, dass er es von allein nie schaffen würde, sich aus dem Loch zu befreien. Irgendwie musste ich zu ihm hinaus, auf Seehundart vielleicht oder sonstwie die dreißig Meter Eis zu der Einbruchstelle überwinden.
Bis zu den Knien im kalten Wassers, versuchte ich also, mich bäuchlings auf das dünne Eis zu legen. Aber wenn es den Robin schon nicht getragen hatte, wieso dann mich mit dem, trotz leidlichem Body-Mass-Index, doppelten Gewicht. Hoffnungslos. Ich brach ein und stand nun bis zum Bauch im Wasser. Immer noch gut zwanzig Meter entfernt, hielt der Robin seinen Kopf tapfer, aber mühsam über der Eiskante. Jetzt kam mir ein jüngerer Mann, Hundemensch auch er und Bewohner eines Hauses an der Strandpromenade, mit einer langen Aluleiter zu Hilfe. Wir legten sie flach auf das Eis, und ich versuchte von neuem mein Glück in der Waagerechten. Keine Chance. Unter meinem Gewicht brach auch die Leiter ein. Leiter also dankend zurück. Aber da, wo sie eingebrochen war, gab es jetzt eine Schneise durch die Eiskruste, und ich kam meinem Hund ein paar Meter näher. Allerdings auch immer tiefer ins kalte Wasser. Deutlich konnte ich jetzt Robins stumm um Hilfe rufende Augen erkennen.
In diesem Augenblick gab einer aus dem Katastrophe-live-Publikum am Ufer, mit erwartungsvollem Schauer in der Stimme, seine Zuschauererwartung zum Besten: »Wirst sehn, der macht’s nimmer lang.«
Das hatte mir gefehlt! Meinem Hund beim Ertrinken zuschauen, täte euch so passen. Zur Sorge um den Robin kam jetzt auch die Wut. Und die brachte mir endlich eine Idee: Wenn das Eis, selbst unter der Leiter, so leicht brach, könnte ich dann nicht die Schneise bis zu ihm verlängern, eine Art Fahrrinne öffnen? Bin ich vielleicht doch ein Eisbrecher? Nass war ich jetzt eh schon fast überall. Am Ende der Leiterrinne war das Eis dünn und ließ sich leicht eindrücken. Das Wasser ging mir hier bis zur Brust. Vier, fünf Meter schaffte ich auf diese Weise. Dann kam die festere Eisdecke, die den beiden Hundemädchen zur Rettung verholfen hatte. Da war es mit dem Eisbrechen auf einmal zu Ende, alles Drücken und Hämmern mit den Fäusten half nichts. Und Robins Schwimmbewegungen wurden erkennbar immer langsamer.
Seltsam, was einem das Kopfkino in solch einem Augenblick für Filme einspielt. In einem Fernsehbericht hatte ich vor vielen Monaten einem russischen Eisbrecher in der Arktis bei seiner Arbeit zugeschaut, einem Kraftprotz aus zusammengeschweißten Panzerplatten, Arnold Schwarzenegger als Schiff, sozusagen. Die Eisdecke vor seinem scharfen Bug zersplitterte am Anfang wie Butterkekse. Doch dann wurde sie dicker, und er konnte sie nicht mehr aufschneiden. Da schob er sich dank kluger Ballasttechniken auf das Eis hoch und durchbrach es mit seinem Riesengewicht von oben. Diese Bilder hatte ich jetzt ganz deutlich vor Augen und wusste, was zu tun war: Ich stieß mich unten vom kiesigen Seegrund ab. Zum Glück ist man ja im Wasser leicht, auch mit vollgesogenen Kleidern. So konnte ich mich mit dem Oberkörper ein Stück weit auf das Eis schieben.
Die Russenmethode hatte Erfolg. Über Wasser half mir das Gewicht meiner nassen Kleider, auch das dickere Eis brach. Jetzt stand ich bis zu den Schultern im See. Der Robin war noch tiefer ins Wasser gesunken, hielt aber seine Schnauze tapfer nach oben, um weiter Luft zu bekommen. »Halt um alles in der Welt durch, Hund! Ich kann nicht auch noch nach dir tauchen!« In wilder Eile arbeitete ich mich weiter zum Wasserloch hin. Meine Beine da unten waren inzwischen gefühlsmäßig aus der Leitung gegangen, taten aber irgendwie noch ihren Dienst. Das Eis wurde zum Glück wieder dünner, ließ sich mit den Händen zerkleinern. Hochspringen war jetzt nur noch schwer möglich, das Wasser stand mir mittlerweile bis unter das Kinn. Bis zum Robin waren es noch etwa drei Meter. Würde ich die weiterhin auf dem Seegrund laufen können? Ein nasser Sack, wie ich einer war, schwimmt nicht.
Als mir der See schließlich in den Mund hinein- wollte, lag zwischen mir und dem Robin immer noch ein guter Meter. Laufen ging nicht mehr, aber Hüpfen, auf den Zehenspitzen. Jetzt also Wasserballett, ich gab den Nurejew als Kröte. Aber ich kam vorwärts. Der Robin schwamm, soweit er in seinem Wasserloch konnte, auf mich zu. Dann versank er das erste Mal ganz unter Wasser und arbeitete sich nur mühsam noch einmal hoch. Also jetzt oder nie mehr! Noch einen Sprung, eher Hüpfer, meine letzte Kugel im Lauf, eine zweite hatte ich nicht. Das Wasser stand mir an den Augen, und die tiefgekühlten Beine waren weiter nicht zu spüren. Aber sie brachten mich noch einmal über das Eis, der ausgestreckte Arm ging Richtung Hundekopf, aber dann versank ich und drückte ihn mit unter Wasser. Himmel, war’s das jetzt, war alles umsonst gewesen? Erst nach ein paar schrecklich langen Sekunden bekam ich das Halsband zu fassen, hüpfte ein weiteres Mal und konnte den Robin hoch und durch den festen Rand des Wasserlochs in die offene Schneise ziehen. Sofort begriff er meine brauchbare Leistung als Amateur-Eisbrecher, bekam vor Freude die zweite Luft und paddelte in meiner Fahrrinne dem Ufer zu.
Vom Publikum am Strand gab es Beifall, wie man mir später erzählte. Ich hatte da noch Wasser in den Ohren. Na ja, ein paar sollen auch enttäuscht gewesen sein, weil ihnen mein Hund nichts vorgestorben hatte. Recht geschehen ist ihnen.
Diesmal aber kann ich – wahrheitsgemäß – von Treue und Dankbarkeit meines Hundes berichten: Der Robin hatte das Ufer längst erreicht, während ich noch auf gefühllosen Beinen einen Teil vom See in meinen Kleidern durch die Eisrinne schleppte. Er schüttelte sich so heftig, dass er beinahe von den Beinen flog. Dann schaute er sich um und sah mich noch immer im Wasser. Ohne zu zögern, rannte er zurück in den See, der ihn eben erst fast das Leben gekostet hatte, und schwamm, wieder in der Schneise, mir entgegen. Er blieb bei mir, bis er sicher sein konnte, dass auch ich das Ufer erreicht hatte. Beifall vom Publikum für die Zugabe.
Der Mann mit der Leiter versorgte mich in seinem Haus mit Handtüchern und Bademantel, bis ich mit einem trockenen Satz Kleidung abgeholt wurde. Zum Glück war der Boden seines Wohnzimmers mit Fliesen belegt, so dass der neue See um meine und Robins Füße keinen größeren Schaden anrichtete. Später bekam ich einen Schnupfen und musste leichte Erfrierungen an den Beinen behandeln lassen. Beim Robin dauerte es, trotz Warmluftdusche, über einen Tag, bis sein dichtes Unterfell wieder trocken war. Weiter fehlte ihm nichts.
Er dankte mir die Rettung damit, dass er noch weitere drei Jahre bei mir blieb.
Von seinen vier Leben war die Rede gewesen. Die hatte er irgendwann wohl verbraucht, mehr standen ihm nicht zur Verfügung, leider. Das Ende kam rasch, aber nicht so, wie jeder Hundebesitzer es sich wohl wünscht, als ein schneller, natürlicher Tod. Etwa von seinem sechzehnten Geburtstag an hatte der Robin immer größere Schwierigkeiten, aus dem Liegen auf seine vier Beine zu kommen, bis dann, etwa zwei Monate später, alle mühevollen Versuche vergebens blieben. Ich musste zu Hilfe kommen und ihn aufheben, um dem hilflosen Gestrampel ein Ende zu machen. Aber auch danach blieb jeder Schritt ein schwankendes Wagnis, die Vorstellung eines schlechten Seiltänzers. Und kaum hatte der Robin den Garten erreicht, fiel er ins Gras. Dort ließ er sich mit sichtbarem Genuss die Sonne auf seinen müden Körper scheinen und die steifen Gelenke erwärmen. Wenigstens in dieser Zeit fühlte er sich noch wohl.
So vergingen zwei, drei Wochen. Immer noch kam der Robin mit meiner Hilfe auf die Beine und taperte ins Freie, an seinen guten Tagen sogar zu einem Altherrenspaziergang in Zeitlupe um das Haus. Doch dann schmeckte ihm auf einmal auch das Fressen nicht mehr. Der gefüllte Napf, den er jeden Tag mit Ungeduld erwartet und mit Begeisterung leergefressen hatte, war ihm plötzlich zuwider. Einmal daran riechen, ein kleiner Happen, das war’s. Und dabei blieb es, tagelang. Wir wissen, das bedeutet höchste Alarmstufe bei einem Vielfraß wie dem Golden Retriever.
Die wölfischen Vorfahren unserer Hunde waren mit Genügsamkeit und Ausdauer für den Fall ausgerüstet, dass sie längere Zeit kein Jagdglück und deshalb nichts zu fressen hatten. So wäre es wohl auch dem Robin, ihrem entfernten Verwandten und Erben möglich gewesen, noch Tage, vielleicht Wochen, ohne feste Nahrung weiterzuleben. Und wir hätten auf Besserung und Wiederkehr des Hungers hoffen können – oder ihm beim Verhungern zusehen müssen. Dann aber holte der verdammte Boandlkramer, um dieses Mal wirklich sicherzugehen, zu einem letzten Schlag aus.
An einem Morgen, Anfang September, weckte mich ein Geräusch aus der Diele, ein gurgelndes Röcheln, als ob da jemand gegen das Ertrinken kämpfen müsste. Hatte es der See doch einmal bis in mein Haus geschafft? Nein, Unsinn. Da würde ja auch der ganze westliche Landkreis im Wasser stehen. Das schwere, mit irgendetwas Flüssigem kämpfende Schnauben kam vom Robin, der zwar trocken auf seiner Decke lag, aber offenbar eine Menge Wasser in seinen Atemwegen hatte. Als ich mich neben ihn kniete, hob er mühsam den Kopf, und wieder einmal glaubte ich in seinen Augen das »Gell, du machst was« zu lesen. Ich versuchte, ihn meine Hoffnungslosigkeit nicht merken zu lassen, und nahm das Telefon, um den Tierarzt zu uns ins Haus zu bestellen. Die mühsame Reise in die Kreisstadt-Praxis wollte ich dem Robin ersparen.
Der Doktor kam schnell und stellte tatsächlich Wasser in der Lunge fest. Das sei, wie bei uns Menschen, die typische Folge eines schwachgewordenen Herzens. Man könnte es, meinte er, mit Medikamenten kurzfristig in den Griff bekommen. Doch für wie lang? Und statt des verweigerten Fressens müsste man den Robin künstlich ernähren, ihn vielleicht an den Tropf hängen. Keine Dauerlösung und mit weiterem Leid für den Hund verbunden, dem man ja nicht erklären konnte, wozu das alles mit ihm geschah. Die Beinschwäche würde ihm trotzdem bleiben und dem zum Rennen geschaffenen Hund für immer die Beweglichkeit nehmen.
Uns Menschen lässt man ja häufig die letzten Tage, oft Wochen, vor dem Tod leiden, verlängert diese Tortur auch noch – gegen angemessenes Honorar, versteht sich – durch allerlei Tabletten und teure Apparaturen. Da haben es unsere Hunde besser. Nicht freilich ihre Menschen, die irgendwann die letzte Endscheidung, das, nun ja, Todesurteil fällen müssen. Ein wenig half mir der Ruf unseres Tierarztes, von dem allgemein bekannt war, dass er noch nie einen lebensfähigen Hund totgespritzt hatte, nur weil die Besitzer vielleicht auf etwas anderes oder Jüngeres aus waren. Als er mir, sichtlich betrübt, mitteilte, er sehe fast nur noch die eine Möglichkeit, dem Hund weiteres Leiden zu ersparen, da wusste ich, dass ich jetzt, dem Robin zuliebe, seinem Medikamententod zustimmen musste. Immerhin hatte er weit über alle Erwartungen für einen Golden Retriever gelebt und war, nach Menschenjahren, über hundert geworden. Aber das tröstete mich in keiner Weise, als ich da über das Ende eines Hundes entscheiden musste, der sein Leben vertrauensvoll in meine Hände gelegt hatte.
»Unsere Hunde«, wusste ein Kenner, »bereiten uns nur ein einziges Mal in ihrem Leben wirklichen Kummer: wenn sie sterben.« Und sage jetzt bitte niemand »es ist doch nur ein Hund«, so wie man sagt »es war ja nur ein Auto«, wenn man jemanden trösten will, der sein teures Teil in den Graben gesetzt hat. Freut sich etwa Ihr Auto, wenn Sie zu ihm auf den Parkplatz zurückkommen? Na bitte.





























