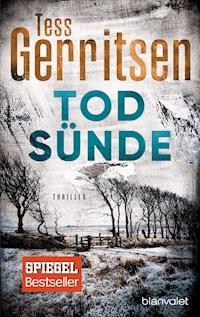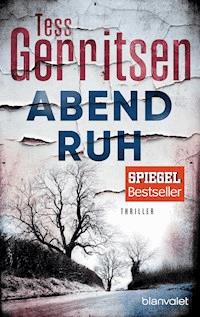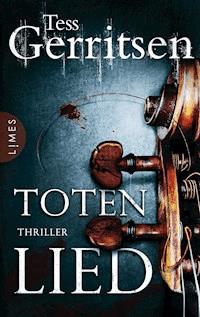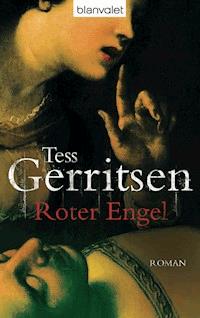
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Während die junge Ärztin Toby Harper Nachtschicht hat, taucht in der Notaufnahme ein alter Mann auf. Er redet wirr, reagiert kaum auf ihre Behandlung - und ist so schnell verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Als im Krankenhaus ein Patient mit den gleichen Symptomen stirbt, vermutet der Pathologe Daniel Dvorak eine hochansteckende Krankheit. Die Spur der beiden Patienten führt zur Seniorenresidenz Brant Hill. Und dort stoßen Toby und Daniel auf Unvorstellbares ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
TESS GERRITSEN
Roter Engel
Roman
Deutsch von Klaus Kamberger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Life Support« bei Pocket Books, a division of Simon & Schuster Inc., New York.
Copyright der Originalausgabe © 1997 by Pocket Books, a division of Simon & Schuster Inc., New York Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1998 by Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Design Team Umschlagmotiv: akg-images/Joseph Martin; Detail aus Caravaggio: Samson und Delila, 1610 MD • Herstellung: Heidrun Nawrot
eISBN: 978-3-641-16414-0V003
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Für Jacob, Adam und Josh,die Männer in meinem Leben
1
So ein Skalpell ist wunderschön.
Das war Dr. Stanley Mackie zuvor nie aufgefallen. Doch als er jetzt, den Kopf gesenkt, unter den hellen OP-Lampen stand, gefiel es ihm, wie die scharfe Schneide das Licht funkelnd reflektierte. Ein kleines Kunstwerk, dieses halbmondförmige, rasiermesserscharfe Stück aus rostfreiem Stahl. So schön, daß er kaum wagte, es in die Hand zu nehmen, weil er fürchtete, am Ende seine magische Aura zu zerstören. Auf der Klinge spiegelte sich das Licht in seinem ganzen Spektrum, wie ein kleiner Regenbogen.
»Dr. Mackie? Stimmt etwas nicht?«
Er sah auf. Die OP-Schwester neben ihm runzelte die Stirn über ihrem Mundschutz. Er hatte bisher noch nie gemerkt, wie grün ihre Augen waren. Anscheinend sah er eine Menge Dinge zum erstenmal, oder er nahm sie erstmals zur Kenntnis. Ihre zarte, cremefarbene Haut. Die Ader, die über ihre Schläfe lief. Das kleine Muttermal direkt über ihrer Augenbraue.
War es wirklich ein Muttermal? Es bewegte sich, kroch wie ein mehrbeiniges Insekt auf ihren Augenwinkel zu…
»Stan?« Dr. Rudman, der Anästhesist, wandte sich an ihn. Seine Stimme fuhr in Mackies Gedanken. »Geht es Ihnen gut?«
Mackie schüttelte den Kopf. Das Insekt verschwand. Es war jetzt wieder ein Muttermal, ein kleiner dunkler Pigmentfleck auf der blassen Haut der Schwester. Er holte tief Luft, nahm das Skalpell vom Instrumententablett und sah auf die Frau vor ihm auf dem Operationstisch.
Die Overhead-Lampe war bereits auf das Abdomen der Patientin ausgerichtet. Die blauen Abdecktücher gaben ein Rechteck frei, das ihre Haut zeigte. Es war ein schöner, flacher Bauch mit den Konturen eines Bikinihöschens, die die beiden hochstehenden Hüftknochen miteinander verbanden – ein seltener Anblick in dieser Zeit der Schneegestöber und der winterblassen Gesichter. Was für eine Schande, daß er in diese jungfräuliche Bauchdecke einen Schnitt machen mußte. Bestimmt würde die Blinddarmnarbe in Hinkunft all die schönen karibischen Brauntöne verschandeln.
Er setzte die Spitze der Klinge auf die Haut, genau auf den Mac-Burney-Punkt zwischen dem Nabel und dem hervorstehenden rechten Hüftknochen. Annähernd der Punkt, an dem der Appendix sich befand. Das Skalpell war stichbereit an der Stelle, da hielt er plötzlich inne.
Seine Hand zitterte.
Er verstand es nicht. Das war ihm bisher noch nie passiert. Stanley Mackie hatte immer die ruhigsten Hände gehabt, die man sich denken konnte. Und nun mußte er sich furchtbar anstrengen, das Skalpell auch nur festzuhalten. Er schluckte und hob die Klinge ein wenig an. Ganz ruhig. Tief durchatmen. Das geht vorbei.
»Stan?«
Mackie sah auf. Jetzt runzelte Dr. Rudman die Stirn. Und auch die beiden Schwestern. Mackie las die Fragen in ihren Augen, die gleichen Fragen, die man sich seit Wochen über ihn zuflüsterte. Ist der alte Dr. Mackie noch auf der Höhe? Sollte man ihm mit seinen 74 Jahren noch erlauben zu operieren? Er ignorierte ihre Blicke. Er hatte sich bereits vor dem Ausschuß verteidigt, vor dem er seine Arbeit zu verantworten hatte. Er hatte die Umstände zu ihrer Zufriedenheit erklärt, die zum Tod seines letzten Patienten geführt hatten. Das Chirurgenhandwerk war schließlich keine Kunst ohne Risiko. Wenn zuviel Blut in die Bauchhöhle floß, dann passierte es nun einmal zu leicht, daß man nicht mehr die richtige Stelle fand und einen falschen Schnitt ansetzte.
Der Ausschuß hatte ihn, dies alles wohl wissend, von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen.
Trotzdem waren dem medizinischen Stab des Krankenhauses Zweifel geblieben. Er sah es den Gesichtern der Schwestern und der gerunzelten Stirn Dr. Rudmans an. Alle Blicke waren auf ihn gerichtet. Und plötzlich spürte er auch noch andere Blicke. Oberhalb von ihm schwebten Augäpfel zu Dutzenden in der Luft, und alle starrten ihn an.
Er blinzelte. Die schreckliche Vision war wieder vorbei.
Meine Brille, dachte er. Ich muß unbedingt meine Brille überprüfen lassen.
Ein Schweißtropfen rann ihm über die Wange. Er faßte den Griff des Skalpells fester. Das hier war nur eine schlichte Blinddarmoperation, eine Aufgabe, die man sogar einem Anfänger zumuten konnte. Natürlich konnte er so etwas auch noch mit zitternden Händen.
Er konzentrierte sich auf die Bauchdecke seiner Patientin, auf dieses flache, goldbraune Stück Haut. Jennifer Halsey, 36 Jahre alt. Sie kam aus einem anderen Bundesstaat und war heute morgen in ihrem Bostoner Motel mit Schmerzen im rechten unteren Quadranten aufgewacht. Die Schmerzen waren immer heftiger geworden, und so war sie durch dichtes Schneetreiben halbblind zur Notaufnahme des Wicklin Hospitals gefahren und dem diensthabenden Chirurgen unters Messer geraten: Dr. Mackie. Von den Gerüchten um seine nachlassenden Fähigkeiten und den falschen Anschuldigungen hinter seinem Rücken, die langsam sein Können und seine Erfahrung immer mehr in Frage stellten, wußte sie nichts. Sie war bloß eine Frau mit Schmerzen im Bauch, der der entzündete Blinddarm herausgenommen werden mußte.
Er drückte die Klinge auf Jennifers Haut. Seine Hand war wieder ruhig. Er konnte es. Natürlich konnte er es. Er setzte den Schnitt, glatt und sauber. Die OP-Schwester assistierte ihm, reichte ihm Tupfer, tupfte selbst Blut ab. Er schnitt tiefer durch das subkutane Fett, hielt immer wieder an und kauterisierte. Kein Problem. Alles lief perfekt. Er würde es schaffen, den Appendix entfernen, zumachen. Dann würde er am Nachmittag heimgehen. Nach einer kleinen Ruhepause würde er wieder einen klaren Kopf haben.
Er drang durch das schimmernde Bauchfell in die Bauchhöhle. »Zurückziehen«, sagte er.
Die OP-Schwester setzte die Haken an und zog die Wunde vorsichtig auf.
Mackie faßte hinein und spürte den Darm warm und glitschig zwischen seinen behandschuhten Fingern. Was für ein wunderbares Gefühl, seine Hände in der Wärme eines menschlichen Körpers zu bergen. Es war wie eine Rückkehr in den Mutterschoß. Er hob den Appendix heraus. Ein kurzer Blick auf das rotgeschwollene Gewebe sagte ihm, daß er korrekt diagnostiziert hatte. Dieser Blinddarm mußte entfernt werden. Er griff nach dem Skalpell.
Nur als er sich den erforderlichen Schnitt noch einmal genau anschaute, merkte er, daß etwas nicht stimmte.
In der Bauchhöhle war viel mehr Eingeweide, doppelt soviel, wie zu erwarten. Viel mehr, als die Frau brauchte. Das war nicht in Ordnung. Er griff nach einer kleinen Darmschlinge, spürte, wie sie ihm glatt und warm über die Hand glitt. Mit dem Skalpell trennte er das überschüssige Stück Darm ab und warf das tropfende Ende in den Instrumentenkorb. Na also, dachte er. Das sah doch schon viel ordentlicher aus.
Die OP-Schwester starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen über den Mundschutz an. »Was tun Sie denn da?« schrie sie.
»Zuviel Eingeweide«, antwortete er ruhig. »Das braucht sie nicht.« Er griff in die Bauchhöhle und packte eine neue Darmschlinge. Kein Bedarf für soviel überflüssiges Gedärm. Verlegte ihm nur den Blick auf die wesentlichen Dinge.
»Dr. Mackie, nein!«
Er säbelte weiter. Blut schoß im hohen Bogen aus dem abgetrennten Stück.
Die Schwester packte seine Hände in dem dünnen Handschuh. Er schüttelte sie wütend ab. Was für eine Unverfrorenheit, daß eine schlichte Schwester es wagte, die Prozedur zu unterbrechen.
»Ich will eine andere OP-Schwester«, verlangte er gebieterisch. »Absaugen. Das Blut muß umgehend abgesaugt werden.«
»Haltet ihn auf! Helft mir, ihn aufzuhalten…«
Mit seiner freien Hand griff Mackie nach dem Saugrohr und schob es in die Bauchhöhle. Blut gurgelte durch die Röhre und rann ins Reservoir.
Eine Hand packte seinen Kittel und zog ihn vom Operationstisch weg. Es war Dr. Rudman. Mackie versuchte, auch ihn abzuschütteln. Aber Rudman ließ nicht los.
»Legen Sie das Skalpell hin, Stan.«
»Sie muß ausgeräumt werden. Viel zuviel Gedärme.«
»Legen Sie es hin!«
Mackie riß sich los und baute sich vor Rudman auf. Daß er das Skalpell noch in der Hand hielt, war ihm gar nicht mehr bewußt. Die Klinge schlitzte den Hals des anderen auf.
Rudman schrie auf und drückte die Hand gegen seinen Hals.
Mackie trat einen Schritt zurück und starrte auf das Blut, das zwischen Rudmans Fingern hervorquoll. »Nicht meine Schuld«, sagte er. »Das ist nicht meine Schuld!«
Eine Schwester kreischte in die Sprechanlage: »Schickt den Sicherheitsdienst! Er dreht uns hier durch. Wir brauchen augenblicklich den Sicherheitsdienst!«
Mackie stolperte durch rutschige Blutpfützen weiter nach hinten. Rudmans Blut. Jennifer Halseys Blut. Ein See, der sich immer weiter ausbreitete. Er drehte sich um und war mit einem Satz aus dem Raum.
Sie rannten ihm nach. Er floh in blinder Panik durch den Gang und irrte durch das Labyrinth von Fluren und Korridoren. Wo war er? Warum kam ihm nichts mehr bekannt vor? Dann sah er geradeaus vor sich ein Fenster und dahinter den wirbelnden Schnee. Schnee. Das kalte weiße Element da draußen würde ihn reinigen, seine Hände von all dem Blut säubern.
Von hinten näherten sich Schritte. Jemand rief: »Halt!«
Mit drei schnellen Sätzen stand Mackie vor dem hellen Rechteck.
Glas zersplitterte in tausend Stücke. Die kalte Luft pfiff um sein Gesicht, und alles war weiß. Ein schönes, kristallenes Weiß. Und er stürzte.
2
Draußen war es glühend heiß. Doch der Fahrer hatte die Klimaanlage voll aufgedreht, und Molly Picker saß fröstelnd auf dem Rücksitz des Wagens. Die kalte Luft blies in Kniehöhe aus den Lüftungsschlitzen und fuhr ihr messerscharf unter den Minirock. Sie beugte sich vor und klopfte gegen das Plexiglas der Trennscheibe.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie. »Hey, Mister. Könnten Sie wohl die Klimaanlage herunterdrehen? Mister?« Sie klopfte noch einmal.
Der Fahrer schien sie nicht zu hören. Vielleicht ignorierte er sie auch. Außer seinem blonden Hinterkopf sah sie nichts von ihm.
Bibbernd schlang sie die nackten Arme um die Brust und rutschte zur Seite, weg vom Luftstrom. Am Fenster glitten die Straßen von Boston vorbei. Sie nahm die Gegend gar nicht richtig wahr, aber sie wußte, daß sie in südlicher Richtung fuhren. Das hatte jedenfalls auf dem letzten Straßenschild gestanden: Washington Street, South. Jetzt fiel ihr Blick auf Häuser wie Kästen und vergitterte Fenster. Davor saßen Männer mit verschwitzten Gesichtern auf den Veranden. Noch nicht einmal Juni, und die Temperaturen gingen schon auf die dreißig Grad zu. Molly mußte sich nur die Leute auf der Straße ansehen, dann wußte sie schon, wie heiß es war. Ihre herunterhängenden Schultern, ihre zeitlupenhaften Bewegungen auf den Gehsteigen. Molly sah sich gerne Leute an. Meistens die Frauen, denn die fand sie viel interessanter. Sie musterte ihre Kleider und fragte sich, warum einige in der Sommerhitze Schwarz trugen, warum die Fetten unter ihnen mit ihren dicken Hinterteilen ausgerechnet bunte Stretchhosen anhatten und warum heutzutage niemand einen Hut trug. Sie beobachtete, wie die Hübschen sich bewegten, wie ihre Hüften dabei leicht schwangen und ihre Füße perfekt auf hohen Hacken balancierten. Über was für Geheimnisse verfügten hübsche Frauen, die ihr selbst nicht vertraut waren? Was hatten ihre Mamas ihnen beigebracht, was Molly nicht gelernt hatte? Sie sah sich lange und genau ihre Gesichter an und hoffte auf tiefere Einblicke, was es denn eigentlich war, das eine Frau schön erscheinen ließ und die andere nicht. Was für eine besondere Ausstrahlung sie hatten, die sie, Molly Picker, nicht besaß.
Der Wagen hielt an einer roten Ampel. Vorn an der Ecke stand eine Frau auf hohen Plateausohlen, die Hüfte weit vorgeschoben. Eine Nutte, genau wie Molly, aber älter –vielleicht achtzehn, mit glänzend schwarzem Haar, das ihr dicht auf die bronzefarbenen Schultern fiel. Schwarze Haare hätte sie auch gerne, dachte Molly sehnsüchtig. Das machte etwas her. Es war keine Sowohl-als-auch-Farbe wie bei Mollys schlaffen Strähnen, die weder blond noch braun waren und nach überhaupt nichts aussahen. Die Fenster ihres Wagens waren dunkel getönt, und das schwarzhaarige Mädchen konnte nicht sehen, wie Molly sie anstarrte. Doch sie schien es zu spüren, denn langsam drehte sie sich auf ihren Absätzen um und schaute zu ihr.
So hübsch war sie gar nicht.
Molly lehnte sich zurück und war komischerweise enttäuscht.
Der Wagen bog nach links ab und fuhr in südöstlicher Richtung weiter. Sie waren inzwischen weit weg von Mollys Heimatbezirk und auf dem Weg in eine ihr zugleich unbekannte und furchteinflößende Gegend. Die Hitze hatte die Leute aus ihren Wohnungen vor die Tür getrieben. Sie saßen jetzt in ihren schattigen Eingängen und fächelten sich Kühle zu. Ihre Blicke folgten dem vorbeifahrenden Wagen. Sie wußten, daß er nicht in ihre Gegend gehörte. So, wie Molly wußte, daß sie nicht hierhergehörte. Wohin schickte Romy sie denn nur?
Er hatte ihr keine Adresse genannt. Normalerweise bekam sie eine hingekritzelte Hausnummer in die Hand, und sie mußte dann selbst zusehen, wie sie ein Taxi organisierte. Doch diesmal hatte ein Wagen vor der Tür auf sie gewartet. Und auch noch ein sauberer. Ohne die einschlägigen Flecken auf dem Rücksitz und ohne zusammengeknüllte, stinkende Papiertaschentücher im Aschenbecher. Alles sauber und ordentlich. In so einem sauberen Wagen hatte sie noch nie gesessen.
Der Fahrer bog nach links in eine schmale Straße. Hier saß niemand draußen auf dem Gehsteig, aber sie wußte, man beobachtete sie. Sie konnte es spüren. Sie wühlte in ihrer Handtasche, fischte eine Zigarette heraus und zündete sie an. Sie hatte gerade zwei Züge gemacht, da meldete sich plötzlich eine geisterhafte Stimme und sagte: »Machen Sie sie bitte aus.«
Molly sah sich überrascht um. »Wie bitte?«
»Ich habe gesagt, machen Sie sie aus. Das Rauchen im Wagen ist verboten.«
Sie wurde rot und drückte die Zigarette im Aschenbecher aus. Dann entdeckte sie den kleinen Lautsprecher in der Trennscheibe.
»Hallo? Können Sie mich hören?« fragte sie.
Keine Antwort.
»Falls ja, könnten Sie dann wohl die Klimaanlage abschalten? Ich friere hier hinten. Hallo, Mister? Fahrer?«
Der kalte Luftstrom brach ab.
»Vielen Dank«, sagte sie. Und mit unterdrückter Stimme: »Arschloch.«
Dann fand sie den Schalter für die Fensterscheibe und ließ das Fenster einen Spalt herunterfahren. Der Geruch des Sommers in der Stadt wehte herein, heiß und schweflig. Die Hitze machte ihr nichts aus. Das war wie zu Hause. Wie in all den feuchten und schweißtreibenden Sommern ihrer Kindheit in Beaufort. Verdammt, sie brauchte jetzt eine Zigarette. Aber sie hatte keine Lust, über die kleine scheppernde Anlage mit ihm zu streiten.
Der Wagen fuhr langsamer, hielt an. Aus dem Lautsprecher kam die Stimme: »Wir sind da. Sie können jetzt aussteigen.«
»Was? Hier?«
»Das Haus da vorne rechts.«
Molly äugte hinaus. Ein dreistöckiges Haus aus braunem Sandstein. Die Fenster im Erdgeschoß waren mit Brettern vernagelt. Auf dem Gehsteig verstreut lagen Glasscherben. »Sie machen wohl Scherze«, sagte sie.
»Die Eingangstür ist offen. Gehen Sie hoch in den zweiten Stock. Dann ist es die letzte Tür rechts. Sie brauchen nicht zu klopfen. Gehen Sie einfach hinein.«
»Von so was wie dem hier hat Romy nicht gesprochen.«
»Romy sagt, Sie machen mit.«
»Ja, also…«
»Das gehört nur zum Vorspiel, Molly.«
»Was für’n Vorspiel?«
»Denen des Kunden. Sie wissen ja, wie das ist.«
Molly seufzte tief und starrte noch einmal zu dem Haus hinüber. Die Kunden und ihre Phantasien. Und was hatte dieser Kerl für einen beschissenen Wunschtraum? Es zwischen Kakteen und Kakerlaken mit ihr zu treiben? Ein bißchen Gefahr, ein bißchen im Dreck wühlen, damit es etwas aufregender wurde? Warum paßten die Phantasien ihrer Kunden nie zu ihren eigenen? Ein sauberes Hotelzimmer, ein kleiner Whirlpool. Richard Gere und Pretty Woman beim Sektschlürfen.
»Er wartet.«
»Ja, ich geh’ schon, ich geh’ schon.« Molly schob die Tür auf und stellte die Füße auf den Bordstein. »Und Sie warten auf mich, ja?«
»Genau hier.«
Sie sah zum Haus und atmete tief durch. Dann stieg sie die Stufen hoch und ging hinein.
Drinnen sah es so schlimm aus, wie sie von außen geahnt hatte. Schmierereien an den Wänden, überall Zeitungsfetzen auf dem Boden. Rostende Sprungfedern. Eine einzige Müllhalde.
Sie stieg die Treppen hinauf. Es war unheimlich still im ganzen Haus, und das Klappern ihrer Schuhe hallte im Treppenhaus wider. Als sie im ersten Stock war, waren ihre Handflächen feucht. So etwas machte alles andere als einen guten Eindruck. Überhaupt keinen guten.
Sie blieb am Treppenabsatz stehen und sah hinauf zum nächsten Stockwerk. In was, zum Teufel, hast du mich da hineingebracht, Romy? Was ist das überhaupt für ein Kunde?
Sie wischte die feuchten Hände an der Bluse ab, holte noch einmal tief Luft und nahm die nächsten Stufen. Im dritten Stock blieb sie am Ende des Flurs vor der letzten Tür rechts stehen. Aus dem Zimmer drang ein Summen – eine Klimaanlage? Sie öffnete die Tür.
Ein Schwall kühler Luft schlug ihr entgegen. Sie ging hinein und stellte angenehm überrascht fest, daß sie in einem Zimmer mit seinerzeit einmal ganz weiß gestrichenen Wänden stand. Mitten im Raum stand so etwas wie ein Untersuchungstisch, wie sie ihn aus der Arztpraxis kannte. Er war mit braunem Vinyl bezogen. Von der Decke hing eine Lampe von gewaltigen Ausmaßen. Weitere Möbel gab es nicht, nicht einmal einen Stuhl.
»Hallo, Molly.«
Sie wirbelte herum und suchte den Mann, der gerade ihren Namen genannt hatte. Doch niemand sonst war im Zimmer. »Wo sind Sie?« wollte sie wissen.
»Keine Angst. Ich bin nur ein bißchen scheu. Ich möchte dich erst einmal ansehen.«
Mollys Blick fiel auf einen Spiegel an der weiter von ihr entfernten Wand. »Sie sind dahinter, nicht? Ist das so eine verspiegelte Scheibe?«
»Sehr gut erkannt.«
»Was soll ich tun?«
»Mit mir reden.«
»Das ist alles?«
»Es kommt dann noch mehr.«
Klar. Immer kam noch mehr. Sie ging fast beiläufig zum Spiegel. Er hatte gesagt, er sei scheu. Das gab ihr ein besseres Gefühl. Damit behielt sie die Sache in der Hand. Sie stand da, eine Hand in der Hüfte. »Okay. Wenn Sie sich mit mir unterhalten wollen, Mister, es ist Ihr Geld.«
»Wie alt bist du, Molly?«
»Sechzehn.«
»Kommt deine Periode regelmäßig?«
»Was?«
»Deine Menstruation.«
Sie mußte lachen. »Nicht zu fassen.«
»Antworte auf meine Frage.«
»Ja, eher regelmäßig.«
»Und deine letzte Periode hattest du vor zwei Wochen?«
»Woher wissen Sie denn das?« trumpfte sie auf. Doch dann schüttelte sie den Kopf und murmelte: »Ach. Von Romy.« Romy wußte natürlich Bescheid. Er wußte es immer, wenn bei einem seiner Mädchen die Tante zu Besuch war.
»Bist du gesund, Molly?«
Sie starrte in den Spiegel. »Sehe ich etwa nicht so aus?«
»Keine Blutkrankheit? Hepatitis? HIV?«
»Ich bin sauber. Bei mir fangen Sie sich nichts ein, wenn das Ihre Sorge ist.«
»Syphilis? Tripper?«
»Hören Sie«, schnappte sie zurück. »Wollen Sie mich nun flachlegen oder nicht?«
Ein Moment Stille. Dann wieder die Stimme, ganz sanft: »Zieh dich aus.«
Das gefiel ihr schon besser. Das war es, was sie erwartet hatte.
Sie trat näher an den Spiegel, so nah, daß ihr Atem sich auf der Scheibe niederschlug. Er wollte bestimmt alle Einzelheiten sehen. Das wollten sie immer. Sie fing an, die Bluse aufzuknöpfen. Ganz langsam. Sie gab eine Vorstellung. Dabei dachte sie an nichts, ließ sich in einen Raum fallen, in dem keine Männer mehr existierten. Sie bewegte die Hüften wie zum Takt einer Musik. Die Bluse glitt von ihren Schultern und fiel auf den Boden. Ihre Brüste waren jetzt nackt, und die Brustwarzen versteiften sich in der kühlen Luft. Sie schloß die Augen. Irgendwie machte sie es alles besser. Bring es hinter dich, dachte sie. Mach es ihm und dann wieder raus ins Freie.
Sie öffnete den Reißverschluß an ihrem Rock und stieg heraus. Dann zog sie das Höschen aus. Alles geschah mit geschlossenen Augen. Romy hatte zu ihr gesagt, sie habe einen schönen Körper. Wenn sie den nur richtig einsetze, werde kein Mensch merken, wie gewöhnlich ihr Gesicht sei. Also gebrauchte sie jetzt ihren Körper und tanzte zu einem Rhythmus, den nur sie allein hörte.
»Schön«, sagte der Mann. »Du kannst aufhören zu tanzen.«
Sie öffnete die Augen und starrte verblüfft in den Spiegel. Dort sah sie sich selber. Strähnige hellbraune Haare. Kleine, aber spitze Brüste. Hüften, so schmal wie bei einem Jungen. Als sie mit geschlossenen Augen getanzt hatte, hatte sie eine Rolle gespielt. Nun stand sie vor ihrem eigenen Spiegelbild. Ihrem wahren Selbst. Unwillkürlich kreuzte sie die Arme vor ihrer nackten Brust.
»Auf den Tisch«, sagte er.
»Bitte?«
»Den Untersuchungstisch. Leg dich hin.«
»Ja, sicher. Wenn es das ist, was Sie antörnt.«
»Das ist es, was mich antörnt.«
Jedem das Seine. Sie kletterte auf den Tisch. Der Vinylbezug war kalt unter ihren nackten Pobacken. Sie legte sich hin und wartete, daß etwas passierte.
Eine Tür ging auf, und sie hörte Schritte. Sie sah genau hin, als der Mann an das Fußende der Liege trat und sich über sie beugte. Er war ganz in Grün gekleidet. Von seinem Gesicht sah sie nur die Augen, stahlblau und kalt. Sie sahen sie über einen Mundschutz hinweg an.
Erschreckt setzte sie sich auf.
»Hinlegen«, befahl er.
»Was, zum Teufel, haben Sie vor?«
»Ich sagte hinlegen.«
»Mann, ich haue ab von hier, wenn…«
Er packte sie am Arm. Erst da merkte sie, daß er Handschuhe trug. »Hör mal, ich will dir nicht weh tun«, sagte er mit sanfterer Stimme. In freundlicherem Ton. »Verstehst du denn nicht? Das hier ist meine Phantasie.«
»Sie meinen, den Doktor zu spielen?«
»Ja.«
»Und ich bin Ihre Patientin?«
»Ja. Macht dir das angst?«
Sie saß da und überlegte. Dachte an all die anderen Phantasien, für die sie ihren Kunden zur Verfügung gestanden hatte. Diese hier schien ihr vergleichsweise eher harmlos.
»In Ordnung«, seufzte sie und legte sich wieder hin.
Aus dem Tisch wurde jetzt ein gynäkologischer Stuhl. Der Mann zog seitlich zwei Beinstützen heraus. »Komm, Molly«, sagte er. »Du weißt doch bestimmt, was du jetzt mit deinen Beinen zu machen hast.«
»Muß ich?«
»Du weißt, ich bin der Doktor.«
Sie starrte in sein maskiertes Gesicht und fragte sich, was sich wohl hinter dem rechteckigen Schutz über Mund und Nase verbarg. Zweifellos ein ganz gewöhnlicher Mann. Sie waren alle so gewöhnlich. Es waren ihre Phantasien, die sie abstießen. Die ihr angst machten.
Zögernd hob sie die Beine und legte sie in die Halterung.
Er klappte das untere Ende des Untersuchungstischs über ein Scharnier nach unten. Sie lag jetzt mit weit gespreizten Schenkeln, und ihr Po hing praktisch über der Kante des Tischs. Sie bot sich Männern immer dar. Doch in dieser Lage fühlte sie sich schrecklich verwundbar. Dieses helle Licht, das ihr zwischen die Beine leuchtete. Ihre totale Nacktheit auf dem gynäkologischen Stuhl. Und der Mann, dessen Blick mit klinischem Gleichmut auf ihre intimsten Körperteile gerichtet war.
Er band einen Kunstfaserriemen um ihr Fußgelenk.
»Hey«, sagte sie. »Ich mag nicht angebunden werden.«
»Aber ich mag es«, murmelte er und band ihr den anderen Riemen um. »Mir gefallen meine Mädchen so.«
Sie zuckte zusammen, als seine behandschuhten Finger in sie eindrangen. Er beugte sich über sie, und vor Konzentration wurden seine Augen schmaler, während seine Finger tiefer drangen. Sie schloß die Augen und versuchte, an etwas anderes zu denken als an das, was da zwischen ihren Beinen passierte. Aber was sie spürte, machte es ihr schwer, alles einfach zu ignorieren. Wie ein Nagetier, das sich tief in sie vergrub. Eine Hand hielt er auf ihren Bauch gepreßt, und die Finger der anderen bewegten sich in ihr. Irgendwie verletzte sie das mehr als jeder ordinäre Fick, und sie wünschte sich, es wäre aus und vorbei. Törnt dich das an, du Widerling? dachte sie. Steht er dir? Wann geht es weiter?
Er zog die Hand zurück. Erleichtert atmete sie auf. Sie öffnete die Augen. Er sah sie gar nicht mehr an. Sein Blick fixierte statt dessen etwas außerhalb ihres Sichtbereichs. Er nickte.
Erst da merkte sie, daß noch jemand im Zimmer war.
Jemand preßte ihr eine Gummimaske auf Mund und Nase. Sie wollte sich wegdrehen, aber ihr Kopf wurde gewaltsam niedergedrückt. Sie griff mit den Händen zum Gesicht und zerrte wütend an der Narkosemaske. Sofort wurden ihre Hände weggerissen und an den Gelenken festgebunden. Ein beißender Gasgeruch stieg ihr in die Nase und kratzte im Hals. Sie mußte krampfhaft husten, bäumte sich auf, aber sie wurde die Maske nicht los. Sie mußte wieder einatmen. Ihre Glieder verloren alles Gefühl. Das Licht schien schwächer zu werden. Aus dem hellen Weiß wurde ein mattes Grau.
Dann Schwarz.
Sie hörte eine Stimme. »Nimm jetzt das Blut ab.«
Doch sie verstand nicht mehr, was das bedeutete. Überhaupt nicht.
»Mann, o Mann, was für eine Sauerei.«
Das war Romys Stimme – soviel begriff sie. Ansonsten begriff sie nichts. Wußte nicht, wo sie war. Wo sie gewesen war.
Warum ihr der Kopf weh tat und die Kehle sich so trocken anfühlte.
»Na, komm, Molly Wolly. Mach die Augen auf.«
Sie stöhnte. Selbst dies genügte schon, daß ihr der Kopf dröhnte.
»Mach deine verdammten Augen auf, Molly. Du verstinkst das ganze Zimmer.«
Sie rollte sich auf den Rücken. Das Licht schimmerte blutrot durch ihre Augenlider. Mit Mühe bekam sie sie auf und sah in Romys Gesicht.
Er starrte sie angewidert aus seinen dunklen Augen an. Sein schwarzes Haar klebte am Kopf und glänzte von Pomade. Es reflektierte das Licht wie ein Helm. Auch Sophie war da und grinste höhnisch, die Arme über ihrem Ballonbusen verschränkt. Sophie und Romy so nah beieinander stehen zu sehen, ganz wie ein altes Liebespaar, machte Molly noch kränker. Vielleicht waren sie ja noch zusammen. Diese Sophie mit ihrem Pferdegesicht hing ständig in seiner Nähe herum und versuchte, Molly auszustechen. Und jetzt stand sie sogar in Mollys Zimmer, war einfach hereingekommen, obwohl sie gar kein Recht dazu hatte.
Aufgebracht versuchte Molly, sich zu setzen, aber dann sah sie nichts mehr und fiel zurück auf ihr Bett. »Mir ist schlecht«, sagte sie.
»Schlecht ist dir gewesen«, sagte Romy. »Und jetzt mach dich mal sauber. Sophie hilft dir.«
»Sie soll mich nicht anrühren. Raus mit ihr.«
Sophie schnaufte. »In deiner vollgekotzten Bude hält mich nichts, Miss Ohne-Titten«, sagte sie und marschierte hinaus.
Molly stöhnte. »Ich weiß gar nicht, was passiert ist, Romy.«
»Nichts ist passiert. Du bist nach Hause gekommen und hast dich ins Bett gelegt. Und dein Kissen vollgekotzt.«
Wieder ruderte sie, um hochzukommen. Er half ihr nicht, faßte sie nicht einmal an. Sie roch ganz fürchterlich. Er war schon auf dem Weg zur Tür und wollte sie ihr verdrecktes Laken allein abziehen lassen.
»Romy«, sagte sie.
»Ja?«
»Wie bin ich hierhergekommen?«
Er lachte. »Meine Güte, dich hat es aber wirklich erwischt, nicht?« Dann war er aus dem Zimmer.
Sie saß eine Zeitlang auf der Bettkante und versuchte, sich an die letzten Stunden zu erinnern. Bemühte sich, ihre restliche Benommenheit abzuschütteln.
Es hatte da einen Kunden gegeben – daran zumindest erinnerte sie sich. Einen Mann ganz in Grün. Einen Raum mit einem riesigen Spiegel. Und da war ein Tisch gewesen.
Doch an den Sex konnte sie sich nicht erinnern. Vielleicht hatte sie den verdrängt. Vielleicht war es eine so abstoßende Erfahrung gewesen, daß sie es weggeschoben hatte, genau wie sie so viele Dinge aus ihrer Kindheit erfolgreich verdrängt hatte. Nur hin und wieder ließ sie einen kleinen Erinnerungsfetzen aus der Kindheit auftauchen. Meistens waren es die schönen Dinge. Ein paar schöne Erinnerungen an die Zeit, als sie in Beaufort aufwuchs, hatte sie schon, und sie konnte sie willkürlich wieder heraufbeschwören. Oder genauso unterdrücken.
Doch an das, was an diesem Nachmittag vorgefallen war, konnte sie sich kaum erinnern.
Mein Gott, wie sie stank. Sie sah hinunter auf ihre Bluse. Voll von Erbrochenem. Die Knöpfe waren falsch zugeknöpft, und an einer verschobenen Stelle schaute die nackte Haut heraus.
Sie zog sich aus, schob den Minirock hinunter, knöpfte die Bluse auf und warf beides in einem Haufen auf den Fußboden. Dann stolperte sie ins Badezimmer und drehte die Dusche auf.
Kalt. Sie wollte es kalt haben.
Unter dem Wasserstrahl wurde der Kopf langsam klarer. Dabei flackerte ein anderes Stück Erinnerung auf. Der Mann in Grün, wie er über ihr stand. Auf sie herabsah. Und die Riemen an Hand- und Fußgelenken.
Sie sah sich ihre Hände an und entdeckte die Druckstellen, die wie die runden Abdrücke von Handschellen aussahen. Er hatte sie festgebunden – nicht besonders ungewöhnlich. Männer und ihre hirnrissigen Spiele.
Dann blieb ihr Blick an einem anderen Bluterguß hängen, in ihrer linken Armbeuge. Er war so schwach, daß sie die kleine blaue Stelle fast übersehen hätte. Mitten in dem runden Fleck war ein winziger Einstich zu sehen.
Hatte sie eine Nadel gespürt? Sie konnte sich, sosehr sie sich auch anstrengte, an nichts dergleichen erinnern. Nur an den Mann mit der Maske.
Und an den Tisch.
Das kalte Wasser tropfte ihr auf die Schultern. Molly schüttelte sich, schaute auf den Nadelstich und fragte sich, was sie wohl sonst noch vergessen hatte.
3
Aus der Sprechanlage an der Wand kam die Stimme einer Schwester: »Dr. Harper, wir brauchen Sie hier.«
Toby Harper schreckte hoch. Sie war an ihrem Schreibtisch eingenickt, mit einem Stapel medizinischer Fachzeitschriften als Kopfkissen. Zögernd hob sie den Kopf und blinzelte ins Licht der Leselampe. Der Wecker in seinem Messinggehäuse auf dem Schreibtisch zeigte vier Uhr neunundvierzig morgens. Hatte sie wirklich fast vierzig Minuten geschlafen? Es kam ihr vor, als hätte sie den Kopf nur einen Augenblick niedergelegt. Die Wörter in dem Artikel, den sie gelesen hatte, hatten angefangen, vor ihren Augen zu verschwimmen: Sie hatte sich einen Moment Ruhe gegönnt. Nichts anderes hatte sie gewollt, nur eine kurze Erholung von dem langweiligen Text und der schmerzhaft kleinen Schrift. Die Zeitschrift lag noch aufgeschlagen mit dem Artikel vor ihr, den sie zu lesen versucht hatte. Jetzt sah man den Abdruck ihres Gesichts auf der Seite. »Eine randomisierte Kontrollstudie zum Vergleich der Ergebnisse bei der Anwendung von Lamivudin und Zidovudin bei HIV-Patienten mit weniger als 500 CD4+-Zellen pro Kubikzentimeter«. Sie klappte die Zeitschrift zu. Mein Gott. Kein Wunder, daß sie eingeschlafen war.
An der Tür klopfte es. Maudeen steckte den Kopf ins Bereitschaftszimmer. Maudeen Collins, Exsanitätsoffizier der U. S. Army, hatte ein Organ wie ein Megaphon – was man nicht gerade erwartete, wenn man diese einsfünfundfünfzig große Elfe vor sich sah. »Toby? Sie haben doch nicht etwa geschlafen?«
»Ich glaube, ich habe ein wenig gedöst. Was ist denn?«
»Wir haben einen entzündeten Zeh.«
»Jetzt?«
»Der Patient hat kein Colchicin mehr, und er fürchtet, seine Gicht hat ihn wieder.«
Toby stöhnte auf. »Herrgott noch mal. Warum denken diese blöden Patienten denn nie im voraus?«
»Sie halten uns für eine Tag-und-Nacht-Apotheke. Na gut, wir nehmen erst mal noch seine Personalien auf. Lassen Sie sich ruhig Zeit.«
»Ich bin gleich da.« Nachdem Maudeen wieder weg war, ließ Toby sich auch die nötige Zeit, bis sie ganz wach war. Sie wollte schließlich halbwegs vernünftig klingen, wenn sie mit dem Patienten sprach. Sie stand vom Schreibtisch auf und ging zum Waschbecken. Seit zehn Stunden war sie nun im Dienst, und bis jetzt war die Schicht ohne Vorkommnisse verlaufen. Das war das Angenehme, wenn man in einem ruhigen Vorort wie Newton arbeitete. Es gab oft lange Phasen, in denen in der Notaufnahme des Springer Hospitals absolut nichts los war und Toby sich bei Bedarf im Bereitschaftszimmer auf dem Bett ausstrecken und ein Nickerchen machen konnte. Sie wußte, daß die anderen Ärzte der Notaufnahme das grundsätzlich taten, aber Toby widerstand gewöhnlich der Versuchung. Sie bekam ihr Geld dafür, daß sie die zwölfstündige Nachtschicht arbeitend verbrachte, und es schien ihr und ihrem Beruf nicht angemessen, irgendeine Stunde davon im weggetretenen Zustand zu verbringen.
Soviel zum beruflichen Aspekt, dachte sie und starrte ihr Spiegelbild an. Sie war während der Arbeit eingeschlafen, und die Folgen davon konnte sie in ihrem Gesicht studieren. Ihre grünen Augen waren verquollen. Druckerschwärze vom Blatt der Zeitschrift hatte ihr ein paar Worte auf die Wange geschmiert. Ihre teure Frisur aus dem Coiffeursalon sah aus, als wäre jemand mit dem Schneebesen hindurchgefahren. Die blonden Haare standen in krausen Büscheln vom Kopf ab. Das war also die stets korrekte und immer elegante Dr. Harper – so elegant nun auch wieder nicht.
Mit gerümpfter Nase beugte sich Toby zum Wasserhahn und rieb energisch die Druckerschwärze aus ihrem Gesicht. Auch das Haar befeuchtete sie und kämmte es mit den Fingern zurück. Soviel zum Thema teure Haarschnitte. Jedenfalls sah sie jetzt nicht mehr aus wie ein zerrupfter Löwenzahn in Blond. Gegen die geschwollenen Augen und den erschöpften Anblick, den sie bot, konnte sie nichts unternehmen. Mit ihren achtunddreißig Jahren konnte Toby die Nächte nicht mehr so zum Tag machen, wie seinerzeit als fünfundzwanzigjährige Medizinstudentin.
Sie ging aus dem Zimmer und den Flur hinunter zur Notaufnahme.
Niemand zu sehen. Der Empfang war unbesetzt, das Wartezimmer leer. Sie rief: »Hallo?«
Über die Sprechanlage meldete sich eine Stimme. »Dr. Harper?«
»Wo seid ihr denn alle?«
»Im Aufenthaltsraum. Könnten Sie wohl mal herkommen?«
»Wartet denn nicht ein Patient auf mich?«
»Wir haben da ein Problem. Wir brauchen Sie jetzt sofort.«
Ein Problem? Das Wort gefiel Toby gar nicht. Gleich ging ihre Pulsfrequenz nach oben. Sie eilte zum Aufenthaltsraum und stieß die Tür auf.
Ein Blitzlicht platzte los. Sie blieb wie erstarrt stehen, während ein vielstimmiger Chor einsetzte:
»Happy birthday to you! Happy birthday to you…«
Über Tobys Kopf flatterten rote und grüne Papierschlangen. Dann sah sie die Torte mit den brennenden Kerzen – Dutzende. Bei den letzten Tönen des Geburtstagsständchens schlug sie die Hände vor das Gesicht und stöhnte. »Ich glaube es einfach nicht. Ich hatte es total vergessen.«
»Wir aber nicht«, sagte Maudeen und schoß noch ein Foto mit ihrer Instamatic. »Sie werden heute siebzehn, ja?«
»Das würde ich gerne. Welcher Witzbold hat denn die Unmengen von Kerzen angesteckt?«
Morty, der Labortechniker, hob sein fettes Händchen. »Hey, niemand hat mir gesagt, wann ich aufhören sollte.«
»Na ja, Morty wollte eben testen, ob unsere Sprinkleranlage ordentlich funktioniert…«
»In Wirklichkeit ist es ein Lungentest«, sagte Val, die andere Notaufnahmeschwester. »Um ihn zu schaffen, müssen Sie sie alle auf einen Schlag auspusten, Toby.«
»Und wenn nicht?«
»Dann müssen wir intubieren!«
»Los, Toby. Wünschen Sie sich was!« forderte Maudeen sie auf. »Groß muß er sein, dunkel und gutaussehend.«
»In meinem Alter entscheide ich mich lieber für klein, dick und reich.«
Arlo, der Wachmann, meldete sich zu Wort. »Hey! Zwei von den drei Qualifikationen bringe ich schon mit.«
»Und eine Frau hast du auch schon«, wies Maudeen ihn zurecht. »Los,Tobe! Einen Wunsch!«
»Ja, einen Wunsch.«
Toby setzte sich vor die Torte. Die vier anderen umringten sie, drängelten und kicherten wie herumbalgende Kinder. Sie waren für sie so etwas wie eine zweite Familie, zwar nicht über Blutsbande mit ihr und untereinander verbunden, wohl aber durch die vielen Jahre, die sie sich gemeinsam in der Notaufnahme um Kranke und Verletzte gekümmert hatten. Mit Nanny-Brigade hatte Arlo auch den passenden Namen für das Team gefunden. Maudeen, Val und die Frau Doktor. Na dann, alles Gute, sollte mal ein männlicher Patient mit einem urologischen Problem bei ihnen vorsprechen. ..
Einen Wunsch, dachte Toby. Was wünsche ich mir denn? Wo fange ich an? Sie holte Luft und blies. Alle Kerzen verlöschten, von heftigem Applaus begleitet.
»Ging ja«, sagte Val und fing an, die Kerzen aus der Torte zu ziehen. Plötzlich sah sie zum Fenster und mit ihr auch die anderen.
Ein Streifenwagen der Polizei von Newton war mit Blaulicht vorgefahren.
»Ein Kunde«, sagte Maudeen.
»Okay«, seufzte Val, »Arbeit für die Damen. Und ihr Jungs eßt nicht die ganze Torte auf, während wir weg sind.«
Arlo beugte sich zu Morty hinüber und flüsterte: »Ach, die Mädchen sind ohnehin immer auf Diät…«
Toby ging voraus. Die Frauen waren gerade im Empfangsbereich, als die automatische Tür zur Notaufnahme aufsprang.
Ein junger Cop steckte den Kopf herein. »Hey, wir haben da einen alten Knaben im Wagen. Haben ihn aufgelesen, als er durch den Park spazierte. Wollen die Damen ihn sich mal ansehen?«
Toby folgte dem Cop nach draußen auf den Parkplatz. »Ist er verletzt?«
»Sieht nicht so aus. Aber er ist ziemlich durcheinander. Alkohol habe ich keinen gerochen. Ich glaube, er hat Alzheimer. Oder einen Diabetesschock.«
Toll, dachte Toby. Ein Cop, der sich für einen Doktor hält. »Ist er voll bei Bewußtsein?« fragte sie.
»Ja. Er sitzt auf dem Rücksitz.« Der Cop öffnete die Hintertür des Streifenwagens.
Der Mann war völlig nackt. Er saß in sich zusammengesunken, ein Bündel aus dünnen Armen und Beinen. Sein kahler Kopf wackelte vor und zurück. Er murmelte etwas vor sich hin, doch sie konnte es nicht richtig verstehen. Irgend etwas wie, daß er jetzt aber ins Bett müsse.
»Habe ihn auf einer Parkbank gefunden«, sagte der andere Cop, der sogar noch jünger aussah als sein Kollege. »Da hatte er noch seine Unterwäsche an, aber im Wagen hat er sie dann ausgezogen. Seine übrigen Sachen haben wir im Park verstreut gefunden. Sie liegen auf dem Vordersitz.«
»Okay, wir holen ihn besser rein.« Toby nickte Val zu, die schon mit einem Rollstuhl bereitstand.
»Na, komm, Kumpel«, forderte der Cop ihn auf. »Diese netten Ladys werden sich um dich kümmern.«
Der Mann krümmte sich noch mehr zusammen und fing an, auf seinen schmächtigen Pobacken hin und her zu schaukeln. »Ich finde meinen Schlafanzug nicht…«
»Wir besorgen Ihnen einen«, sagte Toby. »Kommen Sie zu uns herein, Sir. Wir fahren Sie in diesem Rollstuhl.«
Der alte Mann wandte langsam seinen Kopf zu ihr und sah sie an. »Aber ich kenne Sie nicht.«
»Ich bin Dr. Harper. Darf ich Ihnen aus dem Auto helfen?« Sie streckte ihm ihre Hand entgegen.
Er überlegte, als hätte er nie zuvor eine Hand gesehen. Schließlich faßte er nach ihr. Sie legte ihm den Arm um den Leib und half ihm heraus. Es war, als hebe sie ein Reisigbündel auf. Val schob hastig den Rollstuhl näher, als dem Mann die Beine zu versagen drohten. Sie setzten ihn in den Rollstuhl und stellten seine nackten Füße auf die Fußstützen. Dann rollte Val ihn durch die Tür in die Notaufnahme. Toby und einer der beiden Babyface-Cops folgten ihnen mit wenigen Schritten Abstand.
»Irgend etwas zur Vorgeschichte?« fragte Toby ihn.
»Nichts, Ma’am. Er konnte uns keinerlei Angaben machen. Sieht nicht so aus, als wäre er verletzt oder so.«
»Hat er einen Ausweis oder so etwas?«
»In seiner Hosentasche steckt eine Brieftasche.«
»Okay, wir müssen uns mit seinen nächsten Verwandten in Verbindung setzen und herausbekommen, ob er irgendwelche medizinischen Probleme hat.«
»Ich hole seine Sachen aus dem Wagen.«
Toby ging ins Untersuchungszimmer.
Maudeen und Val hatten ihn schon auf die Rollbahre gelegt und banden seine Gelenke fest. Er brabbelte immer noch etwas von seinem Schlafanzug und machte halbherzige Versuche, sich aufzusetzen. Bis auf ein Tuch, das sie ihm schützend über die Leistengegend gelegt hatten, war er nackt. Hin und wieder bekam er auf seiner bloßen Brust und an den Armen eine Gänsehaut.
»Er sagt, sein Name sei Harry«, sagte Maudeen und schob ihm die Manschette eines Blutdruckmeßgeräts über den Arm. »Kein Ehering. Keine sichtbaren Blutergüsse. Riecht, als könnte er ein Bad gebrauchen.«
»Harry?« sagte Toby. »Tut Ihnen irgend etwas weh? Haben Sie irgendwelche Schmerzen?«
»Machen Sie das Licht aus. Ich will ins Bett.«
»Harry…«
»Bei diesem Licht kann ich nicht schlafen.«
»Blutdruck hundertfünfzig zu achtzig«, sagte Maudeen. »Puls bei hundert, regelmäßig.« Sie nahm das elektronische Thermometer. »Komm, Süßer. In den Mund damit.«
»Ich habe keinen Hunger.«
»Das ist nicht zum Essen, mein Lieber. Ich will nur Ihre Temperatur messen.«
Toby trat für einen Moment einen Schritt zurück und sah den Mann nur an. Er konnte alle Glieder bewegen, und wenn er auch eher dünn war, wirkte er doch ordentlich ernährt. Seine Muskeln waren schlank und zäh. Was sie störte, war seine mangelhafte Körperpflege. Die grauen Bartstoppeln in seinem Gesicht waren mindestens schon eine Woche alt, und die Fingernägel waren schmutzig und ungeschnitten. Und was den Geruch anging, hatte Maudeen recht. Harry brauchte eindeutig ein Bad.
Das elektronische Thermometer piepte. Maudeen zog es ihm aus dem Mund und runzelte beim Ablesen die Stirn. »Siebenunddreißig neun. Sie fühlen sich wohl, mein Bester?«
»Wo ist mein Pyjama?«
»Junge, Sie können aber auch nur an eines denken.«
Toby leuchtete mit einer Minitaschenlampe in seinen Mund und zählte fünf Goldkronen. Man mußte sich nur die Zähne eines Menschen ansehen, dann konnte man eine Menge über seinen sozioökonomischen Status erfahren. Goldfüllungen und Goldkronen bedeuteten Mittelklasse oder mehr. Zerklüftete Zähne und Karieslöcher bedeuteten leeres Bankkonto. Oder eine selbstzerstörerische Angst vorm Zahnarzt. Sein Atem roch nicht nach Alkohol und auch nicht fruchtig, was auf Diabetes-Ketose hätte schließen lassen.
Sie begann mit der äußeren Untersuchung des Schädels, fuhr mit den Fingern über die Kopfhaut, entdeckte aber keine auffallenden Frakturen oder Schwellungen. Auch die Pupillenreflexe, die sie mit der Lampe prüfte, waren normal. Das gleiche galt für die Bewegung der Augen und den Schluckreflex. Alle Kranialnerven schienen intakt.
»Gehen Sie doch endlich«, sagte er. »Ich möchte schlafen.«
»Haben Sie sich irgendwo verletzt, Harry?«
»Ich finde meinen verdammten Pyjama nicht. Haben Sie mir den weggenommen?«
Toby sah Maudeen an. »Okay, nehmen wir ihm jetzt etwas Blut ab. Ganzes Blutbild. Toxisch bedingte Veränderungen, Sauerstoffsättigung. Dann Elektrolysewerte, Glucotest. Vielleicht müssen wir auch die Blase katheterisieren.«
»Alles klar.« Maudeen hielt schon Staubinde und Aufziehspritze bereit. Val hielt den Arm des Mannes, Maudeen nahm das Blut ab. Der Patient schien den Nadelstich in die Vene kaum zu spüren.
»In Ordnung, mein Bester«, sagte Maudeen und drückte etwas Mull auf die Einstichstelle. »Sie sind ein sehr guter Patient.«
»Wissen Sie, wo ich meinen Pyjama gelassen habe?«
»Ich besorge Ihnen gleich einen neuen. Warten Sie einen Augenblick.« Maudeen sammelte die Röhrchen mit den Blutproben ein. »Ich schicke Sie erst einmal unter Mr. Mustermann ins Labor.«
»Er heißt nicht Myer oder Miller und auch nicht Mustermann«, sagte einer der Cops, »sondern Harry Slotkin.« Er war mittlerweile vom Streifenwagen zurück und stand nun mit Harrys Hosen in der Tür. »Habe seine Brieftasche gecheckt. Nach seiner I.D.-Karte ist er sechsundsiebzig Jahre alt und wohnt 119 Titwillow Lane. Das ist weiter geradeaus in dem neuen Brant-Hill-Wohnpark.«
»Die nächsten Verwandten?«
»Es gibt eine Notiz für Notfälle. Man soll einen Daniel Slotkin verständigen. Eine Telefonnummer in Boston.«
»Ich rufe ihn an«, sagte Val. Sie ging hinaus und zog den Trennvorhang hinter sich zu.
Toby blieb allein bei ihrem Patienten. Sie setzte die Untersuchung fort, hörte Herz und Lunge ab, tastete den Bauch ab, fühlte die Sehnen. Sie pikte, stocherte, drückte, fand aber nichts Ungewöhnliches. Vielleicht ist es tatsächlich Alzheimer, dachte sie, trat wieder einen Schritt zurück und studierte den Patienten. Die Anzeichen eines Alzheimer kannte sie nur zu gut: das zerbröselnde Gedächtnis, die nächtliche Herumwanderei. Das Auseinanderfallen der Persönlichkeit, der langsame Verfall Stück für Stück. Dunkelheit machte diese Patienten unruhig. Wenn das Tageslicht nachließ, schwand auch ihr visueller Bezug zur Wirklichkeit. Vielleicht war Harry Slotkin ein Opfer des Sonnenuntergangs – die Nachtzeit-Psychose war unter Alzheimer-Patienten sehr verbreitet.
Toby nahm das Klemmbrett für das Notaufnahmeprotokoll in die Hand und schrieb ihre Hieroglyphen für »vitale Werte stabil« und »Pupillenreaktion gleichmäßig« hinein.
»Toby?« rief Val durch den Vorhang. »Ich habe Mr. Slotkins Sohn am Apparat.«
»Komme«, sagte Toby. Sie drehte sich um und wollte den Vorhang aufziehen. An den Instrumentenwagen, der gleich dahinter stand, dachte sie nicht. Sie stieß gegen das Tablett, das obenauf lag. Ein stählerne Brechschale fiel polternd auf den Boden.
Toby bückte sich und hob sie auf, als sie hinter sich ein anderes Geräusch hörte – ein seltsames, rhythmisches Rascheln. Sie sah zur Rollbahre.
Harry Slotkins rechtes Bein zuckte vor und zurück.
Hatte er einen Anfall?
»Mr. Slotkin!« sagte Toby. »Sehen Sie mich an. Harry, sehen Sie mich an!«
Der Blick des Mannes richtete sich auf ihr Gesicht. Er war bei Bewußtsein, konnte Anweisungen noch befolgen. Seine Lippen bewegten sich, formten Worte, aber alles ohne Ton.
Das Zucken hörte plötzlich auf, und das Bein lag still.
»Harry?«
»Ich bin so müde«, sagte er.
»Was war das denn gerade, Harry? Haben Sie versucht, Ihr Bein zu bewegen?«
Er schloß die Augen und seufzte. »Machen Sie das Licht aus.«
Toby sah ihn mit gerunzelter Stirn an. War das ein Anfall gewesen? Oder bloß ein Versuch, das angebundene Fußgelenk freizubekommen? Er schien jetzt wieder ganz ruhig zu sein. Beide Beine waren bewegungslos.
Sie ging durch den Trennvorhang und zum Schwesternschreibtisch.
»Der Sohn auf Leitung drei«, sagte Val.
Toby nahm den Hörer auf. »Hallo, Mr. Slotkin? Hier ist Dr. Harper vom Springer Hospital. Vor ein paar Minuten ist Ihr Vater hier in unsere Notaufnahme eingeliefert worden. Er scheint keine Verletzungen zu haben, aber er…«
»Was ist passiert?«
Toby machte eine Pause. Die Schärfe, mit der Daniel Slotkin zurückfragte, überraschte sie. War das Ärger in seiner Stimme oder Angst? Ruhig antwortete sie: »Man hat ihn in einem Park gefunden. Die Polizei hat ihn hergebracht. Er ist agitiert und verwirrt. Ich kann keine fokalen neurologischen Probleme entdecken. Hat Ihr Vater eine Alzheimer-Anamnese? Oder sonst ein medizinisches Problem?«
»Nein. Nein, er ist nie krank gewesen.«
»Auch keine Anzeichen von Demenz?«
»Mein Vater ist besser drauf als ich.«
»Wann haben Sie ihn zum letztenmal gesehen?«
»Ich weiß nicht. Vor ein paar Monaten, glaube ich.«
Toby nahm das schweigend zur Kenntnis. Wenn Daniel Slotkin in Boston wohnte, war das weniger als zwanzig Meilen von hier. Bestimmt keine Entfernung, die einen so seltenen Kontakt zwischen Vater und Sohn erklärte.
Als ahne er ihre unausgesprochene Frage, fügte Daniel Slotkin hinzu: »Mein Vater ist sehr beschäftigt. Golf. Eine tägliche Pokerrunde im Country Club. Es ist gar nicht so leicht, gemeinsame Termine zu finden.«
»Und vor einigen Monaten war er geistig ganz frisch?«
»Sagen wir mal so: Als ich ihn das letzte Mal sah, hielt mein Vater mir einen Vortrag über Investment-Strategien. Von A bis Z, von Börsenoptionen bis zu den Preisen von Sojabohnen. Das überstieg meinen Horizont, nicht seinen.«
»Nimmt er irgendwelche Medikamente?«
»Nicht, daß ich wüßte.«
»Kennen Sie den Namen seines Arztes?«
»Er geht zu einem Spezialisten in dieser Privatklinik in Brant Hill, wo er wohnt. Ich glaube, der Arzt heißt Wallenberg. Sagen Sie, wie verwirrt ist mein Vater denn?«
»Die Polizei hat ihn auf einer Parkbank gefunden. Er hatte seine Sachen ausgezogen.«
Langes Schweigen am anderen Ende. »Mein Gott.«
»Ich finde keinerlei Verletzungen. Nachdem Sie sagen, es hat keine Anzeichen von Demenz gegeben, muß es etwas Akutes sein. Vielleicht ein kleiner Schlaganfall. Oder etwas mit dem Stoffwechsel.«
»Stoffwechsel?«
»Erhöhter Blutzucker zum Beispiel. Oder ein zu niedriger Natriumspiegel. Beides kann zu Verwirrungszuständen führen.«
Sie hörte den Mann tief ausatmen. Er klang müde. Und vielleicht auch frustriert. Es war fünf Uhr früh. Um die Zeit geweckt und mit solch einem Krisenfall konfrontiert zu werden, konnte jeden mißmutig machen.
»Es würde uns helfen, wenn Sie herkämen«, sagte Toby. »Ein bekanntes Gesicht könnte ihm guttun.«
Der Mann schwieg.
»Mr. Slotkin?«
Er seufzte. »Ich glaube, das muß ich wohl.«
»Wenn es jemand anderen aus Ihrer Familie gibt, der das übernehmen kann…«
»Nein, es gibt sonst niemanden. Jedenfalls erwartet er, daß ich vorbeikomme. Um dafür zu sorgen, daß alles mit rechten Dingen zugeht.«
Als Toby auflegte, blieben Daniel Slotkins Worte wie eine Drohung in der Luft hängen: Um dafür zu sorgen, daß alles mit rechten Dingen zugeht. Und warum sollte sie dafür nicht sorgen?
Sie griff nach dem Telefon und hinterließ in der Zentrale der Brant Hill Clinic die Nachricht, daß ihr Patient Harry Slotkin sich im verwirrten Zustand und desorientiert in der Notaufnahme des Springer Hospitals befinde. Dann piepste sie den Röntgenologen im eigenen Hause an.
Nach wenigen Augenblicken meldete er sich mit verschlafener Stimme von daheim. »Hier ist Vince. Haben Sie mich angepiepst?«
»Hier spricht Dr. Harper von der Notaufnahme. Können Sie herkommen? Wir brauchen ein Schädel-CT.«
»Wie heißt der Patient?«
»Harry Slotkin. Sechsundsiebzig Jahre, akuter Verwirrungszustand.«
»In Ordnung. Ich bin in zehn Minuten da.«
Toby legte auf und sah auf ihre Notizen. Was habe ich übersehen? fragte sie sich. Wonach sonst sollte ich noch suchen? Sie ließ alle möglichen Anlässe für einen plötzlichen Anfall von Demenz Revue passieren. Schlaganfälle. Tumore. Intrakranielle Blutungen. Infektionen.
Sie sah sich noch einmal die vitalen Werte an. Maudeen hatte per Mundmessung eine Temperatur von 37,9 Grad festgestellt. Kein richtiges Fieber, aber auch nicht ganz normal. Sie würde eine Lumbalpunktion vornehmen müssen – aber nicht, bevor nicht das CT gemacht war. Wäre der Grund eine Raumforderung im Gehirn, könnte eine Lumbalpunktion zu einer katastrophalen Veränderung des Drucks auf das Gehirn führen. Draußen heulte eine Sirene. Sie schaute auf.
»Und nun?« fragte Maudeen.
Toby sprang auf und stand bereits wartend am Eingang zur Notaufnahme, als die Ambulanz mit einem lauten Heulton vor ihr stoppte. Die Hintertür flog auf.
»Noteinsatz. Lebensbedrohend!« rief der Fahrer.
In höchster Eile zogen sie die Bahre aus dem Wagen. Toby erhaschte einen kurzen Blick auf eine fettleibige Frau mit blassem Gesicht und schlaff herabhängendem Kinn. Sie war bereits intubiert.
»Blutdruck war schon unterwegs nicht mehr meßbar – wir dachten, wir halten mal besser hier, als nach einem Homöopathen zu suchen…«
»Anamnese?« schnappte Toby, die das gar nicht witzig fand.
»Lag am Boden. Hatte vor sechs Wochen einen Myokardinfarkt. Ihr Mann sagt, sie bekommt Digoxin…«
Sie schoben die Patientin hastig in die Notaufnahme. Der Fahrer lief neben der Rollbahre her und bemühte sich unbeholfen um eine Herzmassage. Sie erreichten den Behandlungsraum. Val schaltete das Licht ein. Die OP-Lampen tauchten den Raum in blendendes Licht.
»Okay, alle fest zupacken. Sie hat ihr Gewicht. Achtet auf den Infusionsschlauch! Eins, zwei, drei, jetzt!« rief Maudeen.
Mit gekonntem Griff hatten sich vier Paar Hände unter den Körper der Patientin geschoben und hoben sie nun von der Rollbahre auf den Behandlungstisch. Niemandem mußte man sagen, was zu tun war. Trotz des sichtlich kritischen Zustands der Patientin war Ordnung im Chaos. Der Fahrer machte weiter seine Herzmassage. Sein Kollege preßte ihren Brustkorb, aktivierte die Lungentätigkeit, versorgte sie mit Sauerstoff. Maudeen und Val umrundeten den Tisch, entwirrten die Infusionsschläuche und verbanden die EKG-Kabel mit dem Monitor.
»Wir haben einen Sinusrhythmus«, sagte Toby mit einem Blick auf den Schirm. »Ganz kurz mal keine Herzmassage mehr.«
Der Fahrer stellte seine Bemühungen ein.
»Puls kaum noch spürbar«, sagte Val.
»Infusion höher dosieren«, sagte Toby. »Noch Blutdruck?«
Val schaute von der Manschette hoch. »Fünfzig zu null. Dopamin?«
»Ja. Und weiter mit der Herzmassage.«
Der Fahrer legte die Hände über Kreuz auf das Brustbein und fing wieder an zu pumpen. Maudeen huschte hinüber und holte ein paar Spritzen und Ampullen aus dem Notfallset.
Toby setzte der Frau das Stethoskop auf die Brust und hörte den rechten Lungenflügel ab, danach den linken. Auf beiden Seiten deutliche Atemgeräusche. Der Tubus war also gut gelegt, und die Lungen bekamen Luft. »Herzmassage stopp!« Sie führte das Stethoskop weiter zur Herzgegend.
Man hörte kaum einen Puls.
Wieder schaute sie zum Monitor und sah den Sinusrhythmus schnell über den Bildschirm zittern. Die elektrische Herzaktion war in Ordnung. Warum hatte die Frau keinen Puls? So was kam nur bei einem Schock infolge Blutverlusts vor, aber hier… Toby sah sich den Hals genauer an, und sofort wußte sie die Antwort. Die Fettleibigkeit der Frau hatte dafür gesorgt, daß man nicht sehen konnte, wie stark ihre Halsvenen geschwollen waren. »Sie sagen, sie hatte vor sechs Wochen einen Myokardinfarkt?« fragte Toby.
»Genau«, brummte der Fahrer und begann wieder mit der Herzmassage. »Das hat ihr Mann gesagt.«
»Und weitere Medikamente außer dem Digoxin?«
»Auf ihrem Nachtschränkchen stand eine große Flasche mit Aspirintabletten. Wahrscheinlich hat sie Arthritis.«
Das ist es, dachte Toby. »Maudeen, bitte eine Fünfzig-Kubikzentimeter-Aufziehspritze und eine Herzkanüle.«
»Alles da.«
»Und werfen Sie mir ein paar Handschuhe und Alkoholtupfer rüber!«
Das Päckchen kam geflogen. Toby fing es in der Luft und riß es auf. »Keine Herzmassage mehr«, ordnete sie an.
Der Fahrer trat einen Schritt zurück.
Toby desinfizierte die Hautoberfläche, zog die Handschuhe an und griff nach der Spritze. Ein letzter Blick auf den Monitor. Noch immer beschleunigter Sinusrhythmus. Sie holte tief Luft. »Okay, schaun wir mal, ob das hilft…« Den hervorstehenden Schwertfortsatz des Brustbeins als Orientierungspunkt nehmend, stach sie in die Haut ein und führte die Kanüle in Richtung Herz. Ihr Puls hämmerte, als die Spitze langsam eindrang. Gleichzeitig zog sie den Kolben zurück und sorgte für negativen Druck. Ein Schwall Blut schoß in die Spritze.
Sie hielt sofort an. Ihre Hände waren absolut ruhig. Bitte, lieber Gott, laß sie an der richtigen Stelle sein. Sie zog den Kolben weiter zurück und saugte langsam Blut hoch. Zwanzig Kubikzentimeter. Dreißig. Fünfunddreißig…
»Blutdruck?« rief sie und hörte, wie die Manschette schnell aufgepumpt wurde.
»Ja! Ich haben einen!« sagte Val. »Achtzig zu fünfzig!«
»Ich glaube, ich weiß, was wir jetzt brauchen«, sagte Toby. »Einen Chirurgen. Maudeen, rufen Sie Dr. Carey an. Sagen Sie ihm, wir haben eine perikardiale Tamponade.«
»Wegen des Infarkts?« fragte der Ambulanzfahrer.
»Und wegen der hohen Dosis Aspirin. Daher die starke Blutung. Wahrscheinlich hat sie einen Riß im Herzmuskel.« Mit dem vielen Blut draußen im Herzbeutel konnte das Herz sich nicht mehr ausdehnen. Und damit nicht mehr pumpen.
Die Spritze war voll. Toby zog die Kanüle heraus.
»Druck ist jetzt auf fünfundneunzig«, sagte Val.
Maudeen hängte das Wandtelefon ein. »Dr. Carey ist unterwegs. Und sein Team auch. Er sagt, sie soll stabilisiert werden.«
»Leichter gesagt als getan«, brummte Toby und fühlte den Puls. Sie spürte ihn, wenn auch sehr schwach. »Wahrscheinlich reakkumuliert sie. Ganz schnell eine neue Spritze und eine Kanüle. Können wir ihre Blutgruppe bestimmen, mit Kreuzprobe? Und gleichzeitig auch Blutbild und Elektrolytwerte.«
Maudeen holte eine Handvoll Röhrchen heraus. »Acht Stück?«
»Wenigstens. Wenn es geht, holen wir das ganze Blut heraus. Und lassen Sie Frischplasma aus der Kühlung kommen.«
»Blutdruck fällt auf fünfundachtzig«, sagte Val.
»Mist. Wir müssen wieder ran.«
Toby riß ein Päckchen neuer Spritzen auf und warf die Hülle weg. Wie bei jedem Notfall sammelte sich der Abfall aus Papier und Plastik am Boden. Wie oft muß ich das jetzt noch machen? fragte sie sich, während sie die Nadel aufsetzte. Mach, daß du mit deinem Hintern bald da bist, Carey. Ich kann dieser Frau allein nicht das Leben retten…
Dabei war Toby keineswegs sicher, ob Dr. Carey das konnte. Wenn die Frau tatsächlich ein Loch in der Herzwand hatte, dann brauchte sie mehr als einen Thorax-Spezialisten – dann brauchte sie ein komplettes Bypass-Team. Das Springer Hospital war ein kleines Vorstadtkrankenhaus und perfekt auf Dinge wie einen Kaiserschnitt und die Entfernung der Gallenblase eingerichtet, aber größere chirurgische Eingriffe waren hier nicht vorgesehen. Die Ambulanzen kamen mit schweren Fällen normalerweise nicht zum Springer Hospital, sondern fuhren direkt in größere Häuser wie Brigham oder Mass General.
Doch heute morgen hatten sie nichtsahnend Toby einen schweren Fall für die Chirurgie direkt auf den Tisch gelegt. Und sie hatte keinerlei Erfahrung – genausowenig der übrige Stab –, wie sie dieser Frau das Leben retten sollten.
Die zweite Spritze war jetzt auch mit Blut angefüllt. Noch einmal fünfzig Kubik – und keine Gerinnung.
»Blutdruck geht wieder runter«, sagte Val. »Achtzig…«
»Doc, jetzt haben wir Kammerflimmern!« unterbrach sie einer der Sanitäter.
Tobys Blick schnellte zum Monitor. Aus dem Rhythmus war das schnell jagende Muster einer Tachykardie geworden. Das Herz arbeitete nur noch halb und schlug zu schnell, um noch irgend etwas zu bewirken.
»Den Defibrillator!« rief Toby hastig. »Wir gehen auf dreihundert.«
Maudeen schaltete den Defibrillator ein. Die Anzeigenadel kletterte auf dreihundert Joule.
Toby plazierte die beiden Platten auf der Brust der Patientin. Die Gelschicht garantierte den ordentlichen elektrischen Kontakt zur Haut. Sie schob die Platten zurecht. »Zurück!« rief sie und drückte den Auslöseknopf.
Die Patientin bäumte sich auf, und sämtliche Muskeln kontrahierten, als der Stromstoß durch ihren Körper fuhr.
Toby sah auf den Monitor. »Okay, wir haben wieder einen Sinus…«
»Keinen Puls. Ich habe keinen Puls«, sagte Val.
»Weiter mit der Herzmassage«, sagte Toby. »Eine neue Spritze!«
Schon als sie die Hülle aufriß und die Spritze auf die Nadel aufsetzte, wußte sie, daß sie den Kampf verlieren würde. Sie könnte noch literweise Blut absaugen, es würde immer welches nachfließen und auf das Herz drücken. Halt sie nur so lange am Leben, bis der Chirurg da ist, dachte sie. Die Worte wiederholte sie immer wieder wie ein Mantra. Halt sie am Leben. Halt sie am Leben…«
»Wieder Kammerflimmern!« sagte Val.
»Auf dreihundert. Lidocain, die komplette Dosis.«
Das Wandtelefon läutete. Maudeen nahm den Hörer ab. Gleich darauf rief sie: »Arlo hat ein Problem bei der Kreuzprobe mit dem Blut, das ich raufgeschickt habe. Die Patientin hat B negativ.«
Mist. Was wohl noch alles auf sie zukam? Toby legte die Platten auf die Brust. »Alles zurück!«
Wieder bäumte die Frau sich auf. Wieder ein sehr schneller Sinus.
»Hat wieder Puls«, sagte Val.
»Und jetzt das Lidocain. Wo ist das frische Plasma?«
»Arlo ist unterwegs«, sagte Maudeen.
Toby sah auf die Uhr. Seit knapp zwanzig Minuten hatten sie die Patientin hier jetzt auf dem Tisch. Ihr kam es wie Stunden vor. Bei dem Chaos rundherum, dem läutenden Telefon, den Leuten, die alle gleichzeitig redeten, fühlte sie sich plötzlich desorientiert. Die Hände fingen in den Handschuhen an zu schwitzen und klebten am Gummi. Der Fall geriet ihr außer Kontrolle…
Kontrolle war das Wort, das Tobys Leben bestimmte. Das war schließlich ihr Ziel: ihr Leben in Ordnung zu halten, die Notaufnahme in Ordnung zu halten. Und jetzt hatte sie diesen Notfall nicht mehr im Griff, und sie konnte nichts mehr tun. Sie hatte nicht gelernt, wie man den Brustraum öffnet und eine Herzkammer näht.
Sie schaute das Gesicht der Frau an. Es war fleckig. Die schlaffen Wangen wurden rot. Schon beim Hinsehen wußte sie, die Gehirnzellen wurden nicht mehr versorgt. Starben ab.
Der Fahrer tauschte erschöpft den Platz mit seinem Kollegen. Zwei ausgeruhte Hände pumpten weiter.
Über dem Monitor lief nur noch eine wilde Zackenlinie. Kammerflimmern. Das konnte nur noch schlimm enden.
Das Team tat, was zu tun war. Antiarrhythmika-Dosis erhöhen. Bretylium. Immer stärkere Stromstöße aus dem Defibrillator. Verzweifelt zog Toby noch einmal fünfzig Kubik Blut aus dem Herzbeutel.
Auf dem Monitor wurde der Herzrhythmus zu einer mäandernden Linie.
Toby sah in die Gesichter der anderen. Sie wußten alle, es war vorbei.
»In Ordnung.« Toby atmete tief aus. Ihre Stimme klang erschreckend ruhig. »Das wär’s. Wie spät ist es?«
»Elf nach sechs«, sagte Maudeen.
Fünfundvierzig Minuten haben wir sie am Leben gehalten, dachte Toby. Das Beste, was wir tun konnten. Alle hatten ihr Bestes getan.
Der Sanitäter trat einen Schritt zurück und die anderen mit ihm. Es war fast ein Reflex, dieser physische Rückzug, diese paar Sekunden respektvollen Schweigens.
Die Tür schwang auf, und Dr. Carey, der Thorax-Experte, hatte seinen üblichen dramatischen Auftritt. »Wo ist die Tamponade?« bellte er.
»Exitus«, sagte Toby.
»Wie bitte? Haben Sie sie denn nicht stabilisiert?«
»Das haben wir versucht. Wir haben es nicht geschafft.«
»Und wie lange haben Sie sie reanimiert?«
»Glauben Sie mir«, sagte Toby. »Lange genug.« Sie rauschte an ihm vorbei nach draußen.
Am Schwesterntisch nahm sie einen Moment Platz, um sich zu sammeln, bevor sie das Protokoll ausfüllte. Aus dem Traumazimmer hörte sie Dr. Careys Stimme. Er beschwerte sich lautstark. Da scheuchten sie ihn also morgens um halb sechs aus dem Bett, und wozu? Daß er sich um eine Patientin kümmerte, die sie nicht einmal stabilisieren konnten? Konnte hier denn niemand nachdenken, bevor man ihm den Schlaf raubte? Wußten die hier denn nicht, daß ein langer Tag im O.P. auf ihn wartete?
Warum sind Chirurgen eigentlich immer solche Widerlinge? fragte Toby sich und stützte den Kopf auf die Hände. Mein Gott, ging die Nacht denn nie zu Ende? Zwei Stunden Dienst lagen noch vor ihr…
Durch die Müdigkeit, die ihre Gedanken trübten, hörte sie die Tür zur Notaufnahme aufschwingen. »Entschuldigen Sie«, sagte jemand. »Ich komme, um nach meinem Vater zu sehen.«
Toby sah den Mann auf der anderen Seite des Schreibtischs an. Schmales Gesicht. Ohne zu lächeln, sah er sie mit fast bitter verzogenem Mund an.
Toby stand auf. »Sind Sie Mr. Slotkin?«
»Ja.«
»Ich bin Dr. Toby Harper.« Sie streckte ihm die Hand entgegen.
Er schüttelte sie mechanisch und ohne jede Herzlichkeit. Sogar seine Haut fühlte sich kalt an. Obwohl er bestimmt dreißig Jahre jünger war als sein Vater, war die Ähnlichkeit mit Harry Slotkin frappierend. Daniel Slotkins Gesicht war genauso kantig, hatte die gleiche schmale, vorspringende Stirn. Nur seine Augen waren anders. Sie waren klein, dunkel und unfroh.
»Wir sind bei Ihrem Vater noch mit der Auswertung der Befunde beschäftigt«, sagte sie. »Ich habe noch nicht einmal seine Laborwerte zurück.«