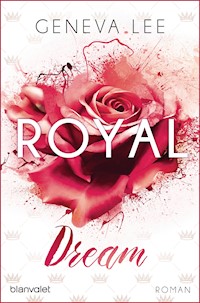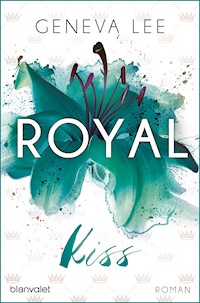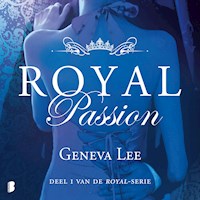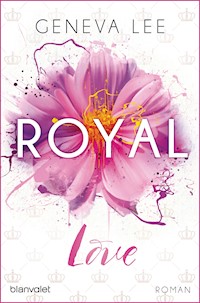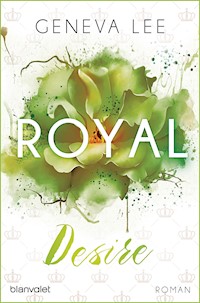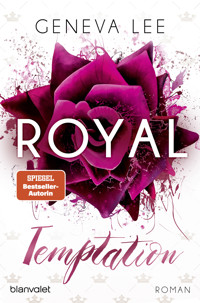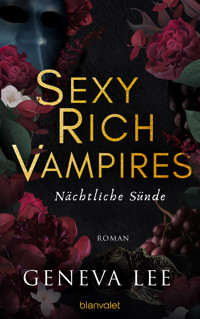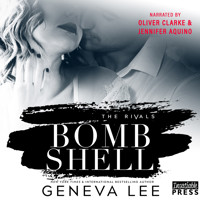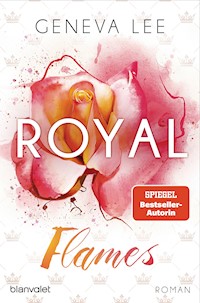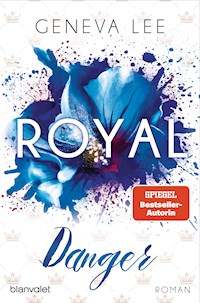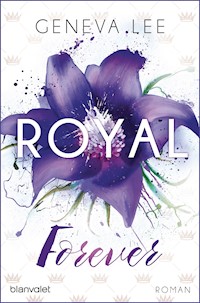
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Royals-Saga
- Sprache: Deutsch
Die große ROYAL-Saga von Geneva Lee: Über 1 Millionen verkaufte Bücher der SPIEGEL-Bestsellerreihe im deutschsprachigen Raum!
Belle & Smith – um endlich glücklich zu werden, müssen sie die Geister ihrer Vergangenheit überwinden …
Band 6 der großen, unvergesslichen ROYAL-Saga …
Die Geister seiner dunklen Vergangenheit überschatten das Leben von Smith und Belle wie ein Albtraum. Um ihnen zu entfliehen, verlassen sie London und suchen Ruhe auf dem Landsitz von Belles Eltern – ein Ort, der schlimme Erinnerungen für Belle birgt. Die Verbindung zwischen Belle und Smith ist so stark wie nie zuvor, dennoch scheint sie etwas vor ihm zu verbergen. Smith tut alles, um Belle zu beschützen, doch kann er ihr helfen, ihre eigenen Albträume zu überwinden?
Die gesamte ROYAL-Saga von Geneva Lee
Clara und Alexander:
Band 1 – Royal Passion
Band 2 – Royal Desire
Band 3 – Royal Love
Bella und Smith:
Band 4 – Royal Dream
Band 5 – Royal Kiss
Band 6 – Royal Forever
Clara und Alexander – Die große Liebesgeschichte geht weiter:
Band 7 – Royal Destiny
Band 8 – Royal Games (April 2020)
Band 9 – Royal Lies (Juni 2020)
Band 10 - Royal Secrets (August 2020)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Die Geister seiner dunklen Vergangenheit überschatten das Leben von Smith und Belle wie ein Albtraum. Um ihnen zu entfliehen, verlassen sie London und suchen Ruhe auf dem Landsitz von Belles Eltern – ein Ort, der schlimme Erinnerungen birgt. Die Verbindung zwischen Belle und Smith ist so stark wie nie zuvor, dennoch scheint sie etwas vor ihm zu verbergen. Smith tut alles, um Belle zu beschützen, doch kann er ihr helfen, ihre eigenen Albträume zu überwinden?
Autorin
Geneva Lee lebt gemeinsam mit ihrer Familie im Mittleren Westen der USA. Sie war schon immer eine hoffnungslose Romantikerin, die Fantasien der Realität vorzieht – vor allem Fantasien, in denen starke, gefährliche, sexy Männer vorkommen. Mit ihrer ersten Royals-Triologie, der Liebesgeschichte zwischen dem englischen Kronprinzen Alexander und der bürgerlichen Clara, begeisterte Geneva Lee die amerikanischen Leserinnen und eroberte auch die deutsche Bestsellerliste.
Die Royals-Saga von Geneva LeeRoyal Passion (Clara & Alexander)Royal Desire (Clara & Alexander)Royal Love (Clara & Alexander)Royal Dream (Belle & Smith)Royal Kiss (Belle & Smith)Royal Forever (Belle & Smith)Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
GENEVA LEE
RomanBand 6
Deutsch von Charlotte Seydel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Capture me« bei Westminster Press, Louisville.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2015 by Geneva Lee
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign
Umschlagmotive: Shutterstock.com
WR · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19914-2www.blanvalet-verlag.de
Für Sharon,die es im Tausch gegen Smith mit mir aushält.Danke
1
Die Musik verstummte, als ich das Telefonat beendete. Das Handy fiel zu Boden, und ich sackte gegen die Wand. Ich öffnete mein Jackett und fummelte an meinen Hemdknöpfen herum, bis auch der letzte offen war, dann hob ich stöhnend den klebrigen, blutgetränkten Stoff an.
Verdammt, das war tief. Es musste genäht werden.
»Du brauchst deutlich mehr als das«, rief ich zu Jake hinüber. Er antwortete nicht. Wahrscheinlich, weil er tot war.
Wir sehen uns in der Hölle wieder.
Er hatte es nicht anders verdient. Jake hatte den gestrigen brutalen Überfall auf meine Frau zu verantworten. Dann war er zurückgekehrt, um sein Werk zu vollenden. Aber ich hatte ihn gestoppt. Für immer. Es spielte keine Rolle, dass er im Auftrag meines abgefeimten Exchefs gehandelt hatte. Er hatte sein Schicksal selbst gewählt, als er sich mit Hammond einließ.
Genau wie ich.
Aber ein Toter mehr bedeutete auch einen Zeugen weniger im bevorstehenden Prozess gegen Hammond. Da Georgia ebenfalls tot war, blieben uns nur noch wenige Optionen. Wir hatten E-Mails und ein paar Gesprächsmitschnitte, aber Alexander war sicher nicht davon überzeugt, dass das reichen würde. Nach dem heutigen Abend und seinen Angriffen auf Belle wollte ich alles in meiner Macht Stehende tun, Hammond vor Gericht zu bringen. Und wenn ich am Ende selbst über ihn würde richten müssen.
Ich war lange genug Anwalt gewesen, um zu wissen, dass sich Gerichte eher auf die Seite der Macht und des großen Geldes stellen. Hammond verfügte über beides und setzte es ein, um systematisch alle Menschen auszuschalten, die er als Bedrohung ansah. Offensichtlich stand ich ebenfalls auf seiner Abschussliste.
Ich betrachtete die Verwüstung um mich herum und wartete auf die Ankunft der Polizei. Zerbrochenes Glas, umgestoßene Möbel, eine zersplitterte Tür und eine Leiche. Entweder ein Tatort oder eine verdammt gute Party.
Natürlich musste ich das teuerste Hotelzimmer in London ruinieren. Die Kosten überschritten mit Sicherheit die hinterlegte Kaution, was bedeutete, dass meine nächste Kreditkartenabrechnung verheerend ausfallen würde.
Du verlierst die Kontrolle, Price.
Ich wusste es. Ich konnte es spüren. Denn von den vielen Gedanken, die mir durch den Kopf schossen, bekam ich keinen mehr zu fassen. Auf dem Boden breitete sich eine Blutlache aus, und ich sah fasziniert zu, wie es in Zeitlupe von meinem Oberkörper tropfte.
Mein Handy klingelte und zeigte Hammonds Nummer an. Ich strich mit dem Daumen über das Display und nahm das Gespräch an. »Price gegen Jake, eins zu null«, verkündete ich. »Wie konntest du nur Margot benutzen, um ihn aufzustacheln. Das war das Letzte.«
»Im Krieg und in der Liebe …«
Ich klemmte mir das Handy zwischen Kopf und Schulter, weil es so unendlich schwer war, dass ich es kaum halten konnte. »Wenn das so ist, sollte ich dir wohl ausrichten, dass Jake einen tüchtigen Bestatter braucht.«
Hammond kicherte. »Das war auch kein Gegner für dich. Hast du wirklich gedacht, ich lasse dich von ihm erledigen?«
»Was ist mit meiner Frau?« Ich presste kurz die Lider zusammen, um wieder scharf sehen zu können.
»Sie ist mir völlig egal«, knurrte Hammond. »Das hier ist eine Sache zwischen uns beiden.«
»Dann lass sie aus dem Spiel.«
»Wie gesagt: Das ist ein Krieg, mein Sohn.«
»Und wer siegt?«, fragte ich. Ich kannte den aktuellen Spielstand, aber der Rest war unklar.
»Nun ja, du wirst jeden Moment für den Mord an Jake verhaftet. Ein Punkt Vorsprung für mich.« Hammond schüttete sich am anderen Ende der Leitung vor Lachen aus.
Ich nicht. Der Witz war nicht besonders lustig. »Für Jake bekomme ich keinen Punkt?«
»Das Kleinvieh zählt nicht. Schließlich kommst du ins Gefängnis. Dann bleiben nur noch drei übrig, die ich von der Liste abhaken muss, und freundlicherweise hast du deine Frau ja gerade zu den anderen beiden Zielpersonen geschickt. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich heute Nacht zuschlagen soll, wenn sie alle zusammen sind, oder ob ich dich lieber noch ein bisschen in der Zelle schmoren lasse. Es wäre lustig, in der Zeitung alles über die Verhaftung eines geisteskranken Mörders zu lesen, der behauptet, es gebe ein Mordkomplott gegen die britische Monarchie.«
»Ja. Aber das britische Königshaus ist auf meiner Seite.« Ich musste blinzeln, denn die Tür war mal da und dann wieder nicht. Ich legte den Kopf schief und versuchte herauszufinden, wohin sie verschwand.
»Im Moment. Aber glaubst du etwa, du bist der Einzige, der den Palast mit Informationen versorgt? Alexander setzt doch nicht alles auf ein einziges Pferd. Sobald er Beweise erhält, dass du die ganze Zeit für mich gearbeitet hast, wird er kaum noch daran interessiert sein, deinen Namen reinzuwaschen. Und solange du hinter Gittern sitzt, nützt du keinem von ihnen etwas.«
»Interessante Intrige. Nur wird dir das niemand abkaufen.«
»Ich bin ein sehr überzeugender Geschichtenerzähler, Smith. Viel Spaß mit Detective Spade. Er freut sich schon sehr darauf, dich kennenzulernen.«
Das Gespräch wurde unterbrochen, und meine Hand sank zu Boden. Es fiel mir immer schwerer, klar zu denken. Warum war es so dunkel? Hatte Belle beim Hinausgehen das Licht ausgeschaltet?
Belle.
Ihr schönes Gesicht schwebte durch den Nebel, der sich in meinem Hirn ausbreitete. Es war, als stünde sie vor mir. Porzellanteint, umrahmt von einer Flut blonder Locken, und dazu dieses hochnäsige Grinsen, bei dem mir selbst die Mundwinkel zuckten.
Belle.
Ganz gleich, welche Pläne er mit mir verfolgte, sie stellte für Hammond ein Problem dar, um das er sich kümmern musste. Ganz gleich, wie viele Beweise Alexander gegen mich in die Hand bekäme, Belle würde sie niemals glauben und alles daransetzen, damit Alexander das auch nicht tat.
Und das hieß, dass sie die nächste Kandidatin auf Hammonds Todesliste war. Nur aus diesem Grund war sie überhaupt erst darauf gelandet.
Ich zwang mich aufzustehen. Warum war ich bloß so höflich gewesen, Belle zu bitten, die Cops zu rufen? Ich sollte wirklich etwas gegen dieses permanente schlechte Gewissen tun. Ich nahm mein Telefon und steckte es ein. Dann taumelte ich zur Tür und fiel dagegen. Ich hinterließ Blutspuren am polierten weißen Holzrahmen.
DNA. Überall DNA.
Herrje, da hätte ich auch gleich eine Spur von Brotkrumen hinter mir auslegen können.
Im Vorbeigehen schnappte ich mir ein Kissen vom Sofa, riss den Bezug ab und presste ihn auf meine Wunde. Jemand musste sich darum kümmern, aber momentan konnte ich nur versuchen, die Blutung zu stoppen, damit die Spuren nicht direkt zu mir führten. Aber es war zwecklos. Als ich den Flur entlanghumpelte, tropfte es neben meinen Füßen auf den Boden. Als ich den Fahrstuhl betrat, zog ich das Jackett zusammen. Das Paar, das neben mir stand, redete unentwegt, sogar noch, als der erste Blutstropfen auf den Fahrstuhlboden fiel. Hier würde ich nicht mehr herauskommen. Ich streckte die Hand aus, strich mit den tauben Fingern über die Tasten und wählte so viele Etagen, wie es nur ging.
Als beim nächsten Halt die Türen zur Seite glitten, stieg ich aus. Ich taumelte hinaus. Meine Knie gaben bereits nach, da entdeckte ich eine Putzkammer und stürzte auf die Tür zu. Ich drehte den Knauf, dann wurde es schwarz um mich.
2
Ich betrat die Lobby des Westminster Royal in einem blutbefleckten Seidenmorgenrock. Offensichtlich wusste ich, was ein gelungener Auftritt war. Rasch ging ich zur Rezeption und lehnte mich an den Tresen, um einen festeren Stand zu bekommen. Meine Beine zitterten. Die Frau, die dort arbeitete, erstarrte, als sie meinen aufgelösten Zustand erkannte. Es verschlug ihr völlig die Sprache.
»Ich würde gern mit dem Manager sprechen«, sagte ich leise. Ich wollte hier keine große Szene hinlegen. Wir waren am Leben, alles Weitere konnte man so diskret wie möglich klären.
In ihrem Gesicht zeichnete sich spürbar Erleichterung ab. Zweifellos war sie heilfroh, mich an jemand anderen weiterreichen zu können. Und das ging mir gehörig gegen den Strich. Irgendwie wollte ich, dass sie sich um die traumatisierte Frau kümmerte, die vor ihr stand. Hätte sie sich nicht erkundigen müssen, ob alles in Ordnung war? Die Antwort darauf wäre mir allerdings leichter gefallen, wenn nicht gerade jemand umgebracht worden wäre, und sei es auch aus Notwehr.
Das war alles zu viel für mich. Das war der wahre Grund meines Zorns. Ich stand zwar hier, aber meine Gedanken waren noch immer in dem Hotelzimmer, das ich gerade verlassen hatte.
Ich warf einen kurzen Blick in die entsetzten Gesichter der Gäste, die an mir vorbeigingen. Smith hatte mich mit dem Privatfahrstuhl zu unserer Suite gebracht, der wichtigen Gästen vorbehalten war, und mir so die Peinlichkeit erspart, mich von Fremden angaffen zu lassen. Was gab ich nur für ein Bild ab – immer noch grün und blau geschlagen von meiner ersten Begegnung mit Jake und jetzt von frischen Schnittwunden übersät? Ich zog den Morgenrock enger zusammen und hörte ein feines Klirren, als Glassplitter aus den Stofffalten auf den Marmorboden rieselten.
Und ich machte mir Sorgen, dass ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehen könnte.
Was zum Teufel mache ich hier überhaupt? Ich hatte keine Ahnung. Oben war Smith und wartete neben einer Leiche auf die Polizei. Ich sollte bei ihm sein. Mein Mann hatte panische Angst, dass Hammond aufkreuzte, um den Job zu Ende zu bringen, aber der würde sich doch nie an einem Tatort blicken lassen. Dazu war er viel zu schlau. Zum Teufel, das würde nicht mal einer seiner bezahlten Helfershelfer riskieren. Und auch Smith war viel zu schlau, um anzunehmen, dass eine echte Gefahr bestand. Das bedeutete, dass er mich ganz bewusst weggeschickt hatte. Als ich das begriff, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Es gab eine Menge vernünftiger Erklärungen, warum er mich weggeschickt haben könnte, aber in unserer Beziehung hatte noch nie die Vernunft regiert.
Nachdem ich der unmittelbaren Gefahr entronnen war, wurde mein Kopf mit jeder Sekunde klarer.
Die Frau, mit der ich gesprochen hatte, hatte sich inzwischen einen gut gekleideten Mann gegriffen. Die beiden standen so weit entfernt, dass ich sie nicht hören konnte, aber mir entging nicht, wie sie in einer merkwürdigen Mischung aus Sorge und Gereiztheit zu mir herüberstarrten.
Wie ich schienen sie eine Szene vermeiden zu wollen.
Andererseits war es auch möglich, dass sie genau wussten, was vor sich ging. Irgendwie musste Jake in unser Hotelzimmer gekommen sein. Hatte ihm ein Angestellter des Westminster Royal den Zugang ermöglicht? Hammond konnte sich überall Freunde kaufen, und es war zu vermuten, dass er für Situationen wie diese noch ein paar Leute in der Hinterhand hatte.
Ich musste hier verschwinden. Smith hatte mir aufgetragen, die Polizei zu rufen, aber wollte er wirklich dort sitzen bleiben und ihre Ankunft abwarten?
Er hatte mich weggeschickt, weil er etwas vor mir verbergen wollte.
Ohne lange zu überlegen, hastete ich zum Fahrstuhl, drängte mich an einem Paar vorbei und murmelte eine Entschuldigung, während ich in die Fahrstuhlkabine sprang und den Knopf zum Türenschließen drückte, bevor sie reagieren konnten.
In meinem jetzigen Zustand hatten mich schon genug Leute gesehen. Mich auch noch im Fahrstuhl angaffen zu lassen, wollte ich mir ersparen. Wenigstens befand sich das Penthouse in einer gesonderten Etage. Falls die Polizei noch nicht da war, hatte auch niemand den Tatort gesehen.
Aber als sich die Fahrstuhltüren öffneten, stockte mir der Atem. Eine Spur von Blutspritzern führte bis zur offen stehenden Tür der Suite. Jemand musste geblutet haben, als er sie verließ, und ich wusste, dass ich es nicht gewesen war. Jedenfalls nicht so schlimm. Entweder war Jake noch am Leben, oder …
An die andere Möglichkeit wollte ich gar nicht erst denken.
Ich eilte zur offenen Tür, lief in das Zimmer und wäre fast über den leblosen Körper meines Angreifers gestolpert.
Er war tot. Das wäre eine Erleichterung gewesen, wäre ich nicht gerade an der Blutspur entlanggelaufen. Da Jake tot war, musste das Smiths Blut sein.
Denk nach.
Jetzt panisch zu reagieren, würde mir in dieser Situation nicht helfen. Mit zittrigen Fingern streifte ich den Morgenmantel ab und versuchte, die Leiche zu ignorieren, die im Zimmer lag. Mein ganzer Körper zitterte wie Espenlaub, weshalb ich große Mühe hatte, die Sachen anzuziehen, die ich mir vorhin auf dem Bett zurechtgelegt hatte. In blutiger Seide herumzulaufen, schien keine gute Idee zu sein, und das war ein Problem, das ich zumindest lösen konnte. Ich holte tief Luft und band mir das Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen. Ich musste mich wieder fangen, das war jetzt das Wichtigste. Ich stopfte den Morgenmantel in meine Tasche und schaute mich um, ob noch mehr von meinen Sachen herumlagen.
Wir hatten nur sehr wenig mitgebracht. Das war Smiths Idee gewesen. Als hätte er damit gerechnet, dass so etwas passieren würde. Doch den deutlichsten Beweis konnte ich nicht einfach in einen Beutel stopfen. Und Zeit zum Aufräumen hatte ich auch nicht.
Als ich sicher war, alle meine Habseligkeiten zusammenzuhaben, wandte ich mich langsam Richtung Korridor. Diesmal sah ich das verschmierte Blut am Türrahmen. Gern hätte ich geglaubt, dass es Jakes Blut war, aber er hätte seine Hände darin baden müssen, um im Kampf solche Spuren zu hinterlassen.
Smith blutete, und zwar stark.
Vielleicht benötigte er einen Krankenwagen, aber wenn das der Grund dafür war, dass er mich losgeschickt und gebeten hatte, die Polizei zu alarmieren, warum war er dann weggegangen? Jeder normale Mensch würde dennoch einen Krankenwagen rufen, aber ich konnte nur daran denken, dass ich meinen Mann finden musste.
Was hätte ich den Sanitätern auch erzählen sollen? Dass er verletzt worden war und sich bei dem Versuch, die Polizei zu rufen, verlaufen hatte? Smith war auf der Flucht. Er wusste es, und die Polizei wusste es vermutlich auch. Auch wenn er verletzt war, hätte ich ihn trotzdem am liebsten umgebracht.
Wenn er nicht schon tot war.
Bei dem Gedanken lief es mir eiskalt den Rücken hinunter, aber ich verdrängte ihn und ging rasch zu den Fahrstühlen am Ende des Korridors. Wie sollte ich erkennen, welchen er genommen hatte? Den Blutflecken nach zu urteilen, war er in einen der Fahrstühle zum Erdgeschoss gestiegen anstatt in den Privatfahrstuhl zur Tiefgarage. Ich hatte keine Ahnung, warum.
Doch in welchen genau? Als ich die Wand betrachtete, entdeckte ich Blut an den Knöpfen. Und dann hatte ich eine Idee. Als ich etwas genauer hinschaute, bemerkte ich einen weiteren Blutfleck am Rahmen des rechten Fahrstuhls. Den musste er genommen gehaben. Ich schloss die Augen und konzentrierte mich auf meinen Wunsch, ihn zu finden. Dann drückte ich den Knopf, um den Lift anzufordern. Es kostete mich fünf Minuten und mehrere verwirrte Fahrgäste, bis der ankam, auf den ich aus war. Erleichtert stellte ich fest, dass er leer war. Das Problem war nur, dass die Hälfte aller Knöpfe an der inneren Schalttafel blutverschmiert war.
Denk nach, Belle.
Ich drückte jeden einzelnen Knopf und betete, dass ich ihn schnell finden würde. Ich musste ihn sehen, ihn berühren. Er war das einzige reale, greifbare Element in diesem Albtraum, in dem wir gefangen waren. Ich musste ihn finden. Bestimmt war er eher früher als später ausgestiegen. Als die Lifttüren zwei Etagen tiefer auseinanderglitten, entdeckte ich dort noch mehr Blut. Ich folgte den Spuren und machte mich auf alles gefasst. Doch sie führten nur zu einer Putzkammer. Schnell öffnete ich die Tür. Das Licht aus dem Korridor fiel schräg über das dunkle Regal und schließlich auf Smiths zusammengesunkenen Körper.
Ich legte meine Finger um sein Handgelenk, fühlte seinen Puls und unterdrückte ein Schluchzen, als ich das leichte Pochen spürte. Es war nur schwach, aber es war vorhanden.
Hätte ich doch nur gewusst, was ich tun sollte.
Der Wärme nach zu urteilen, die sich in meinen Augen ausbreitete, stimmte mein Körper für Weinen. Aber zum Glück erwachte die kaltblütige Krisenmanagerin in mir und rettete mich.
Ich legte die Arme um seinen Oberkörper und versuchte, ihn anzuheben. Er war zu schwer. All diese verdammten sexy Muskeln. Ich wischte eine flüchtige Träne fort und sank neben ihm zu Boden.
»Wach auf!«, verlangte ich. »Ich weiß, du bist ein störrischer Esel, aber dieses eine Mal musst du auf mich hören.«
Wütend wischte ich gegen die Tränen an, die mir jetzt ungehemmt die Wangen hinunterliefen. »Für immer, haben wir gesagt, und das musst du mir jetzt beweisen, Price.«
Ich wartete auf eine Reaktion; ich betete darum.
Smith rührte sich nicht, von dem schwachen Heben und Senken seiner Brust bei unregelmäßiger Atmung einmal abgesehen. Ich brauchte Hilfe und hatte keine Ahnung, woher ich sie bekommen sollte.
Ich schob ihn wieder von mir herunter, kniete mich in der Dunkelheit neben ihn und klopfte ihn ab. Dann berührten meine Finger etwas Glattes, Kühles. Sein Handy.
Es gab einen Menschen, der sofort kommen würde, ohne mir irgendwelche Fragen zu stellen. Jedenfalls nicht sofort.
Ohne weiter nachzudenken, wählte ich die Nummer, zog die Tür von innen zu und hüllte uns in Dunkelheit. Ich lehnte mich gegen den warmen Körper meines Mannes, als das Freizeichen ertönte.
Ein leises Klopfen an der Tür riss mich aus einem traumlosen Schlaf. Das Klopfen verhieß Rettung oder Verdammnis – aufmachen musste ich in jedem Fall. Die Zeit wurde knapp. Ich stieß mit dem Fuß die Tür auf und blinzelte in das helle Flurlicht, bis ein vertrautes und willkommenes Gesicht erschien.
Edwards Miene verriet kein Gefühl bei dem Anblick zu seinen Füßen. Er schob seine Schildpattbrille auf der Nase nach oben und schüttelte den Lockenkopf. »Das war aber eine heftige Party.«
Keiner von uns konnte über den Witz lachen. Es brauchte schon etwas mehr, um die Spannung zu beseitigen, die zwischen uns in der Luft lag.
»Danke.« Später würden Fragen folgen. Ernste Fragen. Fragen, die ich nicht beantworten wollte. Aber jetzt zählte nur eines: dass er gekommen war.
»Du hast bestimmt einen Plan.«
Nicht wirklich. Pläne waren was für Leute, die reagieren, die handeln oder nachdenken konnten. Bis vor einer Minute war ich mir nicht einmal sicher gewesen, ob ich diesem Ort entkommen konnte. Aber jetzt musste ich mir etwas einfallen lassen. Ich schaltete Smiths Handy ein und suchte die Kontaktliste. Es war ziemlich ins Blaue getippt – und keine Wahl, die mir leichtfiel –, aber vielleicht konnte Georgia uns helfen. Doch noch bevor ich zum G hinuntergescrollt hatte, entdeckte ich einen anderen Namen.
»Hier ist ein Dr. Roget in seiner Telefonliste«, meldete ich Edward. »Wenn wir es schaffen, hier herauszukommen, rufe ich ihn an.«
»Nicht gerade ausgefeilt, dein Plan«, bemerkte er.
Ich erzählte ihm lieber nicht, dass Plan B mit Georgia Kincaid zu tun hatte, sondern bedachte ihn lediglich mit einem warnenden Blick. »Momentan will ich nur die nächsten fünf Minuten überleben. Wenn wir das geschafft haben, konzentriere ich mich auf die nächsten zehn.«
»Wir könnten Alexander anrufen«, schlug er vor.
»Nein!« Meine Antwort war barsch, aber sie entsprach meinem Bauchgefühl. Vielleicht hätte Alexander uns helfen können – schließlich hatte er uns diesen Mist eingebrockt –, aber mein Instinkt sagte mir, dass ich Clara und ihr Baby so weit wie möglich vor den Ereignissen des heutigen Abends abschirmen musste. Es war schon schlimm genug, dass ich Edward in diese Sache hineingezogen hatte.
»Wie du wünschst.«
Ich streckte ihm die Hand entgegen. »Hilf mir auf.«
Edward verlangte keine weiteren Erklärungen. Er griff einfach nach unten und zog mich auf die Beine hoch. Doch sobald ich ins Licht kam, verstärkte sich sein Griff um meine Handgelenke. »Was zum Teufel ist passiert, Belle?«
Er hatte mich noch gar nicht gesehen seit dem Überfall. Ich hatte gehofft, ihn erst wiederzutreffen, nachdem alle meine Blessuren verheilt waren.
»Das ist jetzt unwichtig.« Ich schüttelte den Kopf. »Smith ist schwer verletzt. Wir müssen uns auf ihn konzentrieren.«
Edward rührte sich nicht. »Hat er dir das angetan?«
»Gott, nein!«, antwortete ich überrascht. »Er hat mich gerettet.«
Mehr wollte Edward nicht wissen, bevor er Smith über seine Schulter hievte. »Okay, wir haben also einen bewusstlosen Mann dabei, und du siehst aus, als hättest du gerade zehn Runden geboxt. Ich schätze, wir nehmen den Lift in die Lobby?«
»Dein Sarkasmus ist überflüssig.« Aber er hatte nicht unrecht. Edward sorgte schon für Aufsehen, wenn er niemanden über der Schulter trug. Einfach durch den Haupteingang zu verduften, war undenkbar.
Ich schnippte mit den Fingern, als mir eine Idee kam. »Der Bugatti. Er hat ihn sicher in der Privatgarage gelassen.«
»Zeig mir den Weg.«
Den normalen Fahrstuhl zu benutzen, kam nicht infrage. Ich durfte es nicht riskieren, der Polizei über den Weg zu laufen, falls die schon da war. Auf der Treppe nach oben machte ich mich darauf gefasst, wieder in mein Hotelzimmer zu gehen und Jake erneut zu sehen. Doch als ich die Treppenhaustür öffnete, warf ich sie sofort wieder zu. Dort oben wimmelte es schon von Polizisten. Es würde nicht lange dauern, bis sie die Blutspur entdeckten und ihr folgten.
Smith hatte in Notwehr gehandelt. Das – und nicht zuletzt seine Verbindung zu Alexander – sollte reichen, um ihn vor Strafverfolgung zu bewahren. Ich hegte nicht die leiseste Befürchtung, dass er ins Gefängnis musste. Aber solange Hammond noch lebte, war er nirgends in London sicher – nicht einmal in einer Gefängniszelle. Wir mussten komplett von Hammonds Radar verschwinden, und das hieß, dass ich nur mir selbst trauen konnte.
»Und jetzt?«, wollte Edward wissen. »Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber die werden den Laden sehr schnell abriegeln. Wir müssen sofort hier verschwinden.«
»Die Treppen.«
Er beklagte sich nicht, dass er Smith bis in die unterirdischen Etagen des Hotels tragen musste. Als wir endlich unten ankamen, schloss ich die Augen und drehte den Türknauf.
Edward murmelte etwas, das wie »Wunder« klang, als die Tür aufschwang.
»Da ist er!«, schrie ich und zeigte auf Smiths einzigartigen Sportwagen.
Bei seinem Anblick hob Edward eine Braue.
»Das ist ein Zweisitzer«, stellte er fest.
»Du fährst.«
Edward packte Smith auf den Beifahrersitz, und ich kletterte auf den Schoß meines Mannes. Im Dunkeln hatte ich seine Verletzungen nicht sehen können. Jetzt wollte ich nicht hinschauen. Aber ich drückte meine Hände auf das heiße, verkrustete Blut. Meine medizinischen Kenntnisse beschränkten sich auf gesunden Menschenverstand und auf das, was ich in Filmen gesehen hatte.
»Wo soll’s hingehen?«, fragte Edward, legte den Rückwärtsgang ein und röhrte auf die Ausfahrt zu.
Hoffentlich war Dr. Roget ein Freund – ein sehr guter Freund.
Nach dem zweiten Klingeln meldete sich am anderen Ende eine müde Stimme. »Price?«
»Hier spricht seine Frau«, sagte ich hastig und ignorierte das heftige Schuldgefühl, das mich durchzuckte, als mir Edward einen ungläubigen Blick zuwarf. »Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, Sie anzurufen, aber Smith braucht dringend Hilfe. Diskrete Hilfe.«
Entweder hatte ich den Richtigen angerufen, oder ich führte uns in eine Falle. Mir blieb kaum etwas anderes übrig.
»Schaffen Sie es bis zum St. Mary’s Hospital?«
»Ja, aber …«, ich zögerte. Eigentlich wollte ich ein Krankenhaus und all die bohrenden Fragen vermeiden, die damit verbunden waren.
»Im Ostflügel befindet sich die Onkologie. Sie ist abends geschlossen. Wir treffen uns dort.«
»Danke«, flüsterte ich, aber da hatte er schon aufgelegt.
Ich wiederholte die Anweisungen für Edward Wort für Wort. Er nickte nur, biss die Zähne zusammen und enthielt sich jeden Kommentars. Dann beschleunigte er, und wir fuhren unserem Ziel und unserem ungewissen Schicksal entgegen. Er hatte Fragen, und vermutlich hatte er sich mehr als nur ein paar deutliche Worte für mich aufgespart.
Ich wagte es nicht, über die Antworten nachzudenken, die er womöglich verlangen würde. Lieber konzentrierte ich mich darauf, dass Smiths Blut an meiner Haut noch immer warm war, denn das hieß, dass er lebte.
Jedenfalls noch.
3
Wie versprochen war die onkologische Abteilung von St. Mary’s nicht erleuchtet, als wir dort eintrafen. Im Dunkeln wirkte sie ganz unscheinbar. Nur ein weiteres langweiliges, anonymes Gebäude, das abends geschlossen war. Mich überlief eine Gänsehaut. Die nüchterne Zweckdienlichkeit der Anlage ließ unser eigenes Vorhaben umso beängstigender wirken. Ich schaute nervös zu Edward hinüber, als er den Bugatti beim Eingang parkte. Das kümmerliche Licht einer einzelnen Straßenlaterne fiel in den Wagen und ließ seinen Lockenkopf an den Rändern blass schimmern wie einen Heiligenschein.
Das schien mir passend. Man musste schon außerordentlich loyal sein, um einen schon bald Mordverdächtigen quer durch die Stadt zu schleppen, besonders eingedenk des Umstandes, dass ihm Smith nicht besonders sympathisch war. In diesem Augenblick hätte ich mich nicht gewundert, wenn ich ein verborgenes Flügelpaar an ihm entdeckt hätte.
»Bist du dir sicher?«, fragte er und schaute durch die getönten Scheiben zu dem unheimlichen, stillen Gebäude hinüber.
»Ja.« Doch das stimmte nicht. Nicht wirklich. Wäre Smith bei Bewusstsein, würde er mir wahrscheinlich erzählen, dass ich einen Fehler beging, wenn ich Dr. Roget vertraute. Aber genau das war ja das Problem. Er war nicht bei Bewusstsein, und die Gefahr, die von seinen Verletzungen ausging, wuchs mit jeder Sekunde. Ich hatte keine Wahl, ich musste eine Entscheidung treffen und fand, dass es das Risiko wert war.
Edward atmete hörbar aus und nickte knapp, dann stieg er aus, ging ums Auto herum und half mir ebenfalls hinaus. Ich passte auf, dass er nicht noch mehr Blut abbekam, doch kam mir gleich ziemlich dumm dabei vor, schließlich war er schon damit besudelt. Aber je mehr Blutflecken er mit nach Hause brachte, desto mehr Fragen waren zu erwarten, und momentan war es besser, nicht noch jemanden in die Sache hineinzuziehen.
Als Edward bemerkte, dass Smith totenblass war, wirkte er besorgt, sagte jedoch nichts. Was hätte er auch sagen sollen? Dass die Lage ernst war? Dass es zu spät sein konnte? Das alles war mir längst selbst durch den Kopf gegangen. Gott sei Dank kannte mich mein bester Freund gut genug, um das zu wissen. Ich rettete mich in praktische, konkrete Handlungen und würde es nicht ertragen, wenn jemand die Wahrheit ausspräche. Nicht jetzt.
Edward hob Smiths Körper aus dem Wagen, dann wandte er sich zu mir um. »Falls sich herausstellt, dass es ein Fehler war …«
»Ist es nicht«, versicherte ich ihm – und zugleich mir selbst.
»Falls es einer ist«, fuhr er fort und ignorierte mich, »dann siehst du zu, dass du hier verschwindest!«
»Edward, ich bin doch kein …«
Diesmal fiel er mir ins Wort. »Darüber diskutiere ich nicht mit dir. Smith würde das genauso wollen.«
Ich zuckte überrascht zusammen. Er hatte recht. Smith würde wollen, dass ich weglief. Mein bester Freund und mein Ehemann zogen sonst nie am selben Strang. Es war seltsam, dass ausgerechnet Edward jetzt seinen Part übernahm, und das erinnerte mich einmal mehr daran, dass Smith nicht imstande war, die Warnung selbst auszusprechen.
Und obwohl ich es hasste, wenn man mir sagte, was ich zu tun hatte, konnte ich seine Warnung nicht ignorieren. Heute Nacht musste ich abwägen, wann ich dickköpfig sein durfte und wann ich besser clever war – ganz besonders, da unser aller Sicherheit auf dem Spiel stand.
»In Ordnung«, sagte ich und sah ihn durchdringend an. »Aber nur, wenn du auch abhaust.«
»Und Smith?« Edward klang gestresst.
»Er würde darauf bestehen, dass wir uns beide in Sicherheit bringen.«
»Ich weiß ja nicht, ob seine Sorge mich einschließen würde«, erwiderte er knapp.
Ich hatte noch keine Gelegenheit, Edward über Smiths Verbindung zu unserem Freundeskreis reinen Wein einzuschenken. Nach der heutigen Nacht verdiente er es, Bescheid zu wissen. Aber das musste warten. »Vielleicht wärst du überrascht.«
Dabei ließ ich es bewenden.
Edward bedachte mich mit einem frustrierten Blick, dann deutete er mit dem Kopf auf den Eingang. »Ich folge dir.«
Ich holte tief Luft und schritt voran. An den Glastüren angelangt, legte ich eine kurze Pause ein, um neuen Mut zu sammeln. Ich hob die Hand und klopfte zaghaft an die Scheibe. Die Empfangshalle war dunkel. Dort hätte jeder auf uns warten können. Ich warf einen raschen Seitenblick auf Smith und Edward und flehte im Stillen zu allen Heiligen, dass ich die beiden nicht in eine Falle führte. Als sich drinnen etwas bewegte, wandte ich den Blick wieder zur Klinik und sah, wie ein Mann aus einem dunklen Flur kam.
Mir stockte der Atem, während ich darauf wartete, dass er die Tür aufschloss. Als er es geschafft hatte, verzog er bei Smiths Anblick resigniert das Gesicht. Er winkte uns herein. »Mrs. Price, nehme ich an?«
»Ja.« Ich bekam einen trockenen Mund, als ich ihm antwortete. Ich war es nicht gewohnt, mit Smiths Namen angesprochen zu werden. Es war noch zu neu, und unter den gegebenen Umständen klang es noch eigenartiger. Eine Frischangetraute wäre zu diesem Zeitpunkt normalerweise auf Hochzeitsreise, anstatt mit ihrem Ehemann zu einer heimlichen medizinischen Notversorgung zu hetzen.
Roget führte uns in einen Raum, der mit grellem Neonlicht ausgeleuchtet war, und deutete auf einen papierbezogenen Untersuchungstisch. Edward legte Smith vorsichtig darauf ab und trat einen Schritt zurück, damit Roget ihn versorgen konnte. Ich sah ihm bei seiner Arbeit zu und biss mir dabei selbstvergessen auf den Fingernägeln herum. Dem Grau an seinen Schläfen nach zu urteilen, war er schon älter. Der Arbeitsstress hatte eine tiefe Furche zwischen seine Augen gegraben, die immer tiefer zu werden schien, je länger er sich um Smith kümmerte. Ich zweifelte keine Sekunde daran, dass er Arzt war und die professionelle Verantwortung für seinen Patienten sehr ernst nahm. Das änderte aber nichts daran, dass sich auch gute Leute kaufen ließen. Eine Tatsache, die ich künftig nie mehr vergessen wollte.
»Kommt er wieder in Ordnung?«, fragte Edward und sprach damit die einzige Frage aus, die mir ebenfalls im Kopf herumging.
»Erst mal muss ich ihn stabilisieren«, bellte Roget über seine Schulter. »Und sofern sich unter Ihnen keine medizinische Fachkraft befindet, würde ich es vorziehen, ohne Publikum zu arbeiten. Ich melde mich, sobald ich Ihnen mehr sagen kann.«
»Ich gehe nicht.« Ich verschränkte die Arme und merkte, dass ich wie ein bockiges Kind aussehen musste. Aber das war mir egal.
»Mrs. Price. Sie wollen etwas von mir!«, rief mir Roget in Erinnerung, ohne seinen Blick von der Infusion zu lösen, die er gerade in Smiths Armbeuge legte.
»Er hat recht, Mrs. Price.« Edward nahm mich am Arm und zog mich aus dem Raum hinaus in den Flur.
Ich ignorierte seine unverkennbare Spitze, was meinen Familienstatus betraf, und entwand mich seinem Griff. »Vertraust du ihm?«
»Wir haben keine andere Wahl, aber das weißt du selbst.« Edward trat einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. »Sieht aus, als müssten wir jetzt irgendwie die Zeit totschlagen. Lass uns doch mal das Zwanzig-Fragen-Spiel spielen.«
Offenbar war jetzt der Moment gekommen, in dem ich die Karten auf den Tisch legen musste, und in Anbetracht der Situation sah ich keine Möglichkeit, es noch länger zu vermeiden. »Willst du, oder soll ich anfangen?«
»Ich fange an«, sagte er und lachte finster. »Sobald ich weiß, wo ich überhaupt anfangen soll.«
»Wie wäre es damit, dass ich geheiratet habe?«, bot ich kleinlaut an.
Edward ging zu einer Stuhlreihe und setzte sich.
»Ich muss zugeben, dass ich gehofft habe, für Mrs. Price gäbe es eine andere Erklärung.«
»Welche zum Beispiel?«, fragte ich und setzte mich auf den Sitz neben seinem.
»Soweit ich weiß, haben Freundinnen nicht das Recht, Entscheidungen über die medizinische Behandlung ihrer Partner zu treffen, Ehefrauen aber schon.«
»Du hast recht. Vielleicht hätte ich lügen sollen.« Ich rutschte im Sitz zurück und stieß mit dem Kopf sachte gegen die Wand.
»Das tut fast genauso weh wie die Tatsache, dass du mir es nicht gleich erzählt hast. Wie? Wann?«
Ich schloss die Augen und rieb mir über den Nasenrücken, in dem vergeblichen Versuch, einen beginnenden Stresskopfschmerz zu vertreiben. »In New York. Unser Butler hat uns in der Suite getraut.«
»Damit kommt ihr aber nicht in die Klatschpresse.« Ich vermisste den ironischen Unterton, den ich eigentlich bei ihm erwartet hatte.
»Ich war so fertig, dass du nicht da warst.« Ich streckte den Arm aus und nahm seine Hand, weil ich das Bedürfnis nach Körperkontakt hatte. Ich musste mich vergewissern, dass trotz des Vertrauensbruches immer noch eine Verbindung zwischen uns bestand. »Es fühlt sich immer noch ganz irreal an.«
»Wer weiß noch davon?«
»Clara«, gab ich seufzend zu.
»Das ist wohl fair.«
Ich kannte Clara schon viel länger als Edward, aber das war nicht der Grund, warum sie es vor ihm erfahren hatte.
»Eigentlich weiß sie es durch Alexander. Ich glaube, wenn die beste Freundin mit einem der mächtigsten Männer der Welt verheiratet ist, muss man wohl damit rechnen, dass er einem auf die Schliche kommt. Er wusste es eher als sie.«
»Also hast du im Grunde alle deine besten Freunde gegen dich aufgebracht, ihre Gefühle verletzt und einen Kerl geheiratet, den wir kaum kennen. Außerdem wirst du von Mördern gejagt. Habe ich noch etwas vergessen?« Diesmal war mir, als könnte ich trotz seines düsteren Tonfalls ein ganz leichtes amüsiertes Funkeln in seinen Augen entdecken.
Ich stieß mit der Schulter gegen seine. »Du hast das Wesentliche erfasst.«
»Und trotzdem habe ich noch so viele Fragen.«
»Ich auch.« Es tat weh zuzugeben, dass ständig neue und unsägliche Informationen an den Tag kamen, selbst nachdem ich so viel mehr über Smith und seine Beziehung zu Hammond wusste. Der Mann, der mich überfallen hatte, war weitaus mehr als ein bezahlter Schläger. Der Grund, warum er mich umbringen wollte, hatte nichts mit Geschäften zu tun. Es war etwas zutiefst Persönliches. Wie viele von Smiths alten »Freunden« würden noch aus der Versenkung auftauchen und dasselbe im Schilde führen?
Aber das war nichts, worüber ich mit Edward sprechen wollte, was bedeutete, dass ich diesen Gedanken – wie so viele andere – für mich behalten musste.
»Welche denn?«, fragte Edward.
Anscheinend war es ihm ernst damit gewesen, als er das Zwanzig-Fragen-Spiel vorschlug. »Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.«
»Wie wäre es denn mit heute Abend?«, schlug er vor. »Was zum Teufel ist passiert? Die Hälfte von dem Blut war nicht sein eigenes.«
»Nein, das stimmt«, schluckte ich. Wenigstens dafür schuldete ich ihm eine Erklärung, aber ich war mir nicht sicher, ob ich noch einmal durchleben wollte, was passiert war. »Ich bin gestern überfallen worden. Der Kerl hat mich zusammengeschlagen.«
»Oh Gott, Belle.« Edward legte mir den Arm um die Schultern. Ich spürte die Frage, die ihm auf der Zunge brannte.
»Das war’s auch schon«, versicherte ich ihm. »Er hat mich nicht …«
»Genug gesagt.«
Ich war ihm dankbar, dass er mich nicht zwang, mich wieder an jedes schreckliche Detail meines Erlebnisses zu erinnern. Oder daran zu denken, was passiert wäre, wenn nicht ein guter Samariter die Polizei gerufen hätte.
»Es war ziemlich schlimm«, sagte ich und spürte, wie mich die Erinnerung wieder in die dunkle Stunde zurückziehen wollte. Ich kuschelte mich enger an Edward und spürte die Wärme seines Körpers.
»Warum hast du mich nicht angerufen?« Der Vorwurf war nur verhalten und trotzdem unüberhörbar.
»Smith war davon überzeugt, dass mehr dahintersteckte als ein Straßenraub. Deshalb hat er uns im Westminster Royal eingecheckt und ist dann losgezogen, um ein paar Dinge zu klären.«
»Und hat dich dort allein gelassen?«, stieß Edward hervor.
»Nein. Er hat Tante Jane angerufen.« Kaum hatte ich die Worte ausgesprochen, gefror mir das Blut in den Adern.
Tante Jane.
In dem ganzen Chaos hatte ich völlig vergessen, mich bei ihr zu melden. Sie war bestimmt zum Hotel zurückgegangen, und … Der Gedanke war zu schrecklich. Ich wedelte wild mit der Hand, schließlich brachte ich das Wort »Handy« zustande.
Edward wühlte in seiner Tasche und holte sein Telefon heraus. Er sagte kein Wort, als ich ihre Nummer wählte. Dann zählte ich die Klingelzeichen.
Beim dritten Klingeln ging sie ran.
»Ich bin’s.« Ich unterdrückte einen Schluchzer und zwang mich, so normal wie möglich zu klingen.
»Gott sei Dank!« Im Hintergrund hörte ich eine Kakophonie von Geräuschen. »Das ganze Hotel ist abgeriegelt. Sie lassen mich nicht nach oben in dein Zimmer. Alle wurden evakuiert, aber ich kann dich nicht finden.«
Mir schwirrte der Kopf, weil ich nach einer Erklärung suchte, mit der ich sie beruhigen konnte, ohne sie misstrauisch zu machen. Mir fiel nichts ein. »Ich bin nicht dort.«
»Ich kann nicht gerade sagen, dass mir das leidtut.« Doch noch während sie sprach, kletterte ihre Stimme in eine höhere Tonlage. »Wo bist du?«
»Das kann ich dir nicht sagen«, antwortete ich mit Bedauern. Es ihr zu verraten, würde sie nur in Gefahr bringen, aber das machte es nicht leichter, das Geheimnis zu bewahren.
»Ich verstehe.« Jane schwieg einen Moment lang. »Bist du in Sicherheit? Ist Edward bei dir?«
Natürlich hatte sie seine Nummer in ihrem Handy gespeichert. »Er ist hier, und ich bin in Sicherheit.«
»Und Smith?«
»Er ist auch hier.« Ich brachte es nicht über mich zu behaupten, dass er in Sicherheit war. Nicht in diesem Moment. »Ich kann dir nicht mehr sagen, aber das eine musst du mir glauben: Ich werde dich so bald wie möglich anrufen.«
»Ich weiß, Liebes. Ich bin Tag und Nacht erreichbar.«
Ich konnte kaum ertragen, wie verzweifelt sie sich anhörte. Wie immer hatte Tante Jane Verständnis, doch ich wusste, dass ich ihr Angst gemacht hatte. Ich konnte nur hoffen, dass die Furcht nicht lange vorhielt und sich alles eher früher als später aufklärte. »Ich muss jetzt auflegen.«
»Pass auf dich auf.«
Als ich aufblickte, sah Edward mich erwartungsvoll an.
»Was weißt du über Hammond und seine Beziehung zu deinem Bruder?«
Als ich Hammonds Namen aussprach, erstarrte er. Er räusperte sich. »Genug.«
Keiner, der etwas über Hammond wusste, wurde damit fertig. Das lag zum großen Teil daran, dass man mit jedem neuen Puzzleteilchen immer deutlicher begriff, wie viel man nicht wusste. Dieser Mann war ein Rätsel. Dass er gefährlich war, war das Einzige, was ich nicht bezweifelte.
»Wir müssen verschwinden«, flüsterte ich Edward zu. »Und ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll.«
»Alexander …«
Ich hielt eine Hand hoch, um ihn zum Schweigen zu bringen. Sosehr ich meine beste Freundin auch liebte und ihrem Urteil traute – ihr Ehemann sollte aus der Sache herausgehalten werden. »Er darf nichts davon erfahren.«
»Er ist hinter Hammond her«, sagte Edward, als ob das etwas ändern würde.
»Ich weiß.« Ich rieb mir über die Stirn und legte mir passende Worte zurecht, um meine Ablehnung zu begründen. »Das war Smith auch.«
»Aber dann …« Er verstummte, als er begriff.
»Dein Bruder ist so besessen, dass er das Maß verloren hat. Ich muss untertauchen, bis ich mehr weiß – und mit Smith reden kann.«
»Wohin du willst, darf ich dich wohl nicht fragen«, erwiderte er mit gequälter Stimme.
»Wenn du es wissen willst, sage ich es dir, aber vielleicht ist es besser, wenn du es nicht weißt.« Mir gefiel der Gedanke nicht, dass Edward für mich mehr als nötig lügen musste.
»Ich werde ein paar Telefonate führen müssen.«
Ich kam nicht dazu, ihn zu fragen, wen er anrufen wollte, weil Dr. Roget in der Tür erschien.
»Was sind Ihre Blutgruppen?«
»Hm. A, glaube ich.« Es hörte sich richtig an.
»Null negativ.«
Dr. Roget bat Edward, zu ihm zu kommen.
»Das hat man davon, wenn man als Universalspender infrage kommt«, murmelte er und krempelte sich schon auf dem Weg in den Raum die Ärmel hoch.
Ich folgte ihnen und schlug mir entsetzt die Hand vor den Mund, um nicht aufzuschreien, als ich Smith sah, der unter einer Sauerstoffmaske lag und an einem Venentropf hing.
»Er braucht eine Transfusion«, erklärte der Arzt und deutete auf einen Stuhl neben dem Bett, auf den Edward sich setzen sollte. »Ich kann nicht riskieren, Blutkonserven aus dem Krankenhaus zu holen.«
»Gut, dass ich da bin«, sagte Edward mit zusammengebissenen Zähnen.
Ich warf ihm einen dankbaren Blick zu. Ein paar Minuten später floss Edwards Blut durch einen Schlauch in einen Sammelbeutel.
»Und nun sehen wir uns mal Sie an«, schlug Dr. Roget vor. »Vielleicht, wo wir etwas ungestörter sind.«
Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich begriff, dass er mich in ein anderes Zimmer mitnehmen wollte. Hier mit Edward zusammen war Smith in Sicherheit, und in der Klinik war es ruhig. Wenn die Sache aus dem Ruder laufen sollte, brauchte ich nur einmal laut zu schreien.
»Natürlich.«
Edwards anfängliches Misstrauen klang mir noch im Ohr. Ich machte mich auf alles gefasst, als ich auf der anderen Seite des Flurs hinter Dr. Roget in ein Untersuchungszimmer trat. Der Doktor schaltete das Licht an.
»Ihre Schulter blutet«, stellte er fest.
Ich nickte benommen. Beinahe war ich überrascht, dass es keine Falle war. Hatte sich meine Weltsicht wirklich so verengt, dass ich in jedem Fremden gleich einen Feind witterte? Ich zog mir die Bluse über den Kopf und stöhnte, als der Stoff die Wunde streifte, die ich mir bei dem Versuch, aus dem Badezimmerfenster zu klettern, zugezogen hatte.
»Adrenalin«, erklärte er.
Ich blinzelte und schüttelte den Kopf. »Wie bitte?«
»Sie funktionieren nur noch über Adrenalin. Das hat Sie am Laufen gehalten«, klärte er mich auf. »Deshalb haben Sie vergessen, dass Sie verletzt sind.«
»Ich habe mir Sorgen um Smith gemacht«, flüsterte ich.
»Verständlich.« Er wischte den Schnitt mit einem Wattebausch aus, der anfangs kalt und feucht, aber beim Kontakt sofort glühend heiß wurde. »Sie haben Grund zur Sorge.«
»Wird er es schaffen?« Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich die Worte ausgesprochen hatte, so leise war meine Stimme.
»Das wird er. Sie haben schnell reagiert. Sobald die Transfusion durch ist, wird er stabil sein. Fürs Erste jedenfalls.«
»Und später?«
»Leider kann er nicht hierblieben.« Roget lächelte traurig. »Als Arzt muss ich sagen, dass es nicht ideal ist, einen Patienten zu behandeln und dann gleich wieder rauszuwerfen. Aber es gibt einfach keine andere Möglichkeit.«
»Ich verstehe.«
»Sind Sie sicher, Mrs. Price?«, fragte er noch einmal mit Nachdruck. »Ich könnte mir eine Rechtfertigung ausdenken und ihn binnen einer Stunde einweisen lassen, aber dann wäre er morgen tot. Verstehen Sie wirklich, was ich damit sagen will?«
»Ja.« Fast hätte ich mich an dem Wort verschluckt. Es war schon das zweite Mal in dieser Woche, dass ich jemandem mein Jawort gab. Und jedes Mal steckte etwas Schwerwiegendes dahinter.
»Mehr will ich Sie auch gar nicht fragen.« Als er den Schnitt fertig verbunden hatte, ging er zum Waschbecken. »Es ist besser, wenn ich nichts weiß.«
»Was werden Sie denen erzählen?«
»Dass Smith mich wegen eines medizinischen Notfalls aufgesucht hat und ich im Rahmen meiner Vereinbarungen mit Hammond tätig geworden bin.«
»Sie wollen sich dumm stellen«, hakte ich nach.
Er nickte. »Ich habe Sie nicht behandelt, als Sie ins Krankenhaus eingeliefert wurden, Mrs. Price. Aber ich habe mir Ihr Krankenblatt angesehen. Mehr brauchen Sie mir nicht zu sagen.«
Er konnte es sich also denken. Er wusste, dass Smith nicht mehr Hammonds Liebling war, sondern ganz oben auf seiner schwarzen Liste stand.
»Je weniger Ihr Freund davon erfährt, desto besser. Gerade er, in seiner Position.«
Ich biss mir auf die Lippe, damit sie nicht zitterte. Ich hatte ja vorher schon gewusst, dass es noch lange nicht vorbei war. Zwar hatte ich einen Plan ausgeheckt, war jedoch nicht darauf vorbereitet, ihn mit halsbrecherischer Geschwindigkeit und allein umsetzen zu müssen.
»Wenn man mich fragt, werde ich sagen, dass Smith und seine Frau gekommen sind.« Roget wischte sich die Hände an einem Handtuch ab und ließ es in einen Wäschekorb fallen. »Ich muss jetzt nach unserem Blutspender sehen.«
Edward würde aus allem herausgehalten. Das war zwar nur ein kleines Entgegenkommen, aber besser als nichts. Von heute Nacht an war ich auf mich selbst gestellt. Es sei denn, Smith kam zu sich.
Er kommt wieder zu sich, dachte ich und nahm mir fest vor, daran zu glauben.
Lesen Sie weiter in
Geneva Lee
Royal Forever
Roman
Band 6 der Royals-SagaISBN 978-3-641-19914-2 (eBook)erscheint am 19.9.2016ISBN 978-3-7341-0383-4 (Taschenbuch) erscheint am 17.10.2016