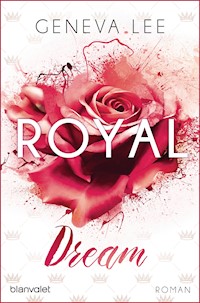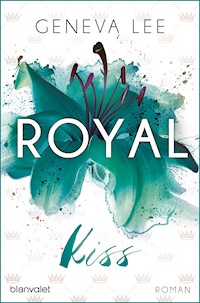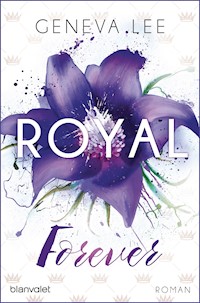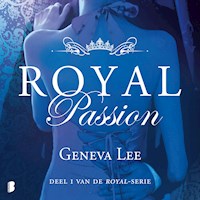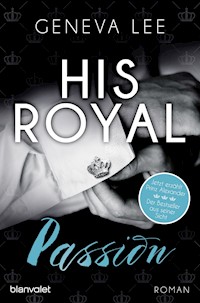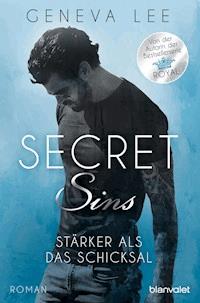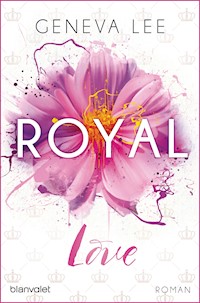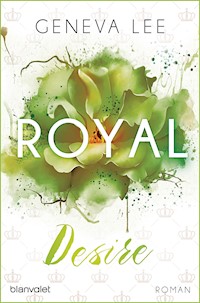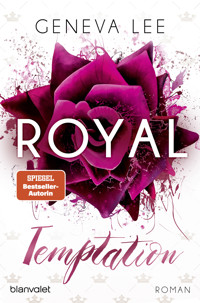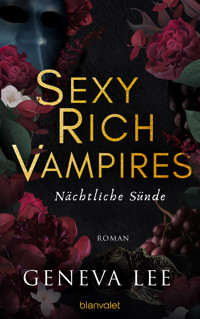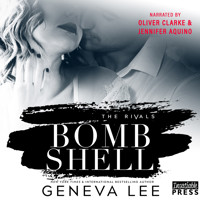12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Sexy-Rich-Vampires-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Welt der Reichen und Schönen ist unsterblich! Die heiße Vampir-Romance von Bestsellerautorin Geneva Lee
Für die reichsten Vampire der Welt beginnt die Ballsaison. Julian, ältester Spross der edlen Familie Rousseaux, soll dabei endlich die passende Frau finden – gegen seinen Willen. Dann stolpert Cellistin Thea in sein Leben. Unschuldig. Arm. Menschlich. Julian weiß, dass er sich niemals in sie verlieben könnte, aber da Thea nun die Wahrheit über die Vampire kennt, braucht sie dringend Schutz – und er eine vermeintliche Verlobte! Also macht er ihr ein Angebot: Wenn sie seine Geliebte spielt, nimmt er ihr sämtliche Geldsorgen. Aber die dekadente Welt der Vampire ist gefährlicher – und anziehender –, als Thea lieb ist …
Der Auftakt der unwiderstehlichen »Sexy Rich Vampires«-Reihe von Geneva Lee!
1: Sexy Rich Vampires – Blutige Versuchung
2: Sexy Rich Vampires – Unsterbliche Sehnsucht
3: Sexy Rich Vampires – Nächtliche Sünde
4: Sexy Rich Vampires – Königliches Begehren
Spice-Level: 4 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Für die reichsten Vampire der Welt beginnt die Ballsaison. Julian, ältester Spross der edlen Familie Rousseaux, soll dabei endlich die passende Frau finden – gegen seinen Willen. Dann stolpert Cellistin Thea in sein Leben. Unschuldig. Arm. Menschlich. Julian weiß, dass er sich niemals in sie verlieben könnte, aber da Thea nun die Wahrheit über die Vampire kennt, braucht sie dringend Schutz – und er eine vermeintliche Verlobte! Also macht er ihr ein Angebot: Wenn sie seine Geliebte spielt, nimmt er ihr sämtliche Geldsorgen. Aber die dekadente Welt der Vampire ist gefährlicher – und anziehender –, als Thea lieb ist …
Autorin
Geneva Lee ist eine hoffnungslose Romantikerin und liebt Geschichten mit starken, gefährlichen Helden. Mit der »Royals«-Saga, der Liebesgeschichte zwischen dem englischen Kronprinzen Alexander und der bürgerlichen Clara, eroberte sie die internationalen Bestsellerlisten. Auch die »Rivals«-Reihe traf mitten ins Herz ihrer Leser*innen. Mit ihrer neuen Trilogie, den »Sexy Rich Vampires«, begibt sich die SPIEGEL-Bestsellerautorin zum ersten Mal in die Welt der Fantastik – ohne dabei aber den großen Gefühlen, der Leidenschaft und dem Luxus untreu zu werden. Geneva Lee lebt zusammen mit ihrer Familie im Mittleren Westen der USA.
Von Geneva Lee bereits bei Blanvalet erschienen:
Die »Royals«-Saga von Geneva LeeClara und Alexander:Band 1 – Royal PassionBand 2 – Royal DesireBand 3 – Royal LoveBand 1 aus der Sicht des Prinzen – His Royal Passion
Belle und Smith:
Band 4 – Royal DreamBand 5 – Royal KissBand 6 – Royal Forever
Clara und Alexander – Die große Liebesgeschichte geht weiter:Band 7 – Royal DestinyBand 8 – Royal GamesBand 9 – Royal LiesBand 10 – Royal Secrets
GENEVA LEE
SEXY RICH VAMPIRES
Blutige Versuchung
Deutsch von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »FILTHYRICHVAMPIRE« bei Estate Publishing + Media.
Die Verse in Kapitel 25 stammen aus dem Gedicht La Belle Dame Sans Merci. In: Keats, John: Gedichte. Übertragen von Gisela Etzel, Leipzig, 1910.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2022 by Geneva Lee
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Hamburg, nach einer Originalvorlage von Estate Publishing + Media
Coverdesign: © Estate Books
JS · Herstellung: sam
Satz: Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30891-9V002
www.blanvalet.de
Für Louise
Die ewig darauf gewartet hat,
dass ich endlich das verdammte Vampirbuch schreibe
1 JULIAN
»Welches Jahr haben wir?«
Ich blinzelte und hob die Hand, um meine Augen zu schützen.
Blendendes Tageslicht drang durch die Fenster herein und machte es unmöglich, etwas zu sehen. Dennoch war einiges ersichtlich:
Die Welt war nicht untergegangen.
Trotzdem war ich wach.
Und jemand hatte die Jalousien hochgezogen.
Es gab nur eine Person, die wusste, wo ich die Fernbedienung für die Jalousien aufbewahrte – die einzige Person, der ich vertrauen konnte. Sie wusste, dass es nicht nur dumm, sondern auch gefährlich war, mich zu wecken. Sie hatte gesehen, wie ich dafür jemanden geköpft hatte.
Sie hatte die Jalousien trotzdem hochgezogen.
Wenn meine Assistentin mich gestört hatte, musste es dafür einen guten Grund geben. Zumindest wäre das sehr ratsam für sie.
Celia bewegte sich geräuschlos durch den Raum, als die Jalousien zu Ende hochfuhren und die raumhohen Fenster freigaben. Das Licht funkelte an der Decke und tanzte im Rhythmus der Wellen draußen. Ruhig. Friedlich. Das einzige Geräusch kam vom Rauschen der Brandung. Ich war ganz allein. So war es mir am liebsten. Menschen störten mich hier nicht – außer Celia, wie es schien. Nicht allein, dass sie mich geweckt hatte – jetzt schlich sie auch noch vorsichtig um mein Bett herum. Sie wusste ganz genau, dass sie besser nicht in die Reichweite eines Vampirs kommen sollte, der seit Jahrzehnten keine warme Mahlzeit zu sich genommen hatte.
»Dich beiße ich doch nicht«, versicherte ich ihr.
Celia schnaubte und blieb auf Abstand. »Das habe ich schon mal gehört, also warte ich lieber, bis ich wirklich sicher sein kann, dass du dich wie ein Gentleman benimmst.«
»Das könnte eine Weile dauern.« Ich schnitt eine Grimasse und rieb mir mit der Handfläche über den Nacken. Ich war nach meinem bösen Erwachen noch recht ungnädig.
»Davon bin ich überzeugt.« Sie war damit beschäftigt, die Gegenstände auf einem Silbertablett zu ordnen.
Fast hätte ich laut geknurrt, aber ich hielt meine Wut im Zaum und biss die Zähne zusammen. »Warum bin ich wach?«, fuhr ich sie an. »Und welches verdammte Jahr haben wir?«
»Ich rede erst mit dir, wenn du nicht mehr so übellaunig bist.« Sie blickte dabei nicht von ihrer Beschäftigung auf. Ihr silbrig-weißes Haar reichte ihr bis über die Schulter und verwehrte mir den Blick in ihr Gesicht. Aber ich hörte das Grinsen heraus, das sie verbarg. Wie schön, dass wenigstens sie sich amüsierte.
Ich versuchte es etwas höflicher. »Welches Jahr haben wir, bitte?«
»Es ist 2021, Sir.« Sie wandte sich mir zu und schenkte mir ein süßes Lächeln. Ich war nicht so dumm, mich davon einlullen zu lassen. Celia konnte einem Mann das Herz aus der Brust reißen, ohne sich dabei einen Nagel abzubrechen. Ich hatte sie dabei beobachtet – mehr als einmal.
»Mein Gott, ich hatte gehofft, noch ein paar Jahrzehnte dranhängen zu können.«
Sie presste die Lippen zusammen, und das Lächeln erlosch, aber sie antwortete nicht, zuckte nur mit ihren schmalen Schultern. Ich betrachtete sie einen Moment, um herauszufinden, was ich verpasst hatte. Aber ihr war nichts anzumerken. Sie sah genauso aus wie vor ein paar Dutzend Jahren. Die Narbe, die sich über eine Gesichtshälfte zog – das Souvenir eines früheren Liebhabers –, war nicht überschminkt. Als Sterbliche hatte sie sie versteckt, als Vampirin trug sie sie mit Stolz. Sie sah sie als Beweis dafür, dass sie überlebt hatte, und als Warnung an jeden, der sie in Zukunft verletzen wollte. Das war einer der Gründe, warum ich ihr vertraute. Sie machte sich nicht die Mühe, ihre Vergangenheit zu verstecken oder zu verbergen, wer sie jetzt war. Sie stand dazu.
Aber obwohl ich ihr vertraute, spürte ich, dass sie mir etwas verheimlichte.
Das verhieß nichts Gutes.
Ich wollte mich aufsetzen und riss dabei fast eine Infusion aus meinem Unterarm. Ich blickte auf den roten Strom, der durch den Schlauch floss, und seufzte. Es war eine fürsorgliche Geste von ihr, aber ein weiteres Indiz dafür, dass mein Nickerchen endgültig vorbei war. Ich lehnte mich an das Bambus-Kopfteil, um das Ende der Transfusion abzuwarten. Sie sollte meinen schlimmsten Hunger stillen, und verhindern, dass mir der Kragen platzte.
Hoffentlich.
Inzwischen war ich hellwach und richtete meine Aufmerksamkeit auf das türkisfarbene Wasser, das gegen das Haus plätscherte. Streng genommen war es gar kein Haus. Mein Wohnsitz nahm eine ganze Insel in der Nähe von Key West ein, lag aber in internationalen Gewässern. Im Gegensatz zu den Keys war die Insel also jeder staatlichen Kontrolle entzogen. Ich hatte das bewusst so eingerichtet und wollte damit allen klarmachen:
Lasst mich verdammt noch mal in Ruhe!
Ich hatte die ganze Insel zu meinem Zufluchtsort gemacht. Mein Schlafzimmer war so gebaut, dass es über das Wasser ragte, drei Wände umgeben von nichts als dem weiten, unendlichen Blau des Ozeans. Der Rest der Insel war so groß wie ein voll funktionsfähiges Resort, und eine ausgewählte Gruppe von Vampiren und Menschen lebte fast das ganze Jahr über auf den dreihundert Hektar und verließ sie nur während der Hurrikan-Saison. Es war entspannend hier – ein Luxus, den ich so lange wie möglich auskosten wollte. Celia musste einen verdammt guten Grund haben, mich zu wecken.
»Ist irgendwas passiert, während ich weg war?«
»Eine ganze Menge. Da ist ein Dossier mit den wichtigsten Ereignissen, den letzten vier Präsidenten und verschiedenen Staatsoberhäuptern, außerdem die Zeitung von heute Morgen.« Sie war anscheinend überzeugt, dass ich kein Beißrisiko mehr darstellte, denn sie platzierte das silberne Tablett neben mir im Bett. Sie drehte sich um und inspizierte den Blutbeutel, dessen Inhalt in meinen Arm sickerte. »Der ist leer. Soll ich einen neuen holen?«
Ich schüttelte den Kopf. Je älter ich wurde, desto weniger Blut brauchte ich nach dem Aufwachen. Ich nahm das Wall Street Journal und überflog die Schlagzeilen. Meine Mundwinkel sanken bei jeder Nachricht tiefer. Das Dossier war noch deprimierender. »Wie konnte dieser Schwachkopf gewählt werden?« Ich blätterte die Seite um. »Oder der da?«
Ich ließ die Zeitung auf das Bett fallen. Die Achtziger waren ein Affentheater gewesen: zu viel Haar, zu viele Schulterpolster und viel zu viel Kokain. Das hatte meinen Geschwistern und vielen anderen Vampiren sehr gut gefallen. Aber ich hatte eine Pause gebraucht. Von den Partys. Von meiner Familie. Von allem. Es war mir damit ernst gewesen, als ich Celia befahl, mich bis zum Jüngsten Tag in meinem Schlafzimmer in Ruhe zu lassen.
Wieso hatte sie mich geweckt? Ich stieß die Bettdecke beiseite.
Ich schlief am liebsten nackt und konnte gleich sehen, dass die Blutinfusion bereits gewirkt hatte. Ich fuhr mit der Handfläche über meinen Bauch, der noch genauso definiert war wie damals, als ich mich zur Ruhe gebettet hatte. Als ich die Zehen beugte, stellte ich fest, dass meine Oberschenkel und die Waden schon wieder Muskelmasse aufgebaut hatten. Nichts deutete darauf hin, dass ich fast drei Jahrzehnte lang geschlafen hatte, außer vielleicht die hartnäckige Erektion, die mir meine Träume beschert hatten. Ich war hinter einer Frau her gewesen. Das war der einzige Traum, an den ich mich erinnern konnte. Ich hatte sie nie erwischt. Das Ergebnis waren ein jahrzehntelanger Samenstau und ein Ständer, der ebenso lästig wie schmerzhaft war.
Celia enthielt sich jeglichen Kommentars, was ihr weitere Pluspunkte bei mir einbrachte.
»Also, was mein vorzeitiges Wecken anbetrifft …« Ich versuchte mich an meinem charmantesten Lächeln, aber es hing schief auf meinen Lippen, die ich so lange nicht benutzt hatte.
»Deine Mutter hat dich nach Hause zitiert.« Sie ignorierte meine säuerliche Miene. »Ich habe den Jet bereitstellen lassen, aber ich sollte …«
Bevor sie den Satz beenden oder erklären konnte, wofür meine Mutter ihren ältesten Sohn benötigte, schwang die Tür zu meinem Zimmer auf. Eine vertraute Gestalt stand im Türrahmen und grinste irre, als wären nicht Jahrzehnte vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Sebastian Rousseaux war nicht mein leiblicher, sondern mein Blutsbruder. Somit unterschieden wir uns vom Aussehen und vom Temperament her sehr deutlich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, trug er gebleichtes, stacheliges Haar. Er hatte sich der Punkrock-Szene zugewandt. Sebastian hatte jede Sekunde der verdorbenen Achtzigerjahre genossen. Menschen, die sich Exzessen hingaben, waren leicht zu manipulieren, und Vampire – die, wie sich herausstellte, Kokain ebenso liebten wie Opium – konnten der Versuchung kaum widerstehen.
Und niemand liebte Drogen und Menschen mehr als Sebastian.
Sein Haar war in den vergangenen Jahren länger geworden und zu seinem natürlichen Blond verblasst. Den Ohrring und das Hundehalsband, die damals sein Markenzeichen waren, hatte er abgelegt, aber die Bikerjacke beibehalten. Er trug sie jetzt über einem schwarzen T-Shirt und einer weiten, abgetragenen Levi’s.
Ich erfasste das alles mit einem einzigen Blick, als die Tür aufflog. Sebastian sah zwar anders aus, aber seine Unverfrorenheit war die alte, denn eine halb angezogene Frau lehnte schief an ihm.
»Guten Morgen, Bruder«, rief Sebastian fröhlich. »Ich habe dir eine Blondine mitgebracht.«
Der Kopf des Mädchens wackelte ein wenig, und sie blinzelte verträumt zu mir herüber. Sie war bei Bewusstsein. Jedenfalls weitgehend. Ihr Blick glitt anerkennend an meinem Körper hinunter, bis er meine Leistengegend erreichte und dort einrastete. Ihr Kiefer klappte herunter, und sie starrte mich mit großen Augen an.
»Nette Geste«, sagte ich trocken. Ich warf die Decke wieder über meinen Schritt, um ihr den Blick auf meinen Schwanz zu versperren. »Aber ich habe keinen Appetit.«
»Wer’s glaubt.«
»Was führt dich her?« Sebastian antwortete nicht.
Es war kein gutes Zeichen, wenn ich nach langem Schlaf erwachte und ihn in meinem Haus antraf. Oder irgendwelche anderen Geschwister. Er schob die Frau in seinen anderen Arm wie eine Puppe. Sie streckte die Arme aus und klammerte sich an seine Schulter.
»Anscheinend bevorzugst du die Transfusion«, sagte er und verzog angewidert das Gesicht, als Celia mit dem leeren Blutbeutel an ihm vorbeiging. »Aber dem Fahnenmast zwischen deinen Beinen nach zu urteilen, könntest du sie für etwas anderes benutzen.«
»Das wird nicht nötig sein.« Doch ich hätte genauso gut mit der Wand sprechen können, denn Sebastian flüsterte der Frau bereits etwas ein.
»Sag ihm, wie gern du reitest.«
»Ich reite sooo gern«, sagte sie mit verträumter Stimme. »Wie wär’s mit einer Runde?«
»Siehst du? Das Fleisch ist willig.« Sebastian betrat den Raum. Er hatte es nicht so eilig wie die meisten Vampire seines Alters, die ihre Schnelligkeit abfeierten. Nein, mein Bruder hatte die Kunst perfektioniert, sich Zeit zu lassen. Als er schließlich das Bett erreichte, schubste er sie darauf.
Sie ließ sich auf alle viere fallen und kroch auf mich zu, aber ich hob die Hand.
»Dein Willkommensgeschenk ist wirklich rührend, aber Celia wollte mir gerade erklären, warum zum Teufel ich wach bin.«
»Darf ich ihm die gute Nachricht überbringen?«, fragte Sebastian Celia, die zustimmend den Kopf neigte. Doch während Sebastian weiter unablässig grinste, formten ihre Lippen einen grimmigen Schrägstrich.
Was meinen Bruder amüsierte und Celia beunruhigte, würde mich aufregen, das wusste ich jetzt schon.
»Dann verständige ich die Piloten, dass wir unterwegs sind.« Sie eilte hinaus.
Ich hatte noch nie erlebt, dass sie so ängstlich vor etwas Reißaus nahm. Ich verstand das nicht. Sofern es keine finanzielle Katastrophe gegeben hatte, garantierte der Familienname Rousseaux immer noch offene Türen und unkomplizierte Bürokratie. Der Jet würde bereitstehen, um mich zu der Privatresidenz meiner Mutter zu bringen, sobald ich ihn anforderte. Unsere Familie besaß mehr als fünfzig Anwesen, die über die ganze Welt verstreut waren – das Ergebnis eines Immobilienportfolios, das über Jahrhunderte gepflegt worden war.
Wir beschäftigten Privatpiloten, besaßen mehrere Flugzeuge. Celia brauchte sich also nicht bei den Piloten zu melden. Sie suchte nur die sichere Distanz, bevor mein Bruder die Bombe zündete.
Es musste eine verdammt schlechte Nachricht sein.
»Was will Mutter?«, fragte ich ihn, sobald Celia gegangen war. Das blonde Mädchen legte sich ans Fußende des Bettes und schlief umstandslos ein, wobei sie ein bisschen an eine Hauskatze erinnerte. Er musste ihr eine gehörige Portion Vampirgift eingeflößt haben, bevor er sie herbrachte. Sie war völlig zugedröhnt.
»Kommst wie immer gleich zur Sache.« Sebastian ließ sich in einen Sessel an der Fensterfront fallen. »Interessiert dich denn gar nicht, was ich so treibe?«
»Frauen und Drogen, nehme ich an.« Wahrscheinlich auch ein paar Männer. Aber ich sprach es nicht laut aus. Sebastian gewährte neuen Erfahrungen immer Spielraum, vor allem im Bett.
»Ich hatte eine Zeit lang eine andere Band.« Sebastian legte nachdenklich den Kopf schief. »Vor allem wegen der Frauen und der Drogen. Andererseits hatte in den Neunzigern so ziemlich jeder eine Band. Es war wie in den Sechzigern.«
»Tut mir leid, dass ich das verpasst habe«, stieß ich hervor. Doch es tat mir überhaupt nicht leid. Die Unsterblichkeit hatte Sebastian nicht mit musikalischen Talenten ausgestattet. Trotzdem war er von Musik so besessen, dass mir ein paar misslungene Sinfonien und eine grauenvolle Oper nicht erspart geblieben waren. Aber Punk hatte schließlich für ihn gepasst, weil da meistens sowieso nur gebrüllt wurde.
»Oh, und die hier sind gerade richtig angesagt.« Er warf mir einen kleinen schwarzen Gegenstand zu.
Ich fing ihn mit der rechten Hand und betrachtete ihn einen Moment lang. Als ich ihn umdrehte, leuchtete ein Bild auf, außerdem wurden die Uhrzeit und eine Reihe kleiner Symbole angezeigt. »Was ist das?«
»Telefon«, erklärte er.
»Das ist ein Telefon?« Ich schüttelte den Kopf. »Das hat die Menschheit beschäftigt? Sag mir, dass sie wenigstens den Krebs geheilt haben.«
»Es ist auch eine Kamera«, fuhr Sebastian fort und reckte sich in seinem Sessel. »Und das Internet. Warte, verdammt, gab es das überhaupt schon, als du dich hingelegt hast?«
Es war wohl die Stunde des Zeigens und Erzählens. Ich ließ das Telefon aufs Bett fallen. Es fühlte sich zwar zerbrechlich an, war aber bestimmt nicht schwer zu bedienen. Später würde ich von Celia einen weniger narzisstischen Überblick über die wichtigsten politischen, technologischen und kulturellen Ereignisse bekommen, die ich verpasst hatte. Im Moment musste ich Sebastians Ego in die richtige Richtung lenken.
»Also, warum bist du hier?«, fragte ich.
Sein Mund verzog sich zu einem wölfischen Grinsen. »Mutter will uns auf den neuesten Stand bringen.«
»Ich sollte lieber nicht wach sein, wenn Mom sentimentale Wallungen bekommt.« Das ging nie gut aus. Als der gesamte Rousseaux-Clan zum letzten Mal am gleichen Ort gewesen war, hatten wir die Aufmerksamkeit der ganzen Stadt auf uns gezogen. Als wir es merkten, war es schon zu spät gewesen.
»Oh nein, keine Feier, das hier ist eine offizielle Vorladung.« Das Lächeln wurde breiter und zeigte ein blendend weißes Gebiss, das in Sekundenschnelle kampfunfähig machen und zerfetzen konnte. »Ich gebe dir einen Tipp: Das letzte Mal ist ungefähr fünfzig Jahre her.«
Ich nahm wieder das Telefon in die Hand und schaute auf das Display. Unter der Uhrzeit stand ein Datum. Ich stöhnte auf, als ich Oktober las. Fünfzig Jahre. Oktober. Alles passte. Wie hatte ich mir nur einbilden können, dass ich da rauskommen würde? Es war einfach nicht aufzuhalten.
Ich hatte mich in der Erwartung schlafen gelegt, dass die Menschheit der Erde den Rest geben würde, während ich weg war. Damals steuerte sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf die totale Selbstzerstörung zu. Ich hatte es nicht länger mit ansehen können. Aber jetzt war ich hier und nicht tot, und angesichts des drohenden Vampirtreffens wünschte ich, sie hätten es getan. Der Weltuntergang hätte mehr Spaß gemacht als das, was mir bevorstand.
»Mist«, stöhnte ich. »Pfähle mich einfach. Ich schreibe dir einen Zettel, auf dem steht, dass ich darum gebeten habe.«
»Kopf hoch, Bruder.« Seine Augen funkelten, was mir nur noch mehr Angst vor dem machte, was er zu sagen hatte. »Das ist nicht irgendein Treffen. Die Riten werden wieder abgehalten. Du weißt, was das bedeutet.«
Jetzt verstand ich die Selbstgefälligkeit meines Bruders. Sowieso trafen Vampire sich alle fünfzig Jahre, um voreinander aufzutrumpfen und den Reichtum und die Trophäen zu präsentieren, die sie seit der letzten Versammlung zusammengerafft hatten. Aber die Riten waren eine Art archaisches Paarungsritual. Traditionell wurden sie alle paar Jahrhunderte abgehalten. Während der Riten speisten die Vampire mit – und von – ihren Familienangehörigen, den Nachkommen einst mächtiger Hexen. Beide Gruppen suchten nach Partnern, einem passenden Brut-Consort, die neue, reinblütige Vampire hervorbringen, um Allianzen zu fördern und die ohnehin schon aufgeblähten Egos weiter zu stärken. Im zwanzigsten Jahrhundert war der Quatsch aus der Mode gekommen. Aber nun war ich wohl fällig.
»Du brauchst gar nicht so selbstzufrieden zu glotzen«, warnte ich ihn. »Eines Tages bist du auch an der Reihe.«
»Ich schätze, ich habe noch ein paar Jahrhunderte Zeit, falls du es nicht vermasselst.«
Die Einladung unserer Mutter zu ignorieren war ausgeschlossen. Das wussten wir beide.
»Ein Rousseaux tritt an, wenn die Pflicht ruft«, sagte ich seufzend und langte nach der Blondine, weil mir plötzlich nach einer Ablenkung zumute war.
»Besser du als ich. Ich lasse euch beide dann mal allein.« Sebastian stand auf und ging auf die offene Tür zu. Kurz davor blieb er stehen. »Aber sauge sie möglichst nicht völlig aus. Ich habe ihr versprochen, sie nicht umzubringen. Wir sehen uns zu Hause.«
Er ging, als sie auf meinen Schritt kletterte. Ich wusste nicht, ob ich sie beißen oder ficken sollte. Nach der Art zu urteilen, wie die Frau den Kopf neigte, war sie zu allem bereit. Sie war hübsch, auf eine etwas künstliche Art. Wie auch immer, sie war willig, und ihr Blut war warm.
Ich kriegte kaum mit, als sie auf mich sank und zu stöhnen begann. Ich hatte Probleme, um die ich mich kümmern musste, und selbst eine hübsche Blondine, die auf meinem Schwanz ritt, konnte mich davon nicht ablenken. Sie hatten die Riten ausgerufen. Das würde schlimmer werden als die übliche langweilige Party mit Schwanzvergleich. Es hatte konkrete Auswirkungen auf mein Leben.
Seit dem letzten Mal waren mindestens zweihundert Jahre vergangen. Damals hatte unsere ältere Schwester noch gelebt, und ihr war die Pflicht zugefallen, an den Bällen und Orgien und all dem Tamtam teilzunehmen, das die Elite der Vampirgesellschaft im Rahmen dieser besonderen Partnervermittlung veranstaltete. Jetzt musste ich in den sauren Apfel beißen.
Ich, Julian Rousseaux, musste mir eine Frau nehmen.
2 THEA
Eines Tages würde ich pünktlich sein.
Aber nicht heute.
Die Sonne war bereits untergegangen, als ich durch den Hintereingang des Herbst Theatre stürmte. Ich hatte es so eilig, dass ich mit meinem Cellokoffer versehentlich gegen ein Servierwägelchen prallte. Ich schrie auf und blieb stehen, um mich zu vergewissern, dass ich nichts zerstört hatte. Zum Glück sahen die Schokoladentörtchen immer noch sündhaft gut aus. Ein vertrautes Paar brauner Augen lugte um die dreistöckige Gebäck-Etagere herum, und ich hörte einen Seufzer.
»Tut mir leid, Ben!« Ich lächelte den Chefkonditor entschuldigend an. »Bist wieder auf den letzten Drücker rein, was?«, fragte er, während er den Wagen rasch vor mir in Sicherheit brachte.
»Du bist aber auch nicht im Zeitplan«, gab ich zurück. Der Grüne Saal sollte für den Empfang bereits so gut wie vorbereitet sein.
Ben schüttelte den Kopf, und sein Mund verzog sich zu einem Grinsen. »Ich werde doch in eurer Nähe keine Schokolade allzu lange unbewacht lassen.«
»Das ist allerdings verständlich«, stimmte ich ihm zu. Fast jeder, der lange genug im Veranstaltungsbusiness arbeitete, hatte die Fähigkeit perfektioniert, Serviertabletts zu plündern und dann alles kunstvoll neu zu arrangieren, um die Beweise zu vertuschen. In der Nähe dieser Crew war keine Schokoladentorte sicher.
Ben arbeitete für das Catering-Unternehmen, das für das San Francisco War Memorial and Performing Arts Center zuständig war. Der Gebäudekomplex beherbergte das Ballett, das Sinfonieorchester und die städtische Oper sowie eine Gedenkstätte. Es gab hier einige der größten und schönsten Gebäude in der Bay Area. Heutzutage deckten Hochzeitsfeiern und Galas die laufenden Kosten des Centers, Aufführungen von Schwanensee oder klassische Konzerte waren Luxus. Ich war für Luxus hier, arbeitete nicht in der Gastronomie, sondern sprang ein, weil das Streichquartett kurzfristig eine Cellistin brauchte.
Ich ging weiter in Richtung Küche anstatt zur Künstlergarderobe. Das Einzige, was ich noch dringender brauchte als fünf Extra-Minuten, war eine Tasse Kaffee. Nur so konnte ich verhindern, dass ich mitten im Konzert einnickte. Ich lehnte meinen Koffer vor der Küche an die Wand und schlich mich hinein, wobei ich mich bemühte, nicht im Weg zu stehen. Ich kam immerhin bis zur Kaffeemaschine, bevor ich erwischt wurde.
»Vergiss es.« Ein Küchenhandtuch klatschte neben meiner Hand auf den Tresen. »Daraus wird nichts.«
Ich erstarrte, den Arm noch immer nach der Kanne ausgestreckt, als Molly, die Küchenchefin, Leiterin des Caterings und Zerberus des Kaffees, sich zwischen mich und mein ersehntes Getränk stellte.
»Ich habe heute noch keinen Kaffee getrunken«, log ich und blinzelte unschuldig, als hätte ich nicht gerade versucht, Mundraub zu begehen.
»Ach ja?« Molly verschränkte die Arme und starrte mich böse an. Ihre Korkenzieherlocken waren mit einem Tuch zu einem engen Zopf gebunden, damit keine Haare ins Essen fielen. Sie trug ihr Haar immer so, dazu Kochjacke und karierte Hose. Ihr Tuch war das Einzige, was sich ständig änderte. Heute war es ein karmesinrotes Paisleymuster. »Du vibrierst ja geradezu. Wie viel Koffein hast du schon intus?«
»Okay, ich hatte unterwegs einen Latte.« Ich hielt inne und hoffte, sie würde sich vom Automaten wegbewegen. Aber sie rührte sich nicht. »Und eine Tasse, bevor ich losgegangen bin.« Die zwei, die ich nach meiner Schicht im Diner getrunken hatte, zählten nicht. Denn das war streng genommen noch gestern Abend gewesen.
»Zwei, hm?« Sie warf einen weiteren misstrauischen Blick auf mich, als ob sie ein unsichtbares Messgerät auf meiner Stirn checken würde. »Du hast mehr Koffein als Wasser in deinem Blutkreislauf. Ich gebe dir einen koffeinfreien Kaffee.«
»Nein! Lieber tot als koffeinfrei! Hab Erbarmen«, flehte ich. »Ich hatte gestern Abend eine Doppelschicht.«
Molly knurrte, bevor sie den Weg freigab. Ich verschwendete keine Sekunde, nahm die Kanne und schenkte mir einen Becher ein. Als ich das kräftige Aroma einatmete, spürte ich, wie mein Energielevel augenblicklich anstieg.
»Du musst den Job als Kellnerin aufgeben«, stellte Molly fest und drehte sich um, um einen Teller zu kontrollieren. Sie ordnete die Garnierung neu und nickte. Die Kellnerin verschwand in Richtung des Festsaals.
»Und mich mit meinem Treuhandfonds auf meiner Jacht zur Ruhe setzen?«, fragte ich lachend. »Ich denk drüber nach.«
Mollys Lippen formten eine gerade Linie – wie immer, wenn sie eine echte Erkenntnis heraushauen wollte – praktische Ratschläge zumeist, die durch Fakten und Logik untermauert waren. Wir wussten beide, dass es reine Glückssache war, ob man seinen Lebensunterhalt als Musiker verdienen konnte. Wie sollte ich ihr klarmachen, dass ich die Musik so liebte wie sie das Essen? Es war nicht meine Schuld, dass Cellisten nicht annähernd so gefragt waren wie preisgekrönte Köche. »Du kannst so nicht weitermachen, Thea.«
»Ich muss aber meine Rechnungen bezahlen«, erinnerte ich sie. Das war etwas, was ich ihr – und mir selbst – schon oft gesagt hatte.
»Gut, dann lass dir aber wenigstens eine Quittung geben.« Molly verdrehte die Augen und begann, auf einem Silbertablett Austern auf Eis zu arrangieren.
Zwischen der gestrigen Doppelschicht, zwei Stunden Schlaf, dem Unterricht und zu wenig Kaffee hatte ich es versäumt, mir die Textnachricht anzusehen, die ich wegen der Veranstaltung heute Abend bekommen hatte.
»Ist das eine Firmenfeier?«, vermutete ich und hoffte, dass es kein ruhiger Abend werden würde, an dessen Ende ich mit meinem Cello zwischen den Beinen einschlief.
»Ich glaube schon. Derek ist lächerlich vage. Du hättest die Menüwünsche sehen sollen, die ich bekommen habe.«
»Glutenfrei?«, riet ich. Molly hasste es, wenn man ihre Kunst einschränkte – wie sie es ausdrückte –, und misstraute Menschen mit speziellen Diäten.
Sie schüttelte den Kopf und schnitt eine Grimasse.
Ich rechnete mit dem Schlimmsten. »Veganer?«
»Schlimmer«, sagte sie mit gesenkter Stimme. Ich konnte mir nicht vorstellen, welche Gruppe ihre Kochkünste mehr einschränken könnte als Veganer, es sei denn, es handelte sich um eine fiese Mischung aus glutenfreien Veganern und Allergikern. »Sie wollten eigentlich ganz auf das Catering verzichten.«
Wegen der großen Nachfrage für Veranstaltungen verlangte das Zentrum eine saftige Saalmiete und eine Mindestbestellmenge für das Catering. Aber ich wusste, dass es hier nicht um Geld ging. Nicht für Molly. »Wissen die denn nicht, dass du ein Genie bist?«
»Derek hat es ihnen gesagt.« Sie schien erleichtert zu sein, dass ich das auch so sah, aber dann schüttelte sie den Kopf. »Am Ende wollten sie Kaviar, Austern, Gänsestopfleber, Steak Tartar und einen Haufen Gebäck, von dem sogar Ben noch nie gehört hatte.«
»Was für unzivilisierte Banausen«, stichelte ich, während ich an meinem Kaffee nippte. »Was ist falsch daran?«
»Für mich gibt es da kaum etwas zu kochen. Klar, Ben darf backen, aber was soll ich mit einem Rohkost-Menü anfangen, denn darauf läuft es doch hinaus. Ich meine, wenn sie das wollen, sollen sie doch einfach eine Tüte Chips aufreißen und in eine Schüssel schütten!«
»Sie haben eindeutig keinen Geschmack.«
»Das ist einfach merkwürdig. Wer veranstaltet schon eine Cocktailparty ohne Häppchen?« Sie lächelte. »Zumindest haben sie einen ziemlich erlesenen Nicht-Geschmack. Obwohl sie erst gar nichts wollten, haben sie es nun geschafft, dass ich eine sechsstellige Summe aufschlagen musste. Wie auch immer: Ich an deiner Stelle würde mich auf ein sehr anspruchsvolles Publikum einstellen.«
»Cellistinnen wird selten viel abverlangt«, beruhigte ich sie. Molly nickte, abgelenkt von einem Küchenhelfer, der ein Tablett mit getoasteten Baguettescheiben, die mit schwarzem Kaviar belegt waren, vorbeitrug. Ich nutzte die Gelegenheit, meinen Becher noch einmal aufzufüllen. Dann sah ich auf die Uhr. »Ich mache mich jetzt besser fertig.«
»Du solltest dich beeilen«, sagte sie abwesend, »und auf koffeinfreien Kaffee umsteigen. Sonst beeinträchtigst du dein Wachstum!«
Ich lachte, als ich meinen Cellokoffer aufhob. Sie hatte sich schon abgewandt, um sich um ein anderes Tablett zu kümmern. Molly ritt zu gern darauf herum, aber ich bezweifelte, dass ich mit meinen zweiundzwanzig Jahren noch wachsen konnte. Ich war genau einen halben Zentimeter größer als einen Meter fünfzig, Kaffee hin oder her. Meistens hielten mich die Leute für ein Kind. Selbst Leute, die mich kannten, schienen sich nur schwer darauf einstellen zu können, dass ich eine Erwachsene war, die ihr letztes Semester an der Lassiter University absolvierte. Das war ärgerlich, auch wenn es nicht böse gemeint war. Außerdem bedeutete meine Größe, dass ich hohe Schuhe tragen konnte, ohne jemals größer als mein Date zu sein. Nicht, dass ich zwischen meinem Job im Diner, meinen Auftritten und den Übungsstunden überhaupt Zeit für ein Liebesleben gehabt hätte. Zur Sache ging es nur in meinen Träumen. Zumindest, wenn ich Zeit zum Schlafen fand.
Mit meinem Instrument verließ ich vorsichtig die Küche, um nur ja keine Servierwagen umzustoßen oder so, und ging in den kleinen Raum, der uns Musikern zur Vorbereitung auf die Veranstaltung diente. Die zusammengewürfelten Möbel waren in eine Ecke geschoben worden, damit wir vier zumindest genug Platz hatten, uns bewegen zu können. Normalerweise war dieser Raum für die Bräute reserviert und mit Tüll und Spitze geschmückt. Im Moment wirkte es eher, als hätte jemand vier Leute in einen Schrank gesperrt.
Ich trank einen letzten Schluck Kaffee und machte mich auf eine lange Nacht gefasst. »Ich bin da!« Ich schaute auf die Uhr und sah, dass uns noch fünf Minuten blieben, bis wir im Ballsaal zu erscheinen hatten. Sam und Jason nickten mir ausdruckslos zu, waren auf ihre Geigen konzentriert. Sam war vor Jahren aus dem Sinfonieorchester ausgeschieden und spielte nur noch zum Spaß. Jason hoffte wie ich, dass bald eine Vollzeitstelle im Orchester frei würde. Da wir nicht dasselbe Instrument spielten, blieb es uns erspart, miteinander zu konkurrieren. Meistens jedenfalls. Das konnte ich von dem vierten Mitglied unseres Ensembles nicht behaupten. Sie betrachtete unabhängig vom Instrument jede andere Musikerin als Konkurrenz.
Unsere Vierte im Bunde, Carmen D’Alba, hatte den kleinen Schminktisch und den Spiegel mit Beschlag belegt und war mehr auf ihr Äußeres als auf ihre Bratsche bedacht. Gerade versuchte sie angestrengt, im Schummerlicht des Zimmers ihr Make-up zu inspizieren. Sie wirkte immer wie ein Gast, nicht wie jemand, der zum Unterhaltungsprogramm beitrug. Und auch heute war das nicht anders. Sie trug ein trägerloses, schwarzes Kleid, das bis zum Boden reichte, und hatte ihr dichtes, schwarzes Haar elegant hochgesteckt. Sie strahlte eine animalische, unverhohlene Sinnlichkeit aus. Ihre weiche, kurvige Figur passte zu ihren vollen Lippen, die in einem kräftigen Rot geschminkt waren und einen Kontrast zu ihrer hellbraunen Haut bildeten. Carmen gehörte zur Zweitbesetzung des städtischen Sinfonieorchesters. Ich hatte mich nie getraut, sie zu fragen, warum sie bei Veranstaltungen mit unserem Quartett auftrat, und sie hatte mir auch nie ihre Beweggründe erläutert.
»Es ist unprofessionell, schon gestylt aufzutauchen«, belehrte mich Carmen. Sie stand auf und holte endlich ihr Instrument heraus. Ihr Blick glitt mit Abscheu über mein abgetragenes, schwarzes Kleid, während sie ihre Bratsche stimmte. »Hattest du das nicht auch schon am Dienstag an?«
»Ja, aber ich hab es gewaschen. Ich hatte eine Nachmittagssitzung, die etwas länger dauerte.« Ich zwang mich zu einem strahlenden Lächeln. Es war nicht leicht, Carmen zu mögen, aber ich hatte mir vorgenommen, sie mit Freundlichkeit zu schlagen. Allerdings schien sie das nur noch mehr zu verärgern. Andererseits war totaler Frust bei Carmen Normalzustand.
»Du solltest dir etwas Neues leisten, vor allem, wenn du für das Reed-Stipendium vorspielst. Ich habe mir schon ein Kleid gekauft«, fuhr sie fort und legte sich vielsagend den Finger ans Kinn.
Das Reed-Stipendium war ein heikles Thema zwischen uns beiden, seit wir über das Center davon erfahren hatten. Ein reicher, anonymer Spender finanzierte ein Jahr lang die Lebenshaltungskosten für eine eine junge Musikerin oder einen jungen Musiker. Niemand wusste, wer das Programm ins Leben gerufen hatte, doch die Gewinnerin oder der Gewinner sollte dafür während der Laufzeit der Vereinbarung Privatkonzerte geben. Da das Center das Stipendium öffentlich bewarb, musste alles mit rechten Dingen zugehen. Die meisten von uns vermuteten, es handele sich um einen exzentrischen Milliardär, der Freude daran hatte, als Mäzen zu wirken. An solchen Leuten mangelte es in San Francisco nicht.
»Das hättest du lassen können«, unterbrach Jason, »denn ich werde das Stipendium gewinnen.«
»Wir werden sehen.« Carmens süffisantes Lächeln verriet sehr deutlich, wie sie seine Chancen einschätzte. An mein Vorspiel schien keiner von ihnen einen Gedanken zu verschwenden, was ich nicht persönlich zu nehmen versuchte. Aber wenn Carmen abfällige Bemerkungen über meine Kleidung machte, fragte ich mich unwillkürlich, ob sie sich einbildete, mir damit einen Gefallen zu tun, ob sie mir einen Dämpfer verpassen wollte oder ob es ihrer verqueren Auffassung von Freundschaft entsprach.
Jason und Carmen waren zu sehr damit beschäftigt, sich zu streiten, um zu bemerken, wie ich mich zu dem freigewordenen Spiegel schlich. Ich war zu gehetzt gewesen, um mir Gedanken über mein Aussehen zu machen. Als ich mich jetzt im Spiegel sah, stöhnte ich auf. Der Nieselregen, der heute Nachmittag über die Stadt hinweggezogen war, hatte meinem Haar übel mitgespielt, obwohl ich es mir heute Morgen sorgfältig zu einem Dutt frisiert hatte. Wenn man bedachte, dass ich mein Cello vom Bahnhof aus fast eine Meile durch die Gegend geschleppt hatte, hätte es allerdings schlimmer sein können. Das größte Problem war mein Haar. Egal, welche Gels und Schaumfestiger ich ausprobierte und welche Wunder sie auch versprachen – innerhalb weniger Augenblicke lösten sich die Haarsträhnchen und kräuselten sich in meinem Nacken. Ich blies eine besonders ungehorsame Strähne aus den Augen und steckte sie mir hinters Ohr. Ich betrachtete die Mittel, die mir zur Verfügung standen, und überlegte kurz, es offen zu tragen. Aber es war noch etwas feucht, was bedeutete, dass ich nicht wusste, wie es trocknen würde. Dann erinnerte ich mich an Carmens glänzenden Dutt. Ich würde nie so gut aussehen wie sie, aber ich konnte es versuchen. Ich hatte nur ein paar Minuten Zeit, und ich brauchte jede einzelne davon sowie zwei Dutzend Haarklemmen, um mein Haar zu bändigen. Wenn ich es hochsteckte, sah es auch weniger kupferfarben und mehr kastanienbraun aus. Ich nahm Carmens Flasche mit Haarspray vom Tresen und sprühte es großzügig auf. Ich befahl meinem Haar, mir gefälligst zu gehorchen, aber mir war klar, dass es das nicht tun würde.
Für mehr als Lipgloss reichte die verbliebene Zeit nicht aus. Mir kam unwillkürlich der Gedanke, dass Carmen mit meiner Kleidung recht haben könnte. Das lange, schwarze Kleid, das ich zur Aufführung trug, war sauber und knitterfrei, aber die Farbe war zu einem dunklen Grau verblasst. Das war nicht verwunderlich, denn meine Mutter hatte es vor ein paar Jahren aus ihrem Kleiderschrank spendiert. Das Etikett war nicht lesbar, aber sie schwor, dass es ein Designerstück war. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie es für eine Beerdigung gekauft hatte. Ich tat mein Bestes, um nicht daran zu denken. Tod und Partys – auch wenn ich auf den Partys arbeitete – waren keine gute Kombination.
Und ein neues Kleid fürs Vorspielen? Keine Chance. San Francisco war eine der teuersten Städte der Welt, und obwohl ich zwei Mitbewohner hatte, war es schwierig für mich, jeden Monat die Miete zu bezahlen. Mein fragwürdiges Designerkleid musste also genügen.
»Die Gäste treffen ein. Es geht los«, verkündete Sam.
Ich beeilte mich, mein Cello aus dem Koffer zu nehmen, als die anderen schon den Raum verließen. Ich ging schnell den Flur hinunter in den Grünen Saal, der, wie ich fand, eher palladiumblau als grün aussah. Vielleicht ließen die vergoldeten Details und die fünf riesigen Kronleuchter die Farbe für andere grün wirken.
Als ich eintrat, stieß ich fast mit den anderen zusammen. Sie waren alle abrupt stehen geblieben und starrten, die Instruktionszettel in der Hand, in eine Richtung.
»Was ist?« Ich versuchte, an ihnen vorbei zu spähen. Ich war zu klein, um ihnen über die Schultern zu sehen.
»Ich glaube, das ist ein Model-Treffen«, murmelte Jason.
Ich knuffte ihn mit dem Ellbogen, und er trat schließlich so weit zur Seite, dass ich sehen konnte, wovon er sprach.
Die atemberaubendsten Menschen, die ich je gesehen hatte, waren unter den hohen Decken des Raumes versammelt. Jede Person, auf die mein Blick fiel, war gutaussehend bis umwerfend schön. Absolut jede, ohne Ausnahme. Eine stattliche Brünette war in einen schimmernden Stoff gehüllt, der ihre makellose Figur wie flüssiges Gold umspielte. Ein attraktiver Mann mit tiefschwarzer, schimmernder Haut unterhielt sich in der Ecke mit einer zierlichen Blondine. Es kostete mich Mühe, meinen Blick von der Gruppe loszureißen. Jason wirkte genauso fassungslos wie ich.
»Mach den Mund zu. Du sabberst«, murmelte ich. Dabei konnte ich es ihm nicht verübeln. Wir waren Sterbliche in der Gegenwart von Göttern.
»Wahrscheinlich ist es eine Tagung für plastische Chirurgie.« Sam zuckte unbeeindruckt mit den Schultern. »Wir sollten wohl besser loslegen.«
Wir entdeckten unsere Notenständer und Stühle in der Nähe der Bar. Ich nahm meinen Platz ein und zwang mich dazu, mich aufs Cello zu konzentrieren, anstatt die Gäste weiter anzustarren. Ich nahm Haltung an und kippte mein Cello so, dass ich den besten Winkel für meinen Bogen hatte. Dann checkte ich meine Noten.
Sam gab uns den Auftakt zum ersten Stück, und ich entspannte mich beim Spiel. Das unbestimmte Lampenfieber, das ich immer zu Beginn eines Auftritts verspürte, ließ nach und wurde durch die Freude an der Musik ersetzt. Wenn ich spielte, war die restliche Welt vergessen. Meine Studienkredite spielten keine Rolle mehr. Moms Krankenhausrechnungen existierten nicht. Alles war richtig. Alles war in Harmonie.
Eine Melodie ging in eine andere über. Ich verlor das Zeitgefühl und tauchte völlig in die Musik ein. Meine Augen schlossen sich, als ich die letzten Noten des Andante con moto aus Schuberts Der Tod und das Mädchen spielte. Ich hörte wie aus weiter Ferne Sams Ankündigung, dass wir eine zwanzigminütige Pause einlegen würden. Innerlich war ich noch beim letzten traurigen Crescendo. Wenn wir dieses Stück beendet hatten, blieb immer ein Gefühl der Sehnsucht in mir zurück.
Als ich schließlich aus meiner Trance erwachte, waren die anderen bereits gegangen. Allmählich nahm ich das Gemurmel um mich herum wahr. Ich holte tief Luft und senkte den Bogen. Ein Gewahrwerden breitete sich in meinem Körper aus, huschte wie auf Spinnenbeinen meinen Nacken hoch, und als ich den Kopf hob, blickte ich in das schönste Gesicht, das ich je gesehen hatte. Ich schnappte nach Luft, aber es war nicht die unglaubliche Attraktivität des Mannes, die mich so überraschte. Sondern der mörderische Blick in seinen stechenden blauen Augen.
3 JULIAN
Dreißig Jahre waren vergangen, und ich hatte nichts verpasst. Ich war daran gewöhnt, dass meine Mutter das Normale einfach ignorierte und direkt ins Extreme ging. Aber sie schien darauf bedacht zu sein, meine Erwartungen noch zu übertreffen. Sie war so mit den Planungen beschäftigt, dass sie mich bei meiner Ankunft in Kalifornien nicht mal begrüßen konnte. Sie behauptete, es sei ihre Pflicht als Oberhaupt einer der großen Familien der Bay Area, zum Saisonauftakt eine Veranstaltung auszurichten. Aber ich wusste, worum es bei dieser Party wirklich ging: Man würde mir aus allen Richtungen potenzielle Partnerinnen zuschieben.
Sebastian hatte sein selbstgefälliges Gesicht nicht mehr sehen lassen, seit wir uns auf der Insel getrennt hatten, aber ich wusste, dass er irgendwann hier aufkreuzen würde. Schon die Ballsaison war ein Höhepunkt, aber die Riten ließ wirklich niemand aus. Nicht mal ich. Ich kannte die meisten Vampire in diesem Raum, was ebenfalls keine große Überraschung war. Ich ließ den Bourbon in dem Glas in meiner Hand kreisen und machte mich auf die unerbittliche Brautschau gefasst, die nun beginnen sollte. Während der normalen Ballsaison gab es immer ein paar Romanzen, von denen einige sogar ohne Blutvergießen endeten. Der Vollzug der Riten jedoch bedeutete etwas viel Schlimmeres als Flirts, Paarungen oder Gewalt. Sie brachten ein Schicksal mit sich, dem ich mich unbedingt entziehen wollte, ungeachtet der Traditionen oder der Einmischung meiner Mutter.
Aber die Pflicht rief, und so fand ich mich im Herbst Theatre ein, dem intimsten Gebäude des Performing Arts Center von San Francisco. Der Ballsaal war nicht der größte Veranstaltungsraum des Komplexes, aber er war prachtvoll genug für den erlesenen Geschmack von Vampiren. Die Fensterbögen und die gewölbten Decken waren mit vergoldeten Ornamenten verziert, die mit den antiken Kristalllüstern harmonierten. Da sich jedoch die Hälfte aller reinblütigen Vampire des Landes hier eingefunden hatte, wurde es eng. Deshalb suchte ich mir einen Platz an der Bar. Sie lag etwas abseits, versteckt im hinteren Teil des Saals. Die anderen waren hier, um sich unter die Leute zu mischen und zu prahlen, zu flirten und zu flanieren. Ich dagegen wollte in Ruhe gelassen werden. Hinter den hohen Fenstern erhellten die Lichter der Stadt die Dunkelheit. Die Nacht rief nach mir, lockte mich, in sie einzutauchen, und ich saß auf einer Cocktailparty fest.
»Deine Zeit ist um, mein Freund!« Zwei blaue Samthandschuhe landeten mit einem dumpfen Schlag auf der hölzernen Theke neben mir und verkündeten dramatisch die Ankunft ihres Besitzers. Die Worte kamen aus dem Mund eines schlanken, dunkelhäutigen Mannes mit Hakennase und grausamen, schwarzen Augen. Er war der untote Beweis dafür, dass nicht alle Vampire so schöne, elegante Geschöpfe waren wie die meisten anderen im Raum.
Manchmal fragte ich mich, wer ihn verwandelt hatte und warum. »Boucher«, begrüßte ich ihn und gab mir keine Mühe, meine Stimme über ein Flüstern zu erheben. »Trinken Sie etwas mit mir.«
»Vielleicht ein Glas.« Bouchers Stimme wurde so leise wie meine, als er einen Finger hob. Die Geste wirkte wie die eines wichtigen Mannes, der sich nie dazu herablassen würde, es eilig zu haben. Sie war sehr französisch, und Boucher war ganz und gar Pariser, bis hin zu seinen sauber geputzten Schuhen und dem Wollschal, den er elegant um seinen Hals geknotet hatte.
»Für das hier sind Sie extra aus Paris gekommen?«, fragte ich. Der Boucher, den ich kannte, hasste es, seine geliebte Stadt zu verlassen.
»Ich hatte eine Meinungsverschiedenheit mit dem neuen Chef der Oper.« Er zuckte mit den Schultern. Der Barkeeper stellte ein Glas vor ihm ab, und Boucher steckte einen nagelneuen Hundertdollarschein in seinen Trinkgeldbecher.
»Wer hat gewonnen?«
»Na wer wohl? Ich.« Er lächelte und zeigte dabei scharfe, weiße Zahnreihen. Ich machte mir nicht die Mühe zu fragen, wie. Wenn er deswegen Paris verlassen hatte, war Gewalt im Spiel gewesen. Wahrscheinlich hatte man ihn verbannt, bis das Verbrechen, das er begangen hatte, aus dem Gedächtnis der Öffentlichkeit getilgt war.
»Ich helfe momentan dem Orchester hier mit meinem Fachwissen.«
»Das können sie bestimmt gebrauchen.«
»Sie ahnen ja nicht …« Er seufzte schwer. »Wann sind Sie angekommen?«
»Vor ein paar Tagen«, antwortete ich knapp. Wir hatten ein wohlwollendes Verhältnis, aber ich hätte ihn kaum als Freund bezeichnet. Vampiren aus anderen Blutlinien zu vertrauen war undenkbar, aber Boucher und ich liebten beide die Musik, deshalb kam ich mit ihm besser aus als mit den meisten anderen.
»Irgendwelche Favoriten?« Er musterte die Menge um uns herum und ließ den Blick über die sterblichen Frauen im Raum schweifen. »Ich beneide Sie nicht. Ich könnte mich nie entscheiden. Sie duften alle berauschend.«
Ich verzog die Lippen bei dieser Anspielung. Ich hatte mein Bestes gegeben, um das Aroma von Blut zu ignorieren, das in der Luft waberte. Die anwesenden sterblichen Männer und Frauen entstammten samt und sonders Familien, die fast so alt waren wie die der Vampire hier. Wie ihre Vorfahren waren sie zu idealen Gefährten herangezogen worden, weil man hoffte, sie mit einer vampirischen Blutlinie zu paaren. Für Menschen waren sie bemerkenswert attraktiv. Die Familien dieser Vertrauten verbrachten Jahre damit, ihre bestaussehenden und talentiertesten Kinder auszubilden, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Die meisten Ehen zwischen Vampiren und Vertrauten waren zeitlich befristete Vereinbarungen, die Jahre, manchmal Jahrzehnte dauern konnten. Doch die Riten machten die Sache etwas interessanter. Denn diese Menschen hier bemühten sich um eine Heirat und die Chance, einen Erben hervorzubringen.
Als ob die Welt mehr Vampire bräuchte.
»Warum in aller Welt nehmen wir immer noch an diesem Fleischmarkt teil?«, fragte ich ihn.
Bouchers dunkle Augenbrauen zogen sich vor Überraschung zusammen. »Hat Ihnen Ihre Mutter nichts gesagt?«
»Sie geht mir aus dem Weg«, sagte ich ihm. Ich hatte sie seit meiner Ankunft nicht gesehen. Über die heutige Veranstaltung war ich durch eine geprägte Einladungskarte und einen Smoking, die in meiner Wohnung in der Innenstadt auf mich gewartet hatten, informiert worden.
»Sabine liebt wirklich ihre Spielchen.« Er kippte den Rest seines Drinks hinunter. »Eine Party ist nicht der richtige Ort, um über ernste Angelegenheiten zu sprechen, aber der Convent hat befunden, eine Blutauffrischung wäre angebracht.«
»Meinen Sie damit etwa Babys?«, fragte ich säuerlich.
»Was denn?«, fragte er zurück. »Sie klingen, als ob Sie keine mögen.«
»Was gibt es da zu mögen? Windeln? Geschrei?« Reinblütige Vampirbabys unterschieden sich von sterblichen Säuglingen nur durch ihre Ernährung und Lebenserwartung. Der Rest war grotesk ähnlich.
»Ihre Mutter hat sehr viel zu tun. Ich glaube nicht, dass sie Ihnen vorsätzlich aus dem Weg geht«, erklärte Boucher lachend. »Ich glaube, sie hat einen Schlachtplan.«
Unser Gespräch wurde von einer Gruppe von Musikern unterbrochen, die ein paar Meter hinter dem Eingang stehen geblieben waren, um zu glotzen. Ich sah Boucher an und verdrehte die Augen, aber der lachte nur, als wir sie in dem beleuchteten Barspiegel unauffällig beobachteten. Eine Flaschenbatterie, aufgereiht wie ein Trupp Soldaten, versperrte mir die Sicht auf alle. Warum brauchten diese prätentiösen Bars einen Spiegel? Aber diese Menschen fesselten unsere Aufmerksamkeit nicht auf Dauer. Bouchers dunkle Augen folgten im Spiegel den interessanteren Vampiren und Vertrauten.
»Sollten sie nicht gebannt werden?«, fragte ich ihn. Meine Gedanken waren noch bei den Menschen. Es war üblich, vor großen Veranstaltungen alle menschlichen Teilnehmer mental vorzubereiten. Eine so große Gruppe von Vampiren war viel zu übernatürlich, um übersehen zu werden.
»Der Convent wird immer fortschrittlicher«, antwortete er. Was Boucher davon hielt, konnte ich an der Missbilligung erkennen, die in seinen Worten mitschwang. »Zwang soll nur in extremen Fällen angewendet werden.«
Ich verzog das Gesicht. »Als Nächstes werden sie uns noch die Eier abschneiden.«
»So weit lässt es niemand kommen«, erwiderte er düster. Doch bevor ich ihn weiter über die Riten oder die neue Menschenfreundlichkeit des Convents ausfragen konnte, nahm er seine Handschuhe. »Ich fürchte, ich muss die Runde machen. Sie werden sich doch nicht den ganzen Abend hier verstecken, oder?«
»Irgendwann werde ich mich wohl ebenfalls unter sie mischen«, erwiderte ich, während er sich die Handschuhe wieder über die Finger streifte. Ich zog meine eigenen Lederhandschuhe aus der Innentasche meiner Jacke, eine notwendige Vorsichtsmaßnahme in gemischter Gesellschaft, und ich hasste es, sie tragen zu müssen.
»Es würde Sie nicht umbringen, sich zu amüsieren«, ermahnte mich Boucher, und zupfte seine Manschetten zurecht.
Es würde mich nicht umbringen. Das war das Problem. Es war lediglich eine Folter, deren Ende nicht absehbar war. Aber Boucher hatte recht. Ich könnte mich in San Francisco amüsieren – sobald ich diese langweilige Party verlassen hatte. Ich beschloss, meine Mutter zu suchen und ihren Vortrag über familiäre Pflichten und Verbindlichkeiten über mich ergehen zu lassen, damit ich verschwinden konnte. Ich drehte mich um, stellte mein Glas auf den Tresen und legte die Handschuhe daneben, um nach meiner Brieftasche zu greifen. Der Barkeeper starrte mich an, als ein weiterer großer Geldschein seinen Weg in den Eimer fand. Man vergaß allzu leicht, dass kleine Geldbeträge den Sterblichen viel mehr bedeuteten. In der Vergangenheit hatte der Bann jegliche diesbezügliche Neugierde der Menschen ausgelöscht. Aber jetzt gab es neue beschissene Regeln, die keinen Sinn ergaben. Es war so typisch für Vampire, auf der richtigen Seite der Geschichte stehen zu wollen.
Doch bevor ich mich umdrehen konnte, wehte ein Duft wie eine Warnung durch die Luft.
Blut. Aber nicht irgendein Blut.
Ich roch sie, bevor ich sie sah.
Zerstoßene Rosenblütenblätter, die über Marie-Antoinettes Dinnerparty schweben. Gebrannter Zucker und Veilchensamt, die auf einen porzellanweißen Hals getupft waren. Die Wärme eines Feuers, das in einem venezianischen Kamin loderte. Der süße Mandelduft eines Frauenschenkels, der sich um meinen Hals legte. Es war, als wäre mein Leben durch ihre Abwesenheit ebenso geprägt gewesen wie dieser Moment durch ihre Anwesenheit. Es kostete mich viel Kraft – mehr als ich in den letzten Jahrhunderten je hatte aufbringen müssen –, mich nicht umzudrehen und den Weg zurückzuverfolgen, den der Duft durch den Raum genommen hatte. Geduld gehörte nicht gerade zu meinen charakteristischen Wesensmerkmalen. Aber dem Aroma zu folgen würde Interesse bekunden, und das durfte ich mir nicht erlauben.
Doch ihr Duft wurde stärker, und ich verfluchte mich selbst dafür, dass ich mir Zeit für einen Drink genommen hatte. Ich hätte schon früher von hier weggehen sollen, um das alles zu vermeiden. Hatte meine Mutter das eingefädelt? War es Sabine Rousseaux endlich gelungen, eine Vertraute zu gewinnen, der ich unmöglich widerstehen konnte?
Meine Finger gruben sich in die polierte Holzplatte, als wäre sie aus Butter geschnitzt, und meine Handschuhe lagen vergessen auf dem Tresen. Die Augen des Barkeepers weiteten sich noch mehr als bei meinem Trinkgeld, und ich stöhnte. Ich nahm mir vor, Celia später zu fragen, in welcher Extremsituation ein Bann gerechtfertigt war. Im Moment war ich mir ziemlich sicher, dass das Durchbohren von massivem Holz mit bloßen Fingern die Kriterien erfüllte.
»Du holst mir jetzt noch einen Drink«, sagte ich ihm also, und er wurde ruhig, als sich unsere Blicke trafen. »Du hast diese Macken am Tresen entdeckt, aber du hast dir keine Gedanken darüber gemacht. Du warst zu sehr mit dem großen Trinkgeld beschäftigt, das du heute Abend einstreichst.«
Er nickte und drehte sich weg, um einen weiteren Scotch in mein Glas zu gießen. Hinter mir begann die Musik zu spielen, und ich entspannte mich. Ich zog meine Finger aus dem Holz und betrachtete die Kerben darin. Ich nahm mir vor, am nächsten Morgen eine größere Spende an das Kunstzentrum zu veranlassen.
Bevor ich aus Versehen noch mehr beschädigte, zog ich schnell meine Handschuhe an und nahm meinen Drink entgegen. Eine weitere Runde würde den Impuls lindern. Der Geruch, der meine Aufmerksamkeit erregt hatte, würde verschwunden sein, wenn ich den Drink geleert hatte, zusammen mit der Vertrauten selbst – verloren unter den vielen Düften, die sich im Raum vermischten.
Doch als ich mich umdrehte, schlug mir das Aroma wieder entgegen. Ein dunkles Verlangen regte sich in mir, und ich begann, den Raum nach dem Ursprung des Geruchs abzusuchen. Ich trat einen Schritt auf die Menge zu, aber die schiere Masse der Partygäste machte es unmöglich, den Duft zu orten. Instinktiv drehte ich mich um, und mein Blick blieb auf dem Streichquartett haften. Irgendwelche männlichen Geiger. Eine kurvige Brünette, die Bratsche spielte. Und dann entdeckte ich die Quelle meines plötzlichen, raubtierhaften Verlangens versteckt im hinteren Teil der Gruppe. Sie saß schief da, das Cello zwischen die Beine geklemmt. Ihr Kleid war abgenutzt und schäbig, und ihr fehlte der Glamour der anderen Frau des Quartetts. Ihr Kopf war konzentriert geneigt und verhinderte, dass ich ihr Gesicht richtig erkennen konnte. Aber eine einzelne Strähne hatte sich aus dem engen Knoten auf ihrem Kopf gelöst. Sie wirkte auf mich ebenso unbeherrschbar wie ihr Haar. Historisch betrachtet war das bei einer Frau ein Warnsignal.
Alles in allem gab es nur ein Wort, um sie zu beschreiben: menschlich.
Sie war ganz sicher kein Objekt der Verkupplungsversuche meiner Mutter. Aber ihr Blut war mächtig. Andere würden es ebenfalls wittern. Sie konnte von Glück reden, wenn sie hier nur ein paar Gläser Blut verlor und mit einem kurzfristigen Gedächtnisverlust davonkam. Normalerweise töteten Vampire keine Menschen, aber während der Ballsaison neigten sie dazu, über die Stränge zu schlagen.
Ich wusste nicht mehr, wie lange ich dastand und überlegte, was ich mit dieser zerbrechlichen Kreatur anfangen sollte. Je länger es dauerte, desto mehr wurde mir etwas anderes bewusst. Ihr Talent. Im Gegensatz zu den anderen spielte sie mit ihrem ganzen Wesen, und diese Fähigkeit würde verloren gehen, falls heute Nacht der falsche Vampir sie in die Finger bekäme.
Ich hasste meine ganze verdammte Spezies. Ich hasste das Getue um mich herum. Ich hasste es, dass man mich aus meinem selbst auferlegten Exil gezerrt hatte, damit ich daran teilnahm.
Und am meisten hasste ich sie – weil sie mich dazu zwang, auf dieser Party zu bleiben. Denn ich konnte sie jetzt unmöglich aus den Augen lassen.
Ich beobachtete sie immer noch, als die Gruppe ankündigte, eine Pause zu machen. Niemand im Raum schien es auch nur zu bemerken. Die anderen drei Musiker verließen rasch den Saal, aber sie verweilte, als wäre sie in ihren Melodien verhaftet. Sollten Menschen nicht einen gewissen Selbsterhaltungssinn aufweisen? Wie konnte sie unbewacht wie ein Snack in einem Raum voller Vampire sitzen? Spürte sie die Gefahr denn nicht?
Plötzlich riss sie die Augen auf und blickte direkt in meine. Ihr Mund formte ein O, und ich hörte ein Keuchen, das nur für meine übernatürlichen Ohren hörbar war. Es war nicht das erste Mal, dass ein Mensch so reagierte, wenn er unvermittelt unserer Art begegnete. Ich kniff die Augen zusammen, fest entschlossen, sie zu verscheuchen. Sie hatte hier nichts zu suchen. Ich starrte sie an, bis ihre Wangen blutrot anliefen, und hielt mich am Tresen fest, damit ich nicht auf sie zuging. Sie wandte sich ab, um ihre Sachen zu holen, und entblößte dabei ihren schlanken, nackten Hals.
Mein Körper interpretierte die Bewegung als eine Einladung – eine Einladung, die anzunehmen ich mich bereits in Bewegung gesetzt hatte.
Wer auch immer sie sein mochte – jetzt war es für sie zu spät.
4 JULIAN
Ich hatte seit vierzig Jahren keinen Menschen mehr getötet. Das würde heute Abend enden. Dabei ging es mir gar nicht darum, sie zu töten. Aber mir war klar, dass mich eine kleine Kostprobe von ihr niemals befriedigen würde. Ihr Blut sang zu mir durch den Raum. Das berauschende Lied lockte mich. Sie war jung. Aber das war mir egal. Sie war begabt. Auch das war mir egal. Ein kleiner Wortwechsel mit ihr, und ich würde sie leicht bannen können, damit sie mit mir ging. Denn wenn ich hier die Kontrolle verlor, konnte es sehr unschön werden.
Die Aktivitäten, die ich plante, waren in der Regel für die After-Partys reserviert, die in privaten Herrenhäusern und Villen stattfanden, wo das Tor unüberwindlich war und die Gästeliste exklusiv. Ein Ortswechsel würde zu lange dauern. Aber das Theater war voller dunkler Ecken und versteckter Winkel, wo ich meine Zähne in diesen Alabasterhals versenken konnte.
Sie rutschte auf ihrem Stuhl herum, als ich mich näherte, und ihr Cello versperrte mir vorübergehend die Sicht auf sie. Es hatte die Wirkung eines Talismans, der sie vor dem Bösen bewahrte.
Ich riss mich von ihr los und ging steifbeinig aus dem Ballsaal. Mit jedem Schritt, den ich mich von ihr entfernte, wurde mein Kopf klarer. Doch jetzt erwuchs in mir ein neues, verstörendes Verlangen. Ich wollte sie beschützen.
Sie beschützen? Wie?
Ich hatte keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte, da ich derjenige war, vor dem sie geschützt werden musste.
Ein sicherer Abstand war unerlässlich. Ich würde nahe genug bei ihr bleiben, um zu verhindern, dass sie einem meiner Artgenossen zum Opfer fiel, aber weit genug entfernt, um nicht vor Hunger den Verstand zu verlieren. Ich hatte Jahre gebraucht, um meinen Blutdurst in den Griff zu bekommen. Warum also fühlte es sich an, als würde mir meine Entschlossenheit wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen?
Der Korridor vor dem Grünen Saal war dankenswerterweise leer. Ich hätte für nichts garantieren können, wenn mir jetzt ein Mensch über den Weg gelaufen wäre. Es gab nur einen sicheren Weg, meinen Durst zu stillen. Ich wollte gerade einen Handschuh ausziehen, als eine zierliche Gestalt in mein Blickfeld trat. Ihr Duft traf mich als Nächstes. So viel zu meiner Strategie.
Es war schwieriger, Abstand zu halten, wenn nur eine Partei von dem Plan wusste. Ich beschleunigte das Tempo und verzog mich in eine dunkle Ecke, um sie vorbeigehen zu lassen. Sie schaffte nur ein paar Schritte, bevor sich ihr eine ziemlich auffällige Person in den Weg stellte.
»Mist«, sagte ich leise, als ich Giovanni Valente erkannte. Der Vampir war nur ein Jahrhundert jünger als ich, aber er stand in dem Ruf, ein Frauenheld zu sein. Das Problem war, dass er dazu neigte, es so mit den Damen zu treiben, dass ihnen Hören und Sehen verging. Auf Dauer und im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber das war keine Überraschung. Mit seinem Aussehen schaffte er es in jeder Epoche, Frauen hinter verschlossene Türen zu locken und zu erobern. Sein schwarzes Haar fiel ihm bis auf die Schultern. Wir waren uns zum letzten Mal in irgendeinem Krieg begegnet. Seit unserer Niederlage hatte ich nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. Zeit war eine heikle Sache. Minuten konnten eine Ewigkeit dauern, während Jahre im Handumdrehen verstrichen. Giovanni hatte immer noch die Statur eines Kriegers. Sein maßgeschneiderter Smoking gab sich keine Mühe, es zu verbergen.
Das Mädchen wich zurück und legte den Kopf in den Nacken, um ihn zu betrachten, denn er war bestimmt mehr als dreißig Zentimeter größer als sie. Ich lauschte und wartete auf eine Reaktion, aber sie gab keinen Laut von sich. Ich kannte sie nicht, aber sie machte mich jetzt schon wahnsinnig.
»Verzeihen Sie«, sagte Giovanni und lächelte sie charmant an, »aber ich wollte Ihnen für die schöne Musik danken.«
Ein Mensch hätte – besonders in dem schwach beleuchteten Korridor – vielleicht nicht bemerkt, dass ihre Finger den Hals ihres Cellos fester packten. Aber mir fiel das sofort auf. Da war er, der Überlebensinstinkt, der ihr im Ballsaal gefehlt zu haben schien. Es ließ darauf hoffen, dass sie nicht dumm war. Aber sie ging nicht auf Abstand von ihm. Stattdessen lachte sie nervös. »Das ist mein Job«, scherzte sie. »Und es geht auch bald weiter, aber jetzt muss ich erst mal für kleine Mädchen …«
»Kleine Mädchen?« Er schnalzte leise. »Sie sollten Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Sie sind eine sehr schöne Frau.«
»Wirklich?« Sie klang, als könnte sie nicht entscheiden, ob sie lachen oder genervt sein sollte.
»Lassen Sie uns spazieren gehen«, schlug er beiläufig vor.
»Aber mein Cello …«
»Nehmen Sie es mit. Sie können mir etwas vorspielen«, sagte er.
Ich hörte den musikalischen Rhythmus, den seine Stimme beim Sprechen bekam. So viel dazu, den hypnotischen Bann nur in Extremsituationen anzuwenden.
Giovanni führte sie von der Party weg in Richtung Theater und ließ keinen Zweifel daran, was er vorhatte. Ich sollte sie ihm einfach überlassen. Sobald sie aus meinem Blickfeld verschwunden war, würde die Faszination nachlassen, die sie ausübte. Ich könnte einfach weggehen. Aber die Frau? Vielleicht war er ja in den letzten Jahren zurückhaltender geworden. Dann ertappte ich mich dabei, dass ich ihnen schnell hinterherlief. Dabei wusste ich gar nicht, was mich das alles überhaupt anging.
Sie verschwanden in der Dunkelheit, und ich spürte, wie etwas in mir Klick machte. Ich eilte ihnen nach, umrundete sie und blieb so abrupt vor ihnen stehen, dass die junge Frau erschrak, sich dabei mit dem Absatz in ihrem langen Rock verfing und nach vorne in meine Arme stürzte. Ihr Cello landete krachend neben uns auf dem Boden, und sie schrie auf.
»Da bist du ja«, sagte ich sanft. »Du warst plötzlich verschwunden.«
Sie stammelte verwirrt und versuchte, sich aus meinen Armen zu befreien.
»Wa …?«
»Giovanni«, unterbrach ich sie. »Entschuldige uns einen Moment. Meine Lady hat eine kleine Neigung zu Pannen und Unfällen.«
Ich bückte mich, löste ihren Schuh von ihrem Kleid und hielt ihn ihr hin. Sie schob den Fuß hinein und drehte sich sofort zu ihrem Cello am Boden um.
»Julian. Ich wusste nicht, dass du wieder in San Francisco bist. Oder dass diese Sterbliche vergeben ist.« Er trat einen Schritt von uns weg. Er hatte lange genug gelebt, um zu wissen, wie sehr Vampire an ihren Gespielinnen hingen.
»Aber ich …«, versuchte die junge Frau uns wieder zu unterbrechen. Ich drehte mich um und warf ihr einen scharfen Blick zu. »Still, Kleines!«
Sie versteinerte, und trotz des hypnotischen Banns, der ihren freien Willen unterdrückte, starrte sie mich an. Es war der erste richtige Blick, den ich auf ihr Gesicht werfen konnte. Ihre Nase lief spitz zu und war von Sommersprossen getüpfelt. In der Dunkelheit war nur ein grüner Ring um ihre geweiteten Pupillen zu erkennen. Ein Mensch hätte ihn gar nicht bemerkt, aber für meine Vampiraugen war er deutlich zu sehen.
»Ja«, sagte ich zu Giovanni, als hätte sie nichts gesagt. »Es ist noch ganz frisch.«
»So sieht es auch aus«, sagte er mit einem gefährlichen Unterton und blickte in ihre Richtung. »Ich habe keine Duftmarke von dir an ihr wahrgenommen. Sonst hätte ich …«
»Ein harmloses Versehen.« Ich schob mich zwischen sie und ihn, um meine Botschaft deutlich rüberzubringen.
»Kann sein. Sie ist ganz hübsch für einen Menschen«, kommentierte er.