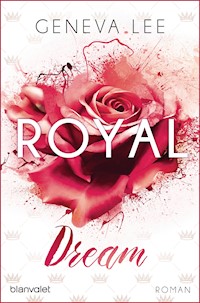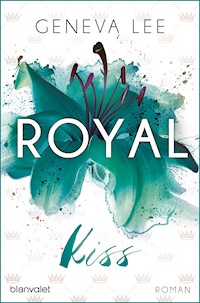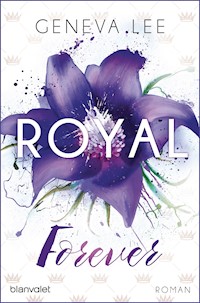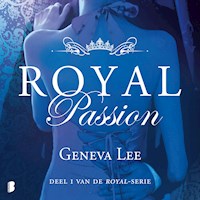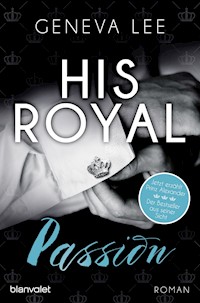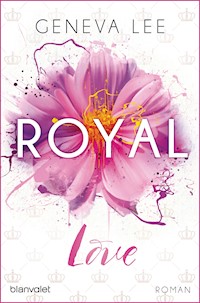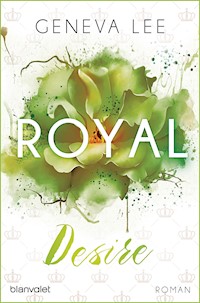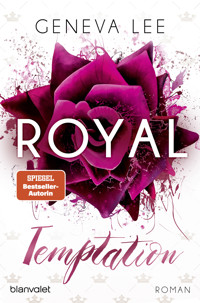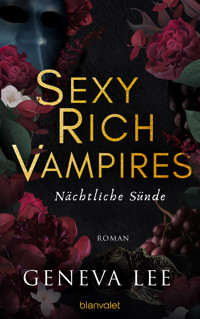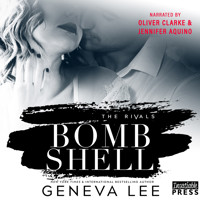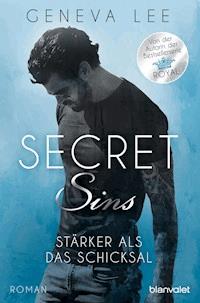
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder Mensch hütet Geheimnisse. Doch wahrhaft lieben kann man nur, wenn man vertraut ...
Faith Kane hält sich und ihren kleinen Sohn Max mit einem Job als Kellnerin mühsam über Wasser. Männern hat sie seit Jahren abgeschworen – bis sie Jude Mercer begegnet, ausgerechnet bei einem Treffen für Suchtkranke. Faith ist klar: Ein Mann, den man an einem solchen Ort kennenlernt – selbst wenn er so attraktiv ist wie Jude –, bedeutet nichts als Ärger. Doch schnell muss sie erkennen, dass bei Jude nichts ist, wie es scheint. Auch er hütet Geheimnisse, ebenso wie sie selbst, und er weiß mehr über Faith, als sie ahnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Faith Kane hält sich und ihren kleinen Sohn Max mit einem Job als Kellnerin mühsam über Wasser. Männern hat sie seit Jahren abgeschworen – bis sie Jude Mercer begegnet, ausgerechnet bei einem Treffen für Suchtkranke. Faith ist klar: Ein Mann, den man an einem solchen Ort kennenlernt – selbst wenn er so attraktiv ist wie Jude –, bedeutet nichts als Ärger. Doch schnell muss sie erkennen, dass bei Jude nichts ist, wie es scheint. Auch er hütet Geheimnisse, ebenso wie sie selbst, und er weiß mehr über Faith, als sie ahnt …
Autorin
Geneva Lee war schon immer eine hoffnungslose Romantikerin, die Fantasien der Realität vorzieht – vor allem Fantasien, in denen starke, gefährliche, sexy Helden vorkommen. Mit der Royals-Saga, der Liebesgeschichte zwischen dem englischen Kronprinzen Alexander und der bürgerlichen Clara, traf sie mitten ins Herz der Leserinnen und eroberte die internationalen Bestsellerlisten im Sturm. Geneva Lee lebt zusammen mit ihrer Familie in Kansas City.
Die Royals-Saga von Geneva Lee
Royal Passion (Clara & Alexander)
Royal Desire (Clara & Alexander)
Royal Love (Clara & Alexander)Royal Dream (Belle & Smith)
Royal Kiss (Belle & Smith)
Royal Forever (Belle & Smith)
Royal Destiny (erscheint im Juli 2017)Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
GENEVA LEE
STÄRKER ALS DAS SCHICKSAL
Roman
Deutsch von Michelle Gyo
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Sins that Bind us« bei Estate Books, Louisville.
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Geneva Lee
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign
Umschlagfoto: © Love N. Creations/Franggy Yanez; Cover-Model: Stu Reardon
WR · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20879-0 V003 www.blanvalet-verlag.de
Für alle, die dem Sturm getrotzt haben, für alle, die ihm noch ausgesetzt sind, und für alle, die wir an ihn verloren haben.
Vorbemerkung der Autorin
Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die »Secret Sins – Stärker als das Schicksal« lesen. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist keine leichte.
Es ist das persönlichste Buch, das ich bisher geschrieben habe, und es taucht ein in Themen, die mein Leben stark beeinflusst haben. Seit meiner Geburt habe ich zusehen müssen, wie die Sucht mir Menschen geraubt hat, die ich liebe. Manche hat sie zu Monstern werden lassen, andere sind daran zerbrochen. Und an manchen Tagen hat es mich selbst zerbrochen, nur hilflos zusehen zu können.
Aber bitte verstehen Sie das nicht falsch, das hier ist immer noch ein Roman. Die Handlung basiert nicht auf realen Begebenheiten, und obwohl die Figuren Wesenszüge von Menschen haben, die ich kannte, basieren auch sie nicht auf lebenden Personen. Und doch ergründet dieses Buch Probleme, die wir nicht offen ansprechen, und die Last, die Drogensüchtige und ihre Freunde und Familien meist stumm ertragen. Man könnte sagen, dass ich dieses Buch schon mein ganzes Leben lang geschrieben habe, und tief in meinem Inneren wünschte ich, ich hätte es nie begonnen.
Falls Ihr Leben in irgendeiner Weise durch Drogen oder Alkohol beeinflusst worden ist oder wird, könnte dieses Buch Sie verstören, aber ich hoffe, Sie lesen es dennoch. Ich habe es für uns geschrieben. Sollten Sie beim Lesen das Gefühl bekommen, mit jemandem reden zu müssen, dann tun Sie es. Und wenn das Buch eine Botschaft hat, dann diese: Du bist niemals allein.
Von ganzem Herzen,
Geneva
1
Manchmal reicht ein einziger Augenblick, um das ganze Leben zu verändern. Und die Veränderung kommt so brutal und unerwartet, dass sie dir die Luft aus der Lunge presst. Doch noch viel häufiger ändert sich das Leben schleichend – durch eine Reihe von winzigen Erschütterungen, die man kaum spürt. Jemand entliebt sich nach und nach, so unbemerkt, wie man sich zu Anfang verliebt hat. Der perfekte Job oder die rosige Zukunft kommen einfach nie so richtig zustande. Der Zusammenbruch dieser Zukunft geschieht nicht plötzlich und ist auch nicht besonders schlimm. Er ist einfach nur unvermeidlich.
Und genau deshalb sitze ich hier, im Keller einer Kirche, ein Mal pro Woche.
Ich rühre beschissenes Milchpulver in den noch beschisseneren alten Kaffee. Den vorherrschenden Geschmack kann man nur verbrannt nennen. Vielleicht ist es aber auch niemandem wichtig, wie er schmeckt. Oder hier sind alle so an Bitterkeit gewöhnt, dass sie ihn genau so haben wollen. Ich habe den Becher aus Gewohnheit genommen. Er ist warm, und ich kann mich an ihm festhalten. Ich kann während der langen, ungemütlichen Pausen an ihm nippen, oder in einem der peinlichen Momente, wenn ein Fremder seine Geschichte erzählt. Er ist eine Requisite, aber ich klammere mich daran, als wäre es eine Kuscheldecke.
Mit dem Styroporbecher in der Hand drehe ich mich um und laufe gegen eine Wand. Nein, es ist keine Wand, es ist ein – er. Die dünne, heiße Flüssigkeit schwappt über den Becherrand, und er kann gerade noch ausweichen, bevor sie sein Shirt ruiniert. Er bewegt sich mit der Präzision eines Mannes, der weiß, wie man es vermeidet, verbrannt zu werden. Die Zeit scheint sich zu verlangsamen, während der Kaffee auf den Boden spritzt. Ich überlege bereits, wie ich die Sauerei aufwischen soll, aber als ich aufblicke, um mich zu entschuldigen, landet mein Blick auf dem muskulösen Oberkörper, den sein schwarzes T-Shirt nicht gerade versteckt. Tattoos bedecken seinen Bizeps, und ich stelle mir vor, dass sie sich bis zu seiner Schulter und zu der wie gemeißelt aussehenden Brust ziehen, die man durch die dünne Baumwolle erkennt. Ein abgetragenes braunes Lederarmband ist um sein Handgelenk gewickelt, und als ich ihm ins Gesicht blicke, erstarre ich.
Seine Augen passen nicht zum Rest – sanft und warm, die Farbe irgendwo zwischen Saphir und Himmelblau. Sie stehen in krassem Kontrast zu den kantigen Linien seines Körpers und dem Kiefer, den er unter einem wilden Bart versteckt, so dunkel wie sein zerzaustes schwarzes Haar. Als er mich jetzt anstarrt, verhärten sich seine Augen zu verächtlichen Edelsteinen.
»Sorry.« Ich mache einen Schritt zurück, damit er vorbeigehen kann, während ich mich nach einer Serviette umsehe.
»Es war ein Missgeschick.« Seine Stimme ist so kalt wie der Blick seiner Augen. »Das passiert.«
Aber nicht ihm. Das höre ich an seinen Worten. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer genau das Gegenteil erfahren habe – mein Leben lang war ich diejenige, die mit Pech und schlechten Entscheidungen gesegnet war, aber sein Verhalten kratzt an meinen Nerven. Ich werde zornig, vergesse die Serviette und den verschütteten Kaffee. »Kein Grund, deshalb zum Arschloch zu werden.«
Seine Augenbraue hebt sich und verschwindet unter einer Haarsträhne, die ihm in die Stirn gefallen ist. »Ich dachte, ich sei ziemlich höflich gewesen, wenn man bedenkt, dass Sie fast einen Becher kochend heißen Kaffee über meine Hose geschüttet haben.« Er beugt sich vor, und ich nehme Seife und einen Hauch Nelke wahr. »Ein Mann muss seine Prioritäten kennen.«
Ah, er ist einer von denen – ein Kerl, der die Aufmerksamkeit ständig auf seinen Schwanz lenkt, als sei er ein Geschenk an die Menschheit. Arrogant. Eben ein Mann.
Ich konzentriere mich auf die Wut, die in meiner Brust brodelt, und ignoriere, dass mein Körper zu dem gleichen Schluss gekommen ist. Ich gebe vor, dass ich den sanften Sog seiner Anwesenheit nicht spüre. Ich verdränge auch den Sprung, den mein Herz macht, als mir ein Bild durchs Gehirn zuckt, wie ich meinen Körper gegen seinen presse.
Ohne ein weiteres Wort wende ich mich ab und lasse ihn und die Sauerei stehen. Er ist dafür genauso verantwortlich wie ich, und meiner Meinung nach kann er ein wenig Verantwortung übernehmen.
Es liegt nicht daran, dass ich mir selbst nicht traue.
Ich setze mich und spekuliere darauf, dass Stephanie, unsere übereifrige Gruppenleiterin, sich nicht neben mich setzt. Zwölf mal vier Metallstuhlbeine scharren über den Gießbetonboden, als sich die anderen anschließen. Stephanie setzt sich neben mich. Ein Becher Kaffee reicht nicht aus, um sich dahinter zu verstecken, aber heute sind ihre Augen auf den Neuen gerichtet: Mister Arrogant.
Ich kann es ihr nicht verübeln. Meine waren es auch, bis er den Mund aufgemacht hat. Ich kann nicht erkennen, ob er wieder weicher geworden ist oder ob unser Beinahezusammenstoß seine Laune nachhaltig beeinträchtigt hat. Das sollte mir egal sein. Es kotzt mich an, dass ich neugierig bin. Männer, die wegen verschüttetem Kaffee ausrasten, stehen ganz oben auf meiner Liste von Leuten, denen ich aus dem Weg gehen sollte.
Stephanie schafft es, sich wieder in den Griff zu bekommen, bevor sie anfangen kann zu sabbern. Dennoch flufft sie ihr wasserstoffblondes Haar auf, als sie aufsteht und uns durch das sinnfreie Mantra über Akzeptanz und Vergebung leitet.
Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf die Worte. Ich habe sie bereits eine Million Mal gesagt. Ich habe sie in mein Kissen geschrien. Ich habe sie wie eine Beschwörung geflüstert. Sie sind nie wahr geworden. Lange Zeit habe ich ihnen geglaubt, dass die Wiederholung langsam, aber sicher an dem Felsen aus Schuldzuweisungen nagt, der auf meinen Schultern ruht. Heute weiß ich, dass ich stattdessen stark genug geworden bin, um sein Gewicht zu ertragen. Sünden, die nicht vergeben werden können, verschwinden niemals. Du kannst sie nicht mit gut gemeinten Worten wegzaubern, weil Vergebung gewährt wird, nicht genommen.
»Möchte jemand etwas mit uns teilen?«, regt Stephanie an. Ihr Anliegen trieft zuckersüß von ihren Lippen, und ich vermisse augenblicklich Ian, unseren früheren Leiter, der keine Zeit hatte für solchen Schwachsinn. Diese Philosophie hat er dann umfassend angewendet und sich zurückgezogen, um die Küste entlangzusegeln. Ich bin mit seinem Ersatz immer noch nicht warm geworden.
Ich schrumpfe in mich zusammen, damit sie mich nicht drannimmt. Das Teilen sollte freiwillig sein. Es gibt immer jemanden, der scharf darauf ist, seine Fehler auszuspucken oder seine Leistungen zu verkünden, aber wenn niemand da ist, dann wird jemand unter Zugzwang gebracht, bis das Treffen läuft. Es ist ja nicht so, dass ich hier sitzen will, um in die Gesichter bekannter Fremder zu starren. Ich will nicht als Erste dran sein. Nicht heute.
»Vielleicht …« Stephanie verstummt, aber ihr Blick hängt an Mister Arrogant fest. Ich schäme mich tatsächlich für sie mit. Es ist mehr als offensichtlich, dass sie ihn in ihrem Kopf vögelt. Es könnte nicht offensichtlicher sein, wenn sie aufstehen und eine pornografische Comiczeichnung auf die Tafel des Kirchenkellers malen würde.
»Jude«, beantwortet er die unausgesprochene Frage.
Großer Gott. Jude. Ich hoffe, er hat ein Motorrad, dann kann er offiziell unser neuer Stadtrebell sein. Sein Blick flackert kurz zu mir, als könne er hören, was ich denke. Er ist wieder weich, bleibt aber nicht bei mir hängen. Ein eiskalter Schauder rieselt mir über den Rücken und streckt seine eiskalten Ranken bis zu meinem Kopf hoch, während mir das Herz unregelmäßig gegen die Rippen pocht.
Ich hoffe, dass er etwas sagt. Ich möchte, dass er seine Geschichte erzählt, damit ich verstehen kann, warum er diese merkwürdige Wirkung auf mich hat. Selbst jetzt, da wir inmitten von zwölf Menschen sitzen, ist die Verbindung zwischen uns greifbar – ein fühlbarer Faden, der sich von ihm zu mir zieht. So habe ich mich nicht mehr gefühlt seit … noch nie. Nicht wegen einem Mann.
Und sicher nicht wegen einem Fremden.
Selbst als er sich jetzt abwendet und an die Gruppe richtet, ist er noch da, bindet uns aneinander.
Er steckt die Hände in die Taschen und grinst. »Wie gesagt, ich heiße Jude. Ähm, wollt ihr meinen Lebenslauf? Eine Liste mit meinen Übertretungen?«
Ein paar lachen leise. Jeder Neuankömmling fällt auf den Klassiker herein: »Ich bin Nancy. Ich bin abhängig« – so hört man es immer in Filmen. Die Wirklichkeit ist ein bisschen anders, abwechslungsreicher. Manche Leute tauchen auf und schütten ihr Herz aus, als würden wir anderen ein Geheimnis kennen, mit dem man alles in Ordnung bringen kann. Andere sitzen da und kochen vor Wut. Das sind die, die gekommen sind, weil ihre Frau oder ihr Mann oder das Gericht es verlangt haben. Am schlimmsten sind die, die bereits alle Antworten kennen. Denen kann man nicht helfen. Dann gibt es die, die zuhören, und die, die warten.
Ich habe keine Ahnung, welcher Typ Jude ist, aber ich weiß, welcher er nicht ist. Er ist kein Herzausschütter, und ich bezweifle stark, dass er zu Hause jemanden sitzen hat, der auf ihn wartet. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, er ist auf richterliche Anweisung hier. Das würde sein Verhalten erklären. Und vielleicht ist da auch ein Teil von mir, der das Gesamtpaket will – Tattoos, Arroganz und Ärger mit dem Gesetz. Keine Frau gibt gern zu, dass sie nie aus der Bad-Boy-Phase herausgewachsen ist.
An meine kann ich mich nicht mal erinnern. Deshalb bin ich hier.
»Die brauchen wir nicht.« Stephanie klimpert mit den Wimpern, und ich begreife, dass ich nicht die Einzige bin, die aus der Phase nicht herausgewachsen ist. »Wenn du uns sagen möchtest, weshalb du hier bist, tu dir keinen Zwang an. Das hier ist ein sicherer Raum.«
Sie malt einen Kreis in die Luft, und ich presse die Lippen zusammen, um nicht loszulachen, und das gerade, als Jude sich auf die Lippen beißt.
Na, das haben wir gemeinsam. Wir erkennen beide die Absurdität der Situation, und doch sind wir beide hier.
Das ist wahrscheinlich unsere einzige Gemeinsamkeit, mahne ich mich selbst.
Er neigt den Kopf ein wenig. »Wenn es dir nichts ausmacht, höre ich erst einmal zu.«
Das hatte ich nicht erwartet. Der Faden, der mich mit ihm verbindet, spannt sich kurz, und ich blicke auf und sehe, dass er mich anstarrt. Diesmal schaut er nicht weg. Sein Blick bohrt sich in meinen, sieht hinter das sorgfältige Bild, das ich von mir selbst erschaffen habe. Diesmal wende ich mich ab, um des Überlebens willen.
Eine Frau fängt an zu sprechen – Anne, bemerke ich –, und er wendet seine Aufmerksamkeit ihr zu. Ihr Mann ist weg. Das musste ja so kommen. Sie ist nicht überrascht. Selbst als sie diese Neuigkeit ruhig vermeldet, wandern meine eigenen Gedanken nach innen. Ich war heute gekommen, um meinen eigenen Durchbruch mitzuteilen. Das möchte ich jetzt nicht mehr, weil die paar Momente mit Jude – einem vollkommen Fremden – das untergraben haben. Die Jahre, die ich mit Büßen verbracht habe, die Opfer, die ich gebracht habe – sie alle sind zerbrochen, als er mich angesehen und die Wahrheit erkannt hat. Meine Welt ist so zerbrechlich wie Glas, schöne Lügen, die sorgfältig in eine Blase gepackt worden sind, um die Hässlichkeit meiner Vergangenheit zu verbergen. Die Hässlichkeit in mir.
Ich weiß jetzt, dass er der Teufel ist, und dass er gekommen ist, um mich für meine Sünden abzukassieren.
Wenig dringt für den Rest des Meetings zu mir durch. Jemand hat Mist gebaut. Es ist sein erstes Meeting, aber seine Ankunft wird von Mister Arrogant überschattet. Heute ist das Jubiläum von Charlies Heilung. Er hat es fünf Monate geschafft. Ich lächle und klatsche mit den anderen mit, aber ich bin mir bewusst, dass meine Nerven eine Grube in meinem Bauch graben.
Meine Gedanken bleiben bei Jude und dem Geheimnis, das er in diese eintönige Stunde meines Lebens gebracht hat. Ich gehe seit vier Jahren zu den Treffen der NA und habe Menschen kommen und gehen sehen. Am Anfang tat mein Herz bei jeder neuen Geschichte weh. Daran leide ich jetzt nicht mehr. Mein Blick ruht auf meinem eigenen Papier, damit ich mich darauf konzentrieren kann, mich im Griff zu behalten.
Nicht dass es in dieser verschlafenen kleinen Stadt viele Versuchungen gäbe. Genau deshalb bin ich hier in Port Townsend hängen geblieben. Es gibt Drogen und Alkohol wie überall sonst auch, aber hier habe ich das Meer und eine winzige, isolierte Welt, die ich mir selbst geschaffen habe. Diese Treffen haben mir genau das beigebracht, was ich zum Überleben brauchte: Je weniger Leute ich an mich heranlasse, desto weniger Möglichkeiten gibt es, dass ich wieder verletzt werde. Ich habe vor Jahren damit aufgehört, diese verletzten und wilden Kreaturen in meine Gedanken zu lassen. Das beschützt mich – was verlockt mich also so an ihm?
Was auch immer es ist – woraus auch immer diese Verbindung zwischen uns besteht –, ich muss es herausfinden und aus mir herausschneiden. Männer wie Jude sind gefährlich. Nicht wegen ihrer Tattoos oder ihrem selbstbewussten Auftreten, sondern weil sie Grenzen als optional ansehen. Und ich kann die Mauern, die ich hochgezogen habe, von niemandem durchbrechen lassen.
Ich kippe die Reste meines Kaffees in den Abfall. Ich habe kein einziges Mal daran genippt. Stattdessen habe ich ihn in meinen Händen kalt werden lassen.
»Was hältst du von Jude?« Sondra ist so alt wie ich, sieht aber aus, als könnte sie meine Mutter sein. Nach jahrelangem Missbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten ist sie auf harte Sachen umgestiegen, sodass sie jetzt Falten so tief wie die Kokslines hat, die sie gezogen hat. Sie ist ein wandelndes Anti-Drogen-Poster.
Ich zucke mit den Schultern, aber ich muss mich nicht besonders bemühen, um sie davon zu überzeugen, dass ich desinteressiert bin. Sie ist zu beschäftigt damit, ihren Angriff zu planen. Ich bewundere ihre direkte Sexualität, obwohl ich nicht vorgebe, sie zu teilen.
Sie wickelt einen Kaugummi aus und steckt ihn in den Mund. »Vielleicht kann ich ihn auf einen Drink einladen. Er ist neu in der Stadt, mit Sicherheit. Ich würde mich daran erinnern, wenn ich ihn gesehen hätte.«
»Einen Drink?«, wiederhole ich spitz.
»Kaffee.« Sie wischt meine Besorgnis beiseite.
»Das wäre nett von dir.« Ich bin nicht bereit, mein eigenes Interesse zuzugeben, aber wenn Sondra ihn dazu bekommt, mit ihr auszugehen, wird sie jede Einzelheit zutage fördern. Ich mache mir eine geistige Notiz, sie nächste Woche nach ihm zu fragen.
»Ich muss gehen. Mein …«, fange ich an, aber meine Entschuldigung ist überflüssig, weil sie bereits weitergegangen ist, um Charlie übertrieben liebevoll zu umarmen. Die feierliche Geste bewirkt, dass sich seine Wangen bis zu den Ohren rosig verfärben.
Das ist nicht mein Ding. Ich umarme nicht oder gebe die Hand. Ich komme, setze mich und versuche, keinen Blickkontakt aufzunehmen, wenn ich diesen Leuten außerhalb dieser Wände hier begegne. Ich gebe eine Stunde meiner Zeit. Nicht mehr.
Da Sondra abgelenkt ist, ergreife ich die Gelegenheit und gehe schnell zum Wandschrank. Das Wetter ist unbeständig, da es auf den Frühling zugeht, aber ich kann eigentlich immer darauf zählen, dass die Brise vom Meer her noch etwas zu kühl ist. Als ich in den Flur trete, halte ich abrupt inne.
Anne schluchzt. Die gefasste Businessfrau, die gerade von ihrer Trennung erzählt hat, ist alles andere als teilnahmslos. Sie ist genauso kaputt wie der Rest von uns.
Schuld schwappt über mir zusammen. So möchte sie nicht gesehen werden. Deshalb kommen wir immerhin hierher – um die Lüge zu perfektionieren, dass wir in Ordnung sind. Solche Lügen müssen geübt werden, bevor sie der Welt glaubhaft vorgeführt werden können, und diese Gruppe ist das unfreiwillige Publikum. Sie will nicht, dass ich sie so sehe, so wie sie nicht will, dass ich – oder ein anderer – die Wahrheit kennt. Ihre Scheidung war nicht unvermeidlich. Sie war nicht einvernehmlich.
Das ist ein weiteres Opfer in dem Kampf, den sie gegen sich selbst führt.
Ich ziehe mich mit dem Plan zurück, meinen Mantel am Sonntag nach dem Morgengottesdienst zu holen. Da tritt Jude aus den Schatten, seine hoch aufragende Gestalt ist bereits vertraut, und geht zu ihr.
Er ist nicht neu bei diesen Treffen. Er hat das durchexerziert wie der Rest von uns. Er hat die richtigen Sachen gesagt und in den richtigen Augenblicken mitfühlend genickt. Er hat sogar gewusst, dass er zuhören muss – eine Fähigkeit, die nur ein bewährter Veteran besitzt.
Und doch nähert er sich jetzt einer Frau, die ihre Maske hat fallen lassen, und bietet ihr Trost an. Ich dachte vorhin, er sei der Teufel, aber jetzt weiß ich, dass er das nicht sein kann. Der Teufel spendet keinen Trost, selbst wenn er lügt. Aber auf einen Engel zu hoffen, wäre zu viel, und außerdem habe ich vor Jahren aufgehört, an sie zu glauben.
Aber ein Mann – aus Fleisch und Blut und mit all den Komplikationen, die damit einhergehen – ist die gefährlichste Möglichkeit von allen.
Ich kann nicht hören, was er zu ihr sagt, als sie zittrig nickt. Seine Hand liegt auf ihrer Schulter, und ich kann das beruhigende Gewicht fast auf meiner eigenen spüren.
Die Einbildung holt mich ruckartig in die Gegenwart zurück, und ich gehe ohne meinen Mantel. Ohne ein weiteres Wort.
Ohne noch einmal zurückzublicken.
2
Den Rest der Woche reiße ich mich täglich zusammen, wenn ich an der Kirche ankomme. Es ist ein unvermeidliches Ritual, und obwohl ich weiß, dass sich die Narcotics Anonymous nur einmal pro Woche im Keller treffen, komme ich nicht dagegen an, mich jedes Mal bloßgestellt zu fühlen, wenn ich über die Schwelle trete. Ich möchte nicht dem mysteriösen Jude in die Arme laufen. Ich habe mir sogar andere Treffen in der Stadt angesehen, mich dann jedoch entschieden, dass das nur der letzte Ausweg ist. Diese Stadt ist meine Heimat. Diese Treffen sind mein sicherer Rückzugsort. Niemand, vor allem kein unhöflicher, arroganter Neuling, wird mich von dort vertreiben. Wahrscheinlich ist er sowieso nur ein Besucher, wie so viele Menschen, die ich täglich auf der Straße sehe. Die Touristen kommen, um sich in der Schickimicki-Hafenstadt auf ihrem Weg zu aufregenderen Orten zu vergnügen. Seattle. Eine Kreuzfahrt nach Alaska. Montreal. Dies hier ist eine Zwischenstation, und die Menschen reisen hindurch und lassen nichts zurück, so flüchtig wie Wellen im offenen Meer.
So ist es schon immer gewesen, und das ist einer der Gründe, aus dem ich diesen Ort ausgewählt habe, um mir hier ein Leben aufzubauen.
Ich überlasse die Stürme der See und finde Frieden auf festem Boden.
Ein Mantra, das ich vor so langer Zeit aufgeschrieben habe, dass ich mich nicht daran erinnern kann, ob es von mir ist oder von jemand anderem. Es ist meine Wahrheit geworden.
Warum hoffe ich also jeden Tag, dass ich diese Tür öffne und ihn wiedersehe? Jude ist ein Sturm – ein Tsunami –, auf den ich nicht vorbereitet bin. Wenn ich könnte, würde ich eine höhere Lage aufsuchen. Ich würde in die Olympic Mountains fahren und dort so lange klettern, bis meine Lungen brennen, statt Gefahr zu laufen, in seinem Fahrwasser zu landen. Doch ich kann mein Leben nicht evakuieren, deshalb öffne ich die Tür und lasse mich von dem bekannten Quietschen beruhigen, mit dem sie mich begrüßt. Ich gehe am Heiligtum vorbei und in den Flur.
Max begrüßt mich an der Tür mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ich schaffe keine zwei Schritte hinein, bevor er über mich herfällt. Seine dünnen Arme schlingen sich um meine Beine, aber ich löse ihn nicht von mir. Stattdessen packe ich ihn und hebe ihn hoch. Er macht es sich auf meiner Hüfte gemütlich, während sein Lehrer aus dem Zimmer stürzt und den anderen Kindern Anweisungen zuruft, aufzuräumen und ihre Sachen zu packen. Max sieht mir kein bisschen ähnlich, bis auf die blassen Sommersprossen auf seiner Nase. Er hat sein wuscheliges dunkles Haar nicht von mir. Meins ist fein und hell. Es fällt mir glatt über den Rücken. Seins ist der Inbegriff eines Pilzkopfs. Meine Augen sind haselnussbraun mit einem Stich ins Grüne, und seine sind so leuchtend blau wie der Himmel. Und doch sehe ich in ihm mein perfektes Selbst.
»Er weiß immer, wann du hier bist.« Miss Marie fängt Max’ Blick auf, während sie unterschreibt. »Er hat den Spinnensinn, nicht wahr?«
Max nickt fröhlich und tut so, als würde er Spinnweben aus seinen Handgelenken abfeuern. Ich spüre heiße Tränen in meinen Augen brennen. Schnell blinzle ich sie zurück, aber Marie streicht mir beruhigend über die Schulter.
»Er macht sich«, flüstert sie.
»Wegen dir.« Ich gebe meinem Sohn einen Kuss auf die Stirn und drücke ihn fest an mich. Miss Marie hat mit ihm in den letzten Monaten an der ergänzten Lautsprache gearbeitet, sie hat ihm geholfen, Lippenlesen zu lernen, zusammen mit der Gebärdensprache.
Marie schnaubt und schüttelt den Kopf. »Eines Tages wirst du akzeptieren müssen, wie wunderbar du bist, Faith.«
Ich lächle, weil sie nicht weiß, dass ich alles andere als wunderbar bin. Weil sie nicht weiß, dass ich verdreht und kaputt bin und dass dieser kleine Junge hier der einzige Grund ist, aus dem ich mich zusammenreiße. Ich lächle, weil ich sie niemals von der Wahrheit überzeugen könnte, und weil ich vor langer Zeit gelernt habe, dass ich die Dinge akzeptieren muss, die ich nicht ändern kann.
Rot. Das ist das erste Wort, das einem in den Sinn kommt, wenn ich meine beste Freundin ansehe. Sie hat sich heute leger gekleidet. Ihre wirren Haare sind zu zwei langen Zöpfen geflochten, die über ihre Schultern fließen. Ihre grauen Augen werden von dem Schirm ihrer Ballonmütze beschattet. Doch trotz ihres lockeren Ensembles wirkt Amie kein bisschen mädchenhaft.
Unser donnerstagnachmittäglicher Lebensmitteleinkauf ist eine wöchentliche Tradition, geboren aus der Not, als sich mein Sohn als Schreibaby erwiesen hatte. Gerade kommt sie herüber, um mit Max »Ich sehe was, was du nicht siehst« zu spielen, während ich die Preise von Tiefkühlgemüse vergleiche.
Ich habe Amie in ihrem winzigen Bistro am Hafen kennengelernt, als ich mich dort nach einem Job erkundigt hatte. Sie hatte einen Blick auf Max geworfen, der erst neun Monate alt war, und mich sofort eingestellt. Wir haben schnell herausgefunden – es gab ein paar peinliche Zwischenfälle mit Tabletts –, dass ich besser hinter den Kulissen arbeite. Jeder andere hätte meinen tollpatschigen Hintern längst gefeuert, aber sie hat mich an den Schreibtisch geschickt, um die Rechnungen zu machen und Vorräte zu bestellen. Das lief besser, als wir erwartet hatten, und so war sie die Erste, die mir dabei geholfen hat, Port Townsend zu meinem Zuhause zu machen. Sie gehörte zu meiner Familie.
Max deutet auf eine Packung Eiscreme, und seine Augen weiten sich zu seinem engelsgleichen Hab-Mitleid-mit-mir-Gesicht. Es würde mich erweichen, hätten wir nicht ein sehr begrenztes Budget. Ich verdiene mit meinem Job bei Amie genug, aber selbst mit dem winzigen Zuschuss, den ich jeden Monat vom Staat bekomme, ist Eiscreme definitiv ein Luxus.
Er versucht seinen Charme bei Amie auszuspielen. Sie wirft mir einen reumütigen Blick zu und öffnet die Tür des Gefrierschranks.
»Ich habe Nein gesagt«, wende ich leise ein. Nicht dass es nötig ist, ich habe ihm den Rücken zugewendet.
»Das ist für mich.« Sie zwinkert ihm durch die beschlagene Glastür zu und nimmt seine Lieblingssorte aus dem Fach: Schoko-Erdnussbutter. »Vielleicht teile ich.«
»Du verdirbst ihn.« Es hilft nicht. Tatsächlich gleicht sie ihren Wunsch, Max zu verwöhnen, mit einer anständigen Portion Realität aus. Wenn Tante Amie da ist, ist sein Bett gemacht und kein Spielzeug liegt auf dem Boden. Sie hat das Ruder fest in der Hand. Und sie kann ihm die kleinen Extras bieten, die ich mir nicht leisten kann.
»Es ist Eiscreme. Kein Pony.« Sie verdreht die Augen, und ich strecke die Hand aus, um ihr den Schirm ihrer Mütze auf die Nase zu ziehen.
Sie hat recht, aber es ist Eiscreme, die ich ihm nicht geben kann, ohne die extra Packung Milch wieder zurückstellen zu müssen. Eiscreme ist kein Frühstück oder ein schneller Magenfüller vorm Zubettgehen.
»Hör auf«, kommandiert sie und schiebt die Mütze wieder zurück.
»Hör auf womit?«
»Alles zu überdenken.« Sie beginnt, in Zeichensprache zu reden, damit Max sie auch versteht: Können wir teilen?
Sein breites Grinsen ist ansteckend. Kein Wunder, dass sie ihm seinen Willen nicht verwehren kann. Wenn ich könnte, würde ich ihm den Mond schenken. Nicht dass er jemals danach fragen würde. Max fragt eigentlich nicht nach viel, nur nach kleinen Sachen wie Eiscreme. Normaler Kram. Ich möchte glauben, dass er zu glücklich ist, um etwas anderes zu wollen, aber ein Teil von mir macht sich Sorgen, dass ich ihm das beigebracht habe. Ich kenne die Gefahr, die Wünschen innewohnt, und wie sie dich zu den verbotenen Früchten locken.
Ich drehe mich um, damit nur Amie mein Gesicht sehen kann. »Ich verstehe das. Ich will ihm nicht beibringen, dass wir arm sind.«
»Das bist du nicht.« Sie presst die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. Diese Miene kenne ich. Normalerweise sieht sie so aus, wenn sie einen Kellner zurechtweist. »Du bringst ihm bei, schlau zu sein. Sparsam. Der Junge hat ein warmes Bett und Essen und jede Menge Liebe. Liebe ist das Einzige, was du im Leben brauchst, um reich zu sein. Mehr ist nur der Zuckerguss.«
»Das klingt nach einem Motivationsplakat. Du machst mal wieder in Mantras, oder?« Ich wünschte, ich würde daran glauben können, dass ich all meine Probleme mit einer positiven Einstellung lösen könnte, so wie sie.
»Zur Hölle, ja.« Sie packt mich an den Schultern und dreht mich herum. »Weißt du, ich habe ein wunderbares neues Mantra, das dich für die Liebe öffnen kann.«
»Ich bin reich genug«, sage ich sofort. Ich bewundere meine beste Freundin, meistens, weil sie das genaue Gegenteil von mir ist. Wenn es um die Liebe geht, leben wir auf verschiedenen Planeten. Ich habe vor Jahren akzeptiert, dass es keine wahre Liebe oder bessere Hälften gibt. Aber das sage ich ihr nicht. Wenn jemand trotzdem eine bessere Hälfte anziehen kann, dann sie.
»Willst du keinen Mann kennenlernen?«, fragte sie mit gesenkter Stimme, damit die Frau, die gerade vorbeiläuft, uns nicht hört. »Sex haben?«
Meine Gedanken sind sofort wieder bei dem Mann von dem Treffen. Jude. Er hat einen Eindruck hinterlassen, und ich habe feststellen müssen, dass er diese Woche in mehr als einer meiner Fantasien die Hauptrolle gespielt hat. Ich hatte vorgehabt, ihn mir aus dem System zu massieren.
»Woah!« Amie packt den Griff des Einkaufswagens, als würde sie eine Notbremse bedienen. »Was war das denn?«
Ich blicke mich um, schaue überallhin, um nur ja nicht sie ansehen zu müssen. Tiefkühlpizza war noch nie so fesselnd. »Nichts.«
»Spuck’s aus! Wo hast du ihn getroffen?« Sie zwitschert förmlich vor Begeisterung.
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und drücke es Max in die Hand. Er kommt besser damit klar als ich, und so vertieft er sich sofort in ein Spiel.
»Bei meinem NA-Treffen.« Ich brauche wirklich nicht mehr dazu zu sagen.
»Und?«
»Und?«, wiederhole ich. »Haben wir uns kennengelernt? Das ist keine Option.«
»Du hast weniger Optionen als bei einem gesetzten Menü. Früher oder später wirst du dem Menü ein paar Auswahlmöglichkeiten hinzufügen müssen – oder wenigstens ein paar leckere Beilagen.«
»Vielleicht«, gebe ich widerwillig zu. »Aber nicht dieser Kerl. Er hat Tattoos und eine miese Einstellung.«
Sie stützt das Kinn in die Hand. »Erzähl mir mehr.«
»Reicht das nicht?« Ich schwöre, manchmal vergisst sie, dass ich ein Kind habe.
»Du bist eine Mutter, aber du bist nicht tot. Hör auf, dich so zu benehmen. Ich meine, du hast einen wahnsinnig tollen Babysitter an der Hand.«
»Er ist bei den NA.« Anscheinend hat sie diese Kleinigkeit verpasst.
»Das bist du auch. Sieh doch mal, das ist gut. Du lernst einen Typen auf der Straße oder in einer Bar kennen …«
Ich starre sie böse an.
»Okay, keine Bar. Die Bibliothek.«
»Weil die, die ihre Nächte nicht mit West’s Tennessee Whiskey verbringen, alle in der Bibliothek herumhängen.«
Sie ignoriert meinen Einwurf. »Du kennst diese Leute nicht. Das könnten Alkoholiker oder Drogenabhängige sein. Er ist zu einem Treffen gegangen. Du solltest ihm eine Chance geben.«
»Ich wünschte, das wäre so einfach, aber …« Als sich ihr Mund öffnet, hebe ich die Hand. »Er ist umwerfend, und das weiß er.«
»Mehr«, drängt sie. Offensichtlich hat sie nach umwerfend aufgehört zuzuhören.
»Dunkle Haare. Blaue Augen.« Tattoos, die ich gern mit meiner Zunge nachfahren würde. Das behalte ich besser für mich.
»Ich sage nur«, Amie senkt verschwörerisch die Stimme, »dass du mal flachgelegt werden musst.«
Ich öffne die Tür der Kühltruhe, sodass das Glas zwischen uns beschlägt, und schnappe mir eine Tüte Tiefkühlerbsen.
»Ich muss nicht flachgelegt werden«, grummele ich, während ich sie in den Wagen werfe und dabei Max’ Versuch, sie zu fangen, ignoriere.
»Niemand musste jemals so dringend flachgelegt werden wie du.« Ihre Stimme wird etwas lauter, was uns einen kurzen Blick von einer Frau am anderen Ende des Gangs einträgt. »Er ist der einzige Beweis, dass du jemals mit einem Mann im Bett warst.«
»Beweis genug, findest du nicht?« Ich gehe an ihr vorbei und auf die Reihe mit Frühstücksflocken zu, um die Cheerios zu holen, die ich vergessen hatte.
Amie schüttelt lachend den Kopf, während sie mir folgt. Max, der im Wagen sitzt, fragt mit seinen Händen: Was heißt f-l-a-c-h-g-e-l-e-g-t?
»Toll gemacht, Tante Amie.« Ich stöhne und werfe ihr einen bösen Blick zu.
»Er wird richtig gut im Lippenlesen.« Sie nimmt eine Packung mit dem zuckrigen Mist, den ich meinem Sohn niemals kaufe, und antwortet ihm in Zeichensprache.
Er nickt eifrig, zu leicht mit dem Versprechen von Marshmallows zum Frühstück bestochen, um sich noch an seine Frage zu erinnern.
»Mein Fehler«, flüstert sie und sieht sich die Packung genauer an.
»Keine große Sache. Ich vergesse es auch.« Das Lippenlesen ist neu, freundlicherweise von der neuen Sonderpädagogiklehrerin zur Verfügung gestellt, die dieses Jahr in der Schule angefangen hat. »Drei Monate, und sie hat bereits mehr Fortschritte gemacht als ich jemals.«
»Mit seiner Kommunikation«, fährt Amie fort. »Niemand kann dich ersetzen.«
Das sagt sie mir nicht zum ersten Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es sich zu ihrer persönlichen Aufgabe gemacht hat, mich jeden Tag zu loben.
»Danke«, sage ich leise.
»Für was?« Sie zuckt mit den Schultern, als hätte sie keine Ahnung, was ich meine.
»Dafür, dass du mir bei diesem neurotischen Single-Mom-Experiment beistehst, in dem ich seit Jahren stecke.«
»Danke, dass ich dir beistehen darf.«
Ihre Betonung fällt mir auf. »Ich kann nicht jeden hereinlassen.«
»Stimmt, und du hast bewundernswerte Arbeit geleistet, als du die faulen Eier aussortiert hast. Aber, Schätzchen, einen Schwanz zu haben bedeutet noch lange nicht automatisch, dass man sich für eine Freundschaft disqualifiziert.«
Ich starre sie an. »Ich kann es gar nicht abwarten, Max’ neues und buntes Vokabular in der Vorschule zu erklären.«
»Was? Max hat nicht geguckt.« Sie hebt ergeben die Hände.
»Ich gehe nicht mit diesem Typen aus. Ich weiß nicht mal, warum ich dir von ihm erzählt habe.« Was auch immer mich da geritten hat, als ich ihr das mitgeteilt habe, ist jetzt verschwunden.
»Du hast dich von ihm angezogen gefühlt«, erklärt sie mir, »und du hast vergessen, wie das ist, deshalb warst du natürlich verwirrt.«
»Das war es nicht.«
Aber sie hört mir nicht zu, sondern schnappt sich eine Gurke und hält sie mit gehobener Augenbraue hoch. Sie steht wieder hinter dem Einkaufswagen, sodass Max sie nicht sehen kann. »Ich könnte dir eine kurze Einführung geben.«
Als sie ihre Finger verführerisch an der Gurke hinuntergleiten lässt, muss ich lachen. »Ich glaube, ich erinnere mich an das Wesentliche.«
»Bist du sicher?« Ihre Augen weiten sich schelmisch.
»Ich bin nicht sicher, ob der Marktleiter dem Missbrauch von Gemüse positiv gegenübersteht«, unterbricht uns in diesem Moment eine heisere Stimme.
Ich fahre herum und achte dabei darauf, eine Hand am Wagen zu lassen. Sämtliche schlagfertigen Antworten oder knappen Ablehnungen, die ich mir in den fünf Jahre als Single angeeignet habe, verpuffen, als ich ihn sehe.
Er muss Aktien bei einer Fabrik für eng anliegende Hemden haben. Wo arbeitet er, dass er so leger herumlaufen kann? Vielleicht ist sein Chef auch eine Frau, der die Show gefällt?
Amie taucht an meiner Seite auf und streckt die Gurke mit einer Geste der Kapitulation von sich.
»Ich bin nicht der Marktleiter«, beschwichtigt er sie und deutet auf seinen Einkaufswagen, in dem ein paar in braunes Papier gewickelte Päckchen von der Fleischtheke liegen und ein einsamer Kopf Brokkoli. »Ich wäre allerdings für eine Vorführung zu haben.«
»Nicht vor dem Kind«, sagt Amie entschuldigend und blickt zwischen uns beiden hin und her. Ohne Zweifel erinnert sie sich an die Beschreibung, die ich ihr von meinem mysteriösen Typen geliefert habe.
»Das ist eine Schande.« Er sieht sie nicht an, während er spricht. Seine Augen mustern mich, dann sieht er Max an, der seine Cerealienpackung umklammert.
Wenigstens muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, meiner Neugier zu erliegen. Max’ Existenz hat diesen Sarg für mich zugenagelt.
»Faith, richtig?« Judes Aufmerksamkeit ist immer noch auf Max gerichtet. »Und wer ist das?«
Max sieht nicht auf, und bevor ich es Jude erklären kann, geht er auf ihn zu und beugt sich herunter, um meinem Sohn in die Augen zu sehen.
Ich möchte gern ignorieren, wie sehr diese Geste mein Herz berührt. Noch bevor ich ihm sagen kann, dass Max nicht spricht, streckt Max die Hand aus und berührt seine Lippen.
»O mein Gott, das tut mir leid!« Ich stürze zu Jude und schüttele den Kopf. »Wir berühren Fremde nicht, Baby«, sage ich zu Max.
Seine leuchtenden Augen sind auf meine Lippen gerichtet, während ich spreche, und er runzelt die Stirn, während er sie liest. Dann beginnt er zu gestikulieren.
Ich versuche, mir ein Lächeln zu verkneifen, aber es gelingt mir nicht ganz. Er hat bereits meine Attitüde.
»Ist okay«, schaltet sich Jude ein. »Er kann von den Lippen lesen?«
Ich bin dankbar, dass er nicht die offensichtliche Frage stellt. Max ist klein genug, dass Fremde manchmal einfach glauben, dass er schüchtern ist. Aber Jude, Mister Arrogant höchstpersönlich, hat die Genauigkeit bemerkt, mit der sich seine winzigen Finger bewegen. Ich muss ihm nicht sagen, dass mein Sohn taub ist, oder den Grund dafür erklären oder die etwas zu persönlichen Fragen beantworten, die sich die meisten Menschen nicht verkneifen können.
»Meistens.« Ich werfe Amie einen schiefen Blick zu. »Es scheint, er wird immer besser. Es tut mir leid, dass er …«
»Das ist wirklich kein Problem.« Jude verwuschelt Max die Haare, und statt der Panik, die eigentlich in mir aufsteigt, wenn ein Fremder meinen Sohn berührt, setzt mein Herz einen Schlag aus. Ich spüre, wie es stehen bleibt und dann seinen Rhythmus wieder aufnimmt. »Er wollte mir zeigen, dass er sie sehen muss.«
Und einfach so hat er es geschafft, dass ich Dankbarkeit ihm gegenüber empfinde. Jetzt stehe ich in seiner Schuld.
Ich trete einen Schritt vor und versuche beiläufig, den Wagen wegzuschieben. Jude macht einen Schritt zurück und schiebt die Hände in die Taschen. Es ist ein Zeichen der Kapitulation, aber mir entgeht nicht die Vene, die sich an seinem Hals anspannt.
Nicht so beiläufig, wie ich gehofft hatte.
»Ähm, darf ich dir meine Mitbewohnerin vorstellen?« Und Amateursexualkundelehrerin, füge ich im Geiste hinzu. Ich deute zu meiner Freundin, die angelegentlich ihren Zopf mustert. »Amie, das hier ist …«
Ich halte absichtlich inne. Er braucht nicht zu wissen, dass ich gerade über ihn gesprochen habe. Er braucht wirklich nicht die Genugtuung, dass sein Name und sein Gesicht und sein Körper in mein Gehirn eingebrannt sind.
»Jude Mercer«, sagt er.
Jude Mercer. Ich hasse mich dafür, dass ich seinen vollen Namen zur Kenntnis nehme.
Amie stürzt mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. »Es ist entzückend, Sie kennenzulernen.«
Wir werden an ihrem Enthusiasmus arbeiten müssen. Vermutlich denkt er jetzt, dass ich seit Tagen über ihn rede, so wie Amie uns beide beäugt. Ich notiere mir im Geiste, niemals wieder einen anderen Mann ihr gegenüber zu erwähnen.
»Sie besuchen unsere kleine Touristenfalle von Stadt?«, fährt sie fort.
O mein Gott. Natürlich fängt sie ein Gespräch mit ihm an. Jude schüttelt den Kopf, seine Aufmerksamkeit ist jedoch von dem Display gefesselt, das Max ihm zeigt.
»Ich mag das Spiel auch. Vielleicht können wir mal gemeinsam spielen.« Er spricht deutlich, formt die Worte sorgfältig mit den Lippen. Aber er spricht nicht lauter oder langsamer. Jude behandelt ihn nicht herablassend, so wie die meisten Menschen. Nichts davon gleicht das leere Versprechen aus, das er Max gerade gegeben hat, der vor Begeisterung über die Aufmerksamkeit strahlt.
»Werden Sie die Stadt bald verlassen?« Ich formuliere meine Frage nicht freundlich, so wie Amie, oder versuche, die Kälte zu verstecken, die meine Worte durchdringt.
»Nein.« Er richtet sich auf, als würde er meine Herausforderung spüren, und grinst süffisant. »Ich habe ein kleines Haus nah am Wasser gekauft.«
Ich kann nur ein einziges Wort denken: Fuck.
»Dann sind wir Nachbarn.« Amie nimmt die Anspannung gar nicht wahr. Sie legt einen Arm um meine Schulter. »Faith und ich betreiben ein kleines Bistro am Hafen. Das World’s End. Sie sollten mal vorbeikommen. Ich mache Ihnen ein Spezial aufs Haus.«
»Vielleicht mache ich das.« Seine Antwort kribbelt auf meiner Haut. Er redet mit ihr, lässt mich dabei aber nicht aus den Augen.
»Dann sehen wir uns wohl«, sagte Jude vielsagend. Er klatscht Max ab und verschwindet. Amie schwärmt neben mir los, aber ich höre nichts davon.
Ein vertrautes Ziehen macht sich an dem Knoten in meinem Bauch zu schaffen: der Wunsch wegzulaufen. Ich war noch nie jemand, der geblieben ist, um zu kämpfen. Mein Überlebensinstinkt zwingt mich immer dazu wegzulaufen, aber diesmal kann ich das nicht. Die letzten vier Jahre habe ich damit verbracht, Hürden zu errichten, damit ich nicht mehr wegrennen kann. Mit dem Meer im Rücken hatte ich geglaubt, dass ich eine Gefahr kommen sehen würde, bevor meine Barrikaden gestürmt werden könnten.
Jude habe ich nicht kommen sehen.
3
Vorher
Nana war um acht ins Bett gegangen. Als die Mädchen nach dem Unfall zuerst zu ihr gekommen waren, hatte keine von ihnen das infrage gestellt. Wenn sie verkündete, dass es Zeit zum Schlafen war, obwohl sie noch nicht müde waren, hatten sie Taschenlampen genommen, um im Dunkeln mit Puppen zu spielen oder zu lesen. Bis zu ihrem dreizehnten Geburtstag hatte sich Faith bis zu den Romanzen vorgearbeitet, während Grace gelernt hatte, aus dem Fenster zu steigen. Zuerst lag Faith wach und stellte sich vor, was passieren würde, wenn ihre Schwester nicht vor Tagesanbruch wiederkäme, aber dazu kam es nie. Es dauerte ein Jahr, bis sie den Mut aufbrachte und fragte, wohin sie ging, und ein weiteres Jahr, bis sie sich überlegt hatte, ob sie sich mit ihr hinausschleichen wollte. Mittlerweile sahen sie fast gleich aus, dunkelblondes Haar, das ihnen in Wellen über die Schultern fiel, die Nasenspitzen, die leicht nach oben zeigten. Grace’ Augen waren mehr grün als haselnussbraun, obwohl Faith wusste, dass sie die Eifersüchtige war.
»Auf keinen Fall.« Grace dachte nicht einmal darüber nach, bevor sie Nein sagte. »Bleib zu Hause und lies deine Bücher.«
»Ich will mitkommen«, jammerte Faith und hob eines von Grace’ achtlos fallen gelassenen Shirts auf, das sie sich vor den Körper hielt. Sie musterte sich im Spiegel und fragte sich, wie es wäre, es anzuziehen. Es war freizügig. Wenn Nana wüsste, das Grace solche Tops besaß … aber Nana wusste es nicht.
Grace sagte nichts, während sie eine weitere Schicht Mascara auftrug. Sie klimperte ein paar Mal mit den Wimpern, dann drehte sie sich zu ihrer Schwester um. »Sieh mal, das wird nicht deine Art Party sein. Wir flechten uns keine französischen Zöpfe oder spielen Flaschendrehen.«
»Ich weiß.« Faith hatte sich entschieden. Sie würde ihr zeigen, dass sie genau wusste, um was es hier ging. Sie riss sich ihr Tank Top über den Kopf und zog Grace’ Shirt an. Es war so dünn, dass sie wohl besser einen BH anziehen sollte.
»Ich kann deine Nippel sehen«, sagte Grace auch schon.
»Und?« Faith zuckte mit den Schultern und hoffte, dass sie nicht rot wurde.
Ihre Schwester seufzte und warf ihr einen Push-up-BH zu. »Hier. Muss ja nicht jeder Kerl auf dem Pioneer Square gleich versuchen wollen, mal anzufassen.«
»Pioneer Square?« Faith’ Mut sickerte langsam aus ihr heraus. Pioneer Square war bei Tag nicht unbedingt das netteste Viertel von Seattle. Vor ein paar Monaten hatte Faith einen Drogendeal an einer Straßenecke in der Nähe der Stadtbahn beobachtet.
»Hast du damit ein Problem?«
Sie wollte sie bloßstellen. Faith schüttelte den Kopf.
»Okay. Sieh nach, ob sie schon schläft.«
Sie bemühte sich, leise zu sein, während sie den Flur hinunterschlich, um einen Blick in Nanas Zimmer zu werfen. Sie würde auf eine Party gehen. So nah am Pioneer Square hieß, dass es keine mal eben zusammengewürfelte wilde Bierparty war, weil die Eltern von irgendwem verreist waren. Das hier war echt. Als sie jetzt am Zimmer ihrer Großmutter ankam, dachte sie über das nach, was sie trug. Falls sie nicht schon schlief, würde es schwer werden, ihr zu erklären, warum sie wie eine Stripperin gekleidet war. Wenn auch wie eine Stripperin mit Stil.
Nana schnarchte.
O mein Gott, das passierte jetzt wirklich. Faith’ Magen schlingerte, sie fasste sich an den Bauch. Sie schloss die Augen und erinnerte sich daran, dass sie mit Grace dort sein würde. Ihre Schwester mochte wild sein, aber sie würde nicht ihr Leben aufs Spiel setzen. Zumindest hoffte sie das.
Sie fuhr mit den Fingern an der Wand entlang, während sie langsam zurück zu ihrem Schlafzimmer ging, wobei sie sorgfältig darauf achtete, keine knarzenden Dielenbretter zu erwischen. Es war dumm, gleichzeitig so voller Vorfreude und nervös zu sein. Es würde getrunken werden, Jungs würden da sein. Auf jeden Fall Jungs. Würde sie einer anfassen? Sie wünschte es sich, auch wenn sie das nicht zugeben würde, nicht einmal Grace gegenüber. Heute Nacht würde sie vielleicht erleben, wie es wirklich war, statt nur im Bett zu liegen und sich vorzustellen, wie ein Junge seine Finger zwischen ihre Beine schob, auf den hartnäckig schmerzenden Punkt, den sie selbst oft in der Dunkelheit berührte.
Sie würde keine Angst bekommen, nicht heute Nacht.
»Alles okay?«, fragte Grace, als sie wieder auftauchte.
Faith schluckte und nickte dann. Grace hielt sich nicht damit auf nachzufragen, sondern schob das Schlafzimmerfenster nach oben. Das war das Schöne an den winzigen alten Bungalows, aus denen der Großteil ihres Viertels bestand: Sie waren eingeschossig. Mühelos konnte sie auf das Fensterbrett steigen und ihren Körper nach unten fallen lassen. Fast fehlte ein bisschen die Aufregung, die sie erwartet hatte. Es war beinahe zu einfach, sich hinauszuschleichen.
»Du musst es ungefähr so weit schließen«, wies Grace sie an und ließ das Fenster einen Spalt offen. »Etwas höher, und es bleibt nicht offen. Etwas niedriger, und die Farbe auf dem Sims klebt es zu. Vertrau mir, du möchtest das nicht um vier Uhr morgens aufstemmen müssen.«
»Ich erinnere mich daran, wie du das gelernt hast«, sagte Faith trocken. Sie war diejenige gewesen, die einen alten Schraubenzieher suchen und das Fenster mit Gewalt hatte öffnen müssen, als Grace kleinlaut am Fenster geklopft hatte.
»Schadet nicht, sich daran zu erinnern.« Grace grinste und schlang sich den Riemen ihrer kleinen Tasche um die Schulter. Sah sie so aus, wenn sie lächelte? Katzenhaft und neckisch? Grace lächelte, als hätte sie Geheimnisse, und Faith hasste das. Sie selbst war so durchsichtig wie ein Einmachglas. An ihr war nichts interessant oder pikant. Ihre Eltern waren gestorben. Sie lebte bei ihrer Großmutter. Sie bekam Einsen in der Schule. Da gab es absolut nichts Skandalöses.
Die kleine Party war in ein heruntergekommenes Haus am Rande des Pioneer Squares gequetscht, aber etwas weiter Downtown, als Faith sich das vorgestellt hatte. Ein paar Mädchen in ihrem Alter musterten sie neugierig, während sie hineinging und sich nah bei Grace hielt. Es dauerte ein paar Minuten, bis sie bemerkte, dass die Leute sie anstarrten, dass sie sie beide anstarrten. Sie sollte an diese Aufmerksamkeit gewöhnt sein. Als eineiige Zwillinge aufzuwachsen, hieß, dass einen jeder darauf ansprach. Das hier war allerdings anders. Die Blicke hatten etwas Berechnendes. Jahre später würde sie begreifen, dass sie auf den Reiz des Neuen reagiert hatten. Der Reiz des Neuen war in diesen Kreisen immer eine wertvolle Ware. Er öffnete Türen und Brieftaschen und Flaschen. Doch in diesem Moment behagte er ihr nicht.
Grace stolzierte zu der Couch und stemmte die Hände in die Hüften. Unter einem zerknitterten Poster von Kurt Cobain saß ein Kerl mit einem ungepflegten Ziegenbärtchen und Ohrringen. »Wo sind die guten Drinks?«
Ein süffisantes Lächeln schlich sich auf sein Gesicht. Als er Faith erblickte, wurde es zu einem breiten Grinsen. »Du hast deine Schwester mitgebracht«, bemerkte er und stand auf.
»Nur anschauen!«, warnte Grace ihn.
Er antwortete nicht, sondern deutete den Flur hinunter. Er zog einen Schlüssel aus der Tasche, schloss ein Zimmer auf und schaltete ein Schwarzlicht an. Faith folgte ihrer Schwester hinein. Merkwürdige Farbflecke glühten an den Wänden. Eine Matratze in der Ecke diente gleichzeitig als ungemachtes Bett. Das ganze Zimmer schien in eines dieser Videos zu gehören, die man zeigte, um die Kids im Gesundheitsunterricht zu erschrecken. Faith hatte diese Videos gesehen, und jetzt war sie hier.
Bevor sie sich noch entscheiden konnte, ob sie gehen wollte – ob diese Matratze ihr Angst machte oder sie anturnte –, drückte Grace ihr schon eine Flasche Wodka in die Hand. Es sah aus wie Wasser, aber als sie sie an die Lippen führte, stach ihr der Geruch in der Nase. Sie beobachteten sie, warteten ab, was sie tun würde. Sie drückte den Flaschenhals an ihren Mund und legte den Kopf in den Nacken. Sie musste sich zwingen, nicht zu würgen. Das Brennen in ihrem Hals und das Feuer in ihrem Bauch hatten etwas Befriedigendes an sich. Nach ein paar weiteren Shots fühlte sie sich selbstsicher – furchtlos. So musste sich Grace die ganze Zeit über fühlen, stellte sie sich vor. Die schüchterne Faith war weg. Das brave Mädchen Faith war weg. Wenigstens für ein paar Stunden. Es war befreiend.
Drink für Drink befreite sie sich, während sie ihr Gefängnis um sich herum errichtete.
4
Anne geht es nicht gut. Es sollte mich nicht überraschen, nachdem ich die kleine Unterhaltung mit Jude beobachtet hatte. Und trotzdem bin ich es. Vielleicht, weil ich immer dachte, dass sie ihren Scheiß im Griff hat. Erfolgreiche Karriere. Gut gekleidet. Ich habe sie im Restaurant gesehen, zusammen mit ihrem genauso tollen Ehemann und ihren beiden statistisch optimalen zweieinhalb Kindern. Von außen betrachtet lebte sie den amerikanischen Traum, aber nach den Augenringen zu urteilen und den Knitterfalten in ihrem Kostüm, die sie nicht weggebügelt hat, lebt sie jetzt wieder den amerikanischen Albtraum, gemeinsam mit dem Rest von uns.
Nicht das Fixerleben. Das fürchten wir alle nicht so sehr. Nein, wir haben Angst vor uns selbst. Wir haben Angst, dass wir nichts taugen, dass unsere Schwächen tödliche Fehler sind und dass uns unsere Sucht zurücklockt mit Versprechungen von Vergessen oder uns erlaubt, uns in unserem Selbsthass zu wälzen, wie wir es uns so sehr wünschen. Weil das ein Geheimnis ist. Die Drogen und der Alkohol bewirken nicht, dass wir uns besser fühlen. Wenn du high bist, dann hasst du dich selbst ungehindert, und das ist in Ordnung, weil du in dem Moment nicht dafür verantwortlich bist. Es steht dir frei, dein schlimmster Feind zu sein – es steht dir frei, die Person zu sein, die sich tief in dir drin versteckt. Die Person, die weniger als ist. Weniger, als du zu sein vorhattest. Weniger, als du sein könntest. Ich glaube, jeder empfindet das, selbst die Menschen, die nicht abhängig sind. Wenigstens nicht abhängig nach der Definition einer Selbsthilfegruppe. Sport. Kaffee. Netflix. Menschen. Jeder ist süchtig. Wir alle haben unsere Droge. Es ist nur so, dass manche unserer Gifte kostspieliger sind als andere.
Anne schlägt die Beine übereinander, stellt sie wieder nebeneinander. Sie schüttelt den Kopf, als Stephanie sie bittet, sich mitzuteilen. Sie macht dicht, und keiner von uns kann das kleinste bisschen dagegen tun. Wenigstens ist sie hier. Nicht so wie andere Leute. Wie Jude. Er ist nicht da, und das beweist, dass ich recht hatte.
Nur Schwierigkeiten.
Nach unserem zufälligen Treffen im Laden hat mich Amie die letzten Tage über angebettelt, Jude wenigstens eine Chance zu geben. Ich weiß nicht, was sie damit gemeint hat. Er hat mir nicht die Tür eingerannt, um mich zu fragen, ob ich mich mit ihm treffen will, und er hat auch nicht angerufen. Ich bezweifle sehr, dass unser Aufeinandertreffen bei den Kühltruhen auf Hochzeitsglocken in der Zukunft schließen lässt. Amie sieht das anders. Laut. Vor dem Servicepersonal. Vor der Kundschaft. Per Text. Auf meinem AB. Bald wird sie wohl eine Plakatwand mieten.
Wie aufs Stichwort kommt er herein, als hätten meine Gedanken ihn auf die Bühne gerufen. Er sieht heute anders aus. Kein T-Shirt. Stattdessen trägt er ein Hemd, das gebügelt wurde. Die Ärmel sind bis zu den Ellbogen aufgerollt, als wisse er nicht, was er mit dem Businessaufzug anfangen soll. Und doch kann ich ihn darin erkennen. Wie er mit Anzug und Krawatte ins Büro geht, um … Um was? Was macht dieser Mann, der sich in unserer verschlafenen kleinen Stadt niedergelassen hat? Er hat Amie erzählt, dass er hierhergezogen ist, aber ich habe ihn noch nicht in der Innenstadt gesehen. Da arbeiten die meisten von uns. Am Rand der Stadt gibt es nicht viel. Vielleicht hat er eines dieser Büros über einem Laden oder einem Restaurant gemietet, die immer angeboten werden. Ein Anwalt? Wirtschaftsprüfer? Nichts davon passt zu ihm. Ich bin so abgelenkt von diesem verdammten Jude Mercer, dass ich nicht mitbekomme, dass Stephanie beschließt, sich auf mich zu stürzen.
»Faith.« Stephanie bricht in meine Gedanken ein.
Aller Augen sind auf mich gerichtet, aber ich spüre, wie sein Blick durch meine Haut dringt. »Oh, tut mir leid. Hm, was?«
»Möchtest du etwas sagen?«, fordert sie mich auf. Diesmal bin ich diejenige, die frustriert ist.
»Nein«, schnappe ich. »Ich lass dich schon wissen, wann und ob ich etwas sagen will, Stephanie.«
Schweigen breitet sich aus. Niemand atmet oder bewegt sich. Und da räuspert er sich.
»Ich möchte.« Jude rettet mich. Verdammter Jude.
Ich möchte ihm sagen, dass er sich seine geduldige Ritter- auf-weißem-Ross-Nummer in den Hintern schieben kann. Das beeindruckt mich nicht. Es bringt mich nur dazu, dass ich losschreien möchte, weil perfekte Kerle nicht in einer Selbsthilfegruppe sitzen. Ich halte den Mund und verschränke die Arme vor der Brust, als könnte ich so meine Worte tief in mir begraben. Zuhören ist eine Fähigkeit, die ich in der Gruppe gelernt habe, und gerade jetzt sollte ich sie anwenden.
»Nur zu.« Stephanies Miene ist hochmütig, obwohl sie mich nicht ansieht. Sie wertet seine Bereitschaft als Zeichen, dass sie etwas richtig macht. Ich sehe sie als das, was sie ist. Er hat mir den Arsch gerettet, bevor ich mich in Verlegenheit bringen konnte.
Jude mustert den Zementboden, und ich stelle fest, dass ich das Gleiche tue. In der polierten Oberfläche kann ich den Umriss meines Kopfs erkennen, aber sonst nichts. Keine Einzelheiten. Keine Miene. Nur die Andeutung eines Menschen, der dort reflektiert wird.
»Ich habe über die Menschen nachgedacht, die ich zurückgelassen habe«, gibt er leise zu. Alle sind ruhig, sein Tonfall zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich.
»Die Menschen, die du verlassen hast, oder …« Stephanies nutzlose Aufforderung verliert sich.
»Zurückgelassen. Eine im Besonderen. Was passiert, wenn dich jemand aufgibt?«, fragt er.
Niemand antwortet. Nicht einmal Stephanie. Wir warten einfach darauf, dass er fortfährt.
»Ich habe sie aufgegeben, um mich selbst zu retten, und ich denke immer, dass ich irgendwann Frieden finde mit meiner Entscheidung.« Er fährt sich mit der Hand über das stopplige Kinn und hält inne. »Aber ich tue es nicht. Ich komme immer wieder und warte darauf, dass jemand einen magischen, alles verändernden Gedanken ausspricht.«
»Es gibt keine Formel«, unterbreche ich ihn, ohne nachzudenken. »Wenn du nach einer Antwort suchst, mit der du alles heilen, alles in Ordnung bringen kannst – so was gibt es nicht.«
»Warum kommst du dann wieder?«
Wir sind jetzt die einzigen beiden Menschen in diesem Raum. Jude und ich, die wir uns gegenseitig anstarren.
»Gewohnheit. Darin sind wir gut, oder nicht?«
Er nickt knapp, aber er findet nicht, dass ich schlau bin. Seine blauen Augen spiegeln nur eine tiefe Traurigkeit, als sie in meine blicken. Eine Ewigkeit vergeht, und keiner von uns spricht, während die Luft um uns herum immer dicker wird. Schließlich wirft Stephanie ein Mantra in die Runde, aber ich höre nicht zu. Sie hat es nicht verstanden. Menschen wie ich und Jude haben es nicht. Wir wissen, dass wir nach etwas suchen, das nicht existiert, aber wir wissen auch, dass wir auf hoher See verloren sind.