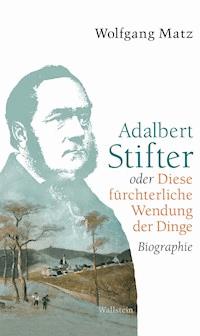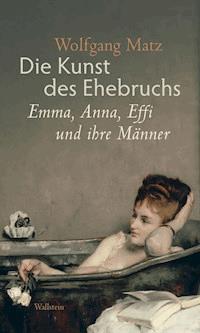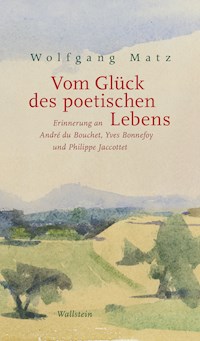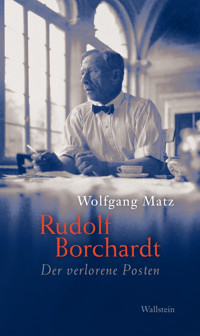
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Matz entwirft ein neues Bild des widersprüchlichen Literaten Borchardt im Zeitalter der Extreme. Rudolf Borchardt ist einer der großen Dichter deutscher Sprache, Meister des Essays und des zeitkritischen Romans, eigensinniger Historiker und Übersetzer. Doch wurde sein Schaffen auch begleitet von Legenden und Skandalen, von erotischer Hochstapelei, autobiografischer Fiktion, politischem Radikalismus zwischen den Weltkriegen. Borchardt war voller Widersprüche: ein junger Mann mit höchstem Anspruch, der kaum veröffentlichte, ein Polemiker der Weimarer Republik, der sein Leben in Italien verbrachte, ein deutscher Nationalist, den die Nürnberger Gesetze zum Juden machten, ein freiwilliger Exilant, der ab 1933 im Zwangsexil lebte. War Borchardt tatsächlich der Exzentriker, den die deutsche Nachwelt aus ihm macht? Wolfgang Matz wagt nach langer Auseinandersetzung mit dem Streitbaren eine konzentrierte Darstellung von Leben und Werk. Er liest ihn als Zeitgenossen von Hofmannsthal, George, Benjamin und Brecht, als Extremisten im Zeitalter der Extreme, als Neuerer, der die europäische Tradition wiedererweckt für die Poesie der eigenen Zeit. So tritt Borchardt als leidenschaftlicher Gegner der neusachlichen Kälte, radikaler Antimodernist und deshalb ganz in der Tradition der modernen Literatur hervor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Matz
Rudolf Borchardt
Der verlorene Posten
Der dichter ist wie jener fürst der wolke •
Er haust im sturm • er lacht dem bogenstrang.
Doch hindern drunten zwischen frechem volke
Die riesenhaften flügel ihn am gang.
Charles Baudelaire
Inhalt
»Ich habe nichts als Rauschen«Prolog
ERSTER TEIL»Wir sind nicht, was wir sind«1877 – 1906
ERSTES KAPITEL»Das Jahrzehnt der Väter«Jugend
ZWEITES KAPITEL»Distanz ertragen«Revolte
DRITTES KAPITEL»Dein Bett ist kalt«Vivian
VIERTES KAPITEL»Der Graf und der Bettler«Wien
FÜNFTES KAPITEL»Es ist so elend, flüchten«Wanderjahre
ZWEITER TEIL»Das Land hat keine Kinder und kein Licht«1906 – 1914
ERSTES KAPITEL»Tausend abgerissene Fäden«Im alten Italien
ZWEITES KAPITEL»Weltfragen«Geschichte und Politik
DRITTES KAPITEL»Auf Machtdurchsetzung gerichtete Absichten«Borchardt, Schröder, Hofmannsthal
VIERTES KAPITEL»Würfler deines eignen Spiels«Selbstbefragung und Bekenntnis
FÜNFTES KAPITEL»Es kehrt von Anfang«Italien in der Krise
DRITTER TEIL»Ganz klein der Trost der neuen Welt«1914 – 1921
ERSTES KAPITEL»Letzter Held«Weltkrieg
ZWEITES KAPITEL»In Schildes Amt«Borchardt, der Redner
DRITTES KAPITEL»Ich kann nicht mehr«Hälfte des Lebens
VIERTES KAPITEL»Was man will, kann man nicht geben«Marie Luise
FÜNFTES KAPITEL»An Monsagrati denken«Kein Friede und kein Krieg
VIERTER TEIL»Schöpferische Restauration«1921 – 1933
ERSTES KAPITEL»Mit rücksichtsloser Gewalt«Die Extremisten
ZWEITES KAPITEL»Dieses Volk selber sein«Tradition gegen Gegenwart
DRITTES KAPITEL»Nicht ohne Leiden vergänglich«Hofmannsthal
VIERTES KAPITEL»Die Edelkastanien am Heidelberger Schlossberg«Judentum
FÜNFTES KAPITEL»Notre vieux monde persévère«Vor dem Untergang
FÜNFTER TEIL»Deutschland ist Kain«1933 – 1945
ERSTES KAPITEL»Es ist das Ende«Nationalsozialismus
ZWEITES KAPITEL»Die Entdeckung Amerikas«Edna St. Vincent Millay, Stefan George
DRITTES KAPITEL»Verzweiflung und Trotz und unsinnige Zeit«Romane
VIERTES KAPITEL»Entschlossen, zu überdauern«Causae victae
FÜNFTES KAPITEL»Das brechende Herz des besseren Mannes«Auf den Brenner
»Zeit ist Meer«Epilog
ANHANG
Nachwort
Bibliographie
Nachweise
Register
»Ich habe nichts als Rauschen«
Prolog
1.
Der kürzeste Tag des Jahres ist der 21. Dezember. Unter dem Sonett aus den Jugendgedichten steht als Entstehungsdatum »1901«. Am 21. Dezember 1901 ist Rudolf Borchardt vierundzwanzig.
Kürzester Tag
In eine Winterfrühe hebst du dich,
So hingegeben in den Stundenschlag
Wie einer Jugendliedern lauschen mag,
Und lauschend nicht mehr hört, und tief in sich
Die alten Augen wendet bitterlich:
Nun ist doch Morgen, und das Licht wie zag!
Am Himmel steht der hoffnungslose Tag
Im Unsichtbaren unerschütterlich.
Es ist nicht schwer, von Tischen aufzustehen,
Wo alle Becher umgeworfen sind
Und wüste Decken in die Nachtluft wehen –
Es ist beinahe leicht, durch diesen Wind
Und nun durch diesen ersten Schnee zu gehen!
Du fühlst dein Herz nicht mehr und bist wie blind.
In diesem Sonett ist nur noch Leere. Der hier im Morgengrau erwacht, findet in sich nichts, was er der lichtlosen Kälte entgegensetzen kann, dem »hoffnungslosen Tag«. Der hier »tief in sich / Die alten Augen wendet« und »Jugendliedern« zu lauschen glaubt, ist dennoch ein junger Mann. Viel später nennt er diese frühe Epoche seines Lebens die »meiner merkwürdigsten Thoren-Zeit«, doch es war viel schlimmer, als es klingt in dem angestrengten Spott über den »gutmeinenden aber ganz verkehrten jungen Menschen«, der er gewesen ist. Am Ende des Jahres 1901 ist der Student zurück in seiner Heimatstadt Berlin, wohnt, mit der Stellung eines »outlaws innerhalb der Familie«, wieder im Haus des Vaters, mit dem er tief zerstritten ist; hinter ihm liegt sein mehr oder weniger entgleistes Studium, liegen erotische Wirren, ein Duell, der Zusammenbruch im Frühjahr, ein halbjähriger Kuraufenthalt in Bad Nassau, dort eine mit größtem Pathos durchlebte, doch vollkommen einseitige, hoffnungslose Liebe, inzwischen ganz im Schweigen erstickt. Borchardt ist am Ende, auch wenn er »diesen Zustand als ein dunkles Zwischenspiel« betrachten will: »Ich rede nach innen und kehre die Augen nach innen, bis es vorüber ist.« Doch das Zwischenspiel dauert: Im Januar 1902 verlässt er nach einem weiteren Streit das Elternhaus endgültig, verbringt in Wien ein paar geisterhafte Monate im Kreis des verehrten Hugo von Hofmannsthal, dann verschwindet er grußlos, und einige Briefe lassen erahnen, dass er die Kontrolle über sein Leben verliert, nicht mehr wirklich unterscheiden kann zwischen sich und dem, der er sein will. Erst jetzt, an der erneuten Jahreswende, nach hektischen Reisen und der abgebrochenen Dissertation, entschließt er sich zum Aufbruch, endlich, zu einem zweieinhalbjährigen, wohnungslosen Wanderleben in jenem Italien, das er bald zu seiner erwählten Heimat macht.
Doch gerade diese verzweifelte Periode wird zu einer lyrisch ungeheuer produktiven Zeit. Borchardt, einer der ganz großen Dichter deutscher Sprache, verweigert lange und konsequent fast jede Publikation, und so erscheinen die Werke jener frühen Wirren erst 1913, in seinem ersten Gedichtband, gedruckt mit dem bescheiden-stolzen Titel »Jugendgedichte« und in stolz-bescheidenen hundert unverkäuflichen Exemplaren. Doch wäre es überhaupt denkbar, dass einer ein so intimes Bekenntnis sofort der Öffentlichkeit überlässt? In »Kürzester Tag« ist beides enggeführt: der Nullpunkt des Jahres und der Nullpunkt des Lebens. Der Blick »tief in sich« ist keine Reflexion, keine Meditation, ist der fast unbewusste Ausdruck einer vollständigen Einsamkeit und Isolation gegenüber der gesamten Welt. So groß ist diese Isolation, dass es ihm »nicht schwer« wird, ja »beinahe leicht«, nun die allerletzte Brücke abzubrechen und endlich fortzugehen, sei’s auch hinaus in Wind und ersten Schnee. Die umgeworfenen Becher und das verrutschte Tischtuch eines eben zu Ende gegangenen Gastmahls verweisen mit Platons Dialog noch einmal auf die verlorene hoffnungslose Liebe, doch auch von ihr ist nichts geblieben, nicht einmal das gerade eben noch so starke Gefühl im Herzen.
Kann man eine Lebenskatastrophe aufrechnen gegen den lyrischen Ertrag? Bei Borchardt muss man es, denn genau hier findet er das poetische Prinzip seiner frühen Dichtung. Dieser Ertrag ist das extrem gesteigerte Formbewusstsein. Der Dichter, schreibt Borchardt zur gleichen Zeit, »bezwingt eine Empfindung von furchtbarer Maßlosigkeit, indem er sich den Reimkäfig vorsetzt, in den er sie sperren wird«. Sein Sonett scheint fast zu zerspringen durch den Innendruck der Sätze, doch es bleibt nicht beim Eingesperrtsein. Fast parallel der Auftakt der beiden Terzette, doch wie verwandelt ist der Gesang! Aus dem dumpfen Staccato: »Es ist nicht schwer, von Tischen aufzustehen«, löst sich ein schwebendes: »Es ist beinahe leicht, durch diesen Wind / Und nun durch diesen ersten Schnee zu gehen« … Der Klangwechsel in dem betonten »leicht«, dem nur hingehauchten »Wind« macht den eisernen Käfig zum durchsichtigsten Gewand, und das, obwohl die strenge Gestalt gewahrt bleibt wie in jedem Vers zuvor: die wundervolle Verkörperung von Borchardts Überzeugung, dass die Form der vollkommenste Ausdruck ist für ihr Gegenteil, die gestaltlose Leidenschaft.
Das Gedicht endet auf den Ton der tiefen Hoffnungslosigkeit: »Du fühlst dein Herz nicht mehr und bist wie blind.« Und dennoch, allein der Titel des Gedichts gibt für einen Dichter, der auf das Echo jedes einzelnen Wortes lauscht, eine winzige, fast unhörbare Andeutung: Der kürzeste Tag ist und bleibt der kürzeste, der Endpunkt eines Jahreskreises ist schon der Anfang des neuen. Auch wenn man es noch nicht spürt, von jetzt an nimmt das Tageslicht wieder zu.
2.
Die südlichen Sommernächte sind kurz und hell. Wie viel Zeit ist nicht vergangen, und wie schnell! Tage, Tage, Jahre. Wohin? Wozu? Borchardt ist schon lange kein Jüngling mehr, die leeren Stunden sind längst verweht; jetzt, nach »ganz vernichteter Jugend«, im Juni 1931, ist er der Mann von fünfzig Jahren, und er hat sehr viel von dem bekommen, wonach es jenen »gutmeinenden aber ganz verkehrten jungen Menschen« damals mit aller Leidenschaft verlangte. Er ist Dichter, er ist verheiratet mit der lang umworbenen Frau, Vater einer Tochter und dreier Söhne, er lebt beinahe arm, gleichwohl in der einzig angemessenen toskanischen Villa, zwar nur gemietet und nicht gekauft, aber dennoch weitab von Deutschland, von der Großstadt, vom verachteten Betrieb. Er hat sich sein Leben geschaffen, so vollkommen anders als das der Zeitgenossen, das hier ist eine eigene, alte Welt, fast schon der andere Planet. Vor Jahren hat er an die Mächte seines Schicksals appelliert: »Gebt mir zu schaffen!« Sie haben ihn erhört. Borchardts Tage sind angefüllt, mit Denken, Schreiben, Übersetzen, mit bohrenden Gedanken an die nahende Katastrophe im fernen Deutschland, mit der Familie, mit Arbeit im Garten. Und die Nacht? Er ist erwacht, vermag nicht mehr einzuschlafen, tritt hinaus auf die mondbeschienene Terrasse über dem Park, wo der Brunnen noch immer rauscht wie schon bei Eichendorff. Die Zeit steht still. Doch die märchenhafte Nacht ist Wirklichkeit, rätselhafte, absolute Gegenwart. Jetzt!
Tiefe Nacht
Still, auf Zehn ans Fenster, – still,
Daß mirs diesmal nicht entglitte!
Denn die Nacht weiß was sie will,
Denn das Plätschern klang wie Schritte.
Nichts. Die Brunnen traufen,
Nichts. Die Becken laufen.
Immer nichts: Ohne Zeit,
Wiesen, Wege, mondverschneit.
Weit und breit immer nichts. –
Oder lachts da? oder sprichts?
Ja es sprach, es lacht’ es weinte, –
Ja, ich fühlte, wen es meinte, –
Jetzt!
Mein Aug’ ward naß, mein Puls hat ausgesetzt.
Nichts. – Die Wasser, drauf es schattet
Aus den Kronen, unersattet
Ihres Silbers, ihres Sprudelns
In der Schwärze, –
Schluchzens, schüttens nieder, strudelns
In den Mond auf, flüssige Kerze. –
Komm zurück. – Laß die Thür
Fallen zu; das Für und Für
Dieser Rede will sich stillen.
Laß der tiefen Nacht den Willen.
Oder wenn michs wollte?
Ich was müßte? Ich was sollte?
Ich weiß, ich habe nicht geträumt.
Wenns draußen wartete,
Weil mir erhartete
Das Herz, als hätt es nichts versäumt?
Denn es gibt sich nicht zur Ruh. –
Auf vom Kissen; in die Schuh;
Leise Tritte
In die Mitte –
Denn der Mond war wie ein Geist
Denn die Luft sagt, wie er heißt,
Denn das Waldgeräusch ist satt
Von der Botschaft die er hat,
Von der Bitte –
Denn sie flüstert jedes Blatt,
Denn das Plätschern klingt wie Schritte.
Was ist das? Ein Gedicht, eine Sprachmusik über nichts? Über alles? Das Ich, das hier spricht, ist für diesen Augenblick hinausgetreten aus aller greifbaren Alltagsrealität und steht noch einmal, steht wieder vollkommen allein. Wie seltsam der Weg, der ihn hierhergeführt hat, in diese Nacht! »Der Weg ist weiser, als der ihn geht.« Wie ewig undurchdringlich dies Dunkel des gelebten Augenblicks!
Der Lyriker Borchardt hat wie nur sehr wenige die Fähigkeit, aus Reim und Rhythmus, aus Sinn und Form ein Sprechen, ein Reden zu gestalten, das imstande ist zurückzutreten hinter die Sprache der Rationalität, imstande, diesen Augenblick der rätselhaften, absoluten Gegenwart, dieser Ewigkeit – nein, nicht zu erklären, sondern hervorzurufen in der Sprache des Gedichtes selber. »Jetzt!« Wovon spricht »Tiefe Nacht«? Ist es ein Liebesgedicht? Sinnt hier der älter gewordene und dennoch häufig verliebte Dichter auf ein nächtliches Rendezvous? Sind die Schritte, die er im Plätschern zu hören glaubt, Schritte einer erwarteten Geliebten? Schritte zu einer ersehnten Begegnung? Wahrscheinlich, vielleicht. »Immer nichts: Ohne Zeit, / Wiesen, Wege, mondverschneit. / Weit und breit immer nichts.« Gab es das Rendezvous etwa nur in seinem Traum? Klingt das Plätschern nur nach Schritten, weil er es unbedingt so will? Vielleicht, wahrscheinlich. Wenn das Gedicht tatsächlich diese Geschichte erzählen soll, dann ist das Gedicht weiser als der Autor: »Denn die Nacht weiß was sie will.« Denn die Nacht, das Gedicht, will aus einer erhofften, doch nicht stattfindenden Begegnung zu etwas ganz anderem gelangen, zu etwas Wichtigerem, Tieferem, zu der Begegnung des Dichters mit sich selbst. Plötzlich fällt alles ab von ihm, plötzlich ist er mit sich so allein, so vollkommen allein wie der junge Mann an jenem fernen Wintermorgen. Wo ist sie hin, die ganze gelebte Zeit? Ist es nicht hart geworden, das Herz, in all den Jahren? Woher dieses Gefühl, all das Erwünschte, Erreichte, sei noch immer etwas Vorläufiges? Woher dieses: Das ist es nicht! Steht ihm noch etwas bevor? Was ist es, das ihn spüren macht, immer noch ist alles offen, es gibt nichts Festes, nichts ein für allemal Gesichertes? Irgendwann, in einem kommenden Jetzt!, wird dieses ganze Leben vorübergeflogen sein wie die Jahre zwischen dem kürzesten Wintertag der Jugend und dieser Sommernacht. Doch bis dahin gilt immer neu der Appell des Lebendigseins: »Oder wenn michs wollte? / Ich was müßte? Ich was sollte? / Ich weiß, ich habe nicht geträumt.« Das Gedicht ist beides zugleich, traumwandlerische Rede in einer poetischen Sprache, die nicht argumentiert, nicht begründet, nicht folgert, die vielmehr Sinn erschafft aus der Hingabe an den eigenen Sprachklang, die eigene Musik; und Selbstbegegnung, die eine Frage stellt an das eigene Leben, Frage in der Sprache der Nacht. »Tiefe Nacht«, das sind tatsächlich freie Verse: Keine äußere, traditionelle Form zwingt das Gedicht mehr zusammen, und doch ist es in jedem Vers, in jedem Wort strukturiert. Im Fließen ist es immer in sich geschlossen; das Spiel von Klang, Reim, Rhythmus erzeugt Bild und Gedanke; im wechselnden Versmaß erschafft sich eine Form sui generis, wo selbst das einzelne Wort zum fest gefügten, reimgebundenen Vers wird: »Jetzt!«
Morgen früh wird er zurückkehren zu seinem Tagwerk, es wartet der Brief, den er gestern abgebrochen hat, es wartet die Schulaufgabe, die durchgesprochen werden muss mit dem Sohn, es warten die Blumen- und Gemüsebeete im Garten. Und bald werden die Tage wieder kürzer. Doch zuerst schreibt der Dichter sein Gedicht »Tiefe Nacht«.
3.
Schon früh, schon immer hat Borchardt gewusst, poetische Rede ist nicht Mitteilung von Inhalten in Versform, Poesie ist die andere Sprache, die nur aus sich selbst heraus redet und nur aus sich selbst heraus verstanden werden kann. Trotzdem, ist nicht gerade Borchardt derjenige, der wie nur wenig andere Dichter argumentiert, räsoniert, polemisiert, erklärt, widerlegt und noch einmal widerlegt; der in allen Formen der Prosa, von der freien Rede bis zur Wissenschaft, vom Essay bis zur politischen Kampfschrift, vom epischen Brief bis zur Erzählung und sogar zum Roman das Wort ergreift? Gewiss. Und gerade das, nur das: nur dieses Doppelgesicht, Doppelleben, führt ins Herz des Dichters und Politikers Borchardt.
Pause
Hinter den tiefsten Erinnerungen
Verwächst die Zeit;
Die alten Wege waren frei und breit,
Nun hat die Welt sie überdrungen.
»O Rauschen tief in mir,
Was aber hast du, das ich gerne hörte?
Ist denn ein Ton in dir,
Der mich nicht störte?«
»Ich habe nichts als Rauschen,
Kein Deutliches erwarte dir;
Sei dir am Schmerz genug, in dich zu lauschen.«
Hat er nicht selbst mit lustvollster Leidenschaft, mit leidenschaftlichster Härte, mit härtester Hand hineingegriffen in das Räderwerk dieser Welt? Hat er nicht selbst es so gewollt, wenn diese Welt die leisen Worte des Dichters zuweilen fast ganz »überdrungen« hat und nur noch den lauten Politiker hört? Er hat es den Zeitgenossen nicht leicht gemacht und noch weniger seiner Nachwelt, hinter dem Getöse der Zeit, hinter dem Schlachtenlärm aus Politik, Geschichte, Polemik etwas zu vernehmen von dem, was dieser Mann nur in der Sprache des Dichters zu sagen vermag. Einen Dichter Borchardt diesseits des Politikers Borchardt gibt es nicht. Doch es gibt auch keinen Politiker jenseits des Dichters. Borchardt bezieht seinen Posten zwischen dem Rauschen und dem Lärm. Doch sogar er selbst ist nicht sicher, ob dort überhaupt noch irgendetwas zu halten ist wie ein Posten.
ERSTER TEIL
»Wir sind nicht, was wir sind«
1877 – 1906
ERSTES KAPITEL
»Das Jahrzehnt der Väter«
Jugend
Wannsee, das ist ein Dorf an der Chaussee von Berlin hinaus nach Potsdam. Die Wilhelms-Brücke überquert das namengebende Gewässer; links der Kleine Wannsee, an dessen Westufer Heinrich von Kleist erst Henriette Vogel, dann sich selbst erschoss, rechts der Große Wannsee, und hier stand damals Stimmings Krug, hier verbrachten die beiden ihre letzte Nacht. Zwischen Berlin und Wannsee verstreute Siedlungen: Wilmersdorf, Schmargendorf, Zehlendorf, sonst Wiesen, Wege, Felder, Wälder. In den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts wird drei Schritt entfernt von Stimmings Krug ein großes Bauprojekt der Gründerzeit begonnen, eine Sommervillenkolonie für wohlhabende Berliner, begründet von dem Bankier Wilhelm Conrad, und nach ihm heißt auch eine der beschaulichen Straßen. Nachdem eine Bahnlinie errichtet ist, wird die Alsen-Colonie immer attraktiver; Max Liebermann sollte 1910 nahezu der letzte sein, der ein noch freies Seegrundstück erwerben kann. Trotzdem, die Bautätigkeit bleibt beschränkt, und Erinnerungen schildern ein auch gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts noch fast unberührtes märkisches Land. »Der grosse Wannsee war in meiner Kindheit ein stiller vornehmer See, vor Allem an Wochentagen; und noch gänzlich unberührt von Massenfreibädern. Der kleine Wannsee, nur auf einer Seite von Villen und Gärten begrenzt, war das Hauptziel unserer Spaziergänge an Nachmittagen, unserer Ruderfahrten an stillen, warmen Sommerabenden. Wir glitten durch die kleine Holzbrücke, die die beiden Seen verband, in unsere Märchenwelt hinein; in den Gärten schwieg es; die uns am Tage so vertrauten Wälder lagen still und geheimnisvoll.« Vera Rosenberg, geborene Borchardt, schreibt ihre Erinnerungen 1941 im Exil in Istanbul, und sie hat auch die literarische Tragödie nicht vergessen. »Dort hinten in den Wäldern lag das Grab von Heinrich von Kleist, an der Stelle, an der er sich selbst den Tod gegeben hatte. Ich glaube, es hat mich nie eine Begräbnisstätte so tief berührt, wie jener stille Stein an der weltabgeschiedenen Waldlichtung.«
Vera Borchardts Eltern haben ihre Villa in der Alsen-Colonie, Conradstraße 8, 1904 verkauft. Jahre später steht der ältere Bruder Rudolf vor dem verlorenen Haus, fremdgewordener Schauplatz auch seiner Jugend. Seine Erinnerungen sind nicht märchenhaft, nein, er scheint sich ihnen zunächst fast gewaltsam zu verweigern.
Der Wagen prallt zurück; die Pferde stehn.
Aussteigen soll ich? nach dem Hause gehn?
Dem da? wo nicht ein Stein,
Nicht eines Steines Schatten zu mir spricht?
Dies ist es nicht.
Ihr hörtet falsch, dies kann das Haus nicht sein.
Und doch, dies ist es. Im August 1911 schreibt Rudolf Borchardt »Wannsee«, seine große, 498 Verse umfassende Elegie auf Kindheit und Jugend, die verlorene und wiedergefundene Zeit, auf die Selbstkonstituierung eines Dichters in der Begegnung mit sich selbst und seiner Vergangenheit.
Antworte meinem Anhauch, tote Runde!
Begeistre dich aus dieser Geisterstunde!
Beschreibe dich, o Haus, mit jener Schrift,
Die keinem deutlich ist, als den sie trifft,
Und selber ihm bleibt sie unsäglich!
Doch gerade das nimmt sich der Dichter vor in seinem großen Gedicht: die Entzifferung der Schrift, der Vergangenheit, der Geschichte, denn wenn es ihm nicht gelänge, wird er weiter vor dem, was er geworden ist und was er bisher geschaffen hat, stehen wie vor einem verwirrten Rätsel.
Der Vorhang ist hinauf und es beginnt
Das Trauerspiel im alten Labyrinth
Der Jugend seine Masken herzugeben:
Kreis ein, Kreis aus, Kreis ein: Das Irre Leben.
Rudolf Borchardt, so viele Masken er auch trägt, ist zeit seines Lebens von zwei Dingen gebannt: Poesie und Geschichte. Beides ist für ihn unauflöslich verknüpft. Und so wie ihm Geschichte nicht nur die große Geschichte der Welt ist, ihrer Menschen und Mächte, sondern immer auch seine eigene, so versteht er sein Werk unauflöslich als Teil seines Lebens. Borchardt ist es selbstverständlich, dass alle Literatur autobiographisch ist, natürlich »in keinem brutalen Dokumentensinne«, wie es schon 1901 in einem Brief heißt, »sondern in dem der höchsten tragischen Gerechtigkeit, auch nicht mit der Tendenz auf Confessionen sondern mit dem Streben nach derjenigen ›Wahrheit‹ die nur der Dichter geben kann«. Wenn man den Dichter nicht versteht, wie verstünde man dann sein Werk? Borchardt begreift das Werk als Wechselspiel von Individualität und Geschichte, als individuelle Gestaltung geschichtlicher Vorgänge; Biographie und Autobiographie sind ihm keine müßige Privatsache, sondern ebenfalls Geschichte: Geschichte eines Individuums. Und die gilt es zu erzählen, will man immer näher heran an diese »Wahrheit«.
Borchardt hat sehr früh begonnen, sich, im Sinne Goethes, historisch zu sehen, wahrscheinlich sogar allzu früh. Immer wieder unternimmt er Anläufe zu Selberlebensbeschreibungen, zu wiederholten Spiegelungen, zu biographischen und bibliographischen Übersichten, die während der Jugendjahre sogar weiter hinaus in die Zukunft reichen als in die Vergangenheit, und jeder dieser Versuche ist für ihn ein selbsthistorisierender »Rechenschaftsbericht«. Das ist er der Welt schuldig, und vor allem sich selbst: Rechenschaft, was er geworden ist. »Wannsee« wird dazu der größte Versuch in poetischer Sprache; in den zwanziger Jahren erscheinen jene Bruchstücke, die, hätte er sie vollendet, etwas Umfassenderes wären: Rudolf Borchardts Leben von ihm selbst erzählt; noch der »Eranos-Brief« ist 1924 weniger das, was er vorgibt, nämlich Huldigung zu Hugo von Hofmannsthals fünfzigstem Geburtstag, als vielmehr ein weiteres Fragment zur Auto-Geschichtsschreibung im Namen jener poetischen Generation, in der er sich mit Hofmannsthal vereint sieht. Alles kann ihm unter der Hand zu Selbstbekenntnis und Rechenschaft werden, und als er 1919 um Marie Luise Voigt wirbt, bald seine zweite Frau, tut er das mit einem Brief von fast hundert Seiten, der seine ganze Lebensgeschichte erzählt – der sie so erzählt, wie sie dem Anlass entsprechend aussehen muss.
Wer die Gestalt Rudolf Borchardt verstehen will, also Werk, Leben, Epoche verflochten, der kann das gewiss mit der Berufung auf den Dichter selbst. Nur schwer aber auf seine eigenen autobiographischen Versuche. Borchardt hat zeit seines Lebens ein wechselndes, aber gerade deshalb problematisches Verhältnis zu dem, was man gewöhnlich Tatsachen nennt. Und wenn er sich früh historisch sieht, hat das auch eine Kehrseite: Das Bewusstsein, eines Tages Teil einer historischen Epoche zu sein, verführt Borchardt früh dazu – kein seltenes Phänomen bei Schriftstellern –, das Bild, das er in dieser Historie einnehmen wird, selbst bestimmen zu wollen. Mit anderen Worten: Nicht alles ist wahr, was man in Borchardts autobiographischen Werken liest. So mancher Beobachter bemerkte an dem Erwachsenen eine starke Kraft der Selbstdarstellung, bis hin zu dem Gefühl, hier schaffe sich einer durch strengste Selbstbeherrschung die Gesichtszüge, die er zu haben wünscht. Seine Lebensbeschreibungen gehorchen einem ähnlichen Gesetz. So stark ist sein Impuls zur geschichtlichen Synthese, zur großen geschichtlichen Einordnung der eigenen Existenz, dass die Prinzipien seines Geschichtsbildes Vorrang haben vor den Details der Realität. Stimmen die Tatsachen nicht ganz überein mit dem großen historischen Vorgang – umso schlimmer für die Tatsachen.
Rudolf Borchardt wird am 9. Juni 1877 geboren, laut Geburtsurkunde in Königsberg. Aber schon das ist nicht sicher, wie Marie Luise Borchardt später angab: »Geboren 9. Juni in Königsberg, vielmehr auf der Bahnfahrt von Moskau nach Königsberg, da die Bahn Verspätung durch Achsenbruch hatte.« Ob sie stimmt, diese Familienlegende, ist unklar, und trotzdem verstünde man es gern symbolisch, dass der große Kritiker der modernen Welt ausgerechnet auf der Eisenbahn geboren wird. Robert Martin Borchardt jedenfalls beharrte 1907 darauf, sein ältester Sohn habe sich als Stammhalter nach der Tradition gerichtet: »In meiner Geburtsstadt erblicktest auch Du das Licht der Welt.« Als wolle er bereits im voraus zumindest der Metaphorik seines Vaters widersprechen, schreibt Borchardt am 4. Juni 1901 an seine angebetete »Vivian«: »Am Sonntag werden es vierundzwanzig Jahre her sein, daß mich das Licht der Welt erblickt hat«. Wie immer man den reizvollen Unterschied der Perspektive versteht, die Tatsachen sind die folgenden.
Sein Vater war ein Kaufmann. Robert Martin Borchardt, 1848 geboren, hatte die väterliche Tee-Handelsgesellschaft übernommen und leitete von 1874 bis 1882 die Niederlassung in Moskau. In Königsberg heiratete er die 1854 geborene Rosalie, genannt Rose, Bernstein. Noch vor der Eheschließung war Robert Martin Borchardt aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten. Der Sohn Rudolf, der sich laut Geburtsurkunde Rudolph schrieb, wird französisch-reformiert getauft; dieselbe Urkunde nennt als Religionszughörigkeit für den Vater »evangel.«, für die Mutter »mosaisch«. Von Moskau aus reiste man zuweilen ins heimatliche Königsberg, und während einer dieser Reisen wurde Rudolf nun geboren, es steht dahin, ob auf der Eisenbahn oder im Bett. Rudolf ist der erste Sohn, aber das zweite Kind; voraus geht die Schwester Else (1876-?); ihm folgen Philipp (1879-1952), Helene (1880-1963), Vera (1882-1954) Ernst (1886-1931) und Robert (1890-1916). Kaum etwas ist überliefert vom Moskauer Leben der Borchardts. Ob die Mehrsprachigkeit der frühesten Jahre – Russisch, Deutsch, Französisch – Einfluss hatte auf die später so offenkundige Sprachbegabung des Jungen, ist bloße Spekulation.
1882 zieht die Familie nach Berlin, Rudolf ist fünf Jahre alt. Robert Martin Borchardt wechselt ins Bankgeschäft, und in den Berliner Wachstumsjahren des neuen Kaiserreichs verdient man hier viel Geld. Die Familie findet eine angemessene Wohnung mit der Adresse Kronprinzenufer 5 am grauen Strand der Spree, nicht weit von Tiergarten und Brandenburger Tor. Wenige Jahre später, 1894 oder 1896, erlaubt der wachsende Reichtum den Ankauf der Sommervilla in Wannsee, und dort verbringt man nunmehr die Monate von Frühling bis Herbst. Eine untergegangene Welt – und auch hier wirkt es fast gewaltsam symbolisch, dass keiner der Orte von Borchardts Jugend das katastrophale Jahrhundert überstehen sollte, dessen Zeuge er wird: die Wannseevilla verkauft, zweckentfremdet, dann im Zuge des Modernisierungswahns 1987 abgerissen und, wie schon Stimmings Krug, durch einen üblen Neubau ersetzt; das Geheimratsviertel im Spreebogen geht unter im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs: Wo heute im wüsten Niemandsland zwischen Hauptbahnhof und Bundeskanzleramt Obdachlose unter den Betonbrüstungen ihr Lager aufschlagen und Touristen vorüberziehen in Richtung Reichstag, steht damals das Haus mit der Wohnung der Familie Borchardt.
Der Grundriss der Zwölfzimmerwohnung ist zugleich Grundriss der Familie. Nach vorne hinaus zum Quai die repräsentativen Gesellschaftsräume: Arbeitszimmer, Persisches Zimmer, Saal der Pompejanerin, Tanzsaal mit Schiebetür, Speisezimmer; dahinter, Fenster zum Hof, die Kinder- und Schlafzimmer, Küche und Dienstbotenkammer; zwei Welten, und auch zwei Treppen, damit die eine nicht auf die andere trifft. Das Arbeitszimmer ist natürlich das des Vaters, und von hier aus herrscht er über Wohnung und Familie. »Wenn das Jahrhundert des Kindes wirklich bevorstand«, schreibt Borchardt mit Blick auf die Pädagogin Ellen Key, »so war ihm immerhin mit höchstem Rechte das Jahrzehnt der Väter voraufgegangen.« Der Vater ist in der bürgerlichen Familie der Epoche uneingeschränkter Diktator, das bestätigen Zeitgenossen wie Franz Kafka und Ernst Jünger ebenso wie in der weiteren Berliner Nachbarschaft Walter Benjamin oder Gerhard Scholem. Robert Borchardt ist Schrecken der Seinen: Ein Gutteil der familiären Aktivität besteht in der Vorsicht, alles aus dem Wege zu räumen, was einen der gefürchteten Zornausbrüche zur Explosion bringen kann; mit dem Vater wird nicht diskutiert; Widerspruch nicht akzeptiert; sein Wort gilt absolut. Was also bleibt einem jungen Menschen, der nach dem eigenen Weg sucht, als die kompromisslose Revolte gegen das Jahrzehnt dieses Vaters?
»Und da ich nun zu bekennen habe, daß ich durch den größeren Teil meiner Jugend die hier erzählt wird«, so spricht noch der Mann von fünfzig Jahren, »im Gegensatze, ja im widersätzlichsten Kampfe, endlich in bitterer Feindschaft gegen ihn gestanden bin, so daß ich kaum übertreibe wenn ich mich dahin fasse, daß ich nichts im Leben getan habe und geworden bin außer darum weil er wollte daß ich das Gegenteil täte und würde«, dann wird dieses harte Urteil von seinem Bruder Philipp noch Jahrzehnte später noch härter bestätigt: »Die Quelle aller Missgeschicke in Rudolf’s Leben ist das völlige Missverständnis seiner Eltern für ein schwieriges Kind, vor allem das Fehlen einer gütigen Mutter, von der Rudolf einmal gesagt hat, sie sei nur die Maske eines Menschen gewesen.« Sucht man überhaupt nach den Anfängen, Ursprüngen eines Charakters, eines Temperaments, eines radikalen Lebenswegs, dann wird man hier fündig. Rudolf Borchardt ist ein Störfall, und die Konsequenz sind Disziplinierungsmaßnahmen, die der Vater entscheidet und die Mutter exekutiert. Rücksicht auf Kinder ist unbekannt. Während einer Sommerreise der Eltern – die Episode spielt eine dramatische Rolle in Borchardts Autobiographie – lässt man den Sohn zunächst in Händen eines Hauslehrers, dann, nach dessen Enttarnung als Débauché, wird er kurzerhand zu Kost und Logis bei einer Lehrkraft im proletarischen Moabit abgestellt; eine nie zu verschmerzende Erfahrung von Verstoßung und Deklassierung zwischen unbegreiflichen Mitschülern aus gänzlich fremdem Milieu. Die Schulleistungen sinken dramatisch, doch der Vater sucht nicht nach Gründen, sondern expediert den missratenen Sohn, der zum Stammhalter offenbar nicht taugt, umstandslos ins Internat; auf sechs Jahre Ostpreußen folgen zwei Jahre in Wesel am Oberrhein.
Borchardts Selbstdeutungen und autobiographische Erzählungen sind alles andere als verlässlich, übermächtig sein Leben lang der Wunsch zur Stilisierung, zur Herrschaft über die eigene Geschichte, und noch mehr: In einer ungewöhnlichen, zuweilen fast pathologischen Weise ist er, erkennbar für Freund und Feind, außerstande, im konventionellen, pragmatischen Sinne zu unterscheiden zwischen Fakten und Traum, Biographie und Fiktion. Für die Jugendgeschichte jedoch ist man nicht – wie es so oft geschieht – auf seine eigenen Berichte angewiesen, denn vor allem die Erinnerungen der Geschwister Vera und Philipp geben ihrerseits ein weitgespanntes Bild jener Jahre. Und gerade hier bestätigen sie nahezu alles, was Borchardt selbst so bitter festhält. Die Geschwister wissen nichts Besseres als er: eine Familie, die an kaum anderem interessiert ist als an gesellschaftlicher Position; ein Vater ohne jede Sympathie für einen ungewöhnlichen Sohn; eine Mutter, die nicht ein einziges Mal im Zimmer ihrer vielen Kinder auf dem Stuhl gesessen hat, für keine Minute. Doch was sich zeigt, ist mehr als das Versagen dieser individuellen Eltern, es ist die Pathologie einer ganzen extrem autoritären, auf wirtschaftlichen Erfolg fixierten Bürgerschicht des wilhelminischen Deutschland. Rudolf Borchardts Leben bewegt sich in diesen Jahren auf einem schmalen Grat: Die Fundamentalopposition ist unausweichlich, doch ob einer sie in so jungen Jahren durchzustehen vermag oder an ihr zerbricht, ist lange nicht ausgemacht. Und eins ist gewiss: Die existenzbedrohenden Krisen werden sich noch etliche Jahre wiederholen, bevor etwas erreicht ist wie ein prekäres Gleichgewicht. Die fundamentale Erfahrung ist und bleibt die Unmöglichkeit, den vorgezeichneten Weg ins Bürgerliche zu gehen, zugleich die verzweifelte Suche nach Selbstkonstitution der eigenen, widerstandsfähigen Person. Genau das wird noch Jahr um Jahr nur misslingen.
»Rudolf Borchardt entstammte einer Berliner Judenfamilie«, schreibt der den Dichter bewundernde und fürchtende Theodor Lessing viel später in seinen eigenen Erinnerungen, »deren Lebenshaltung nicht unähnlich war der zerklüfteten Talmikultur meines eigenen Elternhauses.« Doch muss man sich fragen, inwieweit die Aussage etwas trifft von Borchardts eigener Geschichte. Die »zerklüftete Talmikultur«, das ist eine Beschreibung, wie man sie häufig wiederfindet bei den revoltierenden Söhnen gegen das großbürgerliche und das großbürgerlich-jüdische Milieu ihrer Familien. Das Judentum aber wird bei Borchardt zum wirklichen, zum offenen Thema erst in den Jahren der Weimarer Republik, in den Jahren antisemitischer Propaganda, erst dann sieht er sich gezwungen zu Antwort, Ausweichen, Gegenwehr. Man muss vorsichtig sein, darf die spätere Polemik nicht umstandslos rückprojizieren in die Frühzeit. Liegt hier für den jungen Borchardt überhaupt ein Problem? Seit wann? Wie groß? Hat er das dumpfe Gefühl, anders zu sein, ein Außenseiter, tatsächlich mit dem Jüdischen verbunden? Nur? In jungen Jahren zeigt manche unterirdische Spur, dass die jüdische Vergangenheit nicht so unwichtig ist, nicht so inexistent, wie er es später darstellt, aber auch lange nicht so entscheidend, wie andere es im Nachhinein wissen wollen. Schaut man vergleichend in die Familiengeschichten seiner Berliner Zeitgenossen, so wird manches deutlicher für das Milieu, und zwar ganz besonders der Anteil gewaltsamer Täuschung und Selbsttäuschung in dem überall bekundeten Anspruch, man sei Deutscher und nichts als Deutscher. Vor dem Antisemitismus schließt man die Augen – man will dazugehören.
Als der Antisemitismus ihm dann offensiv nahetritt, wischt Borchardt die Familiengeschichte, die man ihm plötzlich vorhält, beiseite mit dem Hinweis auf die Konversion zum Christentum in unscharf datierter und möglichst grauer Vorzeit, und nicht alles davon stimmt. Die Großeltern sind begraben auf dem jüdischen Friedhof in Berlin, Schönhauser Allee, und noch die eigene Geburtsurkunde dokumentiert die Tatsachen im Augenblick seiner Geburt. Trotzdem, ist das Insistieren auf Korrektur seiner Behauptungen überhaupt berechtigt? Und ist es wirklich so aufschlussreich? Von echter jüdischer Tradition ist in solchen Familien nicht die Rede. Zerklüftete Talmikultur, das meint die auf Repräsentation zugerichteten, geschmacklosen, unbewohnbaren Wohnungen, meint die den Sohn abstoßende großbürgerliche Mischung von materialistischer Gier und konventionellen Resten gleich welcher Religion, von steinernen Hierarchien und steinerner Moral, von konservativem Schein und fortschrittsbesessener Realität in der kapitalistischen Traditionszerstörung, von ausgestelltem Selbstbewusstsein, von der behaupteten Arriviertheit in der deutschen Nation und zugleich der weggeschobenen und nie ganz wegschiebbaren Furcht, als Jude trotz allem eben doch nicht dazuzugehören. Der Berliner Gerhard Scholem stößt seinen deutschnationalen Vater auf den Selbstbetrug, den der nicht sehen will: Als Geschäftsmann akzeptierter Teil der deutschen Gesellschaft – die privaten Bekanntschaften ausschließlich Juden. Konvertierte, säkulare, aber dennoch Juden. Diese Selbsttäuschung herrscht auch in der Familie Benjamin, und bei Borchardts? Alle Erzählungen, alle Namen lassen ahnen, hier ist es, unausgesprochen, nicht anders. Die Nachbarvilla in der Wannseer Conradstraße bewohnt die Familie Rosenberg, und die freundschaftliche Nähe ist so groß, dass es mit Rudolf Borchardt und Käthe Rosenberg im Sommer 1900 zur halben Verlobung, dramatischen Trennung kommt, mit Vera Borchardt und Hans Rosenberg zur Ehe; auch die Schwester Helene heiratet mit Carl Wirtz einen Juden. Fühlt man sich auch deutsch, mag man sogar deutschnational wählen; das private Leben sieht anders aus. Gezwungen, nicht freiwillig, aber gerade das wird möglichst verdrängt.
Borchardt selbst gibt einen Hinweis, dass er dieses von ihm so massiv abgelehnte Milieu der Familie keinesfalls nur, aber auch mit ihrer jüdischen Herkunft verbindet, verbinden muss: »Ihr seid alle trübe und gedrückt und habt das entsetzlichste erbteil des ghettos, unfreiheit, Euch nur allzu frei bewahrt«, schreibt er am 2. Januar 1898 an seine Schwester Helene; »wir stehen zwischen zwei generationen die extreme verhältnisse vertreten. Zwischen einer gebundenen und einer gelösten; um die andere zu lösen, heisst es uns zunächst lösen. Lösen wir uns nicht, so werden sicherlich auch unsere kinder ein verwildertes geschlecht sein, das zwischen zwiespältiger rassenart und zwischen zwei perioden geschichtlicher entwicklung kämpfend den frieden des gemütes verliert.« Und damit bringt er zum Ausdruck, was ihn tatsächlich treibt: das Verlangen nach Freiheit. Als jüdisch empfindet er in seiner Familie nur den Zwang, der ihn an etwas fesseln soll, was er nicht ist, was er nicht sein will, was er nicht sein wird. Er will nicht gebunden sein durch etwas, was für ihn keine Wirklichkeit hat, keine gültige Bindung. Und das unterscheidet ihn dann doch klar von Scholem, der das Judentum als die Befreiung zum eigenen Leben ergreift, und von Benjamin, der sich lebenslang an ihm abarbeitet. Drei mögliche, drei legitime Entscheidungen; drei – das heißt dann aber auch, dass die Nichtzugehörigkeit nicht weniger legitim ist als die Identifikation oder das Zögern.
Dennoch, Jahre später wird die jüdische Frage so offen aufbrechen, dass sie nicht mehr zu ignorieren ist, diskutiert werden muss, denn die Öffentlichkeit stößt Borchardt dann mit Gewalt in eine Position, die nicht die seine ist, mit der er nichts zu tun haben will. Und hat er nicht auch recht? Er nämlich sucht etwas ganz anderes für sich: die Tradition des deutschen Humanismus, wie sie gelehrt wird an Gymnasium und Universität.
ZWEITES KAPITEL
»Distanz ertragen«
Revolte
Revoltieren kann einer nur gegen alles: gegen Familie und Milieu, gegen das Bürgertum und sein Phantasma von unendlichem Fortschritt und Profit, gegen die lauen Christen in der Gegenwart und die lauen Juden irgendwo in der Familiengeschichte. Borchardts Studienjahre sind der permanente Kampf gegen alles, was seine Herkunft ihm mitgegeben hat, und was kann dieser Kampf deshalb anderes sein als ein Kampf um sich selbst, denn wo anders als im eigenen Selbst konzentriert sich die eigene Herkunft. Alles, wogegen er kämpft, findet er dort, in sich selbst. Kampf, Revolte, Totalopposition, das radikale Verwerfen von allem, was jedem anderen als selbstverständlich gilt, das lernt Borchardt in seinen Lehrjahren. Doch erkennbar wird bereits die andere Seite dieses Aufstands eines einzelnen. Sei es, dass er eben doch gefangen bleibt im Radius einer großbürgerlichen Oberschicht; sei es, dass einem jungen Mann in den Neunzigern des neunzehnten Jahrhunderts die Mittel und Perspektiven einer politischen und künstlerischen Revolte des frühen zwanzigsten – Revolution und Avantgarde – noch nicht zur Verfügung stehen; seien es ganz einfach Charakter und Temperament: Borchardt träumt nicht den Traum vom Zerbrechen der alten Ordnung, von der Zerstörung des Alten und der Utopie eines Neuen; nein, im Gegenteil: Borchardt aktualisiert, radikalisiert gerade jene alten Traditionen, die man als Inbegriff des Konservativen begreift, denen er selbst jedoch nur noch als konsequenzlose, schmückende Ideologie begegnet.
Das Bekenntnis, »daß ich nichts im Leben getan habe und geworden bin außer darum weil er wollte daß ich das Gegenteil täte und würde«, ist auch so wörtlich zu verstehen, dass es, über die Neigung hinaus, die nun fällige Studienwahl erklärt. Den naheliegenden Wunsch auf eine Nachfolge im Geschäft hat der Vater bei diesem »schwierigen Kind« wohl bald aufgeben müssen. Borchardts Entscheidung fällt für klassische Philologie, Orientalistik, Archäologie, zunächst auch Theologie, später noch deutsche Literatur; auf zwei Semester Berlin folgen deren fünf an der Universität Bonn, dann, im November 1898, die Jahre in Göttingen. Klassische Philologie ist auf den ersten Blick eine konservative Wahl, in Borchardts Fall jedoch tatsächlich nur auf den ersten. Die Berufsperspektive des Faches steht fest: Lehre an Gymnasium oder Universität. Diese Laufbahn, mit Dissertation und Habilitation, hat der Student durchaus im Blick, und zuweilen sogar die künftige Notwendigkeit eines regulären Broterwerbs, seine Antriebe jedoch sind anderer, ganz eigener Natur. Sein Protest gegen Schicht, Milieu, Familie greift zu einem Argument, das man später als ideologiekritisch bezeichnet hätte: Tradition, Bildung, Kultur, Kunst, all das erscheint ihm nur noch als Dekor, gepflegte Oberfläche im abstoßenden bürgerlichen Geschäfts- und Gesellschaftsleben, doch er, der Sohn, er nimmt die feierlichen Reden beim Wort: Die Antike gegen die Bank des Vaters. Konservativ sind nicht die Geschäftemacher der immer rasanteren Industrialisierung, konservativ ist nur er selbst, der Student Rudolf Borchardt.
Der »Eranos-Brief« von 1924 ist eine autobiographische Hauptquelle für diese Zeit, zu lesen wie stets mit höchst kritischem Vorbehalt gegenüber den Selbstdeutungen, aber doch, aller erkennbaren Stilisierung zum Trotz, mit einem nachprüfbaren Kern an Wahrheit. Seine Neigungen und Interessen entwirft Borchardt dort nicht nur durch die Namen seiner Lehrer, sondern mehr noch durch die holzschnittartige, fast expressive Formung der Gesichter hinter diesen Namen: »Ich hatte Treitschke noch gehört – der taube Riese stand, vor zusammengepreßten Augen auch fast blind wirkend, rauh donnernd an der Rückwand der weiten Sprechhalle, unverständlich, unvergeßlich – Herman Grimm noch, tiefsinnig und silberhäuptig, Augen der edlen Dogge über hingezehrten Greisenwangen, Jacobs und Wilhelms Tiergartenhause vorbeiwandeln sehen; Mommsens verachtender Kohlenblick im Gesichte eines zu Ätherschärfe verklärten neuen Voltaire, hatte neben mir ein rasch zerblättertes Buch durchbrannt, Curtius’ priesterliches Auge sich wie übelabwehrend aufgeschlagen – Blicke ohne Worte, Geistergruß ohne menschliche Lehre, traumhaftes Streifen: diese Hand hatte die Lachmanns noch gedrückt, jener Arm die greise Marianne die herbstverblätterten Stufen zum Gartenhause an der Ilm hinaufgeleitet, vor diesem Auge hatte zuerst das unbetretene Hellas gelegen wie vor dem Goethes Italien. Die Welt verlosch, die Könige waren im Gehen, der Knecht – ›wär selber ein Ritter gern‹ – stieg neben mir in die Bügel.« Der Stil ist das Programm. Das harte Relief, in dem blinde, taube, greise, abgezehrte Riesen des deutschen Geistes hingestellt sind, versteht sich als letztes Tableau einer untergehenden, untergegangenen Tradition. Wie auch immer der späte Borchardt hier die harten Kontraste stilisierend schärft, der junge erblickt als Student jene Geschichtsvision, die ihn sein Leben lang begleitet: die Vision vom Kulturbruch des neunzehnten Jahrhunderts, von der abgerissenen Tradition, von der Talmikultur des Wilhelminismus, von einem Überleben des deutschen Geistes nur in den verborgensten Winkeln der neuen Gesellschaft. Durch sein Studium erarbeitet er sich allein jene Tradition, die von außen nicht mehr kommt. Seine Wahl also ist nicht einfach statisch-konservativ; sie wird konservativ und schöpferisch in jenem revoltierenden Sinn, wie er es später zum Programm erhebt. In einer Volte, wie sie so typisch wird für diesen in Extremen denkenden Geist, macht er sich die klassische Philologie zum existentiellen Protest gegen das bürgerliche Deutschland.
Zugleich aber ist die rein wissenschaftliche Beschäftigung mit den großen literarischen Texten der Antike und der deutschen Klassik längst nicht genug zum Ausdruck für diesen Protest; zu groß der schöpferische Drang; der Wille, etwas von sich, von seinem Inneren gleichsam objektiv nach außen zu stellen, verlangt nach einem Gegenstand, einem Produkt, nach etwas Geschaffenem. Er verlangt nach Kunst. Mitte der neunziger Jahre tut der Student das, was allzu viele tun in ihrer Jugend, er schreibt Gedichte. Doch Borchardt ist es mit der Sache so ernst, dass zu Weihnachten seine erste Publikation erscheint: Die Zehn Gedichte sind ein Privatdruck auf eigene Rechnung und in kleinster Auflage, aber dennoch, sie sind ein Druck; philologisch gesehen gehören sie zum publizierten Werk. Trotzdem spielen sie eine Sonderrolle. Zwar nennt der Autor sie noch 1923 in seiner öffentlichen, halbfiktionalen Autobibliographie – wenn auch mit dem fürs Publikum kryptischen Vermerk »Nicht im Handel« –, jedoch in seine »offizielle« Werkreihe, falls man in diesem zerklüfteten Werk überhaupt so reden kann, hat er sie niemals aufgenommen, er dachte nie an einen Nachdruck, und auch die posthume Werkausgabe stellt sie nicht an ihren chronologischen Ort, sondern in den Anhang. Zurecht. Die Zehn Gedichte teilen das Schicksal jener vorauseilenden Werke, da ein hochbegabter, im Schöpferischen frühreifer Autor – der von Borchardt nicht geliebte Rilke wäre ein anderer – zum Schaffen drängt, bevor ihn die künstlerischen Blitze treffen, die Vorbilder, Spiegelbilder, die ihm seinen eigenen, charakteristischen Weg erst sichtbar, begehbar machen.
Der Moment ist noch nicht da; die Zehn Gedichte beweisen sicher ein großes Talent, zeugen aber, mehr als von eigener Sprache, von dem geistigen Kosmos des Suchenden; er habe damals »ausser Goethe Hölderlin Platen und Mörike nur noch antike Dichter« gelesen, heißt es wenige Jahre darauf im Rückblick, und dieses Unfreie verbannt die frühen Versuche dann doch aus dem lyrischen Gesamtwerk, in dem eine eigene Stimme spricht. Trotzdem, gerade mit dem Klang der wirklichen, reifen Gedichte im Ohr, wird man erste eigene Töne auch hier nicht überhören. Die zwei »Chöre aus einem lyrischen Drama Tantalus« setzen schon durch die Wahl des mythischen Helden einen persönlichen Akzent für den jungen Borchardt und sein quälendes Gefühl eines fruchtlosen Bemühens um das sich immer wieder entziehende Ziel: »Fasse fest dein Herz mit beiden Fäusten«, das ist eine Aufforderung an sich selbst; »lerne dich zum tätigen erdreisten / und dir selber schweigend angehören«. Noch unmittelbarer ausgesprochen ist der Bekenntnischarakter, das furchtbar Autobiographische in diesem frühreifen Lyrismus, durch die Widmung, die Borchardt seinem Bruder Philipp in die Zehn Gedichte schreibt:
Die rosse meines lebens bäumen sich
Und greifen aus. der wagen schüttert mich.
Und alle stehn in scheuem mitleidssinn:
›Die achse bricht! er stürzt! er ist dahin!‹
Noch lange wird es ihn begleiten, dieses durchbohrende: Das ist es nicht! Das kann es nicht sein! Er geht und sucht auf zwei Wegen: der klassischen Philologie und der eigenen Poesie, doch er ahnt in einem elementaren Sinne, für sein Leben, für das, wonach er sucht, braucht es noch etwas anderes. Mehr als ahnen kann er es wohl noch nicht in diesem Augenblick; er weiß nur, er selbst ist zweierlei zugleich, was man allgemein sauber getrennt hält: ist Wissenschaftler, wenn auch nicht historisch, positivistisch fixiert auf Ordnung und Analyse; ist Künstler, wenn auch kein naiver, nur herz-, gefühlsgelenkter. Er ist beides zugleich, nebeneinander, der auf Intellekt, Argument, Austausch, Auseinandersetzung gerichtete Denker und der einsame, ausschließlich dem eigenen Ausdrucksbedürfnis folgende Dichter; spürt, ein aufgeteiltes Doppelleben ist unmöglich; spürt, in einem profunden Sinn ist für ihn beides Dasselbe; doch was ihm fehlt, ist die Idee, wie dieses Dasselbe zu fassen ist, auszudrücken, zu verwirklichen.
Borchardt setzt das Erweckungserlebnis für den eigenen Weg auf die Jahre 1897-1898, und er verbindet es mit drei Namen: Johann Gottfried Herder, Hugo von Hofmannsthal, Stefan George. Ist das Maß an Stilisierung auch hier wieder nur wenig überprüfbar, eines ist dennoch klar: Mit dem Frühling 1898 spricht Borchardt nicht mehr als derselbe. Ob die von ihm gesetzten Daten wirklich exakt sind, spielt deshalb kaum eine Rolle. Für seine Entdeckung Herders gibt es keine Briefzeugnisse, sondern nur die dramatische Erzählung im »Eranos-Brief« über den zufälligen Griff nach einem kleinen alten Buch, aber was heißt hier schon Zufall: »Es galt mir gleich; ich hatte zum ersten Male, was ich suchte. Meine leidenschaftliche Unruhe und Ungeduld war keine Kinderkrankheit gewesen, sondern gerechter nötiger Drang in ungerechter und unverdienter, unwürdiger Lage. Die Welt des Geistes die ich verlangte, gab es, hier war sie. Die Schöpfergewalt, die Formen strömt, Urformen, aus Urform Neuform und Wiederform, aus Unform durch Seele wieder zur Form, ja sie war da, und wie sie aus dem Ewigen stammte, ja, so war sie ewig; wie sie ewig war, so war sie allgegenwärtig, fast allwissend. Der Dichter war Dichter nicht durch Kunst – es gab keine Dichtkunst. Er war es als Mensch, durch Menschheit. Sprache war Dichtung. Wort war Ausruf, nicht Bezeichnung. Staunen des Menschen war sein Beiwort, Handlung und Befehl sein Verbum. Stil war nicht ein Erzeugnis, sondern ein Intensitätsgrad. Die vorgestellte Welt wie die sinnliche gehörte allen. Da stand es.« Mag sein, dass Borchardt einen längeren Entdeckungsprozess dramaturgisch zusammenzieht zu diesem Kairos »an einem frühsommerlichen Nachmittage«, die berichtete Erfahrung stimmt, weil das ganze Leben sie bestätigt.
Mit seinem Erweckungserlebnis beschreibt Borchardt eine alte, immer wieder produktive Denkfigur, nämlich die Geburtshilfe für das eigene durch die Anverwandlung eines fremden Werks, in dem man sich wiederzuerkennen meint. Ob Borchardts Herder-Bild »richtig« sei in allen Zügen, bleibt so nebensächlich wie die Frage etwa nach der Klopstock-Vorstellung des jungen Goethe; entscheidend ist der schöpferische Impuls: Herder, Theologe, Philosoph, Dichter, Übersetzer, wird für Borchardt der lebendige Beweis, dass man die Kulturgeschichte schöpferisch verstehen kann und die Kunst gedankenvoll, dass eines das andere durchdringen muss und befruchten. Und in Herders mytho-historischer, mytho-poetischer Sprachphilosophie sucht und findet er es ausgesprochen: Poesie ist nicht ein Unter-Fach der Literatur, keine Produktionsstätte für sogenannte Texte, sondern ein elementares Sprechen aus dem Urgrund der Sprache, und noch mehr, nämlich die letzte, tiefste Verkörperung von Sprache und Sprechen überhaupt; mit den Worten von Herders Lehrer Hamann, Poesie ist auch für Borchardt jetzt die Muttersprache des Menschengeschlechts. Der wirkliche Dichter spricht zwar aus sich, aus seinem ganz individuellen Inneren, doch wenn er wahr spricht, spricht er als Einzelner für alle, Volk oder Menschheit. Eine Entdeckung von ungeheurer Tragweite für diesen Einundzwanzigjährigen, dessen quälendste Erfahrung gerade die Vereinzelung ist, die Bindungslosigkeit durch eine ihm so zweifelhafte Herkunft. Auch der Einsamste spricht womöglich für alle.
Die Sätze à la Herder sind das glatte Gegenteil von bloß pathetischer Rhetorik, sind gelebte und erlittene Erfahrung, und das beweist Borchardts andere große Entdeckung des Jahres 1898: die moderne Poesie. Bis dato blieb er gefangen in den weiten Kreisen Goethes, und Conrad Ferdinand Meyer ist wohl der gegenwartsnächste Dichter deutscher Sprache, der ihm etwas zu sagen hat, und das ist kein Jünglings-Snobismus. Auch im historischen Rückblick ist die deutsche Poesie der zweiten Jahrhunderthälfte in einer Krise, akademisch, handwerklich, epigonal; eigene Stimmen sind nur von den Rändern zu vernehmen, Meyer, Keller, Storm. Nichts aber vom Gegenwärtigen weckt bei Borchardt ein Echo, wie sollte es auch. Umso stärker treffen ihn die Verse zweier Zeitgenossen. Im Februar 1898 liest er zum ersten Mal Hugo von Hofmannsthal, im April Stefan George. Auch hier gilt: Ein ganzer Lebenslauf und zahlreiche Briefzeugnisse bestätigen den Bericht von der plötzlichen, epiphanischen Gegenwärtigkeit der modernen Lyrik. Der junge Mann, der von seiner ganzen Ausbildung in klassischer Philologie und seinen Lektüren im Kreis der Weimarer Klassik leicht zum Epigonen hätte werden können, findet in diesen beiden jene schöpferische Kraft, die ihm Herder erklärt hat, also bei zwei Dichtern, die nur wenig älter sind als er selbst. Von diesem Augenblick an ist alles verändert, und als erste Konsequenz begreift Borchardt, warum die Zehn Gedichte sofort in der eigenen Prähistorie versinken müssen und mit ihnen auch die geplante Fortsetzung: nicht, weil sie einfach nur »schwächer« wären, das haben frühe Versuche so an sich, nein, Borchardt ist nach der Zäsur ein anderer Autor. Im machtvollen Schatten der Vorbilder schreibt er nun für ein volles Jahr keine Poesie. Was er tatsächlich kennt, ist wenig genug, Gedichte und Das kleine Welttheater von Hofmannsthal, von George das französisch inspirierte Frühwerk in den Blättern für die Kunst und die halbklandestinen Zyklen noch vor dem Jahr der Seele; genug für die Gewissheit, hier sprechen zwei im Sinne Herders eine neue, dennoch wirkliche Dichtersprache.
Ein für allemal entscheidend ist aber schon die Reihenfolge dieser Lektüren, denn die nur zwei Monate frühere Begegnung mit Hofmannsthals Versen verhindert – falls nicht bereits sein wenig zur Unterwerfung neigender Charakter –, dass Borchardt dem charismatischen Phänomen George so hypnotisiert verfällt wie allzu viele der jugendlichen Zeitgenossen. Seine Bewunderung für den Erneuerer, für einen der ganz großen Dichter deutscher Sprache ist und bleibt immens; gegen den Menschenfänger und -führer George immunisiert ihn der Künstler aus Wien, der sich auch selbst hochbeweglich dem gewaltsamen Machtanspruch entzieht. Bei aller Ambivalenz, bei allem Wechsel im Lauf der Jahre – mit Hofmannsthal und George findet Borchardt den großen Freund und den Hauptfeind seines Lebens fast zugleich. Sein Lebensproblem ist noch lange nicht gelöst; doch Herder gibt ihm nunmehr die Begriffe und Ideen in die Hand, seine eigene poetische Intuition zu verstehen, und mit den beiden Dichtern besitzt er ein für allemal die Gewissheit: Dichten ist möglich auch in der geistfernen, verachteten Gegenwart. Sein erträumter Weg ist vielleicht wirklich ein Weg. Doch Steine genug liegen dort noch immer. In seiner explosiven Begeisterung versucht der Bonner Student sich sofort als Propagandist für die natürlich noch wenig bekannten Idole, organisiert eine Soiree mit dem tatsächlich bekannten Berliner Schauspieler Ernst Hardt und bewirbt sie am 24. Mai 1898 durch einen Zeitungsartikel »Wiener Dichter in Bonn«. Die Lesung wird in der akademischen Kleinstadt ein spektakulärer Misserfolg, fast ein Skandal. Borchardt, zutiefst enttäuscht und zudem verheddert in Organisations- und Honorarfragen, würde sich das persönliche Missgeschick am liebsten offensiv umdeuten zur heroischen Niederlage im Kampf für die neue Kunst einer neuen Generation, denn genauso herausfordernd hat er den Abend angekündigt: »Hugo von Hofmannsthal und Stefan George haben die Jugend sehr stark ergriffen und halten sie wie mit unlöslichen geisterhaften Banden fest. Dem jungen Geschlecht dieser Tage, das nicht mit leichten Füßen über die Erde geht, haben sie seine ganze Sehnsucht abgehört und ihm einen reicheren stärkeren glänzenderen Inhalt des Lebens gegeben.« Zwar sind sie ihm bereits jetzt »nicht der Ausdruck derselben künstlerischen Art«, aber noch sieht er eine generationsumfassende Gemeinsamkeit, in die er nur zu gern einen dritten eingeschlossen hätte – sich selbst.
Gerade deshalb bleibt der Bonner Abend, was er ist, persönliches Scheitern, vergebliche Mühe. Borchardt, der sich blamiert fühlt in Bonn, zieht eine schnelle Konsequenz, räumt den Ort der verlorenen Schlacht und wechselt zum Wintersemester 1898 nach Göttingen. Zuvor jedoch führt ihn seine Flucht noch in ganz andere Richtung, nach Italien. Die Flucht wird Flucht nach vorn, und am Ende des Jahres hat Borchardt all das beisammen, was ihm an seinem Anfang noch so schmerzhaft gefehlt hat, die gesuchte Basis seines Lebens: die Poesie, verkörpert in Herder und Hofmannsthal, einen geographischen, geschichtlichen, poetischen Existenzraum, Italien. Im Juli fährt er über den Gotthard, wo Goethe einst das erste Mal umkehrte. August, September, Oktober, Pisa, Arezzo, Florenz, fast schlafwandlerisch findet er sein Italien, Stadt um Stadt. Die klassischen Höhepunkte der Grand Tour – Rom, Neapel – besucht er jetzt und auch später nicht; vor der Rückreise über den Brenner folgt noch ein Frühherbst in Venedig, und von dort überliefert ist ein Fragment, fast weniger als Brief zu verstehen denn als lyrischer Vorschein künftiger Prosa.
Borchardt fährt mit der Eisenbahn; die Gotthardstrecke wurde 1882 eröffnet, der Brenner schon 1867. Kann der Fahrgast mit Umsteigebillet noch einmal reisen wollen wie Goethe? Er kann nicht nur, er muss. Kann er ein Italienerlebnis suchen und vielleicht auch finden, das ihm poetisch, malerisch die Augen öffnet für ein Land auf der Schwelle zum neuen Jahrhundert? Wenn er es nicht mindestens versucht, wenn er beim Blick aus dem Abteilfenster in die eben prächtig aufgegangene Sonne nicht wenigstens davon träumt, seine trivialisierte Gegenwart dem trivialen Verkehrsmittel zum Trotz zu unterlaufen, wozu dann überhaupt ein Aufbruch? Das muss es sein, poetisch leben in einer poesiefernen Zeit. Das venezianische Fragment zeigt überdeutlich seine Vorbilder: die Goethe’sche Schule des Lebens ebenso wie den exklusiven Fin-de-Siècle-Ton des genießenden Ästheten. Illustriert die geliehene Décadent-Attitüde, dass der junge Reisende, der die eigene Statur noch nicht hat, etwas braucht wie Rollenprosa, so finden sich in den Beobachtungen von Kunst und Architektur schon Akzente eigenen Sehens – erste Zeichen für sich langsam vorbereitende gültige Werke. Die Göttinger Jahre 1899 und 1900 sehen in wildem Durcheinander alles zugleich: den Versuch zum Studienabschluss durch die Dissertation, die Entdeckung jetzt auch der englischen und französischen Lyrik des neunzehnten Jahrhunderts, erotische Verzückungen und Katastrophen in Göttingen und im Wannseer Feriengarten; entstehende Elegien und Sonette sind zum ersten Mal nicht nur begabt, sondern gewinnen Klang in eigener Tonart.
Blick nicht in meine Fenster, Tag.
Mein Schiff will Sturm und keinen Stern.
Das letzte, was das Herz vermag,
Ist, es stürbe gern.
Diese Gedichte, die ersten auch, die er später in seine gültigen Ausgaben aufnehmen wird, zeugen noch immer von jugendlichen Konflikten, »Knabenschwermut« und zuweilen Jugendstilmetaphorik, doch dagegen stehen die formale Beherrschung und die jetzt ganz eigene Bildlichkeit. Die »Heroische Elegie« endet mit beidem: »Zwei junge Füße, sanften Vorwärtsstrebens / Geleiten meinen Schritt ins Haus des Lebens.« Borchardt sendet den Privatdruck nicht nur an George und Hofmannsthal, sondern auch an Algernon Charles Swinburne, Giovanni Pascoli, Maurice Maeterlinck, Henri de Regnier. Und im Herbst 1900 entsteht das erste abgeschlossene und auch bleibende Werk des Autors: Das Gespräch über Formen und Platons Lysis deutsch, ein eigentümlicher Doppelschlag, hier die Übersetzung von Platons Lysis-Dialog, ihr gegenüber der zeitgenössische Dialog des Platon-Übersetzers mit einem jungen Freund, erkennbar angesiedelt in Borchardts Göttinger Studierstube. Der zum letzten Mal aufklingende Fin-de-Siècle-Ton mit ägyptischen Zigaretten, Teezeremonie und blasiert-ironischem Wortgeplänkel täuscht trotzdem nicht: Zum ersten Mal entwirft Borchardt eine vollgültige Poetik und sein Bild vom poetischen Leben – das eine unmöglich ohne das andere. Dass es dafür kein Publikum gibt: »Um solche Leser kümmere ich mich nicht«, so Borchardts Alter Ego. »Blinde Seelen, wem lohnte es die Mühe, auch nur bitter zu werden um ihretwillen; mögen sie weiter glauben, das Heil bestehe darin, sich diese Dinge nahe bringen zu lassen. Die, an die allein ich denke, sollen dazu erzogen sein, Distanz zu ertragen. Sie sollen auf irgendeinem Wege in das Gefüge einbrechen.«
Das herrische Diktum überspielt wohl ein jugendliches Schwanken zwischen schöpferischer Einsamkeit und realer Vereinsamung; das Gespräch über Formen lebt dennoch bereits aus einem Gespür für Schaffensprozesse, wie jeder Künstler sie kennt. Das neue Jahrhundert bringt für alle Künste eine Erschütterung traditioneller Form; genau darin hat das Gespräch seinen Gegenstand; in seiner Rede vom Ewigen ist es ein Wort zum Tage, Begründung und Rechtfertigung einer Kunst, die sich dem Formzerfall, der modernen »Verskrise« Mallarmés entgegenstemmt. Die Prämisse »In jedem Kunstwerke ist das Sinnliche primär, nicht das Sittliche« hat zur ästhetischen Konsequenz: »Was der Pöbel Form nennt, ist Inhalt, was er Inhalt nennt, Resultat einer Formung«, oder noch klarer: »Jeder Künstler macht unaufhörlich Experimente: er biegt den Satz und bändigt den Vers, er umreißt diese Arabeske und prüft diese Bewegung, verwirft und schreibt um«, und er »bezwingt eine Empfindung von furchtbarer Maßlosigkeit, indem er sich den Reimkäfig vorsetzt, in den er sie sperren wird«. Fast unglaubhaft, mit welcher Sicherheit der junge Mann eine Vorstellung fürs ganze Leben entwickelt: Form als Ausdruck, Experiment als Produktivkraft, sinnliche Schönheit als inneres Formprinzip. Streichend schreiben, suchend nach dem einzigen mot juste, bis der Vers geformt dasteht in seiner einzig möglichen Gestalt.