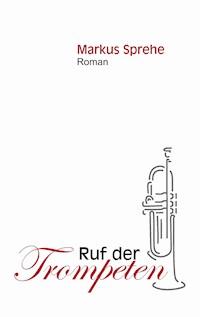
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur wenige Juden sind noch in der Stadt. Unbekannte haben auf die Hauswand eine feindliche Parole geschmiert, die das Judenmädchen Miriam beseitigen soll. So verlangt es ihr Vermieter. Da beobachtet sie aus dem Fenster den Abtransport weiterer Juden, und erkennt, dass nur die Flucht sie retten kann. Sie schleppt sich zu einem Bauernhof in der Nähe, hält sich hinter mächtigen Eichenstämmen verborgen, bis Theo über den Hof in Richtung der Tierställe wankt. Theo, das ist der Bauer, der Miriam Eier und Speck zugesteckt hat, wenn sie an den Wochenenden vom Friedhof in die Stadt zurückgehen wollte. Noch ahnt sie nicht, dass Jahre vergehen werden, bis ihr Martyrium ein Ende nehmen soll. Nur zu wenigen Menschen hat sie Kontakt. Sie wird missbraucht, wird schwanger. Schließlich kommt es zu einem Totschlag. Miriam hat schwere Zeiten und schlimmste innere Konflikte zu durchstehen, bis endlich doch das Ende des Krieges kommt. Viele Jahre später, Miriam ist nun eine alte Frau, trifft sie am Grab ihrer Eltern auf einen Fremden. Es ist eine Fügung des Schicksals, dass beide dasselbe Ziel verfolgen: Die Wahrheit soll ans Licht. Miriam lädt ihn auf eine Tasse Tee zu sich auf den Hof ein, inzwischen eine Ferienpension, und schildert ihm diese, ihre schwersten Jahre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Nur wenige Juden sind noch in der Stadt. Unbekannte haben auf die Hauswand eine feindliche Parole geschmiert, die das Judenmädchen Miriam beseitigen soll. So verlangt es ihr Vermieter. Da beobachtet sie aus dem Fenster den Abtransport weiterer Juden, und erkennt, dass nur die Flucht sie retten kann. Sie schleppt sich zu einem Bauernhof in der Nähe, hält sich hinter mächtigen Eichenstämmen verborgen, bis Theo über den Hof in Richtung der Tierställe wankt. Theo, das ist der Bauer, der Miriam Eier und Speck zugesteckt hat, wenn sie an den Wochenenden vom Friedhof in die Stadt zurückgehen wollte. Noch ahnt sie nicht, dass Jahre vergehen werden, bis ihr Martyrium ein Ende nehmen soll.
Nur zu wenigen Menschen hat sie Kontakt. Sie wird missbraucht, wird schwanger. Schließlich kommt es zu einem Totschlag. Miriam hat schwere Zeiten und schlimmste innere Konflikte zu durchstehen, bis endlich doch das Ende des Krieges kommt.
Viele Jahre später, Miriam ist nun eine alte Frau, trifft sie am Grab ihrer Eltern auf einen Fremden. Es ist eine Fügung des Schicksals, dass beide dasselbe Ziel verfolgen: Die Wahrheit soll ans Licht. Miriam lädt ihn auf eine Tasse Tee zu sich auf den Hof ein, inzwischen eine Ferienpension, und schildert ihm diese, ihre schwersten Jahre.
Autor
Markus Sprehe wurde 1960 in Lechtingen, einer kleinen Gemeinde nahe bei Osnabrück geboren. Er arbeitete viele Jahre als Werbegrafiker, bevor er seinen ersten Kurzroman Laubfärbung veröffentlichte. Nun liegt sein zweiter Roman vor.
Das jüdische Volk feiert ein Fest:
Das Blasen der Trompeten kündigt das zweite Kommen Jesu an und ruft die Gemeinde Israel zusammen.
Es prophezeit, dass Jesus das Volk Israel wieder zusammenbringen wird.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
1. Teil
Als ich Zeugin der Deportation wurde
Meine Flucht
Der Bauer trifft eine riskante Entscheidung
2. Teil
Versteckt auf dem Heuschober
Erinnerungen
Gerhard Markert meldet mich als vermisst
Der Polizist Wankel erscheint auf dem Hof
Karsten darf vorerst bleiben
Der Knecht überrascht mich des Nachts
Der Knecht wird unzuverlässiger
Die letzten Juden sind deportiert
3. Teil
Grabesrede
Der Knecht kommt nun wöchentlich
Der Holländer kümmert sich um mich
Ich will mich gegen den Knecht auflehnen
Ich bin schwanger
Heiner erscheint mit dem Polizist Wankel
Der verletzte Knecht
Im Juni ´45 bekomme ich mein Kind
Epilog
Vorwort
Ein Buchschreiber saß an seinem Schreibtisch und dachte über eine neue Idee nach. Ihm schwebte etwas Trauriges vor, und da entstand in seinem Kopf das Bild einer alten Frau. Sie sollte einsam sein.
Weil er vor kurzer Zeit durch eine kleine Stadt gekommen war, die ihm behagliche Gefühle beschert hatte, sollte die Frau dort wohnen.
Doch alt zu sein und einsam, nein, das war für sich betrachtet nicht traurig genug. Was konnte es also sein, das seine Geschichte traurig und tragisch machen würde? Nach einigem Überlegen fiel ihm eine Dokumentation ein, die er vor Tagen im Fernsehen mit Interesse verfolgt hatte. Ihr Thema war die Geschichte der Juden gewesen.
Die alte, einsame Frau könnte eine Jüdin sein, dachte sich der Buchschreiber. Jawohl, eine alte, einsame Jüdin, die in dieser kleinen Stadt wohnte. Das größte Leid ist den Juden im Krieg widerfahren, ging ihm durch den Sinn, und wenn er lediglich vom Krieg sprach, dann meinte er den Zweiten Weltkrieg, alle anderen bezeichnete er genauer. Also stand nun auch die Zeit fest, während der sich alles zugetragen hatte. Der Schreiber war nun nicht mehr zu bremsen. Er redete bereits von zugetragen hatte. Das Ganze war nicht länger nur eine Option. Er dachte nicht mehr aus; er erinnerte sich schon. Es stand also fest: Dort in der kleinen Stadt war in jener Zeit einer alten einsamen Jüdin etwas Trauriges passiert.
Der Buchschreiber erwärmte sich für den Gedanken, dass die Greisin eine der letzten Juden in der Stadt gewesen war; und wieder wurden Ihrer welche abgeführt, was sie beobachtet hatte.
Alles hilft nichts, dachte er, ich muss diese kleine Stadt noch einmal besuchen. Sie ist schön, sodass mir eine Visite angenehm sein wird. Wo hat die Frau dort gelebt? Wie sind die örtlichen Gegebenheiten? Er fragte sich auch, ob zu jener Zeit, da all das geschehen war, überhaupt Juden dort heimisch waren. Viele weitere Fragen, die auf eine Antwort warteten, schrieb er gewissenhaft in sein Notizbuch.
Als er sich für die Reise bereit fühlte, machte er sich einen Kaffee, überdachte alles noch einmal in Ruhe, während er trank, streifte sich Mantel und Schal über und fuhr los.
Groß war seine Freude, und seine Hoffnung war gestillt, als er einen Platz in der Stadt ausmachte – ein Gebäude, an dem eine Tafel angebracht war mit einer Aufschrift, die auf eine ehemalige Synagoge an jener Stelle hinweisen wollte. Sie ward in der Kristallnacht in Brand gesetzt. Von Passanten erfuhr er, dass es einen kleinen jüdischen Friedhof am Rande der Stadt gäbe. Der Schreiber ließ sich den Weg erklären und des Weiteren sich nicht nehmen, einen Abstecher dorthin zu wagen. Er versprach sich von der Besichtigung weitere neue Erkenntnisse.
Das Eisentor quietschte, als er den Platz betrat. Befriedigt schlenderte er durch die Wege, besah sich die Grabsteine, las die Namen und die Sterbedaten, bis er abrupt seinen Gang unterbrach.
In unweiter Entfernung machte er eine alte Frau aus, die in Ehrfurcht auf ein Grab hinab sah. Ihre Erscheinung entsprach in etwa der in seinem Kopf Entstandenen. Unwillkürlich fragte er sich, ob die Dame ihm schon länger bekannt sei. Sie wirkte ihm vertraut. Doch das war Einbildung. Seine alte Frau hatte in einer anderen Zeit gelebt, da musste diese noch sehr jung gewesen sein.
Nach kurzer Andacht näherte sich der Buchschreiber vorsichtig, weil er die Frau nicht erschrecken wollte. Sie wandte sich ihm ohne Unruhe zu, als hätte sie sein Kommen erwartet. Ihre Blicke begegneten sich. Darauf folgte ein Schweigen, das der Schreiber beendete, indem er sich bekannt machte. Man kam ins Gespräch. Er erläuterte den Grund seiner Anwesenheit, was die Frau zunächst mit einem Schulterzucken quittierte, doch dann lud sie ihn auf eine heiße Tasse Tee zu sich nach Hause ein, denn es war auf die Dauer sehr kühl im Freien.
Prolog
Nach meiner Wohnung fragen Sie, mein Herr? Ja, daran erinnere ich mich. Sie lag dort, wo die Petersilienstraße auf den Alten Markt mündet. Ich lebte im zweiten Obergeschoss eines schmucklosen Fachwerkbaus, der hier seit mehr als hundert Jahren seinen Platz hatte.
Es war ein großes und geräumiges Haus, was beim Blick auf die Fassade verborgen blieb, jedoch, wenn man die Seite abschritt, an der sich die dunkle Eingangstür in einer düsteren Gasse zum Nachbarhaus versteckte, dann wurde man seines ganzen Umfangs gewahr.
Die Front war nur sieben Meter breit, nach hinten dagegen zog sich das Haus dreimal so weit hinaus. Im vorderen Parterre hatte eine Schneiderin ihr Atelier eingerichtet. In zwei großen Schaufenstern stellte sie weiße Puppen aus, denen sie ihre neuesten Kleider anzuziehen pflegte.
Über der Tür zum Geschäft war ein kleines Schild mit einer schmiedeeisernen Halterung an die Wand befestigt. Rechts von der Tür stach ein schneeweißes Feld im Fachwerk ins Auge. Es hob sich gegen die anderen Felder ab, weil es frisch getüncht war.
Irgendwelche Jungs hatten mit roter Farbe darauf geschmiert: Hier wohnt Judenpack. Der Eigentümer des Hauses, ein alter rüstiger Mann, der mit seiner Frau im Ketelhörn wohnte und es gut mit mir meinte, seit ich niemanden mehr hatte, wollte diese `Schweinerei´ nicht dulden und forderte von mir, dass ich sie beseitigen sollte, anderenfalls müsste ich mir eine andere Bleibe suchen.
Ich weiß, dass er nicht böse auf mich war. Seine Abneigung richtete sich gegen die Schmierfinken. Er war nicht auf ihrer Seite, doch glaubte er wohl, genügend für mich getan zu haben, um nun mein Teil einzufordern, zumal die Kritzelei sich aufgrund meiner Anwesenheit in diesem Haus auf seiner Wand befand. Sein Besitz war ihm heilig. Beschädigungen und Verschmutzungen daran duldete er nicht. Das sagte er bei jeder Gelegenheit, wenn ihm etwas Störendes auffiel: Das dulde ich nicht!
Mein Vermieter hatte einen Eimer Wandfarbe und einen Quast bei sich, als er an meine Tür geklopft hatte, Freitagabends gegen sieben. Ich war noch nicht lang zurück von meiner Arbeit in der Blaudruckerei. Der Tee war aufgebrüht und eine warm gemachte Graupensuppe stand bereit, als er mit einer Schirmmütze auf dem Kopf vor mir im Türrahmen erschien. Er musterte mich aus zusammen gekniffenen Augen, damit ihm der Qualm seines stinkenden Stumpens im Mundwinkel nicht in die Augen drang. Den Quast in der einen, den Eimer in der anderen, hatte er keine Hand frei.
Sein Blick war nicht unfreundlich, eher interessiert und neugierig, und wer weiß, vielleicht war es auch Sorge um mich, die ihn zu mir getrieben hatte, jedenfalls sah er seltsam bekümmert zu mir auf, was er musste: Auf sehen, weil er kleiner war als ich.
Ich war unvorbereitet und schwieg, weil mir die Worte fehlten, hatte eine Hand am Türblatt, ängstlich abwartend, was geschehen würde.
„Guten Tag, Miriam“, brach er endlich das quälende Schweigen, „willst du mich nicht herein lassen?“ Dabei sah er sich geheimnistuerisch nach links und rechts auf dem Flur um und drängte mich behutsam in die Wohnung zurück, indem er einfach auf mich zuschritt, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als zurück zu treten.
Nachdem er sich wie ein Kiebitz im Raum umgesehen hatte, sagte er, dass ich die Schmiererei beseitigen müsse und dass ich keine Wahl hätte, weil ich mir sonst einen anderen Platz zum schlafen suchen müsste; das hätte seine Frau gesagt, er würde aber genauso darüber denken und dass es eine schlimme Zeit sei, hat er gesagt, und als ich ihn nur traurig anstarrte, konnte ich nicht weinen, weil mir die Kehle zugeschnürt und auch das Sprechen nicht möglich war. Obwohl ich gern geweint hätte.
Er stand vor mir, wie ein Chamäleon, völlig reglos, die Augen, das einzig Wachsame, auf mich gerichtet: Nur, dass ein Chamäleon keine Stumpen zwischen den Lippen hat. Nach einer Weile des Schweigens bückte er sich, um den Farbeimer vor mir abzustellen. Den Quast legte er darauf. Ohne noch einmal auf zu sehen, wandte er sich in Richtung Tür. Die Klinke hielt er bereits in der Hand, der Kopf war gesenkt, als er nuschelte: „Mach mal, wie ich gesagt habe, Mädchen. Wird schon wieder gut.“ Er schüttelte den Kopf und ich fragte mich, was das zu bedeuten hatte. Glaubte er seinen Worten nicht? Würde doch nicht alles gut? Mit geschlossenen Augen wartete ich ab. Als ich sie öffnete, war mein Vermieter grußlos verschwunden.
Heute glaube ich, dass er sich für die Jungs geschämt hat und für die vielen Menschen, die ihnen in jener Zeit Vorbild waren. Er war keiner von ihnen, und ich hätte ihm gern gesagt, dass ich das wusste, später, als alles wieder gut wurde. Aber ich habe ihn niemals wieder gesehen.
1. Teil
Als ich Zeugin der Deportation wurde
Es war der Sonntag darauf. Ich hatte mich mühsam aus meinem Bett erhoben, das hinter der Tür stand, die zum Hausflur hinausführte. Ich hatte den Sabbat missachtet, und meine Arme waren vom Streichen noch schwer.
Nachdem ich in die Pantoletten geschlüpft war, hatte ich mich gähnend ans Fenster gestellt und den Blumen bestickten weinroten Vorhang beiseite gezogen, damit das Tageslicht die schummrige Dunkelheit vertreiben konnte. Ein junger Kaktus, den ich sehr liebte, kam dahinter zum Vorschein.
Ich musste die Augen zusammen kneifen, als ich durch das Sprossenfenster gegen die beißende Sonne, die darüber stand, auf das Schloss schaute, knappe hundert Meter entfernt; und hatte eine Vision: Dort stand in Übergröße irgendwo hinter dem Schloss das Fräulein Maria, und über ihr strahlte eine Corona. Es war aber doch wohl die Sonne, die mich blendete, und ich spürte Erleichterung, als meine Augen auf der schattigen Fassade des Konzerthauses haften blieben, das sich auf der gegenüberliegenden Seite des Alten Markt präsentierte. Es wirkte recht verschlafen. Auch die schmucke Schlossapotheke am Eingang in die Neue Straße sendete zu dieser frühen Morgenstunde kein Lebenszeichen. Mir war flau im Magen, und ich wagte einen weiteren Blick hinüber zum Schloss jenseits des Alten Markt, weil ich dort im Licht das Leben spürte, den anbrechenden Tag, die spirituelle Anwesenheit des Fräulein Maria, die hier im sechzehnten Jahrhundert residiert hatte, die letzte Häuptlingstochter, der die Bürger von Jever viel zu verdanken haben.
Meine Wohnung war winzig, besaß nur eine Stube, die mir gleichzeitig meine Schlafstatt bot und eine kleine Küche, in die ich durch eine weiß gestrichene, inzwischen vergilbte Tür aus billigem Limba, gelangte. Dahinter hatte ich noch ein kleines Bad.
Ich hatte mich wieder dem Raum zugewandt, rieb meine schmerzenden Augen und betrachtete mein aufgeräumtes Zimmer. Da stand das massive Nachtschränkchen mit der aufgelegten Marmorplatte neben dem Bett. Rechts von der Tür der Kleiderschrank, mein wertvollstes Stück, in dessen Türen aufwendig Intarsien eingelassen waren. Hinter diesen Türen verbargen sich meine wenigen Kleider. Rechten Blicks hatte ich meine Sitzgarnitur. Vier gemütliche Sessel waren um ein rundes Tischchen gestellt. Auf den Tisch hatte ich ein beigefarbenes Deckchen aufgelegt. Gegenüber an der linken Wand stand eine Anrichte aus dunkel gebeiztem Tannenholz. Sie hatte schwere eiserne Beschläge, und auf ihr prunkte ein verschnörkelter Aufsatz mit zwei Glastüren. In der Anrichte bewahrte ich neben dem Porzellan und den Gläsern auch verschiedene andere Dinge auf, wie etwa einen kleinen Karton mit Erinnerungsfotos, mein Nähzeug, eine Flasche Kirschlikör, meine wenigen Bücher, Steinchen und getrocknete Blumen, dich ich während zurückliegender Wanderungen durch die Masch gesammelt hatte.
Wenn Sie sich nun fragen, warum ich meine langweilige Wohnung beschreibe, ... ach, das tun Sie nicht? ... Nun, ich will erwähnen, dass ich heute froh bin, dass ich sie noch einmal so ausgiebig betrachtet hatte. Noch wusste ich nicht, dass dies die letzte Gelegenheit war.
Ich war wieder an das Fenster getreten, da mit dem Achtuhrgeläut der nahen Kirche die Geräusche rascher, harter Schritte und barscher Befehlsstimmen an mein Ohr drangen, die nichts Gutes verhießen. Es waren Soldaten, die da schrieen. Vor Schreck riss ich die Hand vor den Mund, als ich beobachtete, wie ein gutes Dutzend Mitglieder unserer jüdischen Gemeinde niedergeschlagen über das Kopfsteinpflaster des Marktplatzes stolperten, flankiert von den bewaffneten Soldaten.
Als der Anführer, ein Unteroffizier, in meine Richtung schaute, wich ich panisch zurück. Mein Atem ging schwer, zudem begann ich am ganzen Leib zu zittern. Die Uniformierten zogen mit ihrer Beute in Richtung Bahnhof, von wo sie - was ich vermutete - zunächst nach Wilhelmshaven gebracht würden. Das Stampfen der schweren Stiefel wurde allmählich leiser, in meinem Kopf aber dröhnte es, wie ein Schmiedehammer, der die klaren Gedanken aus mir heraus trieb. Durch Nase, Mund und Ohren entflohen sie meinem Hirn und vereinten sich im Raum zu einer bitteren Erkenntnis, die mir Tränen in die Augen trieb: Der Moment des Abschieds war gekommen. Nur das konnte ich denken, doch weder was ich machen, noch wie ich es anpacken konnte, und auch nicht, wohin ich mich wenden sollte. Traurig und zerbrochen glitt ich an der Wand hinab und blieb dort mit angezogenen Knien sitzen, die Hände vor das Gesicht gepresst.
Erst später habe ich erfahren, dass die deutsche Luftwaffe mit schwerem Bombardement auf die Stadt Rotterdam die Niederlande zur Kapitulation gezwungen hatte, die an diesem Tag, dem fünfzehnten Mai Neunzehnhundertvierzig in den Vormittagsstunden unterschrieben worden war.
Nur wenige Tage zuvor waren Soldaten der Reichswehrmacht in ihr Land einmarschiert, gefolgt von Panzern. Unaufhaltsam und siegessicher hatten sie ihren Feldzug begonnen und ihre feindliche Gesinnung, die von Arroganz geprägt war, mit hässlichem Gelächter und Brutalität zum Ausdruck gebracht. Arbeitsfähige Menschen, die sich nicht schnell genug in ihre Häuser zurückziehen konnten, waren zusammen getrieben und mit der Reichsbahn nach Deutschland verschleppt worden. Wie klein und unwesentlich war doch mein eigenes Schicksal, gemessen an diesem bedeutenden Ereignis, dass heute in den Geschichtsbüchern nachzulesen ist.
Was sagen Sie, mein Herr? Sie sind anderer Meinung? Sie denken, dass jedes Puzzleteil im Gesamtbild, so klein es auch sei, ein Existenzrecht hat? Das Auge duldet keine Lücke, sagen Sie, aha, und das Zeitgeschehen ist ein großes Puzzle, das keine Dimensionen kennt. Ein Bild, dass sich aus einer unendlichen Anzahl kleiner verzahnter Teilchen zusammensetzt, jedes ein Menschenschicksal. Jedes eine Geschichte, die Anspruch auf Gehör hat? Aha! So habe ich das noch niemals gesehen.
Meine Geschichte begann an jenem Tag, nur gute hundert Kilometer östlich des besiegten Landes, im kleinen friesischen Städtchen Jever, einem norddeutschen Idyll, gelegen auf einer Anhöhe inmitten der wangerländischen Masch, das im übrigen selbst lange Zeit unter Fremdherrschaft gestanden hat, und einmal auch unter holländischer.
Meine Flucht
Die weißen Wände meines Zimmers färbten sich im langsam verschwindenden Licht des Tages bereits grau, als meine vertränten Wangen getrocknet waren. Viele Stunden hatte ich starr an der Wand verharrt. Die natürliche Reaktion meines Körpers auf den Schock war eine völlige Leere meines Hirns gewesen. In diesem Vakuum war ich gefangen, aber es war mehr eine Schutzhaft, in der ich mich befunden hatte, die mich vor der Panik schützte, die mich heimsuchen wollte. Tränen waren mir unentwegt über das Gesicht gelaufen. Ich hatte sie nicht wahrgenommen, und als sie versiegten, muss das der Grund für mein Erwachen aus der Selbstvergessenheit gewesen sein.
Nun wischte ich mir über die Augen und sah mich um. Alles stand unberührt, wie am Vormittag. Plötzlich verspürte ich einen quälenden Durst. Ich erhob mich angestrengt, geriet dann ins Straucheln, weil meine Füße eingeschlafen waren. In trauriger Verwirrung massierte ich sie, bis das Blut in seinen Venen wieder in Fluss kam. Dann hastete ich in die Küche und trank gierig aus dem Wasserhahn. Das Seltsame war - dieser Gedanke kommt mir erst jetzt, wo ich daran zurück denke - dass ich kein Glas beschmutzen wollte, weil ich soeben entschieden hatte, zu gehen. Ha …, als wenn es auf dieses eine Glas angekommen wäre.
Ja, es war gewiss. Ich müsste meine Wohnung aufgeben - oder mein Leben - sie würden mich holen, bald schon, wie all die Anderen. Wo mochten sie sein, die Gloses, die Lehmanns, die Cohns, Rosenstamms, Josephs, die Levys und alle, die nicht geflüchtet waren, als es noch ging? Vielleicht ging es ihnen gut in den Arbeitslagern. Sicher ging es ihnen gut, so schlimm konnte es nicht sein. Das dachte ich mir. Sie hatten zu essen. Sie hatten vielleicht ungewohnte Arbeiten zu verrichten, aber sie hatten zu essen. Warum sträubte ich mich, wieder mit meiner Gemeinde vereint zu sein? Hier, in dieser Stadt, war ich nun bald allein. Es war die Furcht vor dem Unbekannten, die Ungewissheit, wohin sie mich bringen würden, was mich entsetzte. Alles würden sie mir nehmen. All meine Habe, meine Heimat, meine Freiheit.
Genau genommen war mir schon alles abhanden gekommen, ob ich nun selbst gehen würde, oder mich holen ließe. Ich konnte noch einen Blick auf Alles werfen, was mir so viel bedeutete, aber mein Eigen durfte ich das Ganze nur noch in der Erinnerung nennen. Merkwürdig, aber ich fühlte mich nicht ungerecht behandelt in jenem Augenblick, da ich vor der Anrichte hockte, um nach Fotos meiner Eltern und des Bruders zu kramen, die ich mit mir nehmen wollte; denn Bilder verschwimmen mit der Zeit im Gedächtnis. Es bewahrt Daten, aber die Bilder, die lösen sich auf.
Nein, es war nicht die Ungerechtigkeit, die mich plagte. War es denn ungerecht, dass ich alles hergeben musste? Das würde unzweifelhaft bedeuten, dass Gott ungerecht ist, weil er nicht zulässt, dass der Mensch etwas mitnimmt, wenn er stirbt. Vielmehr hatte sich tiefe Trauer in mir breit gemacht; darüber, dass dies Alles jetzt vorbei sein sollte. Ich war Verstorbener und Hinterbliebener in einer Person. Ich konnte mich selbst als Toten sehen und fragte mich, ob sich meine Seele bereits vom Körper losgelöst hatte, und als ich daraufhin erschrocken meine Hände betastete, mein Gesicht, meine Brüste und die Materie spürte, da glaubte ich, das Seele und Körper irrtümlich ihre Rollen vertauscht hätten.
Sie kucken so verwirrt, mein Herr. Das kann ich verstehen, aber ich fühlte so, weil doch die Seele die Zukunft ist, die immer und ewig erhalten bleibt, während doch der Körper vergänglich ist. Wie aber konnte der Körper, den ich befühlte, um die Seele trauern, die dort vor mir lag, wie konnte die Seele ausgelöscht sein? Warum war der Geist nicht aus meinem Körper gewichen? War denn die Vergangenheit die Überlebende, und ich, war ich tot?
Ich war dem Wahnsinn nahe und habe vermutlich so verwirrt geschaut, wie Sie jetzt. Die Befreiung aus diesen dunklen Gedanken war mir unmöglich, und als ich meinen Rucksack zuschnürte, wusste ich nicht, was ich hineingepackt hatte. Das tiefe Schwarz der Nacht warf seinen Blick zu den Fenstern hinein. Den Rucksack hatte ich auf den Rücken geschnallt. Endlich trank ich noch einmal aus dem Wasserhahn und wusch mir mit dem eiskalten Wasser durchs Gesicht, um klar zu werden. Ich musste wach sein, wenn ich mich durch die Straßen schleichen würde. Ein letzter verzweifelter Blick, dann knipste ich das Licht aus und schlich auf den Flur hinaus.
Von der Hausecke spähte ich auf den Marktplatz, der von wenigen Laternen schwach erleuchtet war. Das feuchte Kopfsteinpflaster glänzte in ihrem Schein. Der Himmel war sternenlos. Die Kulisse, die sich mir bot, hätte man mit behaglich und warm beschreiben können. Meine Angst aber ließ mich vor dieser Szene erschauern. Kein Mensch bewegte sich über den Platz. Die Einwohner versteckten sich hinter ihren Fenstern. Andere feierten den Sieg über die Holländer, je nach Geisteshaltung. Vor den Feiernden wollte ich am meisten auf der Hut sein.
Eine Weile hatte ich das stille Schauspiel beobachtet, und als sich weiterhin nichts rühren wollte, wagte ich mich hervor, schlich dicht an den Häusern entlang, immer Ausschau haltend nach einer dunklen Ecke, in die ich eintauchen könnte, sobald mir Gefahr drohte. Aufatmend erreichte ich die Schlossapotheke. Ich verbarg mich in dem zurückliegenden Eingang, um nach fünfzig Metern Weges zu verschnaufen und meinen weiteren Weg zurechtzulegen. Bisher hatte ich nur die Richtung im Kopf, in die ich mich schlagen wollte, denn es gab lediglich einen Ort, an dem ich mir Zuflucht erhoffen mochte. Der befand sich etwa vier bis fünf Kilometer südwestlich. Im Ortsteil Hohenwarf an der Schenumer Straße, die nach Cleverns raus geht, lag dreißig Meter zurück von der Straße ein Hof, der links, rechts und nach hinten raus von flachen Wiesen umgeben war, in denen sich vereinzelt Baumreihen durchzogen. Auf der anderen Straßenseite fanden sich in einer Reihe vier Wohnhäuser. Daran anschließend in der Richtung zum Ort hinaus ruhten meine Eltern und mein Bruder mit so vielen verstorbenen Mitgliedern der Gemeinde auf dem kleinen jüdischen Friedhof.
Der Hof, den ich meinte, wurde von dem Bauern Theo Repp und seiner Frau Frederike bewirtschaftet. Dabei half ihnen ihr Sohn Karsten und der Knecht Heiner Bartke, beide ein Jahrgang, beide schneidige Burschen; der Knecht hatte einen Gehfehler.
Wenn ich das Grab meiner Angehörigen an den Wochenenden besucht hatte, war ich immer an dem Hof vorbei gekommen. Das dortige Treiben hatte ich im Vorbeigehen so manches Mal beobachtet, und eines Tages stand der Bauer an der Straße, als ich mich vom Friedhof auf den Heimweg machen wollte. Wohl war ihm meine Verunsicherung aufgefallen und mein stockender Gang. Sogleich zog er den Kopf zwischen die Schultern und hob die Hände. Er wollte damit offenbar zum Ausdruck bringen, dass ich vor ihm nichts zu befürchten hatte. Das Gesicht erschien mir auffallend blass für einen Menschen, der einen Großteil seiner Zeit im Freien verbringt. Lang und gerade war seine Nase und darunter tanzte ein verschmitztes Lächeln, wobei die Oberlippe ein wenig hervorstand. Große, eng anliegende Ohren, das Kinn mit leichter Flucht. Inmitten der Blässe vermochten selbst die farblosen graublauen Augen zu erstrahlen. Sie hatten etwas Vertrauenswürdiges und waren ruhig auf mich gerichtet.
Ich war bis auf fünf Meter an ihn heran gekommen, da zog er anständig seine Schirmmütze vom Kopf und machte von vorn nach hinten eine schnelle Bewegung über den Schädel, womit sein ungescheiteltes, nach hinten gekämmtes dunkles Haar gerichtet war.
„Guten Tag, mein Fräulein“, hat er gesagt. Mir fehlten die Worte. Ich wusste ja nicht, wie ich den Bauern anreden sollte und schaute schüchtern auf meine armseligen, durchgelaufenen Schuhe.
„Ich beobachte Dich schon so viele Wochen“, setzte der Bauer neu an, „wie Du immer dort zum Friedhof gehst. Es kommt sonst keiner mehr her, weißt Du?“ Ich sah ihn fragend an.
„Sie bringen Euch alle weg, ... ja, das tun sie wohl. Aber Du kommst immer noch.“ Der Bauer sah nachdenklich in den Himmel: „Sind es Deine Eltern, die dort liegen?“, wollte er wissen. Ich nickte.
„Und mein Bruder“, wisperte ich.
„Auch Dein Bruder? Mädchen, das ist hart. Alle tot? ... Alle tot?“
Das war der Beginn unserer Bekanntschaft gewesen und lag ein Jahr zurück, als ich dort im dunklen Eingang der Schlossapotheke stand und meinen Weg überdachte. Vorsichtig trat ich aus der Finsternis heraus und schlich durch die Neue Straße, kaum wagte ich zu atmen. Meine Stirn war schweißnass, als hätte ich Fieber. Die Furcht vor Entdeckung trieb mich voran - aber wie paradox - vor mir lag ein schwarzes Loch, vor dem ich mich ebenso ängstigte. Wie, um auszubrechen, bog ich schnell in eine schmale Gasse ein, die zwischen zwei Häusern hindurch führte und im Kattrepel mündete. Ich fand mich vor einem schmucklosen Haus aus rotem Klinker. Der Eingang war ein grün gestrichenes, zweiflügliges Holztor. Zwei schießschartengroße Fenster bildeten bei Tag die einzige frontseitige Lichtquelle für den Innenraum: Die Blaudruckerei. Ich wollte sie noch einmal sehen, von alten Linden flankiert, deren Blätterwerk im tonlosen Nachtwind rauschte.
Hier hatte ich Arbeit gefunden, als ich völlig allein gelassen war. Der Eigentümer, Gerhard Markert, war kein Jude, jedoch hatte er sich nicht von der allgemeinen Hysterie anstecken lassen, die sich um mein Volk entwickelt hatte. Wohl eher die Erkenntnis meiner prekären Situation und Erbarmen, als dringlicher Bedarf einer Arbeitskraft, waren der Grund gewesen, mich in seinen Dienst aufzunehmen, denn eine Blaudruckerei brachte nicht mehr viel ein.
Das alte Handwerk, in Europa jedoch erst seit vierhundert Jahren in dieser Form verbreitet, war durch industrielle Methoden nahezu vollständig verdrängt worden. In Jever hatten immer drei Werkstätten gearbeitet. Gerhard Markert war der einzige gewesen, der das Werk seiner Vorfahren fortgeführt hatte. Er hatte sich gegen die Entwicklung der Industrie gestemmt und mit eben solcher Sturheit lehnte er sich gegen die zunehmende Meinungsannahme eines unwerten Lebens auf, für die wortfuchsige Propaganda verantwortlich war.
Er konnte mir nicht viel geben, nur das Geld für die Miete. Darüber hinaus versorgte er mich mit Brot, Tee und den notwendigen Lebensmitteln. Von seiner Frau erhielt ich aufgetragene Kleidung. Die Kunden des Gerhard Markert waren Bauern aus der Umgebung, die in ihren Schränken noch altes Leinen, Samt- oder Seidenstoffe verwahrten, zumeist alte, ererbte Schätze, die sie nicht den industriellen Betrieben anvertrauen mochten. Mein Dienstherr besprach mit den Kunden - in aller Regel waren das die Frauen - die Muster, die so genannten Modeln, die er anschließend aufdrucken sollte. Die Modeln waren aus Birnbaumholz geschnittene Druckstöcke, zusätzlich mit eingesetzten Metallstiften für die feineren Musterteile ausgestattet.
Mithilfe dieser Modeln druckte er den Druckpapp auf den Stoff, eine klebrige Masse, die das weiße Tuch vor dem Indigo zu schützen wusste, mit dem anschließend die übrigen Flächen durchtränkt wurden. Ich hatte immer gern zugesehen, wenn er in liebensvoller Manier und hochkonzentriert die Tücher Stück für Stück im Rapport bedruckte. Gemeinsam spannten wir den Stoff anschließend auf eiserne Kronreifen. Und dann folgte meine Aufgabe, die Gerhard Markert mir mit viel Geduld erklärt und viele Male vorgemacht hatte, bevor er sicher sein konnte, dass ich die nötige gewissenhafte Fertigkeit besaß.
Nun, als ich vor dem Gebäude, in völlige Dunkelheit getaucht, verharrte, erinnerte ich mich an die Aufregung, von der ich ergriffen wurde, als ich zum ersten Mal selbst ein Tuch färben sollte. Jetzt, da ich erstarrt auf das Eingangsportal blickte, schlüpfte ich in die Rolle des Tuches, das, ebenso, wie die Nacht, in tiefblaue Dunkelheit versenkt werden sollte, für Momente den Blicken der aufgerührten Welt entschwunden, dann wieder und wieder hinaus gehievt und erneut eingelassen in den Färbebottich, bis die Farbe tief genug eingedrungen war, und seine Reinheit und Unbekümmertheit für alle Zeiten ausgetrieben hatte.
Mein Dienstherr - im Übrigen ein vollbärtiger Mittvierziger mit rundem Gesicht, einem hohen Haaransatz und einer Nickelbrille auf der Nase - beobachtete mich zufrieden, wie ich später den aufgedruckten Papp mit Oleum Vitrioli abwusch und weiße Blumen auf dem blauen Grund erschienen. Nun war das Tuch der Welt gefällig, doch gefragt, ob es so sein wollte, hatte niemand.
Ich seufzte, als ich da stand, mit dem Rucksack auf dem Rücken, der so dicht anlag, dass mir der Schweiß die Wirbelsäule hinab lief. Meine Erinnerungen schienen so fern, obwohl ich doch gestern noch dort am Färbebottich gestanden hatte. Herr Markert hatte mir eine Brotration gegeben, zwei dicke Scheiben Wurst und etwas Schmalz, bevor er mich ins Wochenende entlassen hatte, am frühen Nachmittag, da hatte ich die Werkstatt bereits gereinigt, die Modeln sorgfältig in die Regale zurück gestellt. Die Druckerei hatten wir gemeinsam verlassen. Der Chef hatte sich noch einmal umgedreht, um die Tür zu verschließen, während ich auf ihn wartete, weil er mich immer bis zum Marktplatz begleitete, damit ich nicht angepöbelt wurde. Zu der Zeit warfen die Linden bereits breite Schatten und aus dem Laubwerk zwitscherten Meisen. Sie ging unser Krieg nichts an.
„Na, mein Mädchen, was wirst Du denn mit dem Wochenende anfangen“, erkundigte sich Herr Markert in seiner freundlichen Art, als wir in die Neue Straße einbogen, wo es noch geschäftig zuging. Ich biss mir auf die Lippen, weil ich nicht schlüssig war, ob ich ihm von der Schmiererei an der Hauswand erzählen sollte. Aus Scham verschwieg ich den Besuch des Vermieters: ich wollte nicht bemitleidet werden und hasste mich dafür, dass ich jüdisch war, obwohl es gar keinen Grund dafür gab. Doch ich hasste mich, da ich nicht einer der edlen, reinrassigen, arischen Deutschen war, unter denen ich groß wurde, die mich jetzt mieden, oder beschimpften; deren verurteilende Blicke ich in meinem Rücken spürte, wie Messerspitzen.
„Wirst Du wieder durch die Felder laufen und Blumen sammeln?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er lächelnd fort, beide Hände in die Hosentaschen gestemmt, seinen Blick durch die Brille auf mich gerichtet: „Das Wetter ist ja herrlich. Lädt zu einem Spaziergang ein.“ Dann stutzte er, und Falten kräuselten seine Stirn: „Pass auf Dich auf, hörst Du?“
Wir hatten den Marktplatz erreicht, den ich überqueren musste. Gerhard Markerts Weg führte geradeaus und dann in Richtung Ketelhörn. Unweit des Schlosses lag seine Wohnung. Wir blieben stehen, um uns zu verabschieden.
„Vielleicht solltest Du nicht allein raus gehen. Ich habe gar kein gutes Gefühl bei dem Gedanken.“
Ich nickte, obwohl ich mich, wie jeden Sonntag in aller Früh aus der Stadt schleichen wollte, hinaus in die Einsamkeit der Felder und des Waldes. Dort konnte ich so gut nachdenken. Das daraus nichts wurde, lag an der Schmiererei, die ich beseitigen musste. Da mich dies sehr ermüdet hatte, verschlief ich die frühe Stunde. Später habe ich überlegt, dass das aber meine Rettung war. Ich hätte nicht die armseligen Gestalten gesehen, von den Soldaten vor sich her getrieben.
Bewegungslos stand ich immer noch vor der Blaudruckerei. Vielen Dank, Herr Markert, flüsterte ich, vielen Dank für Alles. Wie zum Gruß winkte ich dem Haus zu, ehe ich weiter schlich. Ein Käuzchen heulte irgendwo im Giebelgebälk, als ich auf die Schlachtstraße gelangte. Geduckt wandte ich mich nach links und kam am ‚Haus der Getreuen’ vorbei, in dem der Reichskanzler Bismarck einmal für eine Viertelstunde eingekehrt war und nach Kiebitzeiern verlangte. Die Fenster waren verdunkelt, durch die angelehnte Tür suchte sich Qualm von Tabak seinen Weg ins Freie. Die gedämpften Stimmen aus der Schankstube erschreckten mich zutiefst. Von Panik ergriffen, lief ich, bis meine Lungen schmerzten; solange, bis ich in der Große Wasserpfortstraße schnaufend anhielt, mich vornüber beugte und die Hände auf die Knie stemmte. Allmählich beruhigte sich mein Puls. Ich lehnte mich ausgepumpt mit dem Rucksack an den einfarbig getünchten Bretterzaun, der das Gelände abschirmte, auf dem bis zur Pogromnacht im Jahr Achtunddreißig noch unsere ehrwürdige, mit viel Schweiß errichtete Synagoge gestanden hatte. Wie ich dort verweilte, musste ich wehmütig an die überlieferten Worte meiner Eltern denken, nach denen die Jeveraner Juden lange Zeit um ein Gebetshaus hatten kämpfen müssen, über Jahrhunderte, bis sie endlich um die Wende zum neunzehnten Jahrhundert ihr Ziel erreichen konnten. Jene erste Synagoge wurde später an derselben Stelle nochmals schmuckvoller mit einer maurischen Kuppel neu errichtet, als das alte Gebäude zu klein geworden war. Zu der Zeit hatten meine Vorfahren einigen Einfluss in der Stadt. Immer sind wir Juden für unsere Geschäftigkeit missgünstig beneidet worden, und so war es nur natürlich, dass die Hetze gegen unser Volk aufblühte. Dennoch hatte der Großherzog von Oldenburg einen ansehnlichen Zuschuss zum Neubau gegeben. Ich denke, er wollte ein Zeichen setzen.
Aber das sind Dinge, die Sie wohl nicht interessieren werden ... Doch, sagen Sie? Alles ist interessant? Das erstaunt mich, mein Herr. Nun gut, Sie müssen wissen: Meine Leute waren in Jever wohl behütet, was mir mein Großvater, Fritz Birnbaum, oft zu verstehen gegeben hat, als ich noch ein Kind war. Er hatte in den zwanziger Jahren bereits die schlimmsten Befürchtungen, ... wie auch anders, da doch seine Generation die Blütezeit der jüdischen Gemeinde in Jever erlebt hatte und die Veränderungen viel sensibler wahrnahm; einfach aus seiner Erfahrung heraus. Auch unser Kantor Hartog, der mir mit acht weiteren Kindern Religionsunterricht in einem an unser Gebetshaus angrenzenden Raum erteilte, war sehr feinsinnig gewesen: „Wir müssen Halt suchen in unserem Glauben mehr denn je“, pflegte er zu sagen, wobei er den Zeigefinger mahnend erhob.
Wie recht diese Männer gehabt hatten, doch was sollten wir tun? Hatten doch die Eltern geglaubt, es würde ein gutes Ende nehmen; und glauben sollten wir doch. Wer das nicht mochte oder konnte, der war geflohen. Wie sollten wir vorher wissen, was richtig oder falsch war? Tränen brannten in meinen Augen, und durch ihren wässrigen Schleier sah ich im Geiste noch einmal die lodernden Flammen in den Nachthimmel steigen, ich hörte das Knallen der überspannten Fensterscheiben, das Knistern des Lacks, der von den Fensterrahmen abplatzte. Holz- und Steinteile donnerten zu Boden, und als die schmucke maurische Kuppel in sich zusammensackte, da breitete sich eine heiße Staubwolke aus, die uns Haut und Haare ansengte. Die Parteien Gottes und des Teufels standen sich gegenüber: Die Einen weinten, wurden beschimpft und getreten. Die Anderen, Soldaten und angestachelte Zivilisten, nicht selten, nun besessen blickende, grölende, ehemalige Freunde, keiften, brüllten und trampelten auf gefallenen Juden herum.
Jetzt stand hier ein Bretterzaun, an den ich immer noch angelehnt verweilte, die gespreizten starren Finger auf sein Holz gelegt. Die Flammen waren lange erloschen und die kalte Asche mit den Trümmern der Ruine beseitigt. Der Zaun verdeckte einen lichten Platz inmitten meines Jever. Hier hatten wir uns versammelt. Hier waren wir fröhlich gewesen, andächtig und stolz. Nichts war davon übrig geblieben und Uns gab es auch nicht mehr, nur noch mich und eine Handvoll Juden. Ob auch sie sich inzwischen ...
Unerwartet drang ein herzzerreißendes Heulen an mein Ohr. Danach ein kurzes Fauchen, dann erneut das Heulen, das so jammervoll und traurig war. Es erinnerte an das Weinen eines kleinen Kindes. An einer Hausecke im Schein der Laterne standen sich zwei Katzen gegenüber, eine schwarzgrau getigerte und ein schwarzer Panther im Kleinformat. Reglos auf die erste Bewegung des jeweils Anderen lauernd, ohne Möglichkeit, umzukehren, zu flüchten, verharrten sie. Wer war hier in wessen Revier eingedrungen? Welche von Beiden würde sich verjagen lassen? Mit welcher der Beiden teilte ich das gleiche Leid, nämlich unerwünscht zu sein?
Schleunigst schlich ich am Bretterzaun entlang, bis ich nach links abbiegen konnte. Irgendwann kreuzte ich beim Hauptbahnhof einen Schienenübergang und beobachtete am Himmel eine Wolke, die sich vor den Halbmond schob. Der Tritt auf die Gleise bereitete mir Schmerzen. Ich vermeinte die Vibration des Zuges zu spüren, der über sie hinweg rollte, um meine Brüder und Schwestern fort zu schaffen. Ich glaubte, ihre Rufe zu hören: Lauf, Miriam, lauf, solange Du noch kannst.
Immer leiser wurde das Rufen, und als ich den Kopf nach rechts herumwarf, starrte ich in ihre augenlosen Gesichter, die aus den Fenstern guckten. Knochige Hände schauten aus den Jackenärmeln heraus und gestikulierten wild. Ich sah Münder, viele Münder. Ihre Lippen bewegten sich lautlos: Lauf, Miriam, lauf, solange Du noch kannst!
Und dann lief ich los, schluchzend, stolpernd, bis ich erneut außer Atem war. Ich ging in die Hocke, warf den Rucksack ab und stützte die Hände auf das Pflaster. Mir blieb aber keine Zeit zum verschnaufen. Kaum hatte ich drei Atemzüge getan, als das ferne Heulen eines Motorrads mich durchzuckte. Oh Graus, dachte ich, Miriam, Du musst in die Büsche, und ich tauchte in die Hecke eines Grundstücks ein, die dornig und abweisend ihre Stacheln durch die Kleidung in meine Haut trieb. Ich gab keinen Laut von mir, wenn auch Schreien mich nicht verraten hätte, so laut dröhnte das Motorrad, das bald an der Hecke entlang rauschte. Ein Polizist mit behelmtem Kopf saß vornüber gebeugt im Sattel. Lippenlos und geschlossen war sein Mund. Täuschte ich mich oder erzählte sein Gesicht von Entschlossenheit und Energie? Ich hatte ja nur einen kurzen Moment, um in dieses Antlitz zu sehen. Es waren die Züge eines jungen Menschen, vielleicht in meinem Alter. Er raste dahin. Dann hörte ich, wie er zurück schaltete und spähte vorsichtig durch die Hecke, um zu erkennen, dass er vor dem Bahnübergang wendete. Als ich den Rucksack vor der Hecke liegen sah, wich das Blut aus meinem Kopf. In meiner Panik hatte ich ihn völlig vergessen. Schnell griff ich danach und zog ihn an mich, als auch schon das Motorrad zurück geschossen kam. Mir war erschütternd gewiss, dass der Polizist mein Bündel bemerkt haben musste und erfahren wollte, was dort vor sich ging. Ich hoffte inständig, dass er nicht gleich die Flucht einer Jüdin mutmaßte, doch was mich aufs Äußerste ängstigte, war seine Reaktion, sollte er an der Stelle nichts finden, wo soeben noch etwas Verdächtiges gelegen hatte. Inwieweit mochte er zu der Annahme bereit sein, dass eine Einbildung ihm einen Streich gespielt hatte.
Verzweifelt blickte ich in die Runde. Drei Koniferen lehnten sich, wie riesige Wächter, an die Hauswand. Gerade wollte ich mich hinter ihnen verstecken, da fuhr der Polizist an dem Grundstück vorbei. Hatte sein Wendemanöver einen anderen Grund gehabt, wagte ich erleichtert zu hoffen. Hatte er nur etwas vergessen, dort, woher er gekommen war? Ich verspürte einen fast unbezwingbaren Drang, gellend aufzulachen, beherrschte mich aber: Wie sollte er auch den Rucksack gesehen haben, der selbst von dunkelgrüner Farbe, sich mit dem Grün der Hecke verschmolzen hatte?
Das dies doch möglich sein könnte, ernüchterte mich schlagartig, denn der Polizist drehte erneut und fuhr nun zielstrebig und langsam auf die Stelle zu, an der ich mich durch die Hecke gezwängt hatte. Ich wagte kaum, ihn durch die kleine Öffnung im Koniferengezweig anzusehen, als er dort auf seinem Motorrad saß, beide Füße fest auf den Boden gestemmt, beide Hände an der Lenkstange, den Kopf zur Hecke gewandt, die Augen ungläubig an ihrem Saum entlang fahrend. Mit einem Kopfschütteln schaltete er den Motor ab, bockte das Mot6orrad auf und stellte sich breitbeinig auf den Bürgersteig, wobei er die Fäuste in die Hüften presste: „Was is’n jetzt los“, hörte ich ihn zu sich selbst sagen, „das gibt’s doch gar nicht.“ Atemlos und starr beobachtete ich, wie er sich den Helm vom Kopf riss und ihn mit dem Riemen an die Lenkstange hängte. Eine Gesichtshälfte wurde von der Straßenlaterne beschienen. Ich sah blondes, links gescheiteltes Haar. Hohe Wangenknochen, schnurgerade Nase. Arisch durch und durch war dieser Polizist, ein junger Mann von guter Statur. Die gut aussehenden Blonden mit blauen Augen fürchtete ich am meisten. Sie waren so rein; erhaben über jedermann, und alles in ihrer Abstammung, aber unnachgiebig und bar jeder Toleranz in ihrem Wesen.
Das war mein Bild von den Blonden in jenen Tagen, mein Herr, der Sie ja auch blond sind: Ein Vorurteil mag das gewesen sein, geboren aus dem Idealbild Adolf Hitlers, das Jedem bekannt gewesen ist.
Nun ja, Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich mich bereits als verhaftet sah. Wenn er die Stelle entdecken würde, an der ich die Hecke auseinandergedrückt hatte, dann war es aus mit mir. Und in der Tat zog er eine Taschenlampe aus einer Seitentasche, die an seinem Motorrad befestigt war, um damit alles abzuleuchten: Den Bürgersteig, über die Hecke hinweg den Vorgarten, die Hauswand. Und dann hing das Licht auf den Koniferen, endlos lang, wie mir schien. Ich fühlte mich ertappt und fiel mit dem Rücken gegen die Wand. Doch dann geschah etwas, was den Polizisten ablenkte. Augenblicklich war das quälende Licht erloschen, denn vom Hinterhof erschallte das dumpfe Bellen eines Hundes, was den Verdacht erregen musste, dass sich jemand herumtrieb, der dort nichts zu suchen hatte. Deutlich war das Scheppern des Zwingergitters zu hören, gegen das sich der Hund wohl stemmte. Abrupt wurde es wieder still. Der Polizist stand mit gezogener Pistole geduckt an derselben Stelle und bewegte sich dann in Richtung Hofeinfahrt. Ich hörte, wie er die Luft durch die Zähne zischte, als eine schwarze Katze vor ihm auftauchte. Ich erlangte beinahe den Eindruck, sie hätte ein schlechtes Gewissen, da miaute sie beschwichtigend und schlich vorsichtig an dem Uniformierten vorbei, die Hecke entlang, was ich durch das löchrige Laub beobachten konnte.
Der Polizist entspannte sich. Er richtete sich auf und steckte die Pistole weg. Dann schüttelte er den Kopf und lachte leise: „Na, Kätzchen, hast mich reingelegt, was? Du warst das. Hast hier eben an der Hecke gelegen, stimmt’s?“ Die Katze ging unbeirrt an ihm vorbei und verschwand dann auf der anderen Straßenseite. Eine Weile sah der Polizist ihr nach. Plötzlich schien er es eilig zu haben. Er verstaute die Taschenlampe, schwang sich auf den Sitz und stülpte den Helm über. Als er den Motor gestartet hatte, betrachtete er noch einmal kritisch die Stelle, an der mein Rucksack gelegen hatte. Zum Glück blieb er in dem Glauben, er sei auf eine Katze hereingefallen. Ich aber verlor den Aberglauben, dass schwarze Katzen, die dem Menschen nachts begegnen, den Tod bringen. Mich zumindest hatte sie dieses Mal gerettet.
Die Schenumer Straße wurde nur vom Mond beleuchtet. Der Gehsteig auf der linken Seite führte bis zum Friedhof; rechts endete er am Hof des Theo Repp.
Als ich die Einfahrt erreichte, wurde ich unsicher. Was sollte ich sagen, was konnte ich erwarten? Ich würde die Repps in eine bedrohliche Situation bringen, falls sie mich überhaupt aufnehmen und verstecken würden. Darüber hatte ich bisher nicht nachgedacht. Erst jetzt fiel mir die Unmöglichkeit auf, die mein Anliegen darstellte. Von Zweifeln getrieben, überquerte ich die Straße und betrat schon bald durch die eiserne Pforte, die beim Öffnen verräterisch quietschte, unseren jüdischen Friedhof. Mit eingezogenem Kopf spähte ich in alle Richtungen. Nicht Verdächtiges war zu entdecken und so tastete ich mich über den Kiesweg durch die Dunkelheit an das Grab meiner Familie. Es war mit Kantensteinen eingefasst. An seiner Rückseite ragte ein schlichter Stein in die Höhe: Eine Betonplatte, in die die Namen meiner Eltern und des Bruders eingemeißelt waren. Die hatte Abraham Cohn hinein geschlagen, der Steinmetz war. Auch längst abtransportiert, stammelte ich vor mich hin. In der Schwärze war das Erkennen der Schriftzeichen unmöglich.
Aus einem tiefen Bedürfnis heraus trat ich an den Stein heran, spürte, wie unsichtbare Mächte mich zwanghaft in die Hocke zogen. Geister griffen nach mir, als hätten sie mein Kommen erwartet. Mit den Fingern strich ich über die Reliefs der Namen: Margarethe Birnbaum. Abraham Birnbaum. Felix Birnbaum. Ich tastete über das erste Todesdatum, das nun schon so lange aus dem Stein herausstarrte. Fast fünf Jahre waren vergangen, seit meine Mutter eine Lungenentzündung dahingerafft hatte.
Ein leichter Wind streichelte meine Wangen, als ich über das nächste Datum fuhr, dann über das dritte, das sich genauso anfühlte, wie das zweite, weil es derselbe Tag war, der dort eingelassen war.
Es war bereits nach Mitternacht gewesen, also der Zehnte November des Jahres Achtunddreißig, als ich beide, meinen Vater und den Bruder, in einem unbändigen, brüllenden Treiben verloren hatte. Ich habe immer Trost in dem Gedanken gesucht, dass Mutter immerhin nicht länger allein in ihrem kalten Grab liegen musste.
Während ich nun vor dem Grabstein hockte, überkam mich tiefe Melancholie. Dabei keimte in mir der sehnsüchtige Wunsch, mich neben sie zu legen, damit wir wieder eine Familie wären. Und das tat ich schließlich auch. Ich ließ mich auf den Stiefmütterchen nieder, die ich neu würde pflanzen müssen, irgendwann. Das Ohr drückte ich an den Boden und wartete so lange, bis die Stimmen der Toten, wie Flammen, in mein Ohr züngelten. Sie wollten mir Mut machen, flüsterten, das Leben sei zum wegwerfen zu kostbar. Sie signalisierten mir, dass ich ihr letzter Kontakt zum irdischen Leben sei, und sie forderten mich mit kühler Strenge auf, keinen Versuch auszulassen, ihre Verbindung des Himmelreichs zur Erde sicherzustellen, was mich irritierte, da ich in meiner Welt nichts mehr erkennen konnte, was festzuhalten sich lohnte. Doch ihr Wunsch brannte sich in mein Hirn. Das führte dazu, dass ich mich zunächst über die Ungerechtigkeit empörte, die mir, zwischen zwei Welten schwebend, widerfuhr. Dann begann ich meine Lage zu überdenken - da hatte ich mich auf gerichtet. Ich saß nun, die Knie an die Brust gezogen, den Rücken an den Grabstein gelehnt.
Die Stimmen waren verstummt. Ich verspürte nicht nur die Pflicht, sondern auch mein Verlangen, dem Begehren meiner Familie Folge zu leisten, wenn ich auch erst Jahre später erkannte, als ich dieser Stunden am Grab gedachte, dass die Stimmen meiner Eltern aus dem Totenreich lediglich den Fortbestand unseres Geschlechts und auch des jüdischen Volkes erflehten, dass seit der Zerstörung des zweiten Tempels durch die Römer im Jahr Siebzig nach Christus in der Galut lebte ...
Was Galut bedeutet, fragen Sie? Nun, mein Herr, Galut bedeutet nichts anderes als Vertreibung. Ist ihre Frage damit beantwortet? Ach, wann das war, dass ich nochmals an diese Stunden am Grab dachte, wollen Sie wissen? Ich bin mir sicher, dass es genau am vierzehnten Mai Neunzehnhundertachtundvierzig gewesen ist, als ich alles begriff. Der Tag, als der jüdische Nationalrat den Staat Israel ausrief. Merkwürdig: Es waren beinahe auf den Tag genau acht Jahre seit meinem Erlebnis vergangen. Da hatten wir Juden endlich eine Heimat, die Galut hinter uns gelassen. Es zeigte sich, dass wir nicht von diesem Planeten getilgt waren. Die damaligen Stimmen hatten mich bewogen, mein Teil dazu beizutragen.
Die Dämmerung setzte ein und Vögel zwitscherten in den Erlen, als ich mich erhob und meine Kleidung abstaubte. So gut als möglich, richtete ich die platt gelegten Pflanzen. Wolkenbänder rasten über das Firmament, am Boden aber rührte sich nichts. Mein Herz pochte, als ich kühle, feuchte Luft in meine Lungen sog. Ich blinzelte gegen den allmählich aufhellenden Horizont, erahnte dahinter den Sonnenstern, der einen neuen Tag entstehen ließ, in unbefleckter Erwartung, dass die Welt ihm einen Stempel aufdrückte. Vorsichtig wagte ich mich auf die Straße und hastete geradewegs zum Hof der Repps. Unsicher huschte ich die Einfahrt hinunter, bis ich zwischen zwei Eichen Schutz fand, die in einer Flucht mit der Hauswand standen, an der Seite, an der sich der Eingang befand. So war ich behütet vor Blicken von der Straße, als auch aus dem Haus. Die alten Stämme waren so mächtig, dass ich mich ganz dahinter verbergen konnte.
Inständig hoffte ich, der Bauer möge der erste sein, der das Gebäude verließ, um sein Tagwerk zu beginnen. Was sollte ich tun, falls Karsten oder Heiner Bartke vor ihm herausträten. Diese Frage schoss mir durch den Kopf, denn ich kannte die Beiden auch nach einem Jahr Bekanntschaft nur flüchtig. Heiner hatte mir einige Male auf Weisung des Bauern mir einem undurchschaubaren breiten Grinsen, das immer dasselbe war, einige Eier aus dem Hühnerstall übergeben, wobei kaum Worte fielen. Seine Verabschiedung jedoch war immer gleich ausgefallen: „Bitte schön, kleines Judenmädchen.“
Karsten hatte stets freundlich gegrüßt, wenn er meiner ansichtig wurde, kam mir aber niemals näher, als zehn Meter. Immer schien er sehr beschäftigt, wenn er zwischen den Nebengebäuden rochierte oder auf dem Traktor saß und aufs Feld hinausfuhr. So flüchtig war unsere Bekanntschaft, dass ich mich nicht einmal an seine Stimme erinnern konnte.
Der Bauer trifft eine riskante Entscheidung
Nachdem ich eine Weile gelauert hatte, waren mir die Augen schwer geworden. Plötzlich war ich hellwach, als ich eine Tür ins Schloss fallen hörte. Niemand war zu erblicken. Durch den Hauseingang war kein Mensch heraus getreten. Gerade wollte ich flüchten, da kam der Bauer, leise vor sich hin summend, hinter der zurückliegenden Hausecke hervor und blieb abrupt stehen. Theo Repp riss seinen Kopf in Richtung Straße herum, und ich meinen hinter den Baumstamm zurück. Als ich vorsichtig wieder zu ihm rüber lugte, stand er breitbeinig, mit angewinkelten Armen nach oben gestreckt dort und reckte sich ausgiebig. Erleichtert strebte er dem Kuhstall entgegen. Dabei rotzte er einmal kräftig zur Seite.





























