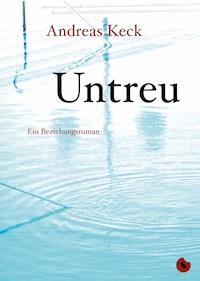8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franz Kappa ist Mitte zwanzig, ungestühm und unersättlich. Der Bohemien studiert an der Münchner Kunstakademie Fotografie und läßt mit seiner schönen Freundin Iana keine Party aus. Bald wird das Duo durch das russische Model Olga ergänzt, das beiden zusehends den Kopf verdreht. Im Gegensatz zu seinem Nachtleben ist Franz Kappas künstlerische Existenz nicht gerade vom Erfolg gekrönt. Seit Jahren versucht er durch auffällige, provokative und irrwitzige Kunstaktionen Aufmerksamkeit zu erlangen. Franz ist durchdrungen von der Idee, berühmt zu werden. Nachdem eine weitere, aufwändige Kunstaktion scheitert und ein erfolgreicher Abschluss seines Studiums immer unwahrscheinlicher wird, trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Diese verhilft ihm zu RUHM und Ansehen. Franz Kappa befindet sich auf dem Zenit seines Erfolges. Die Menage à trois zwischen ihm, seiner Freundin Iana und Olga nimmt groteske Formen an. Es ist abzusehen, dass diese Konstellation, kombiniert mit dem glamourösen, exzessiven Leben nicht von Dauer sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
„...because my duty was always to beauty and that was my crime.”
Condemnation, Depeche Mode
„O Zarathustra, du Stein der Weisheit, du Schleuderstein, du Stern-Zertrümmerer! Dich selber warfst du so hoch – aber jeder geworfene Stein – muss fallen!”
Also sprach Zarathustra, Friedrich Nietzsche
Andreas Keck: RUHM! Ein Künstlerroman
© Periplaneta - Verlag und Mediengruppe
Edition Periplaneta, Dezember2011
Inh. Marion Alexa Müller, Postfach: 580 664, 10415 Berlin
www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, mechanische, elektronische oder fotografische Vervielfältigung, eine kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Ungekürzte, digitale Ausgabe der Printausgabe (ISBN 978-3-940767-10-3).
E-Book-Version: 1.3
Lektorat: Jasmin Bär, Thomas Manegold, Ursula Müller Covergestaltung: Thomas Manegold
Foto: Agnes Keck Graphiken, Bilder, Collagenelemente: Franz Kappa Collagen und Scans: Jasmin Bär und Marion A. Müller Satz, Konvertierung: Thomas Manegold, Johannes Schönfeld
Andreas Keck
RUHM!
Ein Künstlerroman
periplaneta
I
Sitzt man vor einem leeren Blatt Papier, mit einem Stift in der Hand, und wartet darauf, anfangen zu können, und nichts hindert einen daran, die Mine über das Blatt zu führen und ein schönes Jungengesicht anzudeuten, oder eine italienische Landschaft, oder das, was keinen Namen hat und keine Gestalt... Hat man alle Zeit der Welt und kann trotzdem nicht beginnen, dann kann das das Schlimmste sein, was es gibt.
So saß demnach auch Franz Kappa vor einem leeren Blatt Papier und starrte darauf. Genauer: Er stierte durch das Blatt hindurch und hielt einen dunkelroten, plumpen Edding in der rechten Hand. Und er begann bereits den süßlich scharfen Geruch der roten Chemikalie, die süchtig machte, wahrzunehmen und hatte aufgehört, den blechernen Klang aus den leistungsschwachen Lautsprechern seines antiquarischen Nordmende-Fernsehers zu vernehmen, den er vor Stunden eingeschaltet hatte und in dem gerade ein frenetisches Publikum einem bubenhaften Sänger zujubelte, der eben seinen ersten Fernsehauftritt vor einem größeren Publikum absolviert hatte. Leicht war es nicht auszumachen, ob es Abscheu war oder Anbetung, was im großen orchestralen Schall dieses Schreiens lag. Es war schlichtweg Lärm, wie beim Aufreißen einer Straße. Und als das tonale Poltern nachließ, war klar: Es war das reine Entzücken. Dieses Publikum wollte, dass dieser junge Mann, der gegen zehn weitere Singende antrat, die Lorbeeren erntete. Das Publikum wollte genau ihn und keinen anderen. Es selbst wurde in diesem Augenblick zum Schöpfer. Dem Schöpfer eines Künstlers. Etwas, das normalerweise dem Künstler vorbehalten war – erschaffen. Aber der Künstler erschuf die Werke, und das Publikum erschuf den Künstler. Normalerweise. Und in jenem überbordenden Beifall war exakt dieses Element zum Schwingen gebracht. Jener zittrige und wahnsinnige und höchst zerbrechliche Moment des Erschaffens.
Das Publikum entschied. Und ohne, dass Franz Kappa sich dessen bewusst war, war klar, dass er nichts mehr bewunderte und gleichzeitig fürchtete als diese Autorität. Dies war die Herrschaft des Zuschauers, konnte aber auch die Macht des Zuhörers sein, oder des Lesers. Eines einfachen Mannes oder einer einfachen Frau, die letztlich aber doch über alles bestimmten. Darüber, ob ein Lied weiter im Radio lief, ob über einen Film in zwei Jahren auch noch gesprochen würde, oder ob das Portrait eines Irrenarztes, das sein schizophrener Patient vor über hundert Jahren gemalt hatte, bei Sotheby´s achtzig oder nur dreißig Millionen einbrachte.
Und in diesem Moment schreckte Franz Kappa aus seiner konzentrativen Lähmung auf und sah zum Schwarz-Weiß-Bildschirm hin. Ein verstörter junger Mann verließ tapprigen Schrittes die provisorische Bühne und stellte sich vor den gierigen Augen einer vierköpfigen Jury auf, schaute bescheuert, angstvoll, und wartete auf das Hoch- oder Niedergehen der cäsarischen Daumen.
„Vielleicht solltest du noch ein bisschen an deinem Äußeren arbeiten!“, kritisierte das erste Jurymitglied, und sogleich warf die Masse ein Gebrüll wie einen Speer gegen den Juroren, der seine Mundwinkel reumütig nach unten zog und nachsetzte: „Aber dein Gesang war echt klasse, und deine Performance... Ich würde sagen...“ – er hielt inne – das Publikum mobilisierte sich für den atomaren Gegenschlag, da es den Kandidaten bereits liebte... „Deine Performance, sie war wirklich zum Niederknien! Ich hatte das Gefühl, Michael Jackson sei aus dem Kinderzimmer auf die Bühne zurückgekehrt!“ Der Juror lehnte sich süffisant, genüsslich in seinen Sessel zurück und klatschte in langsamen, kontemplativen Intervallen in die Hände. Franz Kappa schluckte, und das Publikum schrie auf diesen Kommentar hin so ekstatisch auf, dass Franz Kappa Angst bekam und wegschaltete, auf Orangensaftwerbung. Ein selbstbewusstes, weizenblondes Kind nahm einen großen Schluck von gelb, setzte das Glas wieder ab und lächelte seine Mutter an. Franz Kappa schaltete den Fernseher aus, das Bild faltete sich, nach Sitte alter Fernsehgeräte, in der Mitte zu einem schmalen weißen Strich zusammen. Er legte seinen Zeichenstift aus der Hand und ging zum Fenster. Die Masse, dachte er, die Masse ist zurück. Sie tut noch ganz harmlos, aber sie beginnt, ihr Potential wiederzuentdecken und ihre Möglichkeiten zu erkunden.
Franz Kappa machte sich häufig diese Art von Gedanken. Schließlich war er Kunststudent und musste sehr sorgfältig beobachten, was sich abspielte, direkt vor seinen Augen: die Welt. Um auf sie reagieren, um zurückschlagen zu können, mit den Waffen der Welt. Er musste erst ihre Waffen kennenlernen, sie richtig bedienen lernen, um dann im richtigen Moment auf den Auslöser drücken zu können.
Seinen Mantel etwa zog er sich immer nach dem Vorbild des Jenenser Studenten an, einem Ölgemälde Ferdinand Hodlers, auf dem ein junger, hoch gewachsener Mann seinen dünnen Körper weit nach hinten reckt, um mit seiner Hand verkrampft nach der Öffnung des linken Mantelärmels zu suchen, während sein Blick gedankenverloren ins Leere geht.
Zwar hatte Franz Kappa für jenen jugendlichen Kandidaten der Talentshow nicht gerade Sympathien gehegt, jedoch die Tatsache, dass er nach Ablauf dieser Sendung nach den üblichen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit alle anderen Kandidaten geschlagen haben würde, stimmte ihn in der Tat neidisch. Franz Kappa war zum Fenster gegangen, starrte mit leeren Augen hinaus, ließ den Fensterhebel auf- und abklacken und war sich plötzlich im Klaren, dass er es wahrscheinlich niemals schaffen würde, ein Millionenpublikum zu bewegen, vielleicht nicht mal Tausend, oder Hundert. Aber genau das wollte er. Eigentlich wollte er nichts anderes.
„... planet earth is blue /
and there´s nothing I can do“, hallte David Bowies Stimme im Nebenzimmer aus dem Transistorradio, und Franz Kappa dachte sich in diesem Moment: Wie nur kann ich die Menschen erkennen lassen, dass eine Blume keine Blume ist, eine grüne Vase keine grüne Vase, Licht nicht Licht und der Mensch kein Mensch!
Franz Kappa bewohnte mit zwei anderen eine seel- und lichtlose WG, deren drei Fenster direkt auf eine der meistbefahrenen Kreuzungen Münchens herabsahen. Er wohnte erst seit einem halben Jahr dort. Hatte die Wohnungsanzeige zufällig auf dem Schwarzen Brett der Tiermedizinischen Fakultät entdeckt, sich beworben, sich dort vorgestellt und wurde auch gleich genommen. Fünfzig andere hatten sich für die Wohnung beworben. Sie war günstig und lag relativ zentral. Ausgewählt wurde er.
„There´s a starman waiting in the sky /
He´d like to come and meet us /
but he thinks he´d blow our minds“, sang Bowie verzweifelt.
In die Aula der Tiermedizinischen Fakultät ging er des Öfteren, um den großen, alten Leguan zu besuchen, der dort in der Ecke der Eingangshalle in einem Terrarium lebte. Und immer setzte er sich auf den kalten und unbequemen Metallstuhl und verlor sich selbst und seine Zeit vor dem Glaskasten, dessen Scheiben sehr dick waren und einen dezent bläulichen Ton hatten, der die Sicht auf das Innere noch klarer machte, so kam es ihm zumindest vor.
Franz Kappa sah gebannt und wach auf den langen, grünlichen, dicht geschuppten Körper des alten Leguans, um einige Zeit darauf ganz vergessen zu haben, wo er hinsah und nicht mehr zu wissen, warum er eigentlich hergekommen war. Aber immer, wenn er dann die kühle und nach Marmor schmeckende Aula der Tiermediziner verließ, fühlte er sich eindeutig besser. Es war der Leguan. Dessen war er sich ganz sicher. Die Regungslosigkeit und das Desinteresse des Tieres, dessen Art schon seit Jahrmillionen die Oberfläche dieses Planeten bevölkerte und einfach nicht auszurotten gewesen war durch Fressfeinde, Menschen oder ähnliches. Das einfach da saß und an nichts wirklich interessiert gewesen war, jemals.
Auf jeden Fall fand er dort den kümmerlichen und nicht gerade ansprechenden Zettel mit der Wohnungsanzeige an der Pinnwand. Und eine Woche später hatte er das Zimmer. Wusste aber nicht, weshalb das Los auf ihn gefallen war. Er war selbstbewusst, sah gut aus, das alles. Aber häufig wurde er als seltsam befunden, von Menschen, die ihn nicht kannten, die ihn zum ersten Mal sahen. Das Problem war, dass man ihn nicht genau zuordnen konnte. Das kann in der Tat zu einem Problem werden. Denn die meisten kann man genau zuordnen, sehr genau sogar. Hat man eine Weile gelebt, kennt man die wichtigsten Kategorien `Mensch´. Fängt mit der Zeit an, Sammlungen anzulegen, von der Sorte und der und der. Und bald kommt einem keiner mehr, der nicht irgendwo dazupasst.
Die zwei in seiner WG waren das – exakt zuordnungsbar. Eine Soziologin aus Nordrheinwestfalen und ein Musikstudent aus China. Aber hierzu später. Erst einmal zu ihm – Franz Kappa. Hoffentlich ist es nicht ein Fehler, ihn zum Protagonisten zu machen!?
Nun, was lässt sich über ihn sagen...
Franz Kappa.
Voller Verve war er. Wach. Er fühlte sich momentan großartig. Seine Kontaktaufnahme mit dem Unendlichen – sie gelang ihm nicht selten – war wie Spaltung von Plutonium. Die Menge an Energie, die hierbei freigesetzt werden konnte, war für jemand anderen unfassbar. Und er wollte nichts anderes, Franz Kappa, als den anderen von seiner Kontaktaufnahme zu berichten – in Zeichnungen, Sätzen, Skizzen, Fotografien. Wie gewaltig diese Kraft war, so einsam fühlte er sich mit ihr. Er studierte im siebten Semester an der Kunsthochschule in München, einer Stadt, die er meistens hasste, bis aufs Blut, und die er in wenigen Momenten auch wieder recht gern hatte. München. Eine Stadt, die gerade sehr gefragt war und in der laut einer Statistik des Sterns jeder einskommazweite Deutsche leben wollte. Darauf folgte Köln und ganz hinten in der Tabelle Berlin, was Franz Kappa ungeheuerlich fand. War da endlich eine Stadt, in Deutschland, die als Metropole bezeichnet werden konnte, rannten dennoch alle ins oberbayerische München, einem Dörferverbund, der vor Vanitas, deutsch: Eitelkeit, Nichtigkeit, Leere, nur so strotzte und einem wirklich nichts schenkte, außer das sichere Gefühl, nicht genügend Geld zu besitzen. München war niemand und München war jeder. Und keiner gehörte wirklich dazu. Kein Gefühl war da, in München, kein Hauch und kein Ruch, kein Beben. Bestand es doch hauptsächlich aus Stein und Stoff.
In dieser Hinsicht stand es bei Franz Kappa jedoch schlecht. Er hatte kein Geld, war aber immer so gekleidet, als hätte er sehr viel. Er wollte als eine Art moderner Dandy durchgehen, aussehen wie ein braver Schuljunge - bis oben geschlossene Hemden, eng anliegende Hosen, kurze, aufgeplusterte, klobige Jacken. Benehmen: höflich und charmant, in der Tiefe aber zerstörerisch und aufwieglerisch, natürlich im Sinne der Kunst.
Er glaubte, es sei ihm anzusehen, sein inneres Dagegensein, gegen alles. Meinte, durch seine zur Schau getragene Nervosität und Unruhe sein inneres Genie für den noch so tumbsten Betrachter zum Ausdruck bringen zu können. Also war er immer in Eile. Ging meist leicht vorwärts gebeugt, wie die Plastiken von Giacometti, deren hauchdünner Körper mit dem linken Fuß eine vollkommen gerade Linie bildete, während der rechte Fuß leicht gebeugt war und nach vorne schritt und den schrägen, dünnen Leib des Gehenden hielt. Sonst wäre der umgekippt. Franz war der Meinung, der Anschein von Eile verursache eine Art Bewunderung bei langsam gehenden Menschen. Und wenn man ihn darauf ansprach, weshalb er eigentlich immer derart hetze, zitierte er einen amerikanischen Jazzgeiger, der behauptet hatte, dass, seitdem er sich den kleinen Finger der linken Hand verletzt hatte, er immer nur kurz verweilen könne.
Eigentlich hätte Franz Kappa Kunst nicht studieren müssen. Er war bereits Künstler. Er war begabt, im Grunde ein bisschen zu viel begabt. Aber er war unbekannt. Und dies zu ändern war er angetreten. In München. Weit jedoch war er noch nicht gekommen. München und sonst auch keine andere Stadt der Welt interessierte sich für einen jungen Menschen, Mitte zwanzig, der berühmt werden wollte. Warum auch. Wer berühmt war, war es. Und wie man berühmt wurde, war nicht bekannt. Berühmtsein war einfach, war klar umrissen und definiert. Aber der Weg dorthin schien nicht mal zu existieren. In einem Monat war die Vorentscheidung des Professorenkomitees, wer bei der Münchner Galerienwoche teilnehmen durfte. Fünf Studenten aus jedem Semester. Und er hatte gute Chancen. Das hätte ein erster Schritt sein können. Wer in einer Galerie hing, war zumindest schon mal öffentlich. Und dann konnte weiß Gott was passieren. Es musste nur der Richtige vorbeispazieren.
Franz Kappa stand noch immer an seinem Zimmerfenster. An der Wand neben dem Fenster hingen verschiedene buntfarbige Edding-Zeichnungen und Blätter mit riesigen Buchstaben, deren Erkennungsform bis zur Unkenntlichkeit mit Bleistiftstrichen entstellt war. Oder Sätze, die über die ganze Wand gingen, Aufforderungssätze, Fragen, immer zwei Worte auf einem einzelnen großen Zettel wie etwa,
haben SIe
Eine lösUng
für DaS
LebeN
geFunden?
Auf dem langen, gläsernen Schreibtisch lagen Stapel von Zeitschriften, eine ganze Sammlung der Vogue, Bildbände großer Architekten, eine Schwarz-Weiß-Abbildung von Walter Gropius´ Wohnhäusern in Dessau war aufgeschlagen. Neben einem Bildband über Albrecht Dürer lagen mehrere Geldscheine, deren Nummern Franz Kappa notiert hatte und die er mit unterschiedlichen, bedenklichen Sätzen versah, die dann vielleicht irgendwann von irgendwelchen Leute gelesen werden könnten, wenn sie den Schein aus ihrer Geldbörse zogen und zufällig den Schriftzug darauf entdeckten – sie wären für eine winzige Sekunde verdutzt.
Indessen spielte Franz Kappa gedankenverloren mit dem Fensterhebel, öffnete das Fenster schließlich und beugte sich hinaus. Er dachte darüber nach, wie weit er sich hinausbeugen könnte, lehnte sein ganzes Gewicht auf den Fensterrahmen und hob ein Bein vom Boden. Dann das andere. Unten stob der Verkehr vorbei. Jetzt balancierte sein ganzer Körper auf der spitzkantigen Metallleiste des Fensterrahmens. Aus dieser Position heraus senkte Franz Kappa sein Gewicht langsam gen Abgrund. Bis er vor sich selbst Angst bekam und seinen Körperschwerpunkt wieder ins Zimmer verlagerte, mit den Füßen den Boden berührte und sich selbst verfluchte. Bescheuerter Vollidiot! Du gehst zu weit! Du gehst immer zu weit!
München lag in Deutschland, und mit Deutschland stand es schlecht, zurzeit. Die Jahrtausendwende war passé, schon seit längerem, und nichts war geschehen. Als sie kurz bevorstand, gab es jene, die sagten, der erste Januar Zweitausend sei nur eine willkürlich gesetzte Zahl, und andere, die meinten, das Ganze sei etwas wirklich Außerordentliches. Der erste Januar war vorbeigegangen, und nichts Außergewöhnliches hatte sich ereignet. Und dann folgte Zweitausendeins, und die Erde begann sich zu erwärmen. Es fing an, bergab zu gehen, mit allem. Ein Haufen Nostalgie-Shows im Fernsehen über die Sechziger, Siebziger oder Achtziger konnte die Neue Angst noch ein wenig kaschieren, bis dann noch die Antike im Kino wiederbelebt wurde, und jene längst vergessenen Schlachtszenarien der vulgärfarbenen Fünfziger-Jahre-Filme ein weiteres Mal auf die Leinwand geworfen wurden und mit einem Mal das Kinopublikum wieder in den Krieg geführt wurde. Womit auch die Zeit der Anti-Kriegsfilme endgültig beendet war, und das Thema Krieg zunächst optisch wieder da war. Kriege von Troja und Rom und Konstantinopel als ultima ratio politischer Ungereimtheiten. Hollywood wollte eigentlich damit sagen, dass Kriege tatsächlich wieder denkbar waren und nützlich und vielleicht auch notwendig. Die Politik hielt sich dann auch ans filmische Vorbild.
In den Neunzigern, bevor die großen Türme brannten, war eher die Leere das Problem gewesen, das große X. Ein X, das nicht ausgefüllt werden konnte. Nun aber begann etwas anderes. Das Auffüllen – das Stopfen dieser Leere. Die Mittelschicht begann zu schrumpfen, und die Portemonnaies wölbten sich nicht mehr, wie noch in den Achtzigern, aus den Hosentaschen der Jeans. Es geschah so rasant, dass einem die Leere bald gar kein Kopfzerbrechen mehr machen musste, da nun andere Probleme vorlagen, wirkliche. Die Sinnleere der Neunziger war überwunden. Das Durchkommen, so einfach und eindeutig wie nichts anderes, stand wieder auf der Tagesordnung.
Und in dieser Zeit lebte unser Protagonist, Franz Kappa. Und er wollte mitreden, als Künstler, jetzt, wo sich diese gesellschaftliche Umwandlung abzuzeichnen begann. Er wollte aufzeigen, wie sehr sich die äußere Welt beständig veränderte, während der Mensch an sich stets der relativ gleiche blieb. Er sah beide klar und deutlich vor sich, Mensch und Welt, und im Grunde wollte er sagen, vereinigt euch! Und passt auf, dass sie nicht größer wird als ihr. Passt ja auf!
Diejenigen, die von früher schwärmten, wusste er, machten sich etwas vor und brauchten Schuldige. Hätten am liebsten das Jetzt verklagt. Bei Franz Kappa dagegen war es andersrum. Schuld an seinem möglichen Versagen als Künstler konnte nur er haben. Er selbst war für alles verantwortlich. Schließlich war er die exakte Mitte der Welt.
Iana, die Freundin von Franz, hatte sich dergleichen Gedanken noch nie gemacht. Wie auch ihr Freund lebte sie im Heute. Lebte vom Heute, wie es Franz einmal nannte. Und als sie ihn fragte, was er mit `vom Heute´ meine, erklärte er ihr, dass sie eben nun mal schön sei, und dass ein Model schön zu sein hatte, und die heutige Zeitepoche ohne Models nicht funktionieren würde, ja, der Spätkapitalismus in ernste Schwierigkeiten geriete, wenn ihre Sorte nicht mehr existieren würde. Das Model sei die Quintessenz der Moderne, meinte er dann immer, ein optisch unschlagbares Argument für das Kapital. Sie erwiderte dann, dass er einen Scheiß daherrede und nur ein Problem habe damit, dass sie modelte. Sie hatte das Gefühl, Franz lehne ihren Beruf vehement ab, verachte ihn.
Sie hatte anderthalb Semester Amerikanistik studiert, bevor sie ein Modelscout in der Münchner U-Bahn ansprach, gerade nachdem eine Gruppe von Fahrkartenkontrolleuren ihre Daten aufgenommen hatte, weil sie ausnahmsweise mal schwarzgefahren war und dann peinlich berührt am Bahnsteig stand und zusah, wie die vier Kontrolleure wieder in der nächsten U-Bahn verschwanden, da war hinter ihr eine Stimme erklungen, „Verzeihung – dürfte ich Sie etwas fragen?“
Sie hatte anfangs versucht, neben dem Modeln, das sie im Handumdrehen beherrschte - ein Naturtalent - ihr Studium fortzuführen. Wollte aber nicht funktionieren. Und nun arbeitete sie schon seit zwei Jahren in diesem Gewerbe und erkannte das Leben, das sie damit führte, als adäquat an. Zürich. Nagoay. Skopje. Stockholm. Argel. Vancouver. Andorra La Vella. Meran. Rijeka. Rozvadov. Nagano-City. Maadi. Tel Aviv. Piräus. Ann Arbor. Alexandria. Kopenhagen. Jene Städte, deren Name auf die hellen, glänzenden Einkaufstüten der großen Modelabels gedruckt war. Städtenamen, deren Abfolge sie schon als junges Mädchen bewundert hatte, da sie dachte, es müsse einem fantastischen Gesetz folgen, dass die Namen der Städte genau in dieser Reihenfolge abgedruckt waren. Heute weiß sie, es war kein geisterhaftes Absehen, sondern Zufall. Und je öfter sie ihre Liebe zum Modeln betonte, desto häufiger redete Franz Kappa ihr ein, dass sie das Modeln nicht wirklich liebe und sie aus eben diesem Grunde so häufig betonen müsse, dass sie es wirklich gern habe.
Franz Kappa hatte Iana vor etwa drei Monaten bei einer Juristen-WG-Party kennengelernt. Sie war das schönste Mädchen, das ihm bis zu diesem Zeitpunkt begegnet war. Als er sie an jenem Abend auf der Party erspähte, wurde seine naturgemäße Verachtung für Juristen ins Unermessliche gesteigert. Gerade dieses Pack durfte die schönsten Kommilitoninnen in seinen Reihen wissen. Und als er sie nochmals ansah, wurde der Hass so schmerzlich, dass er sich entschied, entweder auf der Stelle zu verschwinden oder sie anzusprechen, obwohl er auch sie dafür hasste, dass sie so hübsch war und wahrscheinlich Juristin.
„Juristin?“
„Nein!“, kam ihm entschieden entgegen.
Und ein Lächeln.
„Das beruhigt“, erwiderte er.
„Wieso?!“, hakte sie nach.
„Weil ich Jura-Studenten nicht wirklich gerne hab.“
Und er sah sie an dabei und dachte, dass er sie nur einfach ewig anschauen wollte, und dass er das Gespräch am Laufen halten musste, und wäre der Gesprächsstoff noch so inhaltsleer. Nur um noch ein paar Augenblicke länger vor ihr stehen zu können und dieses verdammte Gesicht anblicken zu können. Er blieb auch noch mehrere Augenblicke vor ihr stehen und sogar noch Stunden und den ganzen Abend, bis sie schließlich gegen Mitternacht gemeinsam die Party verließen, um von da an jeden Tag die Möglichkeit zu haben, sie so lange, wie er es für nötig befand, anzusehen. Es gab nur Schönheit für Franz Kappa, sonst nichts.
Nach jenem Abend in der Jura-WG trafen sie sich täglich, unverbindlich, wie sie beide geflissentlich und sehr häufig betonten. Sie zeigten sich gegenseitig die besten Plätze der Stadt, wobei sie seine Auswahl bisweilen etwas gewöhnungsbedürftig fand. Sie zeigte ihm Klassiker, während er ihr Orte vorführte, die sonderbar und oft unheimlich waren. Als sie merkte, dass noch niemand ihr solche Orte gezeigt hatte, sondern immer nur die schönen, knickte irgendetwas in ihr ein.
Das Unverbindliche wurde verbindlich, und sie beschlossen, zueinander zu gehören. Ab und zu war sie ihm ein wenig zu oberflächlich. Aber das würde sich geben, mit der Zeit, je länger er mit ihr zusammen war. Irgendwann sollte er ihr Sicherheitssystem umgehen können. Und dann war in jedem Menschen unglaublich viel zu entdecken. Dieser unerschütterlichen Überzeugung war Franz. Und nach diesem Richtwert handelte er, behandelte er eigentlich jeden. Wenn Franz Kappa vor einem stand, hatte man das sichere Gefühl, ein fabelhaftes, einzigartiges Wesen der belanglos großen Masse Mensch zu sein. Und das glaubte auch er.
Franz Kappa, der in der Zwischenzeit den Fernseher wieder angeschaltet hatte, als Geräuschkulisse – er liebte eine beständige Nuance Nervosität - ging zu seinem Bücherregal und griff einen Rothko-Bildband heraus. Er schlug eine zufällige Seite auf und betrachtete die leuchtende Fotografie eines Rothko-Bildes. Zwei rechteckige Farbfelder. Übereinander. Das obere rot. Das untere braun, kaffeebraun. Dazwischen eine hauchdünne weiße Trennlinie. Auf die fixierte sich sein Blick. Die satten und festen Farben des oberen und des unteren Rechtecks rasten aufeinander zu. Die weiße Linie konnte sie nicht trennen. Sie drohte zu zerbersten.
Wie hatte der das angestellt, jener Mark Rothkowitz! Wie komponierte er dieses Farbspiel! Franz Kappa ließ den schweren Bildband laut zusammenklappen und dachte an seine eigenen Kompositionen. Und er zweifelte an ihrem Wert und gleich darauf an seinem eigenen und dann an allem, was er tat. Wenn er nicht gut war, wirklich gut, und damit meinte er Rothko-Klasse, Beuys-Niveau, Richter-Ebene, dann musste er auf der Stelle aufhören, ein Künstler zu sein. Er müsste sein Studium hinwerfen und seine Pläne und Konzepte für die Kunstaktionen, die er für die nächsten Wochen und Monaten geplant hatte, und nie wieder eine Eintrittskarte für ein Kunstmuseum lösen. Kunst war für ihn eine kleine Elite von Frauen und Männern, die weltweit den Ton angab oder ihn einst angegeben hatte. Wer nicht zu dieser obersten Schicht von kristallinen, hellen Schaumperlen gehörte, der produzierte auch keine Kunst. Selbstbefriedigung vielleicht, Therapie für eine kleine, gekränkte Seele, die keinen Mensch zu interessieren brauchte. Dann gab es noch andere, die Kunst machten, malten oder modellierten, um Freude daran zu empfinden. Das Allerletzte! Das waren Menschen, die tatsächlich damit zufrieden waren, etwas Schönes gemalt oder geschaffen zu haben. Irgendwelche sich selbst verwirklichenden, wohlhabenden Frauen im reiferen Alter. Pfui Teufel! Nein nein stopp. Qual muss Kunst sein, Pein. Niemals für den Künstler alleine darf sie sein, sondern ausschließlich für alle. Der wirklich große Künstler musste wertlos sein, für sich, als Mensch. Wenn Kunst den Gang nicht schaffte, alle zu erreichen und einen selbst dabei auszuradieren, dann war sie bloß irgendein verdammter Zeitvertreib, ein Hobby wie jedes andere. Das Sammeln von Briefmarken etwa. Philatelie. Kunst war das ganz andere. Das, was innerhalb der Grenzen der Welt im Normalfall nicht stattfand. Erst aufgeweckt werden musste, im Betrachter `Mensch´. Weil es natürlich da war. Wartete. Und träumte. Träge. Das war aber nur möglich, wenn das Kunstwerk so gut war, dass es erwecken konnte. Wenn Franz Kappa eine Stimmung herstellen konnte, wie sie sich einst in den Konzerten des Dirigenten Sergiu Celibidache eingestellt hatte. Oder einen Canyon malen konnte wie David Hockney. Einen Lendenschurz schnitzen, wie ihn Veit Stoss seinen Christusfiguren angepasst hatte.
Franz Kappa dachte an diesem Abend, zur sechsten Stunde, dass er das nicht war. Kein Chris Ofelis. Kein Paul Gauguin. Und kein Georg Baselitz. Er setzte sich in den alten ausgeblichenen, braunen Armlehnstuhl seines Vaters und wusste, dass er es bestimmt nicht war. Seine Kommilitonen und Professoren mochten ihn zwar, in der Hochschule der Künste, sie fanden ihn kurios und aufheiternd, aber Talent hatte ihm noch keiner attestiert. Sie dachten, er sei kurzweilig, ungewöhnlich. Mehr nicht. Und sie gaben ihm das Gefühl, mit seinen Kreationen immer leicht daneben zu liegen. Zu wenig Stellungnahme oder zu wenig Position wurde ihm vorgeworfen. Es sei unklar, worauf er hinaus wolle. Er solle sich an Vorbilder halten. Zumindest für den Anfang. Er müsse das Universum nicht neu erfinden. Er könne das schon tun, erklärte ihm Neudorf, ein Lehrbeauftragter, den er wirklich schätzte, mochte. Ja, er könne das Universum schon noch mal erschaffen, aber das erfordere mehr Zeit als ihm zur Verfügung stünde. Solche Kritik war wenigstens geistreich. Außerdem lachte Neudorf häufig über Kappas Konzeptionen. Das störte ihn nicht. Im Gegenteil. Es war richtig, wenn Neudorf darüber lachen konnte. Wie eine kurze, heftige Liebkosung, eine uralte, gutturale Form wahrer Begegnung. Neudorf lachte nicht irgendwie. Er lachte gewichtig, bedeutungsschwanger. So, als hätte er irgendetwas von dem verstanden, worauf Franz Kappa mit seinem Kunstwerk hinauswollte und eine Saite von Kappas Kunst angezupft, die sonst bisher keiner erspürt hatte.
Zum Zeitpunkt der größtmöglichen Depression, als Franz sich sicher war, der wirklich letzte Versager zu sein und es niemals in jene Reihen hinauf schaffen zu können, rauschte seine Freundin Iana, die ihr Kommen schon Mittags angekündigt hatte, plötzlich in sein Zimmer und bemerkte auch sofort, was vorgefallen war, das heißt, was in ihm vorging. Sie lief auf ihn zu und machte ein maskenhaft trauriges Gesicht, um ihn zu imitieren. Sie trug ein Etuikleid in zartem vanillegelb mit Pattentaschen und zwei winzigen Totenkopf-Ansteckbroschen. Darunter ein grau-grün gestreiftes Longsleeve mit U-Boot-Ausschnitt. Sie sagte nichts, blieb vor ihm stehen und zog die Mundwinkel übertrieben stark nach unten. Dann brach sie plötzlich in Gelächter aus und sagte:
„Franzi. Wir müssen zum Arzt mit dir.
Das gefällt mir gar nicht.“
Als er nicht darauf regierte, sondern sein Blick gekränkt durch das Fenster in die Ferne floh, setzte sie sich auf seinen Schoß und blies ihre Backen auf.
„Aber heute Abend bist du schon dabei!“
„Bei deinen furchtbaren Model-Freundinnen?“ Er.
„Es sind nicht meine Freundinnen! Es sind
Arbeitskolleginnen. Und ich weiß, dass es dir gefallen
wird. Weil sie dir gefallen.“ Wieder sie.
„Ich weiß nicht.“ Franz.
„Sie gefallen jedem. Sie gefallen auch dir. Gib´s zu!“ Iana.
„Vielleicht. Ja. Aber sobald sie den Mund aufmachen...“ Er.
Iana zog ihre Hand, die sie auf seine Schulter gelegt hatte, zurück, und sah ihn unwillig an – was er auch erreichen wollte, nachdem sie ihn vorher lächerlich gemacht hatte.
„So, jetzt bin ich echt sauer!“ Sie.
Er lachte und versuchte sie zu kitzeln
und zum Lachen zu bringen.
„Du kannst mich mal.“ Sie lachte auch und streichelte ihm über den Hinterkopf. „Komm. Olga ist auch dabei. Und du magst sie. Komm. Ich weiß es.“ Ihr Lächeln wurde gemein.
„Ich mag dich.“
„Ja ja ja. Ich weiß.” Abwiegelnd.
„Nein. Weißt du nicht!“ Eindringlich.
„Doch.“ Iana setzte sich ganz auf ihn, umarmte ihn und drückte mit ihren Daumen fest auf seine beiden Ohren.
Er dachte an den Abend, den er anders nutzen wollte, an dem er arbeiten wollte. Er hatte sich „Hexenkessel“ von Martin Scorsese ausgeliehen zu diesem Zweck. Vor Wochen hatte er ihn in einem kleinen Programmkino beim Nördlichen Friedhof gesehen und wollte ihn jetzt ein weiteres Mal ansehen, analysieren. Scorsese hatte seine Figuren so unendlich zärtlich gezeichnet, so verletzlich und ängstlich, in diesem frühen Film, den Scorsese noch mit geringem Budget und unbekannten Darstellern gedreht hatte. Sein Durchbruch. Später würde er diese echten Gefühle nicht mehr herstellen können. In keinem noch so großen Film. Franz dachte an all die Abende, an denen sie unterwegs waren und immer erst mit den Müllmännern nach Hause kamen. Weil sie das brauchte. Um ihre Sinnleere zu kaschieren. Und er dachte an Olga, die er tatsächlich sehr gerne sehen wollte.
Iana und Franz lebten vornehmlich nachts. Tagsüber war zu viel Licht da. In der Nacht war alles reiner. Eine beschränktere Welt. Konkreter. Franz und Iana wollten mitgetragen werden. Von den Menschenwellen, die in den Clubs und in den Theatern und den Cafés hochschwappten und angenehm tiefe Wellentäler ausbildeten, in denen man sich für wenige Sekunden selbst spüren konnte. Ihre nächtlichen Begehungen bestimmten sie nicht willentlich. Sie gerieten überall hin. Franz war vor ihr viel braver und ruhiger gewesen und kaum ausgegangen. Er simulierte jetzt den Wilden. Es stand ihm nicht wirklich. Wirkte etwas unbeholfen und tölpisch. Durch sie kam er nun auf die Festbankette, Verlobungsfeiern, Galadiners, Cocktail-Partys, zu den Wichtigen, Bekannten, Reichen. Und er war der Unwichtige und zudem Unbekannte. Je mehr er diese Zusammenkünfte der oberen Achttausend auszukosten begann, desto ärger wurde es für ihn, sich bei einem ihrer gesellschaftlichen Selbstereignisse zu ertappen und die ganze Wahrheit der eigenen Bedeutungslosigkeit in einem einzigen großen Moment zu erfassen. Dann war es, während sie redeten und tranken und aßen, schrecklich ruhig und einsam um ihn, und Franz hätte sich am liebsten umgebracht. In diesen Fällen half nur eines: das Ersinnen neuer, großartiger Kunstwerke.
Iana dagegen schien von anderem Material. Konnte nächtelang tanzen und über die Maßen trinken und am nächsten Morgen in der Maschine nach St. Barth sitzen, dort ein menschenunwürdiges Shooting eines apathischen und herrischen jungen Fotografen auf kochendheißem Sand absolvieren und danach postwendend wieder nach Hause fliegen, Franz bei der Arbeit, bei der Kunst – etwas, das sie nie als Arbeit ansah – stören und ihm dann im Verlauf des weiteren Tages den Vorschlag unterbreiten, am Abend doch noch auszugehen. Selbst wenn keine Vernissage anstand, keine Finissage, kein neuer Flagship-Store in der Maximiliansstraße eröffnet wurde und jene schnöden und ungeheuerlich faden Clubs in den Obergeschossen von München um zwei Uhr Nacht schon wieder geschlossen waren, fand sie doch immer eine Begründung für das Ausgehen.
Franz fand, sie trank ein bisschen zu viel. Vertrug selber eigentlich gar nichts. Er hätte ihr gerne mal aus einem alten französischen Roman vorgelesen, oder aus Heinrich Manns Künstlernovelle „Die Schauspielerin“, die er vor kurzem entdeckt hatte. Dann hätte sie übernommen, weitergelesen, dann wieder er. Und das war ungemein spannend, aber sie wollte das nicht. Wozu auch die Geschichte einer reizenden, scheiternden Künstlerin aus der Mann-Mischpoke hören, die sich am Ende der Erzählung aus gesellschaftlichen Gründen das Leben nahm! Iana hätte die Eröffnung eines neuen Restaurants oder ein wichtiges Event ihrer Modelagentur, auf dem sie gebucht werden könnte, verpassen können. Und so stand auch an diesem Abend eine Eröffnungsfeier an. Die Einladung bestand aus einem grünen Ledersäckchen, in dem sich ein Aufkleber mit einem künstlichen Muttermal befand, den man auf irgendeiner Stelle des Körpers befestigen musste und am Einlass vorzuzeigen hatte.
Der neue Flagship-Store von Placebo Moholy wurde eröffnet. Am Merolingerplatz. Der erste Moholy in Europa. Deshalb war einiges zu erwarten. Kol Haasrem hatte die Inneneinrichtung entworfen. Roter Bundsandstein. Dann Fachwerk. Eiche. Angeblich inspiriert durch fränkische Fachwerkhäuser. Moholy war etwas ganz und gar Deutsches vorgeschwebt. All diese Dinge wusste Iana, denn sie hatte interne Informationen von Kollegen oder Offizielles aus einschlägigen Zeitschriften, die aus dem Leben von Prominenten berichteten und die sie täglich las. Und sie redete und redete. Doch interessierte es Franz auch am Rande. Schließlich waren auch das Formen von Kunst. Mode. Architektur. Beide waren leider vor allem Kapital. Zweckgedemütigte Schönheit. Nicht um zu erleuchten, sondern um zu verdunkeln. Eine Kunstform, welcher in jenem Moment die michelangelinische Berührung mit dem Genius, dem Göttlichen, gelang, sobald irgendeine Person mit einem Gegenstand Richtung Kasse ging.
Franz Kappa hatte das dunkle Gefühl, dass er vielleicht auch irgendwann diese unheilige Liaison zwischen Kunst und Kapital eingehen musste, um gehört zu werden, gesehen, besprochen, kritisiert, gehandelt.
Sie kamen ziemlich spät an, am Merolingerplatz dreizehn, mit dem Taxi, das sie bezahlte. Franz fuhr immer Straßenbahn oder Bus, schwarz. Die Ecke des Platzes, die ab nun dem amerikanischen Ungarn Placebo Moholy gehören sollte, schien zu zittern, war violett erleuchtet und sog die Blicke und Kräfte aller Passierenden in sich auf. Winzige Stroboskopblitze funkelten aus byzantinischen Terrakottatöpfen, aus denen blühende Medinillae magnificae wuchsen. Das Gebäude hatte eine Art Schnabel, der nach oben zeigte. Er klotzte aus der Fassade heraus, plump und doch sehr sexy. Es gab keine Fenster. Nur diesen Schnabel und eine mit zahlreichen winzigen Fossilien durchsetzte, glatt geschliffene Kalksteinfassade. Unter dem Schnabel der Eingang. Eng. Gerade mannsbreit. Ein arabisches Nadelöhr in einer steingrauen, tumben Stadtmauer. Extrem eng. Man sollte wahrscheinlich darüber ins Grübeln geraten, wie all das Zeug da rein geschafft worden war, durch dieses Nadelöhr. Wahrscheinlich würde dieses stylische Loch bald die Krux der Lieferanten und Verkäufer werden, die es verfluchten und verwünschten, weil einfach nichts hindurch passte. Mit größter Wahrscheinlichkeit jedoch existierte noch irgendwo ein Lieferanteneingang, der ungleich größer und praktischer war als dieses Schlupfloch. Aber er gefiel Franz Kappa. Der Einfall. Gewissermaßen eine Provokation. Nirgends Fenster, die sinnentleerte Tür, im Grunde ein Abgesang des Architekten an den Konsum, den Konsumtempel. Ein Abgesang, der aber unglaublich gut aussah und wirkte und verrückt war und somit doch wieder zu einem Hymnus werden würde. An den Konsum. Den Konsum von Placebo Moholy. Parfums. Brillen. Uhren. Täschchen. Sakkos. Hemden. Pullover. Slips.
„Ah, schau mal!! Das süße Täschchen. Da.“ Sie waren drinnen, und das sakrale Stillschweigen der Geladenen dominierte den Raum. Iana stürzte auf eine der ausgestellten Handtaschen zu und wurde wegen der gierigen Hast in ihren Bewegungen von den umstehenden Honoratioren kritisch in Augenschein genommen. Ihre langgliedrigen, weißen Finger griffen in ein helles Steinregal, das von Neon petrolfarben ausgeleuchtet war, und griffen eine mit Paillettenrauten besetzte Lack-Clutch in Apfelform und einer Logo-Prägung an der Magnetschließe heraus. Sakrileg. Sahen sie sogleich mit Augen an, die Stillstehen und Ruhighalten zu erzwingen suchten. Aber viele der Blicke, die sie musterten, glitten sogleich an ihrem langen, weiblichen Körper auf und ab. Waren es nicht gähnend schwarze Männerpupillen, dann Frauenaugen, die krampfhaft nach irgendeiner Schwachstelle suchten. Hell leuchtend flachsblondes Haar über zartgliedrigen, bronzen gebräunten Schultern. Sie trug ein knielanges Blusenkleid in Egg-Shape-Form mit einem ovalen, bis zum Steißbein reichenden Rückenausschnitt sowie grau-schwarze Lack-Budapester mit roten Ledersohlen. In ihrem Rückendekolleté hing eine feine, schmale Kette aus Silber, an deren Ende ein Anhänger in Münzenform hing. Franz liebte diesen Moment in der Seele der Hinschauenden. Ein paar Augenblicke vollkommener Frage, ein Nichtwissen, wo sonst nur immer Eindeutigkeit und Gewohnheit überwogen. Ein Blinzeln von Ewigkeit, kurze Hilflosigkeit, eine Weichheit. Ehe dann wieder eine Kategorie gefunden war: Fazit – sieht fabelhaft aus, doch maßloser Charakter. Iana legte die Tasche zurück und erstarrte.
Sekt wurde gereicht, auf Silbertabletts, von pakistanischen Kellnern, und als Iana und er sich ein paar Mal bedient hatten, entdeckten sie ihre Freundinnen im Gang zur Toilette, die in eine Unterhaltung vertieft waren, plötzlich wie auf Kommando laut auflachten und dann leise weiterredeten. Iana und Franz waren beruhigt darüber, jemanden in dieser menschlichen Savanne ausgemacht zu haben, der wenigstens über ein Mindestmaß an Normalität verfügte, und steuerten auf sie zu.
Franz erinnerte sich, wie er Olga zum ersten Mal gesehen hatte. Sie hatte sich mit Iana in einem kleinen Café im Stadtzentrum getroffen, und er war nach der Vorlesung dazugekommen. Als er sie sah, in dem Moment, als er die schwere, gläserne Außentür des Cafés aufdrückte, erschrak er. Sie war so schön. Ihr Porzellangesicht hatte ein kleines Kinn, eine leicht grobe Nase mit einem breiten und niedrigen Nasenrücken und einer kleinen, vollkommenen, ebenen Stelle in der Mitte, auf die Franz im Verlauf des weiteren Abends immer wieder starren sollte. Ihre Nasenspitze war rundlich und ihr Mund war nicht groß, aber die dunkelviolett geschminkten Lippen waren äußerst stimmig ausgeformt. Unter ihren Augen war die Haut auf einer münzgroßen, halbrunden Fläche so dünn und hell, dass die feinen Blutäderchen darunter ein zwischen hellrosa und dunkelblau changierendes dezentes Scheinen hervorriefen. Die Augenbrauen waren lang und kräftig und dünn, und sie schützten und weiteten ihren Blick. Mit ihrem sehr kurzen, kräftigen, widerspenstigen und dicht anliegenden Haar erinnerte sie Franz an die jugendliche Jean Seberg, wie sie in Truffauts „Außer Atem“ eine eigenwillige Amerikanerin in Paris gespielt hatte. Nachdem sie zu dritt das Café verlassen hatten, war Franz in der Tat ein wenig unwohl. Er hatte Olga zu lange angesehen. Und in der Nacht konnte er nicht schlafen. Rollte im Bett hin und her. Sah ihr Gesicht plötzlich vor sich und wachte auf. Ging zum Kühlschrank und suchte etwas zu essen. Er fand nichts. Wie konnte ihm so jemand begegnen? Jetzt! Nachdem er Iana kennengelernt hatte.
„Olga!“
Iana fiel ihrer Freundin überschwänglich um den Hals, während Franz Kappa die anderen beiden, Arbeitskolleginnen von Iana, mit Küsschen bedachte. Alle waren zartgliedrig, dünn und groß. Er fühlte sich wohl bei ihnen und bei Olga und bei Iana. Nichts als Musen. Helligkeit. Und er versuchte sich unbeeindruckt zu geben, was nicht gerade leicht war. Alles schien genau zu beobachten, wer das war, der sich in solcher Gruppe bewegte. Der Ausdruck seiner Augen wurde akribisch studiert. Und Franz sah bescheiden und demütig drein, doch ein Anflug von Zorn war in seinen Augen (den niemand in einer solchen Situation verstehen konnte).
Mit Iana hatte er diese Art von Welt betreten, und er wusste, dass er sie – mit oder ohne Iana – bald wieder verlassen würde. Aber dass er hierzu Iana nicht verlassen musste, stand auf einem anderen Blatt. Seit kurzem sagte sich Franz besonders häufig, dass Iana die einzig Richtige sei. Pflegte diesen Satz in seinen Gedanken. Vor allem, seitdem er Olga begegnet war. Seit diesem Tag päppelte Franz den Satz förmlich auf. Und am Ende eines Tages war es dann unbezweifelbar, dass Iana eben das alleinig Richtige für ihn war.
Iana war so stark. Er selbst trug sein Innerstes schrecklich weit außen. Und Iana? Die zeigte nichts davon. Gebärdete sich stets unmissverständlich und eindeutig. Unentwegt fokussiert auf den Angriff, um nicht hinterfragt zu werden, oder angezweifelt. Und Franz wusste, dass trotzdem etwas schimmelte, in ihr, unter ihr, unter diesem Hochdruckstrahl der kühlen Perfektion. Doch, kühl war sie. Kühl, perfekt und...
„Da ist dein Schatz!“, wandte sich Iana an Olga
und zeigte dabei auf Franz.
„Ich bin kein Schatz. Ich bin die Hölle.“
Franz sah Olga mit zusammengekniffenen Augen an.
„Du bist ein Künstler. Du weißt das.“
Sie sprach mit besonders viel Akzent.
Iana ging von hinten auf Franz zu,
umgriff seine Schultern und sagte zu Olga:
„Ja, er spinnt. Das wissen wir alle. Iana setzte ihr Kinn auf seine Schultern. „Wir schauen, dass wir hier sobald wie möglich wieder rauskommen, in Ordnung?!“
„Mir gefällt es hier aber!“, wandte Franz ein.
„Dir?“, wunderte sich Iana.
„Ja, mir. Die Kellner sind witzig, und nachher soll noch ein Kinderchor auftreten, aus dem Haidhauser Kindergarten. Das ist wirklich krank und wirklich gut. Das gefällt mir.“
„Stimmt“, sagte Olga, während sie in ihren kurzen schwarzen Haaren herumzupfte und Franz ausdruckslos anstierte. „Das könnte von dir sein.“
Die vier Mädchen lachten, und Franz zog sich aus ihrem Kreis zurück und beobachtete, wie sie miteinander redeten. Was sonst niemand auf dieser Feier tat. Die anderen sprachen nur. Die vier aber redeten. Franz sah, wie Iana eine Zigarette aus ihrer Schachtel zog und ihr Olga, noch ehe sie sich´s versah, Feuer gab. Olga hatte Iana immer im Blick, und sie verlor auch Franz nicht aus den Augen. Kontrollierte, schien es. Franz tat so, als merke er nichts davon. Versuchte vorzutäuschen, er wüsste nicht, dass sie ihn beobachtete. Schließlich musste er bestimmen, was Olga über ihn denken sollte. Sie durfte nicht über ihn denken, was sie über ihn denken wollte. Ausschlaggebend auf jeden Fall war, dass sie ihn interessant fand, und verwirrend. Dann würde sie ihn akzeptieren. Als Gewöhnlichen aber nicht. Nur als Exzentriker. Einen unentwegt mit Höherem Beschäftigten.
Im Grunde mochte Franz es, wenn man ihn wegen seiner Kunst aufzog. Jetzt eben jedoch hatte es ihn gestört. Weil es wieder mal von Iana gekommen war. Weil die wusste, dass er sich gerade heute über dieses Thema den Kopf zerbrochen hatte. Schließlich fand er seine Kunstideen im Moment erbärmlich und kindisch. Er sah, wie hässlich seine Bilder waren, und gewöhnlich, steif und ohne Kraft. Unauthentisch. Keine eigenen Wesen, die einfach da standen. Erschaffen waren und nun eigenständig agierten. Nein. Er musste ihnen unentwegt Atem einhauchen, damit sie nicht in sich zusammenfielen. Und ein Gedanke bohrte ganz vehement: Was geschieht, wenn ich erfolglos bleibe, das heißt, wenn ich als gewöhnlicher Mensch ende? Es war unvorstellbar. Ein Ding der Unmöglichkeit. Nein. Seine Kunst war schuld. Bisher. Ihre Mittelmäßigkeit. Sein Kunstbegriff war ja auch nicht ganz einfach. Sie, die Kunst, war für Franz nicht ausstellbar, nicht aufhängbar in Galerien, Museen oder Messehallen. O nein. Kunst war das Andere. Das, was sie eben nicht in Galerien, Museen oder Messehallen hineinzwängen konnten. Was kein Privatsammler, nur vorausgesetzt, er verfügte über genügend Mammon, sich an irgendeinen verdammten Nagel hängen konnte. Kunst war Aktion. Kunst war Handlung. Kunst geschah. Und sie durfte nicht lange anhalten. Musste verpuffen. In der Luft. Nur für sich selbst sein. Sie für sich. Alleine. Vollkommen rein.
Der Haidhauser Kindergartenchor gruppierte sich ungeordnet, sang und gab nach seltsamem, zaghaftem Zurufen einzelner Gäste noch eine Zugabe. Hans saß am Fenster und putzte seine Schuh. Ein altes Kinderlied, das auch Franz noch kannte.
„Hans saß am Fenster und putzte seine Schuh. /
Da kam des Nachbars Mädelchen und sah ihm zu. /
Hans, was machst du! Weinst du oder lachst du! /
Ich weine nicht, ich lache nicht / ich putze meine Schuh“
Die in winzige, schwarze Moholy-Anzüge und weiße Moholy-Kleidchen gezwängten Kinder, die Kindergärtnerin im einfachen Strickpulli, alles schillerte in widersprüchlichen Bedeutungen und machte unsicher. Franz Kappa stellte sich ganz alleine neben das Buffet und leerte einen Sekt Orange nach dem anderen. Als dann der Gastgeber Moholy