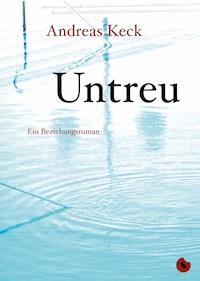
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein schickes Haus, zwei hübsche Töchter und der Mann ist äußerst erfolgreich in seinem Job. Christine ist Hausfrau und führt ein glückliches Leben. Zumindest ein zufriedenes, denn eines fehlt: die Leidenschaft. Einzig ihr Putzwahn bietet ihr Erfüllung. Als der neue Geschäftspartner und Freund ihres Mannes häufiger Gast in ihrem Haus wird, bringt das Christine in emotionale Schwierigkeiten. Ludwig ist von ihr fasziniert und macht ihr den Hof. Sie will der Versuchung widerstehen und eher sich selbst als die Ehe verraten.Doch wo fängt Untreue an und wie weit darf in die eigene Beziehung investiert werden, bevor es Selbstaufgabe ist? Kann der Verrat an sich selbst das Hintergehen des Partners aufwiegen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andreas Keck: Untreu Ein Beziehungsroman 1.Auflage, Juni 2012, Periplaneta Berlin
© 2012 Periplaneta – Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, mechanische, elektronische oder fotografische Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Coverfoto: Veronika Engelmann Lektorat: Falk Strehlow, Thomas Manegold Satz, Layout: Thomas Manegold Produktionsassistenz: Julia Wiese
Ungekürzte, digitale Version der Printausgabe
print ISBN: 978-3-940767-79-0epub ISBN: 978-3-943876-30-7E-Book-Version: 1.3
Andreas Keck
Untreu
Ein Beziehungsroman
periplaneta
„No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today“ John Lennon
I. Haus
Ehe sie sich’s versah, war Christine zu all dem geworden, was sie bisher immer bekämpft hatte, erfolgreich, wie sie meinte.
Haut wird nun mal älter. Um die Augen herum vor allem. Oder die Mundpartie. Durch das viele Lächeln.
War soviel Lächeln dabei gewesen, bisher, in ihrem Leben? Ja, auf jeden Fall, früher. „Früher“, dieses Wort konnte sie nun seit etwa sieben Jahren gebrauchen. Mit zwanzig kann man noch nicht „früher“ sagen. Mit fünfundzwanzig auch nicht. Aber ab dreißig, einunddreißig geht’s los.
Ja, während ihrer Schulzeit! Da war sie Lachmöwe genannt worden, von ihren vielen Freundinnen, von denen jetzt vielleicht noch zwei, drei übrig waren. Die zwei, drei – wie lange hatte sie selbst die nun schon nicht mehr gesehen! Die eine lebte noch in ihrer Stadt, während die anderen beiden weggezogen waren, weg aus Tannenhausen. Ja, mit denen hatte sie wirklich sehr viel gelacht.
„Etwaszuviel“, denkt sie, als sie kurz innehält, während sie die Tür des Schlafzimmers schließt und dann über die geschwungene Treppe hinuntergeht. Sie betritt den lichtdurchfluteten Wohnbereich. Ihr Blick schweift über die exklusive aber nun bereits ältere Sofagarnitur, die aus fünf verstellbaren Elementen besteht und damals schon ganz und gar nicht billig gewesen war.
Der Möbelverkäufer – Christine erinnert sich als sei es gestern gewesen – hatte von einem Kunstwerk gesprochen, in „Farbvariationen von Nachtblau“. Als er dann den wohlklingenden italienischen Namen des Designers aussprach, hatte es bei Christine Klick gemacht: Markus musste das Sofa kaufen. Und in der Tat, die fünf Elemente komponierten jedes Mal ein stilsicheres Ambiente, das bisher jedem Besucher eine Bemerkung wert gewesen war. Unpassend konnte man sie gar nicht positionieren.
Christine geht weiter bis in die Küche und setzt sich kurz, nicht um zu verschnaufen, sondern weil sie noch einem Gedanken folgen muss, den sie vom Schlafzimmer mit heruntergebracht hat, und der Christine nun irgendwie dazu drängt, Platz zu nehmen.
Im Spiegel des Schlafzimmers hatte sie vorhin einen Blick auf ihr Gesicht erhascht – ein kurzer unerwarteter Blickwechsel – und nun musste sie darüber nachdenken, ob wirklich nur ihre Haut um die Augen herum so gealtert war, oder viel mehr. Aber alles andere war noch dasselbe wie immer, oder? Eigentlich schon. Doch! Es hatte sich nichts geändert in den letzten paar Jahren.
Ihr Mann war zum Geschäftsführer der Firma Börer aufgestiegen, einer in Tannenhausen ansässigen GmbH, die für die halbe Welt Bauschalungen anfertigte. Und die nun auch in ihrem neuen Sektor „Fertigbauten“ die Marktführung in Süddeutschland zu übernehmen begann – seitdem Markus diese Sparte leitete. Ihr Mann war bereits kurze Zeit nach seinem Einstieg in das Unternehmen zur rechten Hand des Senior-Chefs avanciert. Und der letzte Schritt, die Ernennung zum Geschäftsführer, war nur noch eine Frage des guten Benehmens - von Seiten Markus’ und schließlich auch von Seiten seines Chefs, Alfons Börer. Nein, großartig war nichts geschehen seitdem Laura, die jüngere ihrer beiden Töchter, den Übertritt in die nächste Klasse des Gymnasiums schließlich doch geschafft hatte. Und ihre ältere Tochter, bei der klappte sowieso immer alles auf Anhieb, wie bei ihrem Mann, im Grunde – sehr ähnlich.
Und schon ist Christine wieder aufgestanden, von ihrem Küchenhocker, ohne eine Antwort auf ihre Frage gefunden zu haben. Aber sie hat sie auch längst vergessen und verliert sich, während sie den Abwasch macht, wieder in alltäglichen Gedanken. Den Abwasch erledigt sie immer noch mit der Hand, obwohl ihr Mann das überflüssig findet. „Es ist doch eine erstklassige Spülmaschine vorhanden,“ sagt er immer. „Die hättest du dir sparen können“, erwidert sie dann. Und so wie sie es sagt, klingt es beinahe wie ein sanftes Lob – wie gutes Zureden.
Das warme Wasser, das jetzt ihre Hände umgibt, auf dem sich gerade eine Schaumkrone bildet und immer höher wächst, in die Christine das Geschirr hineingleiten lässt, unendlich sanft und vorsichtig; und wie es dort verschwindet, auf dem Grund des Spülbeckens aufkommt, und nun der Moment, in dem sie den Hahn abdreht – Stille. Diese Stille ist im Grunde das Schönste, das Schönste überhaupt – im Grunde.
Warum hatte sie es sich nur angewöhnt, die Straße, die vor dem Küchenfenster vorbeiführt, zu beobachten! Schon bei der kleinsten Regung, die sich dort ergab, musste sie hinausstieren; doch es ergab sich selten etwas wirklich Sehenswertes, eigentlich so gut wie nie. Doch das war es ja gerade, weswegen sie immer wieder einen Blick auf die Mozartstraße warf – auf diese fünf Meter, die sie durch das Küchenfenster einsehen konnte. Meistens sah Christine irgendwelche Autos, deren Farbe und Form sie problemlos den Nachbarn zuordnen konnte, oder Fahrräder, selten Fußgänger. Die waren dann natürlich am interessantesten und meist warfen sie einen kurzen schuldbewussten oder längeren messenden Blick auf ihr Haus. Mit diesem Blick konnte Christine rechnen. Fehlte er, wurde sie unruhig.
Einmal war da etwas Wirkliches passiert, auf diesen fünf Metern, etwas Tatsächliches, im Gegensatz zu dem ansonsten traumhaft erscheinenden Vorbeischweben der Außenwelt, in diesem Ausschnitt einer flüchtigen Wirklichkeit von fünf Metern, die sich irgendwo da draußen bestimmt aufregender gestaltete, wie Christine annahm. Ja, einmal war ein Wagen direkt vor ihrem Fenster mit einem anderen zusammengestoßen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Sie stiegen aus ihren Wagen und regelten die ganze Angelegenheit mit ruhigen Gesten; ihre Worte konnte Christine nicht verstehen. Es war unmöglich, das Küchenfenster zu kippen – ein Manko, das drei Wochen nach diesem Vorfall von ihrer Schreinerei behoben wurde. Die Reparatur hatte freilich nichts mit dem Unfall zu tun, nur mit der Tatsache, dass Christine seit dem Zusammenstoß in der Mozartstraße immerzu an dieses Manko hatte denken müssen.
Christine verständigte also ihre Schreinerei, Schreinermeister Jehle, der Christine kannte, persönlich, und der sie gern hatte, wie eigentlich jeder, der sie kannte, und der, wie jeder, sofort zur Stelle war, wenn sie etwas wollte. Dass Christine nun mal so aussah wie sie aussah, mag ein Hauptgrund dafür gewesen sein, gefolgt jedoch von ihrer liebenswürdigen Art, die ein weiteres Argument war, sofort zu handeln, wenn sie einen anrief oder gar vorbeikam, in der Schreinerei, oder sonst wo. Sie kam am liebsten persönlich vorbei. Ihr Erscheinen war stets wirkungsvoller als jedes Gespräch. Wenn Christine so vor einem stand, war sie nun mal unheimlich nett –unheimlich.
„Gut, also gut“, denkt sie, immer noch in ihrer Küche stehend, an diesem Montag Vormittag, nachdem sie den Stöpsel des Spülbeckens gezogen, das Küchenfenster gekippt hatte und sich nun daran machte, die matte Edelstahloberfläche des Beckens mit einem Reinigungstuch zu wischen. Was sie nach jedem Spülen tut – und wenn es nur ein einziges Glas war, das sie abgewaschen hatte – der Edelstahl wurde stets in seiner Gesamtheit gereinigt. Christine meinte, Schmutz sehen zu können, selbst wenn er für andere unsichtbar war. Sie meinte ihn fühlen zu können, und vermutete ihn. Vermutete ihn überall, im Grunde.
„Gut, also gut“, sagt sie sich, und sie fühlt sich nun – sie sieht auf die Küchenuhr: zehn vor elf – absolut vollständig. Nur am Vormittag, um diese Uhrzeit, wenn alle aus dem Haus waren, kam diese Empfindung auf – vorausgesetzt sie hatte noch etwas zu Reinigen. Es war eine Vollständigkeit, die sich sonstnieeinstellte. Nur wenn sie allein war. Christine fühlte sie hier und jetzt. Was sie auch getan hatte, es an anderen Orten, zusammen mit anderen Menschen oder mit ihrer Familie zu empfinden – sie fühlte es nur hier.
Das Spülbecken sieht jetzt sagenhaft aus! Dieses matte Glänzen sollte sich nun ausbreiten über den Rest der Küche.
Christine fährt mit dem feuchten Wischtuch über die robuste Arbeitsplatte aus Granit und Gneis. Die zahlreichen Materialien der Küche: gebürsteter Edelstahl, amerikanischer Nussbaum, satiniertes Glas, Kastanie, Aluminium, europäische Eiche... safrangelb, blaugrau, oliv, ocker.
In der Mitte der Küche thront ein hüfthoher titangrauer Inselblock, ein Küchenmöbel, das mit seinem Cerankochfeld das Herz der Küche bildet und jahrelang das Versteck ihrer beiden Töchter gewesen war. Als wäre hier der Mittelpunkt der kleinen Welt von Patricia und Laura gewesen – ihr Nest; zwischen dem Geruch der Reinigungsmittel, Zwiebel- und Fettdämpfen und der Hitze der Herdplatten. Wenn sich eine ihrer Töchter in der Einbuchtung des Inselblocks versteckt hatte, musste Christine so tun, als wäre nichts, so als koche und arbeite sie wie jeden Tag. Das tat Christine immer. Jedes Mal spielte sie mit und kochte, putzte und schnitt, als wäre gar nichts.
Aber sie tat es auch, wenn die beiden nicht Versteck spielten, wenn überhaupt kein Anlass gewesen wäre, so zu tun, als ob.
Daran muss sie denken, an die Zeit der Versteckspiele, während sie mit dem Wischtuch auf die schwarze glänzende Glasplatte des Cerankochfelds kommt. Jetzt haben die beiden gerade Mittagspause, in der Schule. Die Kleine würde heute schon früher heimkommen – Laura. Die Große – Patricia – erst am Abend, kurz vor ihrem Mann. Der kommt immer gegen halb sieben heim.
Christines Mutter hatte stets handwarmes Wasser benutzt, wenn sie Flächen und Böden putzte. Daran konnte Christine sich gut erinnern. Christine hingegen nahm kochend heißes Wasser. Lauwarmes Wasser fühlte sich an, als sei es bereits schmutzig. Heißes Wasser hingegen bewirkt das Gegenteil: das Gefühl von Sauberkeit. Früher, da hatte Christine Hygiene und Reinlichkeit niemals so hoch gehalten. Der Wunsch nach der bedingungslosen Sauberkeit des Hauses war nach neun Jahren Ehe entstanden – damals als bei ihrer älteren Tochter die Probleme losgegangen waren. Patricia war von der jüngeren Laura dermaßen unterdrückt worden, dass ihr Übertritt von der Grundschule ins Gymnasium in Frage stand. Heute ist Patricia Schulbeste – und auch in jeder anderen Hinsicht die Beste. Ihre Patricia ist wie der Klang, der entsteht, wenn die Schubladen von Christines Küche schließen: dieses sanfte und doch nachdrücklicheGlubb.
Christine hebt den schweren Messerblock und entdeckt darunter einen Kalkfleck. Scheinbar beiläufig wischt sie ihn mit ihrem Wischtuch weg, obwohl sie eine große Befriedigung empfindet, einen nicht unbedeutenden Fleck gefunden und entfernt zu haben. An diesem Vormittag findet sie keine größeren Flecken mehr; zumindest keinen von solchem Ausmaß, der bereits so lange unentdeckt vor sich hin geschlummert hat.
Vorhin, als Christine wieder einmal aus dem Küchenfenster sah, stand da ein Pärchen mittleren Alters wie gebannt vor ihrem Haus und hatte jedes Detail der Fassade genauestens gemustert. Christine fand sie ulkig. Die beiden hatten komisch ausgesehen: altmodisch gekleidet, er riesengroß und sie furchtbar klein. Christine hatte noch nie versucht, Menschen zu verstehen oder sie zu durchschauen; und so dachte sie sich bei den beiden auch nichts anderes als: ulkig sehen die aus. Als die beiden im Fenster ihre Beobachterin bemerkt hatten, wandten sie sich abrupt ab und waren weitergegangen. Auch Christine hatte sich schnell umgedreht und war am sanft surrenden Kühlhochschrank vorbei in das Wohnzimmer geschlendert. Dieses Surren, das sie während der ganzen Zeit in der Küche vernommen hatte, war plötzlich fort – so wie ein Gewicht, das man mit sich trägt, unentwegt, ohne davon zu wissen, und das, wenn es weggenommen wird, das Leichtere erst spürbar macht. Im Wohnzimmer war es vollständig still. Im Gegensatz zu ihrem Mann hatte Christine Geräusche nicht nötig und fühlte sich durch Ruhe nicht bedroht. Ihr Gatte hingegen schätzte Geräuschkulissen jeder Art.
Es läutet an der Tür.
Der jüngeren Tochter hatte sie noch keinen Wohnungsschlüssel gegeben. Das hätte Christine auf eine bestimmte Art anstößig gefunden.
Der Gong hallt durch das Erdgeschoss; nicht laut oder durchdringend, sondern wie ein fernes Echo, vielversprechend.
Christine geht zur Tür und öffnet.
Was hätte sie anderes tun können!
Gestern am Abend hatte Christine noch lange ferngesehen, obwohl Markus schon hochgegangen war, ins gemeinsame Schlafzimmer; da kam eine Reportage über Mikrochips und wie sie funktionieren. Das hatte sie plötzlich furchtbar interessiert, was übrigens immer geschah bei Sendungen, bei denen er nicht neben ihr saß und nicht mit in den Fernseher sah, vor allem bei wissenschaftlichen Reportagen. Ja, und es ist ja unglaublich, wie klein das alles ist – die Zellen und Brücken und Speicher, alles auf einer winzig kleinen Platte.
Furchtbarinteressant hatte sie das gefunden.
Als sie dann den Fernseher ausgeschaltet und noch die letzten Sachen vom Tisch weggeräumt hatte, musste sie darüber nachdenken, ob nicht vielleichtallesviel kleiner war als man meinte. Viel kleiner. Ein seltsamer Einfall, hatte sie sich gedacht, als sie da gestern die Lichter im Parterre ausmachte: Wir bilden uns nur ein, dass wir groß sind, derweil sind wir winzig klein. Die Vorstellung hatte sie nicht mehr losgelassen, auch noch während sie neben ihrem schlafenden Mann im Bett lag. Sie war dann aber doch recht schnell eingeschlafen und hatte nur noch ein-, zweimal in der Nacht vernommen, dass Markus laut schnarchte.
Laura trödelte wieder herum. Sie saß auf dem Bänkchen am Küchentisch und blätterte in der Fernsehillustrierten, doch sie las nicht; sie blätterte nur, hin und her, eine Seite vor, eine zurück, während sie mit dem Kopf wippte und die Lippen lautlos bewegte, als sage sie etwas vor sich hin, irgendetwas Bedeutungsloses, ohne Belang, da es ohnehin niemanden interessierte.
Das wusste sie. Dass es sowieso keinen interessierte, was sie im Allgemeinen von sich gab. Christine sah ihr dabei zu, beziehungsweise musste sie immer wieder hinsehen, auf die Illustrierte, die in den Händen von Laura dicker und dünner wurde und wieder dicker und wieder dünner, wie ihre Tochter die Seiten so am Daumen durchblätterte, geschwind.
„Was starrst du so?“, meinte Laura, als sie von der Illustrierten zu ihrer Mutter aufsah. „Deine Augen fallen gleich raus!“
„Du, gell!“, sagte Christine und senkte ihren Blick; sie starrte nun auf die leere Mitte des Küchentisches. Laura betrachtete ihre Mutter: dieses dichte nussbraune Haar, das eine feste, steife Form einnahm. Wie ein Bilderrahmen, dachte Laura, der noch schöner ist als das Bild; obwohl doch das Bild schon so schön ist. Diese Form musste ihre Mutter nicht frisieren. Sie hatte sie einfach. Ihr Haar fiel in einem so starken und dennoch zarten Schwung – ein Halbrund bildend – so dass Laura sich manchmal fragte, ob die da wirklich ihre Mutter sei.
Laura selbst hatte eher helleres Haar, das seine eigene Form nie zu finden schien – es hatte keine. Ständig wurde es umhergeweht. Fiel sehr helles Licht darauf, so wirkte ihr Haar unendlich fein, so als würde es nicht der Schwerkraft gehorchen. Es schien so weich, dass die beiden anderen Frauen – ihre Mutter und ihre Schwester – andauernd hineinfassten und darin herumzupften. Laura störte das nicht. Sie fand es schön. Lieber aber hätte sie das Haar ihrer Mutter gehabt oder das ihrer Schwester – dieses gesunde, kräftige.
Während Laura immer noch hin und her blätterte, verschwand mit einem Mal das Starren aus den Augen ihrer Mutter.
„Mein kleiner Trödler!“, sagte Christine und sah ihre Tochter ganz verliebt an. Die fing den Blick ihrer Mutter auf und sah schnell wieder weg, indem sie auf die Illustrierte blickte und wahllos irgendetwas vorlas.
„Erzähl mir doch lieber was von dir!“, sagte Christine, während sie noch immer ihre Tochter betrachten musste.
Laura sah nicht auf, las weiter. Nur lauter. Sie betonte die Worte, als hätten sie eine tiefere Bedeutung.
„Du hast eine schöne Stimme!“, meinte ihre Mutter. Laura stoppte sofort. Sie stand schleppend von ihrem Platz auf und sagte: „Scheiß Tag, heute. So langweilig. Ich langweile mich hier noch zu Tode.“
„Deine Schwester kommt doch bald!“
„Was will ich denn mitder?“, entgegnete Laura und schlürfte mit den viel zu großen Hausschuhen, die eigentlich ihrem Vater gehörten, aus der Küche und stapfte laut die Treppe hinauf.
Christine nahm die Zeitschrift an sich und begann zu lesen.
Draußen fing es ganz leicht zu regnen an. Ein verhaltener Frühjahrsregen. Der Himmel hatte sich im Laufe des Vormittags zugezogen. Am frühen Morgen hatte noch kein einziges Wölkchen am Himmel gestanden. Da hatte es noch versprochen, ein richtiger Frühlingstag zu werden. Der erste richtige. Doch jetzt wurde es wieder dunkler. Nicht dunkel, aber dämmrig, als ginge der Tag bereits um vierzehn Uhr zur Neige.
Der Regen wurde immer stärker. Christine schaute von ihrer Illustrierten auf, deren Artikel sie schon kannte, und sah zum Fenster hinaus. Sie sah in den Regen, ganz ohne Enttäuschung, obwohl sie sich schon sehr auf einen Frühlingstag gefreut hatte. Ihre Enttäuschung über das Wetter hatte sie schon vor vielen Jahren endgültig abgelegt. Das Wetter: dieser große Enttäuscher, dieser boshafte Enttäuscher mit seinem unendlichen Repertoire an Versprechungen, Täuschungen, Kniffen. Jahrelang war sie denen erlegen gewesen. Doch dann hatte sie sich fest vorgenommen, ihn zu besiegen und sich nicht mehr reinlegen zu lassen.
Es konnte sich also einregnen. Christine würde das nichts anhaben können.
Zum Glück war nichts Schlimmeres passiert während der letzten Jahre – den Kindern oder ihnen, Markus und ihr. Eigentlich war alles gut gegangen. Schließlich konnte ja jederzeit etwas passieren, auch etwas Furchtbares; das wusste man nie... ein Unfall oder eine Krankheit oder Ähnliches. Aber nein, da war eigentlich nichts gewesen – zum Glück.
Christine hörte wie über ihr die Musikanlage anging, im Zimmer von Laura – nicht zu laut, das musste Christine zugeben, zu laut war es nie. Sie war eben gerade in ihrer Trotzphase, die Laura. Wenn Markus nachher heimkam, würde sie wieder im siebten Himmel schweben und alles versuchen, um ihm ein Lächeln abzuringen, herumtanzen, um ihn, ihren jungen Körper verbiegen und verrenken, sich an ihn schmiegen und nicht mehr von ihm weichen. Sie würde kurz bevor Markus eintraf, herunterkommen, aus ihrem Zimmer, und in Stellung gehen. Noch saß sie oben.
Sie saß auf ihrem Bett und hörte Musik und dachte an den Kunstunterricht vor vier Stunden. Die Kunstlehrerin hatte sie ermahnt. Laura hatte sehr lange über ihrem Wasserfarbenbild gesessen, den Kopf in die Hände gestützt und nachgedacht. Da war die Befeld mit langsamem Schritt an ihren Tisch gekommen, hatte die Hände in die Hüften gestemmt und gemeint, sie solle malen. Doch Laura dachte nach. Was sie malen wollte, wusste sie. Sie wusste nur nicht, auf welche Weise sie ausdrücken konnte, was ihr vorschwebte. Aber diese dämliche Tussi von junger Kunstlehrerin mit ihrem winzig kleinen Nasenring in der Fresse verstand das nicht.
Auf dem Weg von der Schule nach Hause hatte Laura versucht, das ihrer besten Freundin Hanni klarzumachen.
„Ich hasse Kunst“, meinte Laura.
„Du hasst die Befeld!“, wurde sie von ihrer Freundin berichtigt. „Du bist doch gut in Kunst.“
„Ich bin gut in Kunst, aber ich hasse Kunst“, wiederholte Laura einsilbig.
„Die Befeld hat doch ein Rad ab, mit ihrem blöden System-Of-A-Down-Hemd!“, sagte Hanni.
„Warum?“
„Merkst du nicht, wie die redet?“
„Nein. Wie denn?“
„Die redet wie ein Schwein.“
„Wie redet denn ein Schwein?“ Laura lachte.
Ihre Freundin hielt eine Hand vor den Mund und rülpste. Laura musste losprusten und sprang vom Bordstein in den Rinnstein und wieder auf den Bordstein. Sie stellte sich auf einen Fuß und drehte sich im Kreis und warf den Kopf nach hinten und schaute nach oben in den grauen Himmel und drehte sich weiter und lachte und wankte, weil sie auf einem Bein hüpfte und nach oben sah und sich drehte – und fiel ihrer Freundin in die Arme.
In den Armen ihrer Freundin prustete es aus Laura hervor: „Die Befeld ist in einen Hund verliebt. Der Hund heißt Ivan und kommt aus Moskau und ist den ganzen Weg aus Russland hierher gelaufen, nur weil die Befeld in ihn verliebt ist. Weil sie ihm Liebesbriefe geschickt hat.“
„Weil Ivan der Befeld seine Liebe gestanden hat“, fügte Hanni hinzu und drückte Laura ganz fest an sich.
„Der Hund ist aber ein Arschloch“, meinte Laura. „Er liebt die Befeld nicht wirklich. Er macht ihr nur was vor.“
„Er will die deutsche Staatsbürgerschaft!“ Die Freundin schubste Laura zärtlich.
„Aber er hat die Befeld kleingekriegt, als er ihr sagte, dass er ihr gerne ein Kind machen würde und dass nuuuuuur sie die Mutter seiner Kinder sein kann.“
„Morgen werde ich die Befeld warnen“, meinte ihre Freundin.
„Wegen Ivan?“
„Ja.“
„Nein! Tu das nicht!“
„Doch. Sie tut mir leid.“
„Mir nicht“, schimpfte Laura.
„Mir schon.“
„Mir aber...“
„Mir überhaupt schon sehr.“
„Mir überhaupt eigentlich schon gar nicht mehr.“
„Mir viel viel mehr als überhaupt alles sehr.“
„Mir fuul fuul uba uba luba kreer.“
Übermütig lachte es aus Hanni hervor. Kräftig stieß ihre Faust gegen Lauras Oberarm. Sie fassten sich an der Hand und rannten los. Sie rannten vorbei an den dunkelgrünen Hecken, welche die großen Grundstücke wie Mauern umgaben Es roch nach frisch geschnittenem Lebensbaum. Ein Gärtner kehrte die hellgrünen Heckentriebe im Rinnstein zusammen. Laura schrie „Hallo“ und kicherte. Im Rennen drehte sie ihren Kopf zur Seite und sah wie die Eingangspostamente der Häuser an ihr vorbeizogen: scharfkantige, graue Betonquader, an denen Klingelknöpfe fixiert waren und im Licht der Nachmittagssonne aufblinkende Messingschilder, in welche die Familiennamen geprägt waren. Oder kaum mehr zu entziffernde Namensschriftzüge hinter grauen Plastikplättchen. Im Innenraum der Quader standen Mülltonnen – das wusste Laura. Sie hatte die Eisentüren schon einige Male geöffnet oder sich drinnen versteckt.
Als die beiden am Grundstück der Aettingers vorbeikamen, ertönte das Brummen eines Rasenmähers. Denen gehörte das große Aluminiumschmelzwerk, das Laura schon einmal mit ihrem Vater zusammen mit Herrn Aettinger besichtigt hatte. Das Dröhnen des Rasenmähers wurde lauter. Es kam aus dem Garten dort hinter dem langen breiten Haus mit den weit überstehenden Dachrändern und der steil ansteigenden Eingangstreppe.
Beim nächsten Grundstück lugte plötzlich eine riesige feuchte Dobermannschnauze zwischen den Heckensträuchern hervor und erschreckte die beiden mit ihrem Gebell fast zu Tode. Sie schrien wie am Spieß und flüchteten zur Straßenmitte. Erst als sie am Anwesen des Lederwarenfabrikanten Droegerts vorüberkamen, war nichts mehr zu hören – nur das entfernte Surren eines Grasschneiders. Bis schließlich sämtliche Geräusche verstummt waren. Laura und ihre Freundin gingen nun langsamer. Zuletzt trotteten sie im Gleichschritt nebeneinanderher.
Laura saß immer noch in ihrem Zimmer und dachte an ihre Freundin und daran, dass die viel beliebter war als sie, in der Klasse und in der ganzen Schule. Von den anderen wurde sie kaum beachtet. Die Jungs fanden sie schräg.
Die Hanni, unter deren Pullover sich schon deutlich Brüste abzeichneten, stand überall im Mittelpunkt. Die Hanni hatte einen coolen Style. Wenn morgens, eine Viertelstunde vor Unterricht, alle im Klassenraum waren und über Serien und You-Tube-Clips redeten, konnte Hanni immer die Sätze aus einer Serie oder einem Spielfilm wiedergeben, die am witzigsten oder coolsten waren. Und alle lachten. Wenn sie, Laura, dann etwas von sich gab, hörte sie nur ihr eigenes Lachen. Keines der Mädchen und auch keiner der Jungs fand in irgendeiner Weise das lustig, was sie lustig fand. Hanni ging doch nur immer mit ihr zusammen nach Hause, weil sie im gleichen Viertel wohnten. Aber ihre Eltern waren reicher als die Eltern von Hanni. Eigentlich war das Laura egal. Aber in diesem Moment zählte es.
Laura nahm sich fest vor, morgen erst ganz kurz vor Unterrichtsbeginn ins Klassenzimmer zu kommen.
Sie entschied, Hanni nicht mehr als beste Freundin einzustufen.
Nun fühlte sie sich besser.
II. Auto
„Er wird dir gefallen“, sagte Markus und sah im Rückspiegel, wie Christine den Kopf gesenkt hielt und konzentriert nach unten blickte. Sie schälte Orangen.
„Er ist dein Geschäftspartner“, erwiderte Christine schälend, „warum müssen wir ihn heute treffen.“
„Ach komm, das passt doch gut. Wir schauen uns dieses Kloster an und danach gehen wir ins Klosterbräustüberl. Das hat er uns empfohlen. Er wird dir gefallen, glaube ich.“
„Warum müssen wir in dieses scheiß Kloster?“, rief Laura, die neben Christine hinten im Wagen saß.
„Jetzt lass doch Papi in Ruh’!“, meinte Patricia. Immer wenn Patricia ihn verteidigte, wusste Markus, dass er nichts mehr sagen musste, da alles gesagt war – nachdem Patricia ein Machtwort an Laura gerichtet hatte.
„Jetzt lass doch Papi in Ruh’!’’, hallte es in seinem Kopf nach: diese kristallklare Stimme seiner hochgewachsenen und hochkontrollierten älteren Tochter, die reglos neben ihm auf dem Beifahrersitz saß und im Gegensatz zu der kleineren ihn niemals von sich aus anredete, beim Fahren. Es sei denn Markus selbst sprach sie an. Dann antwortete sie. Von Patricia kam der Rückhalt. Bei allem, was er tat. Wie eine Skulptur saß sie da, wie eine in den Kiel geschnitzte Galionsfigur eines Segelschiffs, bildhübsch sowieso. Als würde sie durch dieses bestimme Dasitzen das Wesen ihres Vaters gutheißen, flankieren. Ihr Schweigen war eine einzige große Zustimmung.
Laura äffte ihre Schwester nach: „Papperlipapi, gell Patricia, papperlipapi.” Eigenwillig schlug sie neben ihrer Orangen schälenden Mutter ihr Buch auf, mit dem sie eine geheime Freundschaft pflegte, von der niemand etwas ahnte.
„Was liest du denn für schwere Bücher?“, fragte ihre Mutter.
„Wieso. Ich lese gerne.“
„Ja, aber gleich so was.“
„Ja und?“
„Theodor Fontane.“
„Laura liest nur schwere Sachen“, tönte es von vorne. Ihre Schwester drehte sich ruckartig um und maß Laura mit kühlem, stechenden Blick: „Laura mag es eben, wenn sie bewundert wird.“
Christine war mit der letzten Orange fertig, reichte die Orangenschnitten, von denen keine einzige eingerissen war, an die Drei weiter, und meinte: „Bisher hast du Arbeit und Wochenende immer trennen können. Ich reg’ mich nicht auf, aber ich meine nur, es passt doch nicht, wenn wir mit unseren beiden Töchtern dort aufkreuzen und er allein mit uns zu Abend isst, in dieser Klosterwirtschaft.“
Markus sah nach vorne auf die Straße. Er musste runter von der Autobahn; er setzte den Blinker. Für einige Momente erklang ein sanft klackendes Geräusch, und er fuhr die Ausfahrt hinaus. Das Klicken des Blinkers war ihm eine willkommene Antwort auf die Fragen seiner Frau, die sie aber ohnehin immer so formulierte, dass eigentlich keine Antworten nötig waren.
„Wenn der das empfiehlt, dieses Klosterbräustüberl, dann muss das was Besonderes sein. Kannst du mir glauben!“
Laura klappte hörbar ihr Buch zu und fragte: „Wer ist das?“
„Ein zukünftiger Geschäftspartner von mir“, antwortete ihr Vater von vorne. „Es war reiner Zufall. Beim Mountainbiken. Wir kannten uns nicht. Er fuhr so gut wie ich, am Berg, und weil keiner den anderen abhängen konnte, waren wir irgendwann auf gleicher Höhe und dann mussten wir beide lachen – genau im selben Moment. Gerade als er wieder versucht hatte zu überholen, kurz nachdem ich ihn überholt hatte, das machten wir bestimmt an die fünf, sechs Mal: da schaute er zu mir rüber, und wir lachten.“
„Hi hi, ha ha, hu hu “, rief Laura.
„Ja, so kamen wir ins Gespräch. Eigentlich stellte sich erst viel später heraus, dass wir in derselben Branche sind. Er ist sogar ein verdammt Wichtiger. Aber das haben wir echt erst am Schluss festgestellt, wie gesagt. Und so kam das zustande, die ganze Sache, und jetzt treffen wir ihn, treffe ich ihn, zu einem ersten konkreteren Gespräch. Heute Abend im Klosterbräustüberl. Aber das hatervorgeschlagen. Na, er gehört eben zur nächsten Generation von Managern, vielleicht zehn Jahre jünger als ich. Nicht mehr wie wir: immer mit Krawatte und so. Aber vielleicht will er auch ein bisschen Familie spüren. Er hat nämlich keine, ist allein.“
„Au, toll, dann soll er uns spüren“, rief Laura.
„Ich weiß nicht, der ist einfach ganz bescheiden und man meint gar nicht, dass er so ein hohes Tier ist. Wirkt eher wie ein Journalist oder so was. Ich weiß nicht... ein ganz feiner Kerl.“
Als er sprach, hatte Markus plötzlich die Vorstellung einer kompletten Fusion von Ludwig, seinem neuem Geschäftspartner, Christine, Patricia und Laura: alle zusammen, in unendlicher Gemeinschaft, sich selbst auflösend, miteinander, in Liebe – nicht körperlich, natürlich – aber, egal, nein, eine irrwitzige Vorstellung, durch die er da wie durch eine Nebelbank hindurchglitt, für wenige Momente. Er selbst würde den Raum verlassen, damit alle noch besser zusammenfinden könnten, noch schneller, und sich nicht beobachtet fühlten, von ihm; damit sie sich gegenseitig völlig unbekümmert entdecken könnten. Klammheimlich würde er hinausschleichen. Sie würden ihn einfach vergessen. Aus dem Gedächtnis streichen. Das ist vollkommene Freundschaft. Zwischen ihm und Ludwig. Er wird sein Freund. Das wusste Markus nun. Es soll eine große Freundschaft sein, nicht nur eine Geschäftsbeziehung, wie die Beziehungen der letzten Jahre, nein – eine echte Männerfreundschaft.
„Was erwartet ihr euch denn von Ludwig?“, fragte Markus plötzlich.
„Nichts“, sagte Patricia, „was sollen wir uns denn erwarten!“
„Gar nichts“, erwiderte Markus, „ich meinte nur.“
„Was meinst du?“, fragte Patricia.
„Euer Vater meint...“, mischte sich Christine ein, „dass dieser Ludwig ein wichtiger Geschäftspartner für ihn ist. Und wenn man Geld verdienen und im Geschäft bleiben will, braucht man gute Partner, neue Partner, immer wieder.“
„Nein, das meinte ich nicht“, setzte Markus nach. „Ich meinte, dass...“, er schwieg, „Ach, es ist egal.“
„Was meinst du?“, hakte Christine nach.
Markus blickte gebannt geradeaus, verkrampfte sich ein wenig und sagte dann: „Seit langem habe ich nicht mehr so einen getroffen. Er ist was Besonderes. Ich weiß nicht. Das habe ich sofort gemerkt,sofort.“ Er stockte. „Und es ist mir eigentlich auch egal, was ihr von ihm haltet. Und wenn es für euch so eine Last ist und so furchtbar, ihn nachher kurz zu treffen, dann könnt ihr euch von mir aus auch an einen anderen Tisch setzen oder sonst was tun.“
Beinahe wäre Laura eingeschlafen. Doch noch immer starrte sie durch ihre schmalen Lider aus dem Fenster.
Seitdem sie von der Autobahn abgefahren waren, summte der Wagen über die Landstraße. Laura konnte kaum noch gegen die Müdigkeit ankämpfen. Die vorbeiziehende Landschaft verschwamm vor ihren Augen, die Landschaft mit ihren kahlen Bäumen, jetzt im März, mit ihrem alten matten Grün vom Vorjahr, Gras, vom Winter fahl, herzlos. Sie war die Einzige, die aus dem Fenster sah. Die immerzu das Grün betrachten musste. Es machte sie matt, steigerte ihren Unmut ins Unermessliche, heute, am Sonntag, in dieses Dreckskloster fahren zu müssen.
Diese Herzlosigkeit der Sonntage, die damit verbracht wurden, immer andere, immer langweiligere Ziele in der näheren oder weiteren Umgebung von Tannenhausen ausfindig zu machen, um dann mit der ganzen Familie dorthin zu fahren und den grausamen und nutzlosen Sonntag ebendort zu verbringen, hinter sich zu bringen, umzubringen, bis er sich nicht mehr rührte. „Ja, genauso ist es“, dachte Laura, der Sonntag war so, dass man nicht mehr glaubte, dass es noch irgendwas anderes gab, auf der Welt oder in diesem Leben. Heute würde es nur diesen Tag geben, danach nichts mehr, nie wieder. Nur diesen Sonntag.
„Was hören eigentlich Taube?“, fragte Laura in die Stille des Wageninnenraums. Da sich keiner angesprochen fühlte, rief sie: „Ihr wisst es nicht!“
„Was wissen wir nicht?“, reagierte endlich Patricia.
„Was Taube hören“, fauchte Laura.
„Was ist das jetzt wieder für eine blöde Frage“, entgegnete Patricia.
„Dich hab ich nicht gefragt. Hm, Papa, sag mal, was hören Taube?“
„Wie meinst du das?“, fragte Markus.
„Also, eigentlich denkt man ja, die hören gar nichts; aber um gar nichts zu hören, muss man ja hören können.“
„Wie meinst du das?“, wiederholte er.
„Na ja, wenn man nichts hören kann, dann kann man ja auch keine Stille hören, zum Beispiel.“





























