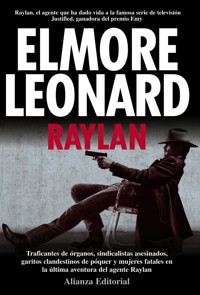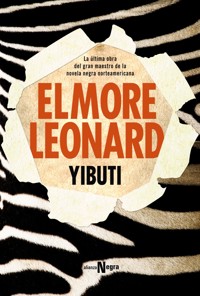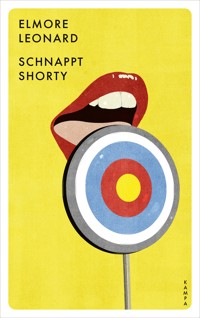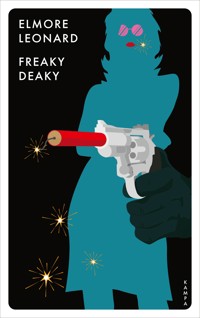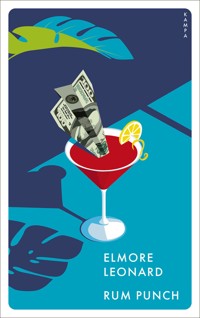
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jackie Burkes Zukunft sieht düster aus: Nach zwanzig Jahren als Stewardess einer kleinen Fluggesellschaft wird sie noch auf dem Flughafen in Palm Beach in Gewahrsam genommen. In ihrer Tasche: fünfzig Riesen, die sie aus Jamaica in die USA geschmuggelt hat. Das FBI weiß, dass Jackie im internationalen Waffenschiebergeschäft unterwegs ist und will, dass sie die Namen ihrer Auftraggeber nennt. Doch wenn sie redet, so viel ist klar, dürfte ihr Leben nicht mehr viel wert sein. Jackie wählt die Alternative: fünf Jahre Sicherheitsverwahrung. Da taucht als Retter in der Not Max Cherry auf, seines Zeichens Kautionsagent, und bietet an, sie auszulösen. Nicht ganz uneigennützig, versteht sich. Max hofft auf ein Geschäft, außerdem hat Jackie es ihm angetan. Die allerdings hat eigene Pläne …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Elmore Leonard
Rum Punch
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Hans M. Herzog
Kampa
Für Jackie, Carole und Larry
1
Sonntagmorgen nahm Ordell Louis mit ins Zentrum von Palm Beach, um sich mit ihm die White-Power-Demonstration anzusehen.
»Junge Nazi-Skinheads«, sagte Ordell. »Guck mal, da marschieren sogar Nazi-Mädels die Worth Avenue runter. Ist das nicht unglaublich? Als Nächstes kommt jetzt der Klan angetrabt, heute eher spärlich vertreten. Einige tragen Grün, offenbar die neue Frühlingsfarbe von diesen Dumpfbacken. Die hinter ihnen sehen aus wie die Nazi-Biker von Rocker für Rassismus, auch bekannt als Dixie Knights. Wir müssen weiter nach vorn«, sagte Ordell und zog Louis mit sich fort.
»Ich will dir einen Mann zeigen. Mal sehen, an wen er dich erinnert. Mir hat er erzählt, dass sie die South County Road raufmarschieren. Sie wollen ihre Versammlung am Rathaus abhalten, auf der Treppe vor dem Springbrunnen. Hast du schon mal so viel Polizei gesehen? Klar, hast du vermutlich. Aber bestimmt nicht so viele verschiedene Uniformen auf einem Haufen. Und die lassen nicht mit sich spaßen, haben Helme auf und Schlagstöcke dabei. Bleib auf dem Gehweg, sonst ziehen sie dir noch eins über den Schädel. Sie halten den Nazis die Straße frei.«
Die ersten Leute drehten sich um und betrachteten Ordell.
»Mann, die vielen Fotografen und Fernsehkameras. Dieser Scheiß ist erstklassiges Nachrichtenmaterial, das lässt sich keiner entgehen. Normalerweise sind hier sonntags bloß reiche Weiber mit ihren Schoßhündchen unterwegs. Pipi machen. Also die Hündchen, nicht die Weiber.« Eine junge Frau vor ihnen grinste den beiden über die Schulter zu, und Ordell sagte: »Wie geht’s, Baby? Alles klar?« Dann sah er an ihr vorbei nach vorn, sagte mit einem Blick zu Louis: »Ich glaub, ich seh ihn«, und drängte sich durch die Menge näher zur Straße. »Genau, da ist er. Der im schwarzen Hemd mit Schlips. Ein ausgewachsener Nazi-Skinhead. Ich nenn ihn Big Guy. Das hört er gern.«
»Das ist ja Richard«, sagte Louis. »Lieber Himmel.«
»Zum Verwechseln ähnlich, oder? Weißt du noch, wie Richard immer über den ganzen Nazi-Dreck gestolpert ist, der in seinem Haus rumlag? Wie viele Knarren er besessen hat? Big Guy hat noch viel mehr.«
Louis sagte: »Harter Bursche. Sieh dir den an.«
»Der will es wissen. Ist ein Waffennarr«, sagte Ordell. »Weißt du, wo man solche Typen sonst noch zu sehen kriegt? Auf Waffenbörsen.«
Ordell wartete ab. Louis hätte ihn jetzt fragen müssen, was er auf Waffenbörsen zu suchen hatte, doch er ließ es bleiben. Er war zu beschäftigt damit, die Nazi-Mädels zu beäugen, alles dürre Rednecks mit kurz geschorenen Haaren, wie Jungs.
Ordell sagte: »Ich könnte denen Sachen zeigen, da würde denen Hören und Sehen vergehen.«
Und wieder drehten sich Köpfe zu ihm um. Einige Leute grinsten. Louis trat den Rückzug an, und Ordell musste sich beeilen. Louis war breit geworden, weil er im Gefängnis mit Gewichten trainiert hatte.
»Hier lang«, sagte Ordell, und dann spazierten sie vor der Demo die South County Road entlang. Zwei alte Kumpel: Ordell Robbie und Louis Gara – ein hellhäutiger Schwarzer und ein dunkelhäutiger Weißer. Beide ursprünglich aus Detroit, wo sie sich in einer Kneipe kennengelernt hatten, ins Gespräch gekommen waren und herausgefunden hatten, dass sie beide im Southern Ohio im Knast gesessen hatten und einige Ansichten teilten. Bald darauf war Louis nach Texas gegangen, wo er erneut verhaftet wurde. Als er wieder nach Hause zurückkehrte, legte Ordell ihm einen Plan vor: Eine Million Dollar waren drin, wenn sie die Frau eines Typen entführten, der illegal verdientes Geld auf den Bahamas geparkt hatte. Die Sache ging voll in die Hose, und Louis schwor sich: Einmal und nie wieder. Das war jetzt dreizehn Jahre her …
Und jetzt hatte Ordell wieder einen Plan. Louis spürte das. Nur deswegen sahen sie zu, wie Skinheads und andere Trottel die Straße hochmarschierten.
Ordell sagte: »Weißt du noch, wie du gerade aus Huntsville raus warst und ich dich mit Richard zusammengebracht hab?«
Gleich würde er mit der Sprache rausrücken. Louis war sich sicher.
»Das war damals so ähnlich wie heute«, sagte Ordell. »Da hat garantiert das Schicksal seine Hand im Spiel. Diesmal kommst du aus dem Knast in Florida, und ich zeige dir Big Guy, der aussieht wie ein wiederauferstandener Richard.«
»Ich weiß nur noch«, sagte Louis, »dass ich mir damals gewünscht hätte, ich hätte Richard nie kennengelernt. Was hast du bloß auf einmal mit diesen Nazis?«
»Es ist lustig, ihnen zuzusehen«, sagte Ordell. »Sieh dir mal ihre Fahne an, die mit dem verwackelten Blitz drauf. Keine Ahnung, was sie damit meinen. SS? Oder Captain Marvel?«
Louis fragte: »Hast du wieder eine deiner Ideen, wie man an eine Million rankommt?«
Ordell wandte sich von der Parade ab, musterte ihn kühl und ernst. »Du bist in meinem Schlitten gefahren. Das ist nicht bloß eine Idee, Mann. Die Kiste kostet richtiges Geld.«
»Warum zeigst du mir dann diesen Nazi?«
»Big Guy? Eigentlich heißt er Gerald. Als ich mal Jerry zu ihm gesagt hab, hat er mich fast vom Boden hochgehoben und gesagt: ›So heiße ich nicht, Jungchen.‹ Ich hab ihm gesagt, dass ich für Rassentrennung bin, darum hält er mich für okay. Bin ihm einmal begegnet – auf ’ner Waffenbörse.«
Wieder versuchte er Louis zu ködern.
Louis sagte: »Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was wollen wir hier?«
»Hab ich dir doch gesagt. Ich wollte sehen, an wen dich Big Guy erinnert. Hör zu, es ist noch jemand hier, du wirst es nicht glauben. Eine Frau. Rat mal, wer.«
Louis schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung.«
Ordell grinste. »Melanie.«
»Du machst Witze.«
Noch jemand aus der Zeit vor dreizehn Jahren.
»Tja, wir haben uns nicht aus den Augen verloren. Melanie rief mich irgendwann an … Ich hab sie in einer Bude von mir untergebracht, oben in Palm Beach Shores. Willst du zu ihr?«
»Ihr wohnt zusammen?«
»Zeitweise, könnte man sagen. Wenn du willst, können wir heute Nachmittag vorbeifahren. Melanie ist immer noch ein prachtvolles strammes Mädchen. Mann, ich kann dir sagen, das Schicksal hat wirklich Überstunden gemacht, um uns alle wieder zusammenzubringen. Ich überlege ernsthaft, ob ich Big Guy mit Melanie bekannt mache.«
Er kam langsam zur Sache. Louis spürte das.
»Wozu?«
»Nur um zu sehen, was passiert. Wäre bestimmt interessant. Du kennst ja Melanie, sie hat sich nicht verändert. Kannst du sie dir zusammen mit diesem Nazi-Arschloch vorstellen?«
Ordell benahm sich wie ein kleiner Junge, der ein Geheimnis hatte – er wollte es unbedingt verraten, wollte aber danach gefragt werden.
Er sagte zu Louis: »Ich wette, du hast keinen blassen Schimmer, wie es weitergehen soll, oder? Kommst aus dem Knast und fängst wie immer bei null an. Hast deinen Schnurrbart abrasiert, wie ich sehe. Das Haar wird langsam grau. Aber du hältst dich in Form, das ist gut.«
»Und du?«, fragte Louis. »Hast deine Haare geglättet? Du hattest doch früher ’n Afro.«
»Man muss mit der Zeit gehen, Mann.«
Ordell fuhr sich vorsichtig mit der Hand über die straff zurückgekämmten Haare, bis er beim Zopf anlangte, den er zwischen den Fingern zwirbelte und damit herumspielte. Er sagte: »Nein, du hast keine Ahnung, was du jetzt machen willst.«
Louis sagte: »Das glaubst du, hm?«
»Glotzt mich an mit seinem Knackiblick. Na, irgendwas hast du im Knast doch wohl gelernt«, sagte Ordell. »Aber ehrlich, Louis, mit dem Hemd, das du da anhast, siehst du nicht wie ’n Bodybuilder aus, mehr wie ’n Tankwart. Auf der Hemdtasche da müsste ›Lou‹ draufstehen. Windschutzscheibe putzen, Ölstand prüfen …«
Dann grinste er, um zu zeigen, dass er nur Spaß machte. Ordell in Leinen und Gold – orangefarbener Pullover mit rundem Halsausschnitt und weißer Hose, das Gold prangte an Hals, Handgelenk und zwei Fingern.
Er sagte: »Komm schon, sehen wir uns die Show an.«
Louis sagte: »Du bist die Show.«
Ordell lächelte, bewegte die Schultern wie ein Boxer. Sie näherten sich wieder der Menge, die von einem gelben Absperrband der Polizei zurückgehalten wurde, das man um die Treppe vor dem Springbrunnen gespannt hatte. Oben stand ein junger Nazi und sprach zu den unten versammelten Menschen in ihren Rassistenklamotten. Ordell wollte sich durch die Menge zwängen, um weiter nach vorn zu kommen, aber Louis packte ihn am Arm.
»Ich geh da nicht hin.«
Ordell drehte sich um und sah ihn an. »Das ist nicht wie im Knasthof, Mann. Hier hat keiner ein selbst gebasteltes Messer dabei oder so was.«
»Mit dir geh ich da nicht hin.«
»Na schön«, sagte Ordell. »Muss ja nicht sein.«
Sie suchten sich eine Stelle, von der aus sie den jungen Nazi gut sehen konnten. Der schrie gerade: »Was wollen wir?« Und seine Kumpel, die Nazi-Mädels und die übrigen Bekloppten schrien zurück: »White power!« Das ging so lange, bis der junge Nazi fertig war und schrie: »Eines Tages wird die Welt begreifen, dass Adolf Hitler recht hatte!« Darauf brüllten manche Leute aus der Menge, er sei ein hirnverbrannter Idiot. Und er brüllte in die Menge zurück: »Wir werden dieses Land für unser Volk zurückerobern!«, wobei sich seine junge Nazi-Stimme überschlug. Und die Zuhörer riefen zurück, was für ein Volk er da meine, wohl solche Ärsche wie ihn. Eine Schwarze in der Menge sagte: »Erzähl so was in Riv’era Beach, und du bist tot.« Der junge Nazi-Skinhead begann »Sieg Heil!« zu grölen, aus vollem Hals und immer wieder, und die Bekloppten stimmten ein und reckten ihre Arme zum Nazi-Gruß in die Höhe. Nun riefen ihnen junge Typen aus der Menge zu, sie seien Rassistenschweine und sollten nach Hause gehen, na los, zieht endlich Leine, und damit war die Show offenbar aus.
Ordell sagte: »Gehen wir.«
Sie gingen rüber zum Ocean Boulevard, wo sein Auto stand, ein schwarzes Mercedes-Cabrio mit offenem Verdeck. Die Parkuhr war abgelaufen, und auf der Fahrerseite steckte ein Strafzettel hinter dem Scheibenwischer. Ordell zog den Wisch raus und warf ihn zu Boden. Louis sah zu, ohne etwas zu sagen. Er sagte überhaupt kaum etwas, bis sie auf der mittleren Brücke waren und nach West Palm Beach zurückfuhren. Dann legte er los.
»Warum hast du mir diesen Typ gezeigt? Hat er dich Nigger genannt, und jetzt willst du ihm die Beine brechen?«
»Diesen Rachescheiß«, sagte Ordell, »den hast du bestimmt von den Itakern, mit denen du jetzt rumhängst. Du glaubst, sich an jemandem zu rächen, ist das Größte. Na klar doch.«
»Willst du dir ansehen, wo ich rumhänge?«, fragte Louis. »Bieg rechts in die Olive Avenue ein. Fahr die Banyan hoch, die frühere First Street, und halt dich links.« Als sie auf der Olive waren, sagte Louis: »Das da drüben ist das Gerichtsgebäude.«
»Ich weiß, wo hier die Gerichte sind«, sagte Ordell. Jetzt bog er in die Banyan Street ein und fuhr Richtung Dixie Highway.
Auf halbem Weg dorthin sagte Louis, er solle anhalten. »Das hier, das weiße Gebäude«, sagte er, »da treib ich mich rum.«
Ordell wandte den Kopf und betrachtete ein flaches Haus auf der anderen Straßenseite, ein Schaufenster mit dem Schriftzug Kautionsbüro Max Cherry.
»Du arbeitest für einen Kautionsagenten? Mir hast du erzählt, du wärst bei irgend so einer Versicherungsgesellschaft, die sich die Itaker unter den Nagel gerissen haben.«
»Glades Mutual in Miami«, sagte Louis. »Max Cherry stellt für den Verein Kautionen aus. Ich sitz im Büro … wenn einer seinen Gerichtstermin platzen lässt, hol ich ihn.«
»Ach ja?« Das klang schon besser, als wäre Louis Kopfgeldjäger, jemand, der geflüchtete Bösewichte einfing.
»Hauptsächlich soll ich die dicken Kautionen für Drogenhändler reinholen, hundertfünfzig Riesen und mehr.«
Ordell sagte: »Tja, offenbar hast du im Knast ein paar Kontakte geknüpft. Haben die dich deshalb eingestellt?«
»Der Tipp kam von meinem Zellennachbarn. Hat seine Frau umgebracht. Er hat mir gesagt, ich soll Freunde von ihm aufsuchen, wenn ich aus dem Knast komme. Ich geh also hin, und sie fragen mich, ob ich irgendwelche Kolumbianer kenne. Darauf ich: Klar, ein paar. Ein paar Typen, die ich über einen Knacki kennengelernt habe. J.J. heißt er. Hab dir doch von ihm erzählt. Der, den sie wieder eingebuchtet haben. In wohn in seinem Haus.« Aus der Tasche seines Arbeitshemdes fischte Louis eine Zigarette. »Ich besuch also diese Kolumbianer unten in South Beach und verteile Max Cherrys Visitenkarten. ›Macht Ihnen das Gefängnis Kummer? Kautionen unter dieser Nummer.‹ Er hat noch ’ne andere. Auf der steht: ›Dieser Anruf wird sich lohnen, denn hier kriegen Sie Kautionen‹, und dann kommt sein Name mit Telefonnummer und so.« Louis griff wieder in die Tasche und zog ein Streichholz heraus.
Ordell wartete. »Und?«
»Das ist alles. Die meiste Zeit sitze ich nur rum.«
»Und du kommst mit den Kolumbianern klar?«
»Warum nicht? Die wissen, wo ich herkomme.« Louis zündete das Streichholz an seinem Daumennagel an. »Die spielen ihre Cha-Cha-Musik so laut, dass man sowieso kein Wort versteht.«
Ordell holte eine Zigarette seiner Marke raus, und Louis gab ihm zwischen seinen gewölbten Händen Feuer.
»Du klingst nicht gerade glücklich, Louis.«
Er sagte: »Egal, was du vorhast, ich will nichts damit zu tun haben, klar? Einmal hat gereicht.«
Ordell lehnte sich zurück und zog an seiner Zigarette. »Der tugendhafte Louis. Dann bin ich also schuld, dass die Entführungsgeschichte in die Hose gegangen ist?«
»Du hast Richard ins Boot geholt.«
»Und was hat das damit zu tun?«
»Er hat versucht, sie zu vergewaltigen!«
»Okay, und du hast es verhindert. Aber dadurch ist der Deal nicht in die Hose gegangen, Louis. Du kennst doch den Grund. Wir sagen zu dem Mann: Bezahl, oder du siehst deine Frau nie wieder … So macht man das schließlich, oder? Und dann stellt sich raus, dass er sie gar nicht wiedersehen will, keine fünf Minuten, weil er lieber mit Melanie in seinem Liebesnest auf den Bahamas herumturtelt! Wenn man mit dem Mann nicht verhandeln kann und ihn auch nicht bedrohen kann, Louis, dann hat man nicht die geringste Chance, an sein Geld zu kommen.«
»Es hätte sowieso nicht funktioniert«, sagte Louis. »Wir waren doch völlig ahnungslos.«
»Ich merk schon, du bist jetzt der Fachmann. Aber wer war hier dreimal im Knast und wer nur einmal? Hör zu, ich hab jetzt Leute, die für mich arbeiten. Ich hab Brüder, die machen die Drecksarbeit. Ich hab einen Mann drüben in Freeport … erinnerst du dich noch an Mr. Walker? Ich hab einen Jamaikaner, der ist spitze im Kopfrechnen. Kann addieren, kann multiplizieren, was Sachen wie viel Mal kosten« – Ordell schnippte mit den Fingern – »einfach so.«
»Du hast also einen Buchhalter«, sagte Louis. »Das freut mich für dich.«
»Hab ich dich gebeten, für mich zu arbeiten?«
»Noch nicht.«
»Weißt du, was ein M-60-Maschinengewehr ist?«
»’ne große Knarre, ’ne Militärwaffe.«
»Davon hab ich drei für zwanzig Mille das Stück verkauft und mir diesen Schlitten angeschafft«, sagte Ordell. »Wozu brauch ich dich?«
2
Montagnachmittag rief Renee Max in seinem Büro an und teilte ihm mit, sie brauche sofort achthundertzwanzig Dollar, und er solle ihr einen Scheck bringen. Renee war gerade in ihrer Galerie in der Gardens Mall am PGA Boulevard. Allein um hinzukommen, hätte Max mindestens eine halbe Stunde gebraucht.
Er sagte: »Renee, es geht nicht, selbst wenn ich wollte. Ich warte darauf, dass sich ein Typ bei mir meldet. Gerade habe ich mit dem Richter über ihn gesprochen.« Dann musste er zuhören, während sie erzählte, wie sie versucht hatte, ihn zu erreichen. »Da war ich doch gerade im Gericht. Hab deine Nachricht auf dem Pieper erhalten … Bin eben erst zurückgekommen, ich hatte noch keine Zeit … Renee, ich arbeite, Herrgott noch mal.« Max verstummte, hielt zwar noch den Hörer ans Ohr, konnte aber nichts mehr sagen. Als er aufsah, stand da ein Schwarzer in einem gelben Sportsakko in seinem Büro. Ein Schwarzer mit glänzenden Haaren und einer Miami-Dolphins-Sporttasche in der Hand. Max sagte: »Renee, hör mal kurz zu, okay? Hier geht’s um einen Knaben, der zehn beschissene Jahre in den Bau muss, wenn ich ihn nicht erwische und vor Gericht bringe, und da verlangst du von mir, dass ich … Renee?«
Max legte den Hörer auf.
Der Schwarze sagte: »Aufgelegt, hm? Ihre Frau, vermute ich.«
Der Typ grinste ihn an.
Max war drauf und dran zu sagen: Stimmt, und wissen Sie, was sie mir an den Kopf geworfen hat? Eigentlich hätte er das gern gesagt. Aber das war ja Unsinn, schließlich kannte er den Kerl gar nicht, hatte ihn noch nie gesehen …
Der Schwarze sagte: »Im Vorzimmer war keiner, da bin ich einfach reingekommen. Es ist was Geschäftliches.«
Das Telefon klingelte. Max nahm den Hörer ab, deutete mit der anderen Hand auf einen Stuhl und sagte: »Kautionsbüro.«
Ordell hörte ihn sagen: »Ist mir egal, wo du warst, Reggie, du hast deinen Gerichtstermin verpasst. Jetzt muss ich … Reg, hör mir gefälligst zu, ja?« Jetzt redete dieser Max Cherry mit ruhigerer Stimme als vorhin zu seiner Frau. Bei dem Gespräch mit ihr hatte er sich gequält angehört. Ordell stellte seine Sporttasche auf den Schreibtisch, der dem von Max Cherry direkt gegenüberstand, und kramte eine Zigarette raus.
Das hier sah eher aus wie die Behausung des Mannes, nicht wie ein Kautionsbüro. Die Wand hinter Max Cherry wurde vollständig von einem Regal eingenommen, in dem Bücher standen, alle möglichen Bücher, ein paar geschnitzte Holzvögel, ein paar Bierkrüge. Für ein derartig mieses Geschäft war das zu ordentlich, zu wohnlich. Der Inhaber selbst wirkte ordentlich, glatt rasiert, sein blaues Hemd offen, kein Schlips, muskulöse Schultern. Der gleiche dunkle, hart aussehende Typ wie Louis, dunkelhaarig, hohe Stirn. Vielleicht Mitte fünfzig. Eventuell italienischer Abstammung. Ordell war allerdings noch keinem Kautionsagenten begegnet, der nicht Jude war. Gerade erzählte Max dem Typ am Telefon, der Richter sei so weit, ihn wegzusperren. »Willst du das wirklich, Reg? Zehn Jahre riskieren statt sechs Monate mit Bewährung? Ich hab zu ihm gesagt: ›Euer Ehren, Reggie war immer ein vorbildlicher Mandant. Ich weiß, dass ich ihn im Handumdrehen finden werde …‹«
Ordell, der sich gerade eine Zigarette anzündete, stockte, weil Max stockte.
»… und wenn Handumdrehen nicht reicht, dann dreh ich ihm eben den Hals um.«
Hör dir den an. Ein echter Komiker.
»Ich kann den capias außer Kraft setzen lassen, Reg … Den Haftbefehl, Mann, die suchen dich steckbrieflich! Aber das heißt, dass ich dich abholen muss.«
Ordell atmete Rauch aus und blickte sich nach einem Aschenbecher um. Er sah das Rauchen-verboten-Schild über der Tür, die in eine Art Besprechungszimmer führte, wo ein langer Tisch stand, daneben so was wie ein Kühlschrank, eine Kaffeemaschine.
»Bleib bei deiner Mutter im Haus, bis ich dich abhole. Du musst wieder einfahren – aber bloß über Nacht. Morgen bist du wieder draußen, Ehrenwort.« Ordell sah zu, wie Max den Hörer auflegte. Max sagte: »Entweder ist er zu Hause, wenn ich hinkomme, oder ich hab ein Fünftausend-Dollar-Problem am Hals. Und was für eins haben Sie?«
»Ich sehe keinen Aschenbecher«, sagte Ordell und hielt die Zigarette hoch. »Das andere Problem: Ich brauche zehntausend Dollar Kaution.«
»Was können Sie als Sicherheit anbieten?«
»Ich muss wohl Geld hinblättern.«
»Haben Sie es dabei?«
»In meiner Tasche.«
»Benutzen Sie den Kaffeebecher auf dem Schreibtisch.«
Ordell ging um den Tisch herum. Er war leer, bis auf seine Sporttasche, ein Telefon und den Becher, in dem noch etwas Kaffee war. Er streifte die Asche ab, setzte sich in den Drehstuhl und wandte sich wieder Max Cherry hinter seinem Schreibtisch zu.
»Wenn Sie Geld haben«, sagte Max, »wozu brauchen Sie dann mich?«
»Kommen Sie«, sagte Ordell, »Sie wissen, wie die sind. Erst fragen sie einen, woher man’s hat, und dann behalten sie einen dicken Batzen, angeblich für Gerichtskosten. Die hauen einen übers Ohr, wo sie nur können.«
»Die Kaution kostet Sie tausend.«
»Das weiß ich.«
»Für wen ist es, einen Verwandten?«
»Der Typ heißt Beaumont. Sitzt oben im Gun Club.«
Max Cherry sah ihn weiterhin starr an, ein wenig vorgebeugt. Auf seinem Schreibtisch befanden sich ein Computer, eine Schreibmaschine und ein Stapel mit Aktenmappen, von denen eine geöffnet war.
»Hilfssheriffs haben ihn Samstagabend aufgegriffen«, sagte Ordell. »Erst hieß es nur Trunkenheit am Steuer, aber dann haben sie ›unerlaubten Waffenbesitz‹ draus gemacht. Er hatte eine Pistole dabei.«
»Zehntausend Dollar – das klingt nach mehr.«
»Sie haben seinen Namen durch den Computer gejagt und einen Treffer gelandet. Er hat schon mal gesessen. Oder vielleicht passt ihnen nicht, dass er Jamaikaner ist. Verstehen Sie? Die haben Angst, er könnte sich dünnemachen.«
»Falls er das macht und ich ihm nach Jamaika folgen muss, bezahlen Sie die Spesen.«
Das war interessant. Ordell sagte: »Sie glauben, Sie könnten ihn da unten finden? Ihn in ein Flugzeug setzen und zurückholen?«
»Wäre nicht das erste Mal. Wie heißt er mit vollem Namen?«
»Beaumont. Mehr weiß ich nicht.«
Während Max Cherry Unterlagen aus seiner Schreibtischschublade holte, warf er wieder einen Blick in Richtung Ordell, dachte bestimmt: Du streckst solche Beträge vor und kennst nicht mal seinen Namen? Ordell gefiel es, wenn die Leute ihn nicht einschätzen konnten, so wie dieser Mann hier. Guck ihn dir an – zögerte regelrecht, ihm die Frage zu stellen. Ordell kam ihm zu Hilfe: »Mir tun manche Leute einen Gefallen, die keine richtigen Namen haben, außer vielleicht Zulu oder Cujo. Einen nennen sie Wawa. Spitznamen. Wissen Sie, wie man mich gelegentlich nennt? Whitebread, wegen meiner hellen Hautfarbe. Oder einfach Bread. Das geht in Ordnung, ist keine Respektlosigkeit.« Mal abwarten, was der Mann davon hielt.
Er verriet es nicht. Er nahm den Telefonhörer ab.
Ordell rauchte seine Zigarette, sah zu, wie der Mann eine Nummer eintippte, und hörte, wie er sich mit dem Strafregister verbinden ließ und dann jemanden bat, nach den Haftunterlagen eines gewissen Beaumont zu suchen, vermutlich der Nachname, er wisse es aber nicht genau, und der Mann sei Samstagabend festgenommen worden. Er musste warten, bis er die gewünschte Auskunft erhielt, dann fragte er nach und füllte auf seinem Schreibtisch ein Formular aus. Als er fertig war und aufgelegt hatte, sagte er: »Beaumont Livingston.«
»Livingston, hm?«
»Beim letzten Mal«, sagte Max Cherry, »hat er neun Monate gesessen und wurde entlassen, vier Jahre auf Bewährung. Wegen Besitzes unregistrierter Maschinengewehre.«
»Was Sie nicht sagen.«
»Er hat also gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Da blühen ihm zehn Jahre, dazu kommt das mit dem unerlaubten Waffenbesitz.«
»Mann, das wird ihm gar nicht schmecken«, sagte Ordell. Er zog an seiner Zigarette und ließ sie in den Kaffeebecher fallen. »Beaumont ist fürs Knastleben nicht geschaffen.«
Max Cherry sah ihn wieder eine Weile an, bis er sagte: »Waren Sie schon mal im Gefängnis?«
»Vor langer Zeit. Als junger Mensch hab ich kurz im Ohio gesessen. Nichts Großes, Autodiebstahl.«
»Ihren Namen brauche ich auch und Ihre Adresse.«
Ordell sagte, er heiße Ordell Robbie, buchstabierte es ihm auf Nachfrage und gab an, wo er wohnte.
»Ist das ein jamaikanischer Name?«
»Hey, klinge ich vielleicht so? Wenn man die in ihrem Insel-Patwa reden hört, das ist wie ’ne andere Sprache. Nein, Mann, ich bin Afroamerikaner. Ich war mal Neger, Farbiger, Schwarzer, aber jetzt bin ich Afroamerikaner. Was sind Sie – Jude, oder?«
»Wenn Sie Afroamerikaner sind, bin ich wohl Franko-Amerikaner«, sagte Max Cherry. »Vielleicht mit einem Quäntchen kreolischem Blut drin, aus grauer Vorzeit.« Mittlerweile wühlte er in den Papieren auf seinem Schreibtisch, um die nötigen Unterlagen zu finden. »Sie müssen einen Kautionsantrag stellen, eine schriftliche Garantieerklärung abgeben, eine selbstschuldnerische Ausfallbürgschaft unterschreiben … in der steht, dass Sie die Spesen zahlen, falls Beaumont abhaut und ich ihn verfolgen muss.«
»Beaumont wird brav hierbleiben«, sagte Ordell. »Da müssen Sie sich schon was anderes einfallen lassen, um auf Ihren Schnitt zu kommen und mehr als zehn Prozent zu machen. Erstaunlich, dass Sie nicht versuchen, Ihre Gebühren zu verdoppeln, weil er Jamaikaner ist …«
»Das ist gesetzlich verboten.«
»Klar, soll aber vorkommen, oder? Ihr habt doch so eure Methoden. Einfach die Bürgschaft nicht zurückzahlen und so.« Ordell stand auf, ging mit der Sporttasche, die er im Souvenirladen im Flughafen gekauft hatte, zum Schreibtisch des Mannes und nahm ein Bündel Geldscheine heraus, alte Scheine, von einem Gummiring zusammengehalten. »Hundertmal hundert«, sagte Ordell, »und noch mal zehn für Ihren Anteil. Sie kommen ganz gut zurecht, was? Ich wüsste nur noch gern, wo Sie mein Geld aufbewahren, bis ich es zurückbekomme. In Ihrer Schublade?«
»In der Bank gegenüber, First Union«, sagte Max Cherry, nahm die Scheine und streifte den Gummiring ab. »Es geht auf ein Treuhandkonto.«
»Sie verdienen sich also mit den Zinsen was dazu, hm? Ich hab’s gewusst.«
Der Mann sagte weder Ja noch Nein, war jetzt ganz mit dem Zählen von Hundertdollarscheinen beschäftigt. Als er damit fertig war und Ordell die verschiedenen Papiere unterschrieb, fragte Max Cherry, ob er ihn zum Gefängnis begleiten wolle. Ordell richtete sich auf, dachte drüber nach und schüttelte dann den Kopf.
»Nur wenn’s unbedingt sein muss. Richten Sie Beaumont aus, ich lass von mir hören.« Ordell knöpfte seinen Zweireiher zu, das kanariengelbe Sportsakko, das er an diesem Nachmittag über dem schwarzen T-Shirt und der schwarzen Seidenhose trug. Da er sich fragte, wie groß dieser Max Cherry war, verabschiedete er sich mit: »Hat mich gefreut, mit Ihnen Geschäfte zu machen«, und streckte die Hand aus, absichtlich nicht weit genug. Max Cherry erhob sich darauf zu seiner vollen Größe von eins achtzig und ein paar Zerquetschten, einen Tick größer als Ordell, und reichte ihm seine Pranke, die dieser schüttelte. Der Mann nickte, das war’s, und wartete darauf, dass Ordell ging.
Ordell sagte: »Wissen Sie, warum ich zu Ihnen gegangen bin und nicht zu jemand anderem? Soviel ich weiß, arbeitet ein Freund von mir für Sie.«
»Sie meinen Winston?«
»Ein anderer, Louis Gara. Das ist mein weißer Freund«, sagte Ordell und lächelte.
Max Cherry nicht. Der sagte: »Den habe ich heute noch nicht gesehen.«
»Tja, egal, irgendwann erwische ich ihn mal.« Ordell nahm seine Tasche und ging zur Tür. Dort blieb er stehen und drehte sich noch einmal um. »Eine Frage habe ich noch. Fällt mir gerade ein. Was ist, wenn Beaumont vor dem Gerichtstermin von einem Auto überfahren wird oder so und dabei stirbt? Dann krieg ich das Geld doch trotzdem zurück, oder?«
In Wirklichkeit hieß das, er wusste, dass er es wiederbekam. Er war einer von denen, die sich bemühen, cool zu wirken, es aber kaum erwarten können, einem alles Mögliche über sich zu erzählen. Er kannte das System, wusste, dass man das zentrale Bezirksgefängnis nach der Straße, an der es lag, Gun Club nannte. Er hatte gesessen, kannte Louis Gara und fuhr in einem Mercedes-Cabrio weg. Willst du sonst noch was wissen? Ordell Robbie. Erstaunlicherweise hatte Max vorher noch nie von ihm gehört. Er wandte sich vom Fenster ab und ging wieder in sein Büro, um Kautionsformulare auszufüllen.
Als Erstes die Vollmacht. Max spannte die dafür vorgesehene Vorlage in die Schreibmaschine und hielt inne, betrachtete sein Problem. Es stach ihm zwangsläufig in die Augen, sobald er ein Formular ausfüllte, auf dem am oberen Rand die Worte Glades Mutual Casualty Company standen.
Die Vollmacht besagte, dass Max Cherry zugelassener Kautionsbevollmächtigter der Versicherungsgesellschaft war, in diesem Fall für Beaumont Livingston. Das bedeutete, dass die Versicherung ein Drittel der Prämie in Höhe von zehn Prozent bekam und ein Drittel davon zur Deckung von Verlusten in einen Fonds zahlte.
Falls Max Kautionen in Höhe von fünfzigtausend Dollar pro Woche übernahm, machte er fünf Riesen, abzüglich seiner Ausgaben und des Drittels, das Glades Mutual in Miami bekam. Es war zwar eine ziemliche Plackerei, brachte aber, wenn man die Zeit investierte, gutes Geld.
Das Problem war, dass, nachdem er neunzehn Jahre lang – zu allseitiger Zufriedenheit – Bevollmächtigter von Glades gewesen war, die Firma kürzlich die Besitzer gewechselt hatte, und die Typen, die den Laden übernommen hatten, hatten Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Das stand für Max fest. Sie hatten sogar einen ehemaligen Sträfling in seinem Büro untergebracht, Ordell Robbies Freund Louis Gara. »Zur Unterstützung«, hatte der Verbrecher von Glades Mutual gesagt, der von dem Geschäft keinen blassen Schimmer hatte. »Er kümmert sich um die großen Kautionen bei Drogenvergehen.«
»Ist doch klar, was solche Leute machen«, hatte Max zu dem Burschen gesagt, »sobald ihre Kaution gestellt wurde, hauen die ab.«
Der Typ sagte: »Na und? Wir haben die Prämie.«
»Ich nehme aber keine Leute, von denen ich weiß, dass ich sie abschreiben muss.«
Der Typ sagte: »Wenn sie nicht vor Gericht erscheinen wollen, ist das ihre Sache.«
»Und wen ich nehme, ist meine Sache«, sagte Max.
Der Typ von Glades sagte: »Mir gefällt Ihre Einstellung nicht«, und teilte ihm Louis zu, der seither im Büro herumlungerte – ein frisch aus dem Knast entlassener verurteilter Bankräuber.
Max war noch mit dem Ausfüllen der Formulare beschäftigt, als Winston hereinkam. Winston Willie Powell, der nach einer Karriere als Mittelgewichtsboxer mit neununddreißig Siegen und zehn Niederlagen konzessionierter Kautionsagent geworden war. Nach seiner aktiven Laufbahn versuchte er sich mittlerweile als Halbschwergewichtler. Er war klein und untersetzt, und sein bärtiges Gesicht war so dunkel, dass man kaum die Gesichtszüge erkennen konnte. Max sah ihm zu, wie er an den anderen Schreibtisch trat, die rechte Schublade aufschloss und ihr eine kurzläufige Achtunddreißiger entnahm, bevor er zu Max rübersah.
»Muss mir den kleinen puerto-ricanischen Einbrecher schnappen. Zorro. Der mit den Schwertern an der Wand. Hat seine Bewährungshelferin angelogen. Sie meldet den Verstoß gegen seine Auflagen. Wir zahlen die Kaution, und dann taucht er bei seiner Verhandlung nicht auf. Ich ruf die Polizei in Delray an und sag, könnte sein, dass ich ein bisschen Unterstützung brauche. Und die nur: ›Das ist Ihr Problem, Mann.‹ Wollen sich nicht mit den Frauen anlegen, die bei ihm wohnen. Wer ihren Zorro anfasst, dem kratzen die die Augen aus.«
»Brauchst du Hilfe? Nimm Louis mit.«
Winston sagte: »Mach ich lieber allein«, schob die Achtunddreißiger in den Hosenbund und strich sein geripptes T-Shirt darüber glatt. »Was hast du da?«
»Unerlaubter Waffenbesitz. Zehntausend.«
»Das ist viel.«
»Nicht für Beaumont Livingston. Den haben sie mal mit Maschinengewehren erwischt.«
»Beaumont … Wenn er Jamaikaner ist, ist er längst abgehauen.«
»Der afroamerikanische Gentleman, der mir das Geld bar auf den Tisch geknallt hat, meint Nein.«
»Kennen wir ihn?«
»Ordell Robbie«, sagte Max und wartete.
Winston schüttelte den Kopf. »Wo wohnt er?«
»In der Thirty-First Street, kurz hinter der Greenwood Avenue. Kennst du die Gegend? Gepflegt. Da haben die Leute Gitter vor den Fenstern.«
»Wenn du willst, überprüf ich ihn.«
»Er kennt Louis. Die beiden sind alte Kumpel.«
»Dann steht fest, dass der Mann nicht sauber ist«, sagte Winston. »Wo wohnt Beaumont?«
»Riviera Beach. Er ist Hilfsarbeiter, aber für Mr. Robbie ist er zehn Riesen wert.«
»Der will, dass sein Freund draußen ist, bevor er unter Druck gesetzt wird und sich auf eine Absprache einlässt. Ich kann seine Papiere mit rübernehmen, wenn ich Zorro abgebe.«
»Ich fahr sowieso hin. Ich muss Reggie abliefern.«
»Hat er wieder seine Verhandlung sausen lassen? Ist das nicht entzückend?«
»Er sagt, seine Mutter hatte Geburtstag, und er hat den Termin vergessen.«
»Und du glaubst das. Ehrlich, manchmal tust du, als wären das ganz normale Leute.«
»Was für ein erfreuliches Gespräch«, sagte Max.
»Allerdings. Mich ärgert nun mal, wie du dich verhältst«, sagte Winston. »Also verschon mich mit deinen Sprüchen. Du tust, als könnte dich nichts aufregen. Nicht mal Mr. Louis Gara, der dir nur die Zeit stiehlt. Und rauchen darf er hier auch noch.«
»Nein, Louis regt mich auf«, sagte Max.
»Dann schmeiß ihn endlich raus und schließ die Tür hinter ihm ab. Danach ruf diese Verbrecher von Glades Mutual an und sag ihnen, dass du genug von ihnen hast. Wenn nicht, machen sie dich nämlich fertig, oder du kriegst Schwierigkeiten mit der Aufsichtsbehörde, das dürfte dir wohl klar sein.«
»Ja«, sagte Max. Er wandte sich zu seiner Schreibmaschine um.
»Hör zu. Alles, was du tun musst, ist, keine Kautionen mehr für sie zu übernehmen.«
»Du meinst, ich soll meinen Job an den Nagel hängen.«
»Nur vorübergehend. Was ist daran so schlimm?«
»Falls du in letzter Zeit keinen Blick in die Bücher geworfen hast«, sagte Max, »wir haben fast eine Million Dollar da draußen rumlaufen.«
»Was nicht heißt, dass du arbeiten musst. Sitz es aus. Und wenn die Bücher wieder sauber sind, fängst du von vorn an.«
»Ich muss Rechnungen bezahlen, wie jeder andere Mensch auch.«
»Klar, aber du könntest es tun. Es gibt immer einen Weg. Ich glaube jedenfalls, dass du von dem Job die Nase gestrichen voll hast.«
»Auch das ist richtig«, sagte Max, der es jedoch leid war, darüber zu reden.
»Nur weil du nicht weißt, wie du aus der Sache rauskommst, führst du dich auf, als könnte dich nichts aus der Ruhe bringen.«
Max leugnete es nicht. Nach neun gemeinsamen Jahren kannte Winston ihn zu gut. Eine Weile war es still, dann sagte Winston: »Und wie geht’s Renee?« Winston versuchte es auf die Tour. »Kommt sie zurecht?«
»Willst du wissen, ob ich noch ihre Rechnungen bezahle?«
»Erzähl mir nichts, was du nicht erzählen möchtest.«
»Na schön. Das Neueste«, sagte Max und drehte sich von seiner Schreibmaschine weg. »Ich komm rein, war gerade beim Richter wegen Reggie, da ruft sie an.«
Er hielt inne, während Winston sich setzte und seine Unterarme auf den Schreibtisch stützte. Jetzt sah er ihn an, wartete.
»Sie ist in der Mall. Hat etwas bestellt, drei Olivenkrüge, wurde per Nachnahme geliefert, und sie braucht sofort acht zwanzig. Heißt achthundertzwanzig Dollar.«
»Was ist ein Olivenkrug?«
»Woher soll ich das wissen? Sie hat von mir verlangt, dass ich alles stehen und liegen lasse und ihr einen Scheck bringe.«
Winston saß da, starrte ihn an, den Kopf tief zwischen den massigen Schultern. »Für diese Olivenkrüge.«
»Ich sag zu ihr: ›Renee, ich arbeite gerade. Ich versuche einen jungen Mann davor zu bewahren, dass er zehn Jahre kriegt, ich warte auf seinen Anruf.‹ Ich geb mir Mühe, es ihr auf nette Weise zu sagen. Und was sagt sie? Sie sagt: ›Ich arbeite auch.‹«
Offenbar grinste Winston. Schwer zu sagen. Er sagte: »Ich war mal da. Renee hat getan, als würde sie mich nicht sehen, dabei war ich der Einzige im Laden.«
»Meine Rede«, sagte Max. »Sie sagt, sie arbeitet. Wie denn? Es ist ja nie jemand da. Außer, es gibt Wein und Käse. Verstehst du, was ich meine? Bei Vernissagen. Dann kommen die ganzen Schnorrer. Dann tauchen da Typen auf, die aussehen, als würden sie in Pappkartons unter der Autobahn leben, die futtern sich durch, saufen den Wein … Du weißt, wen ich meine? Die Künstler und ihr Gefolge. Ich hab sogar schon Typen wiedererkannt, für die ich Kautionen übernommen hab. Renee macht einen auf Peter Pan, lässt sich die Haare kurz schneiden, und all die Idioten sind ihre verlorenen Jungs. Dann ist der Laden leer, und sie hat am Ende kein einziges verdammtes Gemälde verkauft.«
»Mit anderen Worten«, sagte Winston, »du finanzierst immer noch ihre Sucht.«
»Sie hat jetzt einen Kubaner, David. Oder besser: Da-viid. Sie meint, er wird ganz groß rauskommen. Nur eine Frage der Zeit. Der Typ ist Hilfskellner bei Chuck & Harold’s.«
»Ich begreif nicht«, sagte Winston, »dass du dich von einer Frau, die gerade mal neunzig Pfund wiegt, so herumkommandieren lässt. Genauso wie von diesen abgewrackten Pennern, mit denen wir zu tun haben. Die lügen dir die Hucke voll, und du sagst Ja und Amen. Gleichzeitig fängst du ständig Typen ein, die sich aus dem Staub gemacht haben, irgendwelche besoffenen Ärsche, legst ihnen Handschellen an, kein Problem, und bringst sie in den Knast. Verstehst du, was ich damit sagen will? Warum sagst du deiner Frau nicht, sie soll ihre Rechnungen gefälligst selber bezahlen, sonst lässt du dich scheiden? Ihr wohnt doch nicht mehr zusammen. Was bringt dir deine Ehe denn noch? Nichts. Hab ich recht? Außer du gehst immer noch mit ihr ins Bett.«
»Wenn man getrennt lebt«, sagte Max, »ergibt sich das nicht mehr. Man will es auch gar nicht.«
»Na ja, ich schätze, du kannst nicht klagen, was Frauen angeht. Aber wo bedient sie sich? Bei den Künstlern? Bei dem Knaben aus Kuba, Da-viid? Wenn, dann ist das ein eins a Scheidungsgrund. Erwisch sie dabei, wie sie dich betrügt.«
»Jetzt wirst du persönlich«, sagte Max.
Winston schien überrascht. »Mann, wir sind schon die ganze Zeit persönlich. Schließlich hat dich dein Privatleben zugrunde gerichtet. Ein Problem jagt das nächste. Weil dich Renee so am Wickel hat, fehlt dir die Kraft, die Versicherungsgesellschaft loszuwerden. Wenn du nicht ständig ihre Rechnungen bezahlen würdest, könntest du den Laden dichtmachen und davon leben, bis du wieder sauber bist, und dann noch mal neu anfangen, mit einer anderen Versicherung. Und du weißt genau, dass ich recht habe, deswegen halte ich jetzt die Fresse.«
»Gut«, sagte Max. Er widmete sich wieder der Vollmacht in seiner Schreibmaschine.
»Hast du ihr den Scheck gebracht?«
»Nein.«
»Hat sie noch mal angerufen?«
»Bis jetzt noch nicht.«
»Ich wette, sie hat geheult und nicht lockergelassen. Wie üblich.«
»Sie hat den Hörer aufgelegt«, sagte Max. »Hör zu, ich muss das hier fertig machen und dann los.«
»Lass dich von mir nicht stören.«
Max fing wieder an zu tippen.
Als er Winston »Scheiße« fluchen hörte und zu ihm rübersah, stand der an seinem Schreibtisch, den Kaffeebecher in der Hand.
»Dieser verfluchte Louis. Guck dir das an. Hat seine Kippe einfach in meinen Becher geworfen. Der kriegt eine in seine Scheißfresse.«
Max widmete sich wieder seinem Formular, auf dem oben Glades Mutual Casualty Company stand. Er sagte: »Ich versteh deinen Ärger. Aber wie heißt es so schön: Ehe du einem Ex-Knacki, der dreimal im Bau war, eine in die Scheißfresse haust, leg ihn lieber um.«
3
Ordell gab einem seiner Jackboys den Auftrag, ihm ein Auto zu besorgen, in dem der Zündschlüssel steckte. Er solle es auf dem Parkplatz der Ocean Mall drüben am Strand abstellen. Als der Jackboy fragte, nach was für einem Modell ihm genau der Sinn stand, sagte Ordell: »Eins mit einem großen Kofferraum mit einem Gewehr drin.«
Er mochte Jackboys, weil sie verrückt waren. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie damit, dass sie Dealern auf der Straße ihren Stoff und ihre Knete abnahmen und schwer bewaffnet in Crackhäuser eindrangen. Die Jackboys wiederum mochten Ordell, weil er cool war. Nicht irgendein Homie, den jedermann kannte. Der Mann war eine große Nummer aus Detroit, hatte verschiedene Frauen, mit denen er abwechselnd zusammenlebte, wie es ihm gerade passte, und er konnte einem innerhalb von zwei Tagen eine vollautomatische Knarre beschaffen. Daher arbeiteten inzwischen einige Jackboys für Ordell, besorgten spezielle Schusswaffen, die er brauchte, um seine Aufträge zu erledigen. Cujo, der ihm den Wagen besorgte, rief Ordell an diesem Dienstagabend bei einer seiner Frauen an und teilte ihm mit, ein Oldsmobile Ninety-Eight warte dort auf ihn, Schrotflinte vom Kaliber zwölf im Kofferraum.
Ordell sagte: »Übrigens, wenn der Wagen jetzt sauber ist, dann ist er es nachher nicht mehr.«
Cujo sagte: »Kein Problem, Bread, ist geklaut. Hat ein Brother gefahren, der neulich gekillt wurde. Nicht gehört? Ein Bulle hat ihm von vorn und von hinten eine Kugel verpasst. Wir haben noch versucht, ihn aus dem Haus rauszuholen, aber er ist uns verblutet, also haben wir ihn liegen lassen.«
»Hab es in der Zeitung gelesen«, sagte Ordell. »Der Bulle hat gesagt, wenn einer von ’ner Kugel getroffen werde, drehe er sich manchmal noch um, sei nicht ungewöhnlich. Deswegen. Aber wo hat er ihn zuerst getroffen, von vorn oder von hinten?«
Cujo sagte: »Verdammt – da is was dran.«
Man konnte Jackboys abrichten, bis sie einem schließlich erzählten, was man hören wollte, weil sie vom vielen Crackrauchen einfach weich in der Birne waren.
Ordell dankte ihm für die Beschaffung des Autos, und Cujo sagte: »Bread? Unter den Schlüsseln liegt ein Schießeisen, falls du eins brauchst. Das hat dem erschossenen Brother gehört.«
Ordell war mit drei Frauen zusammen, die er in drei verschiedenen Häusern untergebracht hatte.
Sheronda wohnte in dem Haus in der Thirty-First Street, Nähe Greenwood Avenue, in West Palm. Sie war eine junge Frau, die er in Fort Valley, Georgia, aufgelesen hatte, als er auf der Rückfahrt von Detroit war. Sheronda stand damals barfuß am Straßenrand, und in der Sonne sah man gut ihren Körper in dem abgetragenen Kleid. Sie konnte vortrefflichen Krauskohl mit gepökeltem Schweinefleisch, Augenbohnen und panierte Steaks zubereiten, hielt das Haus sauber und machte für Ordell Tag und Nacht die Beine breit, aus purer Dankbarkeit, dass er sie aus den Erdnussfeldern gerettet hatte. Nichts in dem kleinen roten Backsteinhaus im Ranch-Stil verriet, womit Ordell seinen Lebensunterhalt verdiente. Etwa einmal die Woche musste er Sheronda erklären, wie man die Alarmanlage einstellte. Sie hatte Angst, in dem Haus eingesperrt zu sein und durch die vergitterten Fenster nicht rauszukommen.
Simone war eine niedliche Person, trotz ihres Alters, sie war dreiundsechzig. Sie kam aus Detroit, kannte sich gut mit Alarmanlagen aus und mochte die Gitterstäbe vor ihrem Fenster. Ordell hatte sie in einem hübsch verputzten Haus im spanischen Stil in der Thirtieth Street untergebracht, Nähe Windsor Avenue, keine zwei Straßen von Sheronda entfernt, aber ohne dass die beiden voneinander wussten. Simone hatte Dauerwellen und glaubte, sie sähe aus wie Diana Ross. Sie legte gern Motown-Platten auf. Sie liebte es, mitzusingen und sich Schritte und Handbewegungen zu den Supremes, Martha and the Vandellas, Gladys Knight and the Pips oder Syreeta Wright auszudenken. Wenn Ordell sich von Simone ins Bett locken ließ, war es immer zehnmal besser als erwartet. Simone hätte ein Buch über die verschiedenen Methoden schreiben können, wie man einen Mann befriedigt. In diesem Haus lagerte Ordell vorübergehend Schusswaffen, halb automatische Knarren wie die TEC9, legal von »Strohmännern« – meist Rentnern – gekauft, die Simone anwarb. Sie gab einer alten Frau den Kaufpreis und zwanzig Dollar extra. Keiner der Lieferanten kannte Ordell, wenigstens nicht namentlich.
Eine Weiße, Melanie, hatte er in dem Apartment in Palm Beach Shores einquartiert, am südlichen Ende von Singer Island, nur zwei Blocks vom öffentlichen Strand entfernt. Melanie war das attraktive, gut gebaute Mädchen, das Ordell auf den Bahamas kennengelernt hatte, als er dort den Ehemann der Frau aufsuchte, die er und Louis entführt hatten. Melanie, damals gerade mal einundzwanzig, mochte also jetzt vierunddreißig sein, hatte sich aber schon auf der ganzen Welt herumgetrieben und überall reiche Typen aufgerissen. Sie war mit dem Mann der Entführten liiert gewesen. Weil der aber gerade auf den Bahamas untergetaucht war, hatte sie sich beharrlich geweigert, sein Versteck zu verraten. Deshalb waren sie mit Ordells Freund Mr. Walker in dessen Boot aufs Meer rausgefahren, wo Ordell Melanie kurzerhand über Bord warf. Sie entfernten sich ein Stück und fuhren dann im Bogen wieder zu der Stelle zurück, wo Melanies blonder Schopf auf den Wellen tänzelte, und Ordell fragte sie: »Verrätst du mir jetzt, wo der Typ steckt?« Sie war wirklich eine heiße Nummer. Nachher hatte sie Ordell erzählt, sie wolle ihm dabei helfen, den Mann der Entführten auszunehmen, weil er, Ordell, ihr besser gefalle. Der zweite Grund sei gewesen, gestand sie, dass sie nicht in dem Scheißmeer hatte verrecken wollen.
Ebendieser Melanie, zu der er stets Kontakt gehalten hatte, war er hier in Miami über den Weg gelaufen … Melanie schmiss sich immer noch an die Männer ran. Besonders gut kochen oder putzen konnte sie nicht, und obwohl sie so lasziv redete und tat, war sie im Bett nur Durchschnitt. (Ordell überlegte manchmal, ob er sie nicht ein Weilchen bei Simone in die Lehre stecken sollte.) Das attraktive, gut gebaute Mädchen war in den dreizehn Jahren molliger geworden, der mächtige Vorbau eine halbe Etage tiefer gesackt, aber immer noch ganz okay. Sie präsentierte sich stets gut gebräunt, weil sie sich in ihrem Apartment sonnte, auf dem Balkon mit Meerblick. Ordell benutzte die Wohnung manchmal zu Geschäftsbesprechungen, dann musste seine gut gebaute blonde Begleiterin ihren Hintern heben und Drinks servieren, während er den Kunden aus Detroit oder New York seinen Waffenfilm vorführte. Drüben in Freeport hatte Mr. Walker eine Kopie, die er Interessenten aus Kolumbien zeigte.
Cujo, der Jackboy, hatte eben erst hier angerufen und gesagt, dass der Olds Ninety-Eight bereit stehe. Ordell hielt den Hörer noch in der Hand. Jetzt tippte er eine Nummer in Freeport auf Grand Bahama ein.
»Mr. Walker, wie geht’s so heute Abend?«
Melanie sah von ihrer Vanity Fair auf, in der sie gerade auf dem Sofa blätterte. Sie lief in einer Cut-off-Jeans herum und hatte jetzt ihre hübschen braunen Beine untergeschlagen.
»Ich habe Beaumont rausgeholt. Hat mich zehntausend gekostet. Die krieg ich zwar wieder, aber ich lass sie nur ungern aus den Augen.« Ordell hörte zu und sagte dann: »Das war gestern. Ich musste was überlegen, darum hab ich nicht sofort angerufen.«
Melanie hatte ihn beobachtet. Als Ordell zu ihr hinübersah, vertiefte sie sich wieder in ihre Zeitschrift, tat desinteressiert. Sie hörte aber zu, und das war in Ordnung. Sie sollte ruhig das eine oder andere wissen, nur nicht alles.
»Sie waren einfach schneller als ich, Mr. Walker. Ich hatte dieselbe Idee.« Cedric Walker war in seinem Walfangboot mit Touristen zum Hochseeangeln hinausgefahren, bis Ordell ihm gezeigt hatte, wo das große Geld zu holen war. Jetzt besaß der Mann eine elf Meter lange, mit allen Schikanen ausgestattete Carver-Jacht. »Nicht wahr, allein die Trunkenheit am Steuer verstößt bereits gegen Beaumonts Bewährungsauflagen. Dass er die Pistole dabeihatte, war im Grunde genommen egal … Genau, Sie werden wieder die Sache mit dem Maschinengewehr hervorkramen. Das heißt, er muss sich auf zehn Jahre einstellen. Außerdem der neue unerlaubte Waffenbesitz. Das sagt jedenfalls der Kautionsagent … Nein, ich lasse ihn die Kaution stellen. Max Cherry … Genau, so heißt der Mann. Klingt wie ein waschechter Calypso-Sänger, was? Maximilian Cherry und die Oil Can Boppers … Was? Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn sie ihn über Nacht dabehalten, reißt er sich die Haare aus. Ich würd ihn ja zurück nach Montego schicken, wenn mir dadurch nicht die zehn … Nein, darüber brauchen wir gar nicht erst zu reden. Mr. Walker? Schöne Grüße übrigens von Melanie.« Ordell hörte wieder zu, sagte dann: »Sie wird begeistert sein, Mann. Ich sag’s ihr. Und immer schön sauber bleiben, klar?«, und legte schließlich auf.
Melanie, die Zeitschrift auf dem Schoß, fragte: »Du sagst mir was?«
»Er schickt dir ein Geschenk. Kommt mit der nächsten Lieferung.«
»Er ist ein Schatz. Ich würd ihn wirklich gern wiedersehen.«
»Wir könnten rüberfliegen. Mit seinem Boot rausfahren. Würde dir das gefallen?«
»Nein danke.« Melanie griff nach ihrer Zeitschrift.
Ordell beobachtete sie. Er sagte: »Du weißt ja, das Boot ist immer verfügbar.«
Um zwei Uhr morgens verließ Ordell das Apartment und ging zur Ocean Mall, wo es eine Tanz-Bar namens Casey’s gab, das Restaurant Portofino, eine Handvoll Lebensmittelläden, ein paar Schnellimbisse, sonst war in diesem gegenüber vom öffentlichen Strand gelegenen Einkaufszentrum der Hund begraben. Der Parkplatz lag hinter dem Einkaufszentrum und war fast völlig leer, sämtliche Läden hatten ja zu. Er stieg in den schwarzen Olds Ninety-Eight, fand die Schlüssel und eine kurzläufige Achtunddreißiger unter dem Sitz, fummelte an den Armaturen herum, bis er den Lichtschalter und die Lüftung gefunden hatte, und fuhr los, über die bucklige Brücke nach Riviera Beach, eine Fahrt von zwei Minuten.
Ordell war der Meinung, wenn man Beaumonts Adresse nicht kannte, müsste man nur langsam durch die dunklen Straßen in der Nähe des Blue Heron Boulevard fahren, bis karibischer Reggae die Nacht erfüllte – Musik, zu der man high wurde –, und dann dem Rhythmus bis zu dem Drecksloch folgen, in dem Beaumont zusammen mit einem Haufen Jamaikaner hauste. Sie drehten die Musik immer voll auf, während sie sich ihr Crack reinzogen … Bloß dass sie an diesem Abend, wie er mit einem kurzen Blick feststellte, anscheinend Gras rauchten. Sie hockten wie fröhliche Flüchtlinge in dem Zimmer aufeinander und tranken süßen Wein und dunklen Rum zu dem Marihuana. Ging man da rein und atmete ein paarmal durch, war man schon bekifft. Fast immer roch es auch nach Essen. Und alles versifft: Als Ordell einmal aufs Klo gehen wollte, hatte er nur einen Blick reingeworfen und war nach draußen gegangen, wo er sich zwischen Mülleimern und auf der Wäscheleine hängenden bunten Klamotten erleichtert hatte.
Vom Flur aus sah er Beaumont – mit pomadierten, fast normalen Haaren zwischen all den Bärten und Dreadlocks. Er machte ihn auf sich aufmerksam, bedeutete ihm durch den Qualmvorhang mit einer Handbewegung, nach draußen zu kommen.