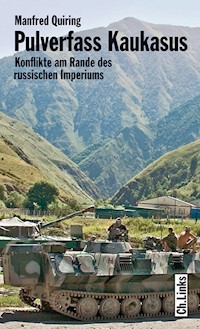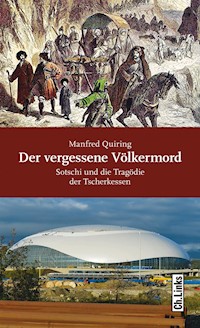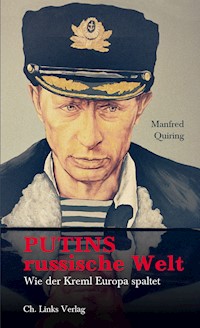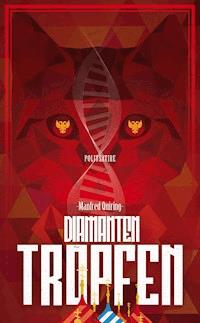4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Links, Ch
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Länderporträts
- Sprache: Deutsch
Manfred Quiring, seit über 30 Jahren journalistisch in Moskau tätig, schildert faktenreich, wie sich der Alltag des Riesenreiches in den letzten Jahren rasant gewandelt hat. Er beschreibt den Kontrast zwischen neuem Reichtum und verbreiteter Armut, zwischen Traditionalisten und westlich orientierten Reformern sowie zwischen der Metropole Moskau und der Provinz. Zugleich erklärt er aber auch, was man die »russische Seele« nennt, welche Rolle der Wodka im Zusammenhang mit Gastfreundschaft spielt und warum die russischen Frauen als die schönsten gelten. Anhand der reichen Anekdotenkultur des Landes macht er manches verständlich, was auf den ersten Blick eher Kopfschütteln auslöst. Seine Tipps und Erklärungen helfen all jenen, die das Land bereisen oder einfach besser verstehen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Manfred Quiring
Russland – Orientierung im Riesenreich
Manfred Quiring
Russland
Orientierung im Riesenreich
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
1. Auflage, September 2013 (entspricht der 1. Druck-Auflage von März 2008)
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Internet: www.linksverlag.de; [email protected]
Umschlaggestaltung: KahaneDesign, Berlin unter Verwendung eines Fotos von der
Basilius-Kathedrale in Moskau (Susanne Dönitz)
Inhalt
Vorwort
Eigenheiten des Zusammenlebens
Russlands Frauen, Russlands Männer
Besonderheiten der russischen Ehe
Wodka – Droge und Kultgegenstand
Die russisch-orthodoxe Kirche
Tausend Jahre russischer Geschichte
Die Waräger und die Kiewer Rus
Wie die Russen zu ihrer Schriftsprache kamen
Kasan und der Anfang des russischen Imperiums
Strauchdiebe, Freiheitssuchende, Gardisten – die Kosaken
Der Große Vaterländische Krieg
Russen und Deutsche
Zwei exemplarische Charaktere: Oblomow und Stolz
Die ersten Kontakte
Die deutsche Siedlung in Moskau
Deutscher Adel am Hof der russischen Zaren
Wissenschaftler und Handwerker
Arbeit in der Sowjetunion
Stalin, Hitler und die Folgen
»Klassenbrüder« und »Revanchisten«
Untergang des Sowjet-Imperiums
Der Putsch der Memmen
Das Treffen in der Beloweschsker Heide besiegelt das Ende
Der Phantomschmerz nach dem Zerfall
Privatisierung in Russland oder Wie wird man Milliardär?
Start in den Raubtier-Kapitalismus
Die Stunde der Oligarchen
Aufstieg und Absturz des Michail Chodorkowski
Kurz leben, viel verdienen, Geld ausgeben – notfalls für den FC Chelsea
Das Putin-Prinzip
Der Weg ins Präsidentenamt
Die Vertikale der Macht
Der Geheimdienst-Staat
Die Zähmung der Oligarchen
Der Neue
Moskau, die Hauptstadt
Verwandlung einer Metropole
Das Zentrum der Macht – der Kreml
Die Straße der Milliardäre
St. Petersburg – Konkurrentin und nördliche Hauptstadt
Das andere Russland – Leben in der Provinz
Die Kluft zwischen Stadt und Land wächst
Vom Dollar-Millionär zum Einsiedler
Die Regionen ticken anders
Russland als Vielvölkerstaat
Praktische Tipps für das Leben in Russland
Der Vatersname und andere Stolpersteine
In geselliger Runde
Gibt es sie, die russische Seele?
Worauf muss man sich bei einem längeren Aufenthalt in Moskau einstellen?
Deutsche in Moskau. Was lockt, was hält sie?
Anhang
Basisdaten Russland
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Kontaktadressen
Bildnachweis
Vorwort
Eine schwarze Krawatte und eine große Kiste Toilettenpapier gehörten zu meiner Ausrüstung, als ich im Sommer 1982 zum ersten Mal für längere Zeit nach Moskau reiste. Beides erwies sich als überaus nützlich. Im November starb Staats- und Parteichef Leonid Breschnew. Das Poltern seines Sarges, der dem Beisetzungskommando aus den Händen geglitten war und krachend in die Grube fuhr, habe ich noch heute im Ohr. Dem greisen Staats- und Parteichef folgten innerhalb von drei Jahren mit Juri Andropow und Konstantin Tschernenko zwei ebenfalls alte und kranke Generalsekretäre sowie zahlreiche weitere Mitglieder des gerontokratischen Politbüros. Deren Beisetzungen auf dem Roten Platz erforderten auch die Anwesenheit der Medien, die Investition in den schwarzen Halsschmuck amortisierte sich.
Auch das Toilettenpapier hatte ich nicht vergebens transportiert. Gehörten derlei Artikel zu sowjetischer Zeit doch zum permanenten »Defizit«. Trat der Ausnahmefall ein, und es gab überraschend eine Lieferung, liefen die Moskauer mit Girlanden aufgefädelter Klopapier-Rollen um den Hals nach Hause.
Mein geistiges Gepäck erwies sich als weniger hilfreich. Meine Kenntnisse waren gespeist aus propagandistischen Versatzstücken, in denen Begriffe wie Ruhm, Heroismus, Fünfjahrplan und Kollektivwirtschaft einen großen Raum einnahmen. Sowjetbürger, wie die Einwohner des inzwischen untergegangenen Landes in der DDR genannt wurden, schienen mir aufgrund der trockenen Berichte der DDR-Medien langweilig und weitgehend humorlos. Ein Vorurteil, das sich im sowjetischen Alltag sehr schnell auflöste.
In der UdSSR, und das gilt mit einigen Abstrichen auch im heutigen Russland, blühte der scharfsinnige politische Witz. Das pfiffige Spiel mit Worten, leider in vielen Fällen nicht übersetzbar, hatte Hochkonjunktur. Besonders beliebt waren die fiktiven »Anfragen an der Sender Jerewan«. So fragt ein Hörer den Rundfunksender: »Kann man in der Schweiz den Kommunismus aufbauen?« Antwort: »Im Prinzip ja, aber schade um die Schweiz.« Überhaupt war die Kluft zwischen der kommunistischen Realität und den Versprechungen von einer »hellen kommunistischen Zukunft« ständiger Quell neuer Anekdoten, die man sich weitgehend offen erzählte. So klagt ein alter Bolschewik gegenüber einem Gleichaltrigen: »Nein, nein, mein Lieber, den Kommunismus werden wir nicht mehr erleben. Aber die Kinder, um die tut es mir leid.« Repressionen waren in den achtziger Jahren wegen dieser Anekdoten kaum noch zu befürchten. Es sei denn, man bot der Staatsmacht als Dissident die Stirn. Es herrschte eine unausgesprochene Übereinkunft: Ihr da oben kümmert euch um eure Angelegenheiten, wir hier unten um unsere. Oder in der Sprache eines politischen Witzes ausgedrückt, der auch in der DDR bekannt war: »Ihr da oben tut so, als würdet ihr uns bezahlen, und wir tun so, als würden wir arbeiten.«
Dass die politische Meinung selbst innerhalb der herrschenden Eliten nicht so monolith war, wie es nach außen den Anschein hatte, war ebenfalls eine überraschende Erkenntnis. Bei einer privaten Abendgesellschaft nahm mich der kulturpolitische Beobachter der Staatszeitung »Iswestija« ins Gebet. Nadein erklärte mir zu vorgerückter Stunde, die Teilung Deutschlands sei nur provisorisch. Es wäre lediglich eine Frage der Zeit, wann die beiden Teile wieder zusammengefügt würden.
Das war zu jener Zeit und für meine Ohren etwas nachgerade Sensationelles. Zumal die politischen Beobachter in der »Iswestija« einen hohen Rang in der Sowjethierarchie und Zugang zu den oberen Etagen der Macht hatten. Zeitweilig gehörte sogar der ehemalige Sowjet-Botschafter in Bonn, Valentin Falin, dazu, der später zum Leiter der ZK-Abteilung für internationale Beziehungen aufstieg.
Doch derlei private Treffen waren selten zu jener Zeit. Trotz aller Freundschaftsbeteuerungen galten auch die Leute aus der DDR in der Sowjetunion als Ausländer. Private Kontakte waren unerwünscht. Mitarbeiter des sowjetischen Außenministeriums beispielsweise folgten Einladungen zu mir nach Hause immer in Gruppen, und sie gingen auch immer in Gruppen. Weit tiefere Einblicke in das Alltagsleben gewannen die Studenten, die zum Teil auch in Provinzstädten wie Wolgograd oder Kasan studierten, und diejenigen, die mit einem russischen Partner oder einer russischen Partnerin verheiratet waren.
Themen für die Berichterstattung waren das ebenso wenig wie die politischen Vorgänge im Lande. Als damaliger Korrespondent der »Berliner Zeitung«, so das ungeschriebene Gesetz, hatte ich parteikonform über Land, Leute und Regionen zu berichten. Mit einer riesigen Schere im Kopf. Die reichte während der Perestroika-Zeit offensichtlich nicht mehr aus. Der Chefredakteur redigierte meine Reportagen höchstpersönlich, damit keine geistige Schmuggelware ins Blatt gelangte.
Die Politik blieb offiziellen Kanälen wie der Nachrichtenagentur ADN (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst) vorbehalten. Vor und während großer Ereignisse – Parteitage, Staatsbesuche und Ähnliches – fand sich in Moskau die »Viererbande« zusammen, die schon am Vorabend das Ereignis des nächsten Tages in einem »lebensprallen« Bericht aufschrieb, in dem selbst »spontane« Freudenausbrüche vorausgeahnt wurden. Mit Viererbande waren die Chefkorrespondenten der Nachrichtenagentur ADN, des »Neuen Deutschland«, von Rundfunk und Fernsehen gemeint. Ihr Bericht ging dann an die Agitationskommission des Zentralkomitees der SED, die oberste Zensurbehörde. Dort wurde er entsprechend den an dem Tage gültigen Vorgaben und Tabus umgeschrieben und an die Nachrichtenagentur ADN weitergereicht, die ihn dann, mit einer 4000er Nummer versehen, verbreitete. Damit wusste jeder Redakteur, dass dieses Material im Wortlaut zu drucken war. Nur bei 2000er Nummern durfte redigiert werden.
Der damalige Chef der Zensurbehörde, Heinz Geggel, von DDR-Journalisten auch »Dr. Geggels« genannt, regierte auch direkt in die Arbeit der Redaktionen hinein. Selbst die Seitenspiegel wurden im ZK parallel zu denen in der Redaktion angefertigt, um gegebenenfalls genau anweisen zu können, wo welche ADN-Meldung – andere existierten nicht – in welcher Länge zu platzieren war. Der Journalismus, so lautete das Selbstverständnis von Oberzensor Geggel, ist eine Waffe, und so benutzen wir ihn auch: Auf Befehl! Das war wörtlich zu nehmen. Über ein Direkttelefon hing die Redaktion unmittelbar am »heißen« Draht der Behörde.
Das Telefon in der »Berliner Zeitung« stand in einem Großraum, wo auch der diensthabende Chefredakteur des Spätdienstes saß. Vormittags allerdings noch nicht. Und so begab es sich, dass eines schönen Tages gegen elf Uhr das Telefon klingelte und niemand ranging. Bis es einem Handwerker, der gerade mit Reparaturarbeiten beschäftigt war, zu viel wurde und er den Hörer abnahm. Der Mitarbeiter des ZK bekam nahezu einen Schlag. Kann denn da jeder an das Telefon gehen? Die Chefredaktion wurde zusammengefaltet und versprach Abhilfe. Ein Tresor wurde angeschafft, eine kleine Ecke von der Tür abgefeilt, damit das Kabel keinen Schaden erleide, und das Telefon eingeschlossen. Jeder der Chefredakteure bekam einen Schlüssel. Und dann geschah, was geschehen musste: Eines Tages klingelte das Telefon, eine wichtige Anweisung sollte übermittelt werden, aber keiner von den Anwesenden hatte einen Schlüssel.
Eingedenk all dieser Erfahrungen griff ich 1991 mit beiden Händen zu, als sich erneut die Chance auftat, in der damals noch existierenden Sowjetunion zu arbeiten. Berichten, ohne das ZK im Nacken zu wissen! Der neue Herausgeber des Blattes, der ehemalige langjährige »Spiegel«-Chefredakteur Erich Böhme, diese Zusammenhänge nicht ahnend, sagte vor meiner Abreise verwundert: »Sie sind also der arme Mensch, der da freiwillig nach Russland geht?« Leider traute ich mich damals nicht, die Situation auszunutzen und um eine Gehaltserhöhung zu bitten.
Das alles ist jetzt mehr als 15 Jahre her. Deutschland, aber vor allem Russland, seine Hauptstadt Moskau und auch die Menschen haben sich gründlich verändert und sind sich treu geblieben. Für jüngere Moskauer sind das Geschichten aus einer anderen Welt, die sie so nie kennengelernt haben. Die Älteren dagegen erinnern sich nur allzu gut der zahlreichen Schicksalsschläge, von denen sie in den letzten Jahrzehnten gebeutelt wurden und die sie mit erstaunlichem Stoizismus ertragen haben. Der Zusammenbruch eines Weltreichs, der KGB-Putsch 1991, die Beschießung des Parlaments 1993, Hyperinflation und Wirtschaftschaos der neunziger Jahre, der zweimalige Verlust aller Ersparnisse, der rauschhafte Aufstieg infolge der Preisexplosion auf dem Erdgas- und Erdölmarkt – all diese Ereignisse haben kaum weniger intensiv auf die Russen gewirkt als der Zweite Weltkrieg, der auch der Große Vaterländische Krieg genannt wird.
Fünf Jahre habe ich in der Sowjetunion und insgesamt 15 Nachwende-Jahre in Russland verbracht. Dieses Buch ist ein Versuch, die Veränderungen zu beschreiben, die sich hier vollzogen haben, und sie mit eigenen Erinnerungen und Erfahrungen zu verbinden. Ein persönlicher Blickwinkel ist also durchaus gewollt. Russische Bekannte fragen mich manchmal, ob ich ihr Land liebe, weil ich schon so lange hier lebe. Die Antwort fällt mir schwer. Ich mag Russland, ich habe viele Freunde hier, mehr inzwischen als in Deutschland. Aber kann man ein Land lieben? Ich halte es da eher mit dem Ausspruch des einstigen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Gefragt, ob er Deutschland liebe, sagte er: »Ich liebe meine Frau.«
Und noch zwei eher technische Anmerkungen. Zitate, die mit keiner Quellenangabe versehen sind, entstammen Gesprächen, die ich geführt habe. Bei der Wiedergabe russischer Namen und Ortsbezeichnungen habe ich die vom Duden vorgegebene deutsche Schreibweise verwendet. Dadurch kann es zu Abweichungen von aus der englischen oder französischen Umschreibung stammenden Bezeichnungen kommen.
Eigenheiten des Zusammenlebens
Ein russischer Bär geht mit seinem Freund, dem Wolf, durch den Wald. Da sehen sie einen Hasen. Der Bär meint zum Wolf, eigentlich habe er Hunger, der Hase käme gerade recht. Der Wolf stimmt zu, und beide verspeisen den Hasen. Wohlig satt, überkommt sie das schlechte Gewissen. »Wir hätten das arme Häschen doch nicht fressen sollen«, meint der Bär. »Wenigstens sollten wir ihn ordentlich begraben.« Gesagt, getan, sie begraben, was von dem Häschen übriggeblieben ist. Sie setzen ihm einen Grabstein und denken über eine Inschrift nach. »Unserem lieben Feind« wird ebenso verworfen wie »Unserem lieben Freund«. Beides scheint unpassend. Schließlich einigen sie sich und schreiben: »Unserem lieben Partner«.
(Soll Putin Angela Merkel erzählt haben.)
»100 Werst (etwa 107 Kilometer) sind keine Entfernung, 100 Rubel sind kein Geld und 100 Gramm kein Wodka«, heißt es in einem russischen Sprichwort aus einer Zeit, als der Rubel noch einen Wert hatte. Es beschreibt sehr anschaulich die Weite des Landes, aber auch die Maßstäbe, in denen seine Bewohner denken. In Russland ist alles etwas größer, etwas weiter und etwas grenzenloser. Das betrifft die Geografie ebenso wie die Menschen und ihre Ansprüche.
Die Russische Föderation ist so groß wie Südamerika. Aber diese Landmasse zwischen Europa, dem Nahen Osten und Asien erstreckt sich über mehr als 10 000 Kilometer von Kaliningrad im Westen bis zum Kap Prowidenija im äußersten Fernen Osten an der Behring-Straße. Auf der anderen Seite der Meeresstraße befindet sich Alaska, das einst zu Russland gehörte. Zar Alexander verkaufte die Region 1867 für 7,2 Millionen Dollar an die USA. Er hatte keine Verwendung für den »Sack voll Eis«. Die immer wieder auftauchende Behauptung, es habe sich um einen auf 99 Jahre befristeten Pachtvertrag gehandelt, ist allerdings ein Mythos.1
Russlands Nord-Süd-Ausdehnung nimmt sich etwas bescheidener aus. Zwischen dem nördlichsten Punkt des Landes auf der Kola-Halbinsel und dem südlichsten in der Bergrepublik Dagestan liegen aber immerhin noch gut 4000 Kilometer. Diese Art der Entfernungsangabe ist eigentlich untypisch für Russland, denn »wsjem iswestno, schto semlja natschinajetsa s kremlja«, reimte Wladimir Majakowski. Zu Deutsch: Alle wissen, dass die Welt am Kreml beginnt. Dort, am Zugang zum Roten Platz, ist denn auch eine Windrose ins Pflaster eingelassen, die den Kilometer Null für ganz Russland markiert. Alle Entfernungen werden von hier aus gemessen.
Wenn auch die Art der Entfernungsbestimmung befohlen werden kann, so entziehen sich die Zeitangaben den Ukasen (Erlassen) der jeweiligen Kremlherrscher. Der Versuch, 1945 nach dem Sieg über Hitlerdeutschland auch in Berlin die Moskauer Zeit anzuwenden, scheiterte schon nach kurzer Frist an den Realitäten der Natur. Wenn die Sonne in Moskau schon aufgegangen war, lag das zerbombte Berlin noch in tiefer Finsternis. Das Tagwerk in der unbeleuchteten Stadt musste noch warten.
Russland hat wegen seiner gewaltigen Ost-West-Ausdehnung mit seinen elf Zeitzonen durchaus ernsthafte Probleme. Während die Uhren in Murmansk im Norden und Machatschkala in Dagestan im Süden lediglich eine Differenz von einer Stunde anzeigen, liegen zwischen dem westlichsten und östlichsten Punkt des Landes elf Stunden Zeitunterschied. Wenn sich die Menschen im Fernen Osten morgens um neun Uhr an ihre Arbeitsplätze begeben, geht bei den Kaliningradern gerade der Vortag zu Ende, und sie machen sich fertig fürs Bett. Moskauer Nachtschwärmer brechen auf in die Bars.
Beginnen die Einwohner von Magadan – acht Stunden Unterschied zu Moskau – gerade ihren Arbeitstag, ist es noch tiefe Nacht in Moskau, und die Büros sind menschenleer. Keineswegs günstige Voraussetzungen für Kommunikation und administrative Leitung in dem Riesenreich.
Flugreisen in westöstlicher Richtung liefern einen nachdrücklichen Anschauungsunterricht für die Weite des Landes und für das, was sich ein Jetlag nennt. Für gewöhnlich starten die Maschinen gen Fernost in der russischen Hauptstadt gegen Mitternacht. Acht, neun Stunden später – immer der Sonne entgegen – ist der Zielort Magadan, Wladiwostok, Juschno-Sachalinsk oder Anadir erreicht. Jetzt addiert man je nach Ortslage weitere acht, neun oder zehn Stunden Zeitunterschied und findet sich am späten Nachmittag wieder, zerschlagen und unausgeschlafen. »Du fliegst und fliegst, kommst nach neun Stunden an, und die Leute sprechen immer noch russisch!« Selbst ein weitgereister Journalistenkollege wie Igor Andrejew lässt sich immer wieder beeindrucken vom Phänomen der russischen Weite.
Sie ist auch ein wichtiger Teil des russischen Selbstwertgefühls, das Größe an sich zu einem unabdingbaren Attribut der russischen Staatlichkeit hochstilisiert. Dabei geht oft die Tatsache unter, dass Russland bis heute nicht so recht etwas anzufangen weiß mit seinen riesigen Gebieten, die weitgehend unbewohnt sind. Das trifft nicht nur auf unwegsame Regionen zu, sondern auch auf für das Leben durchaus geeignete Breiten. Doch in den vergangenen Jahren haben sich Hunderte von Dörfern in Zentralrussland entvölkert. Alles drängt, was angesichts der riesigen sozialen Unterscheide zwischen Stadt und Land verständlich ist, in die Ballungszentren. Dort nimmt die Bevölkerungsdichte immer mehr zu, während auf dem Lande immer weniger Russen leben. In Sibirien und im Fernen Osten drängen nach und nach Chinesen in die entvölkerten Gebiete vor. In Moskau geht die Sorge um, man könnte diesen Teil Russlands verlieren, ohne dass ein einziger Schuss fällt.
Erfahrene Dienstreisende, im Fernen Osten angekommen, beißen jetzt die Zähne zusammen, stellen die Uhr auf Ortszeit um und halten durch bis zur Schlafenszeit. Nur so kann man sich zügig an den örtlichen Rhythmus anpassen. Auf dem Rückweg kann man dann eine Sonne beobachten, die stundenlang scheinbar bewegungslos am Himmel steht. Abflugszeit in Fernost ist gleich Ankunftszeit in Moskau, die nächsten Tage werden schrecklich sein.
Natürlich ist auch der Landweg möglich. Aber bis heute existiert keine durchgehende Straße, die den Westen Russlands mit dem Fernen Osten verbindet und diesen Namen auch verdient. Ganz zu schweigen von einer Autobahn. Die ohnehin von Schlaglöchern durchsetzte Chaussee wird irgendwo hinter Tschita zur einfachen Schotterpiste, wo das Leben eines Pkw schon bei Tempo 30 höchst gefährdet ist. Der Zug braucht von Moskau bis Wladiwostok sieben Tage, der Reisende viel Geduld. Zur Zeit von Katharina II. mussten noch ganz andere Fristen veranschlagt werden. Aus nicht ganz erfindlichen Gründen befahl die aus Deutschland stammende Zarin eines schönen Tages, man möge ihrem Hofe in St. Petersburg junge Mädchen von der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka zuführen. Die Reise der gerade den Kinderschuhen entwachsenen Kamtschadalinnen zog sich hin. Als sie in St. Petersburg ankamen, hatten sie den Schmelz der Jugend schon etwas eingebüßt und mit den Begleitsoldaten mehrere Kinder gezeugt.
Auch klimatisch ist Russland ein Land der Extreme. In den zentralen Regionen und in Sibirien herrscht strenges Kontinentalklima. Heiße Sommer mit über 30 Grad Hitze wechseln mit langen, frostkalten Wintern ab. Selbst in Moskau können die Temperaturen bis auf 30 Grad Frost fallen, 40 sind eher die Ausnahme. Sibirien ist mit Wintertemperaturen um die 50 Grad und weniger deutlich kälter. In Oimjakon liegt der Kältepol der Nordhalbkugel. Dort wurden schon minus 72 Grad gemessen. Und während es in den arktischen Regionen des Landes nie richtig warm wird, herrscht in südlichen Landesteilen subtropisches Klima.
Juri Afanassjew, ehemals Rektor der staatlichen russischen humanistischen Universität, Historiker und Anhänger einer liberalen Demokratie in Russland, sieht in diesen extremen Naturbedingungen, in dem heftigen Wechsel zwischen heiß und kalt, auch eine Ursache für die Extreme des russischen Charakters. »Perioden heftigster Anstrengung wechseln sich ab mit der langen Zeit der winterlichen Ruhe, des Nichtstuns. Sie bildeten die Kontraste des russischen Charakters heraus, der, wenn es sein muss, alles Menschenmögliche hervorbringt, der aber auch monatelang auf der Bärenhaut liegt und nichts tut.« Dann neigt er zur Schwermut bis hin zum Selbstmitleid.
In Extremsituationen dagegen, wenn es um alles oder nichts geht, in den kurzen Vegetationsperioden etwa, wenn es darauf ankommt, das Überleben für den nächsten Winter zu sichern, wächst der russische Mensch plötzlich über sich hinaus und ist zu Großem fähig. Der Große Vaterländische Krieg darf dafür als Beleg gelten, ohne dabei zu vergessen, mit welch repressiven Mitteln gegenüber den eigenen Soldaten der Sieg errungen wurde. Und kein Zweifel: Nachdem der Schwarzmeer-Kurort Sotschi jetzt den Zuschlag für die olympischen Winterspiele 2014 bekommen hat, darf man gewiss sein, dass das Land unter Aufbietung aller Kräfte innerhalb der verbleibenden sechs Jahre die nicht vorhandene Infrastruktur nebst den erforderlichen Sportanlagen in die kaukasischen Berge klotzen wird. Begleitet natürlich von einer überbordenden Propaganda, die die Vorbereitungen auf die Spiele zu einer Entscheidungsschlacht um Russlands Ansehen und seine Rolle in der Welt hochstilisiert.
In sowjetischer Zeit wurde – freilich erfolglos – versucht, permanent solche Alles-oder-nichts-Situationen zu suggerieren. Der Arbeitstag war nach Meinung der Parteiideologen nicht nur ein Feiertag, er war jedes Mal auch ein Tag der Höchstleistungen in Industrie und Landwirtschaft. Der »Udarnik« wurde erfunden. Abgeleitet vom Wort »Udar« (Schlag). Er war als sogenannter Stoßarbeiter dazu bestellt, Normen zu brechen und Bestleistungen aufzustellen, die allen zum Vorbild dienen sollten.
Die DDR-Oberen nahmen sich daran ein Beispiel und schufen Vorzeige-Soldaten an der Arbeitsfront wie Adolf Hennecke. Der Bergmann überbot die Fördernorm um über 700 Prozent, wurde allen als Vorbild präsentiert und dafür gehasst. Denn diese Leistung hatte er, organisiert von Parteikadern, unter idealen Treibhausbedingungen erbracht, die sonst nicht existierten.
Ein klassisches Beispiel für die charakterlichen Extreme und die Stimmungsschwankungen war Russlands erster Präsident Boris Jelzin. Immer, wenn sich die Lage in einem Höchstmaß zugespitzt hatte, lief er zu großer Form auf. Berühmt sind die Bilder, wie er im August 1991 vor dem Weißen Haus den Putschisten die Stirn bot. Das war auch schon früher so. Der Volleyballer Jelzin fing erst so richtig an zu spielen, wenn das Match schon verloren schien. Die Mühen der Ebene dagegen waren nichts für ihn. Nach Stunden und Tagen höchster Anspannung, wenn er dem störrischen Parlament mal wieder neue Vollmachten abgerungen hatte, tauchte er manchmal für Wochen ab, ergab sich seinen Depressionen und dem Suff, während seine Umgebung das Land verwaltete.
Russische Nationalpatrioten versuchen heute, daraus die Essenz für die Einmaligkeit des russischen Charakters zu pressen. Die Mühen des Alltagslebens, die immer wiederkehrende, angeblich unschöpferische Routine, das Handeln und Schachern sei eben nichts für Russen, glauben sie. Deren Weg sei vielmehr »der Weg des heldenhaften Mannes, der Weg des russischen Recken, der bezaubernden russischen Frau«.2
Russlands Frauen, Russlands Männer
»Russlands Frauen sind die schönsten der Welt.« Dieser Satz ist wie ein Granitmonument eingepflanzt in das Bewusstsein der russischen Männer. Ihn zu bezweifeln hieße, an Russland zweifeln. Aber woher weiß ich, dass sie die Schönsten sind, wenn ich doch noch nicht in Indien, auf Bali oder in der Karibik war? Ein Einwand, der nur von einem übermäßig rational denkenden Deutschen kommen kann, der alles ganz genau wissen und begründet haben will, höre ich dann von russischen Freunden. Unsere sind eben die Schönsten, und fertig!
Tatsächlich ist dagegen ja auch kaum etwas zu sagen. Die Moskauerinnen heute sind tatsächlich atemberaubend schön, meist gertenschlank und mit betörenden Beinen. Es ist, als habe sich eine genetische Veränderung vollzogen. Oder sind es die veränderten Ernährungsgewohnheiten – »Sushi, die Speise des 21. Jahrhunderts« wirbt ein über die Straße gespanntes Transparent –, die den neuen Typ der Moskauer Frauen hervorgebracht haben? Wie auch immer, die jungen Damen der Hauptstadt unterscheiden sich fundamental von ihren Vorgängerinnen in den achtziger Jahren, die sich tagsüber vorwiegend von Weißbrot und Sliwki, einem Sahnegetränk mit 20 Prozent Fett, ernährten. Die Moskauerinnen heute ziehen Salat und Joghurt vor.
Sie haben zudem, im Vergleich zu der Generation der achtziger Jahre, der die Mittel dazu fehlten, ein ausgeprägtes Gefühl für modischen Chic. Elegante Schuhe, kurze Röcke, knappe Jäckchen und nabelfreie Tops werden auch dann gerne getragen, wenn die Temperaturen eher für Nierenentzündungen sorgen. Und keine Hauptstädterin, die auf sich hält, geht ungeschminkt aus dem Hause, manchmal allerdings so, dass man eher einen Barbesuch denn den Gang ins Büro vermuten könnte.
Es gibt Firmen, die ihren jugendlichen Mitarbeiterinnen per Anordnung eine etwas zurückhaltendere Garderobe »empfehlen« mussten. Das alltägliche Schaulaufen auf High Heels lenkte die männliche Belegschaft zu sehr von ihren eigentlichen Aufgaben ab. Was Wunder: Jobs in Banken, Handelsfirmen oder Hotels werden immer auch als Ehe- oder wenigstens Beziehungsanbahnungsmöglichkeit gesehen.
Gelegenheit, sich mit der allerneuesten Mode einzudecken, haben die Moskauerinnen reichlich. Und die Russinnen des Mittelstandes, anders als ihre deutschen Geschlechtsgenossinnen, sind viel eher bereit, einen erheblichen Teil ihres Monatssalärs für schöne Kleidung und gute Kosmetik auszugeben. So manch eine Moskauerin kehrte schon enttäuscht aus Deutschland zurück und bemängelte, dass die deutschen Frauen so gar nichts aus sich machten.
»Bei uns herrscht eben noch immer das Patriarchat. Es ist üblich, dass Männer leiten und Frauen ausführen.« Die Frau, die das bedauernd feststellt, ist eigentlich der Beweis des Gegenteils. Galina Sawina war schon mit 37 Jahren Generaldirektorin einer großen amerikanischen Firma. Die blonde Schönheit mit dem gewinnenden Lächeln ist eine der russischen Frauen, die es geschafft haben. Sie leitet mit viel Geschick, Kenntnis und weiblicher Intuition die amerikanische Werbefirma Rose Creative Strategies, die sich ganz auf das Russlandgeschäft konzentriert hat.
Die Business-Woman gehört zu einer neuen Generation russischer Frauen, die sich mit Geschick, Zähigkeit und viel Intelligenz ihren Platz in einer vorwiegend von Männern beherrschten Welt erkämpft haben. Sie sind Bankdirektorinnen, Pilotinnen und Politikerinnen. Sie verbinden oft auch noch erfolgreich den Job mit der Familie. Galina Sawina beispielsweise zieht – mit Hilfe einer Kinderfrau – ihren elfjährigen Sohn auf. Auch ihr Mann steht im Geschäftsleben »und hilft im Haushalt«, lobt sie den Gatten.
Das freilich ist noch immer ungewöhnlich im russischen Alltag, der von der traditionellen Rollenverteilung geprägt ist. Der Mann geht seinem Beruf nach, die Gattin tut es – soweit sie einen Job hat – auch, versorgt aber nebenher die gesamte Familie. Und die ist anspruchsvoll. Wenn nicht jeden Abend ein mehrgängiges Menü auf dem Tisch steht, hängt der Haussegen schief. Doch eine richtige russische Ehefrau hat derlei Probleme im Griff, auch wenn sie das an den Rand der Erschöpfung treibt. Das mag sich in Großstädten wie Moskau oder St. Petersburg schon etwas geändert haben, aber in der Provinz wirkt die Tradition in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit.
Auf der einen Seite beherrschen die Ehefrauen, manchmal auch die »Babuschkas«, das familiäre Leben in beinahe erdrückender Weise. »Heute ist es bei uns doch so, dass sich die Frauen um die Männer kümmern müssen und sie beschützen und umsorgen sollen«, hat schon die erst 26 Jahre alte Anna Semjonowa, Moderatorin der russischen MTV-Version, verinnerlicht. Das nimmt dann auch schon mal für westeuropäische Verhältnisse sonderbare Züge an. Mit erdrückender Fürsorge und Dominanz bestimmen die Frauen alles, was in den eigenen vier Wänden geschieht. In einer zeitgenössischen Anekdote sagt Borja zu Wanja: »Bei mir zu Hause herrscht Gleichberechtigung. Ich entscheide die lebenswichtigen Fragen – Krieg oder Frieden, Aufrüstung oder Abrüstung, Sozialismus oder Kapitalismus. Meine Frau erledigt die kleinen Probleme – die Verwaltung des Familienbudgets, unsere Ernährung, die Kindererziehung.«
Auf der anderen Seite ziehen viele Frauen und Großmütter, geprägt von den sowjetisch-russischen Familientraditionen, die verzärtelten, verwöhnten Kerle heran, deren Opfer sie selbst oder ihre Töchter und Enkelinnen dann werden. Sie lieben ihre Söhne über alles und glauben, ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablesen zu müssen.
Valja, 62 Jahre alt, hat zwei inzwischen erwachsene Söhne, sie ist in zweiter Ehe glücklich verheiratet. Valja hat sich immer sehr um ihre beiden Jungen Ljoscha und Sascha gekümmert, die jahrelang ohne Vater aufwachsen mussten, nachdem sie sich von ihrem Gatten, einem Alkoholiker, getrennt hatte. Sie sorgte nicht nur fürs leibliche Wohl, auch jedes Steinchen wurde den beiden aus dem Wege geräumt, auf dass sie keinen Schaden nähmen. Während der Schulzeit trug sie kleine Geschenke zu den Lehrern, um die Zeugnisse günstig zu beeinflussen, gab aber gleichzeitig allen Launen der beiden kleinen Paschas nach. Als Ljoscha studieren wollte, beschaffte sie über Bekannte einen Studienplatz an einer renommierten Militär-Akademie. Nach dem Abschluss drohte der Einsatz im hohen Norden, weit entfernt von jeder Zivilisation. Wieder mobilisierte Valja ihre Bekannten, Ljoscha durfte in Moskau bleiben und zog mit seiner jungen Frau in Valjas Dreizimmerwohnung in einem Plattenbau am Stadtrand. Schon bald führte er sich gegenüber seiner Mutter wie der Inhaber der Wohnung auf, zog Kreidestriche, die sie nicht übertreten durfte.
Als Valja wieder heiratete, zog sie mit dem jüngeren Sascha zu ihrem neuen Mann Wolodja in dessen Einzimmerbehausung. Ihre vergleichsweise große Wohnung überließ sie Ljoscha, der inzwischen schon zwei Kinder in die Welt gesetzt hatte. Irgendwann besorgte sie auch für den jüngeren Sascha eine kleine Wohnung. Das Ehepaar bekam über die Behörde, in der Wolodja beschäftig ist, endlich nach Jahrzehnten der Einschränkungen eine schöne Zweiraumwohnung mit einer großen Wohnküche. Doch die Freude über die neue Umgebung währte nur kurz. Der pfiffige Sohn Sascha renovierte seine kleine Bleibe aufwendig, vermietete sie an einen englischen Geschäftsmann und zog wieder zu seinen Eltern. »Wo sollte er denn auch hin? Seine Wohnung hat er doch vermietet«, meinte die Mutter verständnisvoll. Der Gedanke, dass ihr Sohn sich für einen Teil seiner Mieteinnahmen weiter außerhalb sehr wohl etwas Eigenes hätte mieten können, lag ihr fern. »Aber dann muss er ja so weit fahren bis zu seiner Arbeitsstelle!« Gatte Wolodja, der sich in den zurückliegenden Jahren sehr engagiert an der Erziehung der Sprösslinge beteiligt hatte, hielt zum ersten Mal dagegen. »Weißt du, der Junge schläft im Nebenzimmer, man traut sich ja nicht einmal, im eigenen Schlafzimmer Geräusche zu machen.«
Ein Leben lang wird den kleinen Burschen, später dann den Halbwüchsigen, eingeredet, dass sie die Ernährer, die Beschützer des heimischen Herdes seien. Erst durch ihre Fürsorge, so erfahren sie schon frühzeitig, können eine Familie und insbesondere die Frauen existieren. Die Folge: Generationen kleiner Zaren schwingen sich zu Alleinherrschern in ihren Familien auf, verteilen Gunst oder Tadel nach eigenem Gutdünken. Bis zur körperlichen Züchtigung ist es dann manchmal nicht weit. In drei von vier Familien, so die Schätzungen von Experten, gehört Gewalt zum Alltagsleben. Der Volksmund hat sogar noch Verständnis dafür. »Er schlägt dich? Also liebt er dich«, heißt eine russische Redewendung.
Die Gewalt hat zugenommen in den vergangenen Jahren. Denn in dem Maße, wie verwöhnte Familienpaschas mit den neuen, harten Konkurrenzbedingungen nicht mehr zurechtkommen, entlädt sich der Frust in den eigenen vier Wänden. In jeder Stunde wird irgendwo in Russland eine Frau Opfer einer Gewalttat in der Familie. Jedes Jahr sterben 9000 Frauen infolge von Gewalt in der Ehe, konstatierte Lidija Bardakowa, Koordinatorin des UN-Programms für Bevölkerungspolitik. Russische Frauen sterben zehn Jahre früher als ihre Geschlechtsgenossinnen in Europa – und leben dennoch deutlich länger als die russischen Männer. Die Müttersterblichkeit ist sechsmal höher als in europäischen Ländern.3
Das Paradoxe daran ist, dass dessen ungeachtet die russischen Männer vom Aussterben bedroht scheinen. Sie haben mit 59 Jahren eine um 13 Jahre geringere Lebenserwartung als die Frauen, die im Durchschnitt 72 Jahre alt werden. Das männliche Geschlecht stellt nur noch 47 Prozent der Gesamtbevölkerung – Tendenz fallend. In den vergangenen Jahren setzten rund 60 000 Menschen in Russland ihrem Leben durch Selbstmord ein Ende. Dabei hatten die Männer einen sechsmal höheren Anteil als die Frauen.4
»Männer«, urteilt eine Moskauer Bekannte resolut, »halten eben nichts aus. Sie sind anfällig gegen Stress, sie werden schneller krank und sind weniger leistungsfähig. Männer sind schwach.« Gebraucht werden sie dennoch. Obwohl die Zahl der Scheidungen hoch ist, obwohl viele Frauen alleine besser zurechtkämen und es dann oft auch in der Praxis tun, legen sie vielfach Wert auf einen ordentlich angetrauten Ehegatten. Erst dann werden sie in der ausgeprägten Macho-Gesellschaft rundum akzeptiert und ernst genommen.
Natürlich ist auch das alles nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich gibt es auch in Russland den aktiven, schnell zupackenden und rational handelnden Mann. Allein die Existenz der russischen Oligarchen, über deren Motivation und Methoden kaum Zweifel angebracht sind, beeindrucken in gewisser Weise mit ihrer schier unbändigen Energie, mit ihrer skrupellosen, durch nichts zu bremsenden Gier nach mehr.
Besonderheiten der russischen Ehe
Die Ehe hat unter den erwachsenen Russen einen relativ hohen Stellenwert. Auf die Frage, was das Wichtigste ist, dem man sich in der Jugend widmen sollte, waren 44 Prozent der Befragten der Meinung, dies seien die Gründung einer Familie und Kinder. Erst dann folgen mit 39 Prozent der Beruf und die Karriere. Die Meinung, man lebe in der Jugend vor allem zu seinem Vergnügen, teilten nur zwölf Prozent. Ein Paradigmenwechsel kündigt sich indes an. Bei den 18- bis 24-Jährigen sah nur ein Viertel der Befragten die Familie als wichtigstes Lebensziel. 56 Prozent setzten Beruf und Karriere ins Zentrum ihrer Lebensplanung.5
Das macht sich auch am Alter derer bemerkbar, die sich zur Ehe entschließen. Während zu sowjetischer Zeit schon sehr früh, noch während oder gleich nach Abschluss des Studiums mit Anfang 20 geheiratet wurde, steigt das Heiratsalter – wie in Westeuropa schon lange üblich – langsam an. Der Bräutigam ist heute durchschnittlich 25,8, die Durchschnittsbraut 23,1 Jahre alt. Die Tendenz: steigend. Dazu muss man wissen, dass Russlands Studenten die Universitäten sehr früh verlassen. In der Regel sind sie mit 21 oder 22 Jahren bereits graduiert.
Dabei beeilen sich viele der bis 30-Jährigen nicht mit der offiziellen Besiegelung dieses Status. Zehn Prozent ziehen die sogenannte »zivile Ehe« vor, was bedeutet, dass sie in einer Lebensgemeinschaft ohne Trauschein zusammenleben.6
Doch für die Mehrheit der Russen bleibt die Institution Ehe vorrangiges Lebensziel, auch wenn mehr als 50 Prozent schon in den allerersten Jahren scheitern. Hochzeiten werden mit großem Pomp begangen. So manche Familie stürzt sich in Schulden, um die Feier standesgemäß auszurichten. Weißes Brautkleid und Schleier sind obligatorisch, sexuelle Beziehungen vor der Ehe sind es auch. Sex wird in Russland von 65 Prozent der 15- bis 19-Jährigen und 97 Prozent der 20- bis 24-Jährigen praktiziert.
Je nach Geldbeutel fährt die Hochzeitsgesellschaft entweder mit schlichten Lada- und Wolga-Pkws oder auch mit amerikanischen Stretch-Limousinen und sogar mit Stretch-Hummern vor dem Hochzeitspalast vor. Brautjungfern und Brautführer tragen bunte Schärpen, Sekt fließt schon vor der Zeremonie. Besonders an Wochenenden werden die Ehen wie am Fließband geschlossen.
Pausenlos wiederholen die Standesbeamten, die in der Regel weiblich sind, ihre salbungsvolle Rede mit der Aufforderung zu staatsbürgerlichem Handeln, wobei oft nur die Namen des Brautpaares ausgetauscht werden. Anschließend geht es in Kolonne durch die Stadt zu den Orten, wo traditionell Blumen niedergelegt werden. Mit dieser Geste am Grabmal des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer, am Denkmal des Sieges auf dem Verneigungshügel oder am Panzersperren-Denkmal gedenken die Hochzeitsgesellschaften der Toten im Großen Vaterländischen Krieg, in dem praktisch jede russische Familie den Verlust von Angehörigen zu beklagen hatte.
Die kirchliche Trauung, die wieder populärer wird, findet entweder noch am selben Tage, meist aber aus Gründen der Organisation Tage oder sogar Wochen später statt. Zu sowjetischer Zeit war sie zwar nicht gesetzlich verboten, aber für Mitglieder des parteigelenkten Jugendverbands Komsomol oder der Kommunistischen Partei aus ideologischen Gründen praktisch nicht machbar. Auch Parteilose, die beruflich engagiert waren, unterließen das tunlichst. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat es deshalb zahlreiche Fälle gegeben, da alte Ehepaare ihre kirchliche Trauung noch lange nach der Eheschließung nachgeholt haben.
Auf dem Lande ist es heute üblich, dass der Bräutigam die Braut unter dem johlenden Beifall der Hochzeitsgäste über die Brücke eines nahe gelegenen Flusses trägt. Das ist nicht so ganz leicht, da die jungen Frauen meist stämmig gebaut und die angehenden Ehemänner zu dem Zeitpunkt schon kräftig angetrunken sind. Auch ist es durchaus die Regel, dass eine Hochzeit auf dem Dorfe, die gleich mehrere Tage dauert, mit einer kräftigen Prügelei abgeschlossen wird.
Ist es der Männermangel oder sind es optisch nicht erkennbare Werte, die die Zusammensetzung so manches Paares bestimmen? Jedenfalls kann man an den traditionellen Moskauer Orten des Kranzabwurfs des Öfteren etwas sonderbar erscheinende Pärchen beobachten: Sie, bildschön, resolut und Anfang 20, natürlich mit Schleier und ganz in Weiß, hat »ihn« im Schlepptau: einen unscheinbaren, nichtssagenden Typen, der nur wenig älter ist, aber im Gegensatz zu seiner aufgeweckten, frisch angetrauten Gattin schon jetzt mit glasig werdenden Augen in die Welt blinzelt.
Wodka – Droge und Kultgegenstand
»Wenn es dir morgens gutgeht, hast du am Abend schlecht getrunken. Geht es dir morgens schlecht, hast du am Abend gut getrunken«, sagt der Volksmund in Anlehnung an ein Majakowski-Gedicht. Trinken ist männlich, trinken adelt die Runde tapferer Kerle und ist eine Sache der Ehre. Das jedenfalls ist vor allem auf dem Lande die weit verbreitete Auffassung. Es gehört – auch wenn sich die Gewohnheiten in der Großstadt zu wandeln beginnen – zum russischen Leben, wie Pelmeni, Bliny und Piroggen.
Doch »Sastolje« – das gemeinsame Tafeln – ist in Russland mehr als nur ein Gelage, mehr als ein Bankett oder eine Tafelrunde. Das ist in Jahrhunderten gewachsene Lebensweise, eine Philosophie des familiären Zusammenhalts, des gemeinsamen Erzählens, Fabulierens und Prahlens im Freundeskreis. Legendär sind die Gespräche in den Küchen der Intelligenzija, wobei die KGB-Häscher zugleich Jagd auf Dissidenten machten.
»Russkoje sastolje« ist ein Ausdruck uralter russischer Kultur, die in ihrer gemäßigten Form für kuschelige Geselligkeit, für gutes Essen, gemeinsames Singen und herzwärmende Trinksprüche steht. Die dürfen auch schon mal etwas pathetisch sein: »Wodka ist Gift, Gift ist Tod, Tod ist Schlaf, Schlaf ist Gesundheit. Wollen wir auf die Gesundheit trinken.« Auf dieses Kommando hin wird das Glas – es müssen nicht die berühmten 100 Gramm sein, es reichen auch 40 – an die Lippen gehoben und zügig heruntergekippt.
Deutsche können da in der Regel nicht mithalten. Was wiederum von Russen mitleidig belächelt wird. Der Autor Iwan Iwander schreibt: »Der normale Durchschnittsdeutsche wird sich in der Gesellschaft seiner Freunde nie erlauben, sich bis zur Bewusstlosigkeit zu besaufen oder das volle Feierabendprogramm zu absolvieren. In meinen jahrelangen Begegnungen mit Deutschen habe ich nur einen einzigen Alkoholiker gesehen und zwei, drei, die auch ohne Anlass gerne mal einen getrunken haben.«7
Aber was ist das eigentlich, was da als urrussisches Nationalgetränk gilt und die Bezeichnung »Wässerchen« trägt? Seine »Erfindung« wird dem berühmten russischen Naturwissenschaftler Dmitri Mendelejew zugeschrieben. Mendelejew, dessen eigentliche Leistung die Entdeckung des Periodensystems der Elemente ist, soll als Erster die für den russischen Wodka klassische Alkoholkonzentration festgelegt haben. Es müssen genau 40 Prozent reinsten Sprits sein, jede Abweichung davon nach oben oder nach unten sei von Übel, postulierte der Wissenschaftler.
Dieses Getränk wird gut gekühlt, manchmal aber auch lauwarm, in einem Zuge getrunken. Anschließend wird sofort etwas nachgegessen. An »Zubiss« mangelt es in Russland nie. Die Tische biegen sich unter dem Gewicht der reichhaltigen »Sakuski«, ohne die Trinken als Sauferei gilt. Die in Deutschland übliche Trennung, Gästen zuerst ein Abendessen zu servieren und dann anschließend eventuell auch härtere Getränke anzubieten, wäre in Russland ein Stilbruch. Aus sowjetischer Zeit ist ein Ausspruch überliefert, demzufolge es in deutschen Geschäften alles, auf deutschen Tischen nichts gebe. Dagegen seien die sowjetischen Geschäfte leer, aber auf den Tischen in Russland gebe es alles. Reichliches Essen und Trinken wechseln sich den ganzen Abend über ab und mildern die Folgen des Alkoholgenusses. Schwarzer oder roter Kaviar passen perfekt zu Wodka. Ebenso Stör, Räucherlachs, eingelegte Pilze, Salzgurken, Fleischbällchen, verschiedene Salate, Roggenbrot und Butter. Nach jedem Schluck wird sofort etwas gegessen.