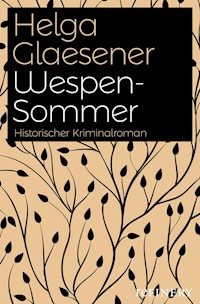6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Safranhändlerin-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Paradies liegt in Venedig - und genau dorthin zieht es die Safranhändlerin Marcella mit ihrem Verlobten Damian, um zu heiraten und um einen neuen Gewürzhandel in der Lagunenstadt aufzubauen. Doch auf dem Weg erreicht die beiden eine alarmierende Nachricht, die sie zwingt, nach Frankreich zu reisen. So gelangt Marcella in das Dorf ihrer Kindheit, wo ihre Ankunft für Aufregung sorgt. Was verbirgt sich hinter den biederen Gesichtern der Bauern? Wie starb Marcellas Schwester Jeanne wirklich? 'Herbst 1327. Die Gewürzhändlerin Marcella Bonifaz ist mit Damian Tristand, der Liebe ihres Lebens, auf dem Weg nach Venedig, wo die beiden in den Stand der Ehe treten wollen. Da erhält Tristand die Nachricht, dass sein Handelskontor in Narbonne schwere Verluste macht, und er bittet Marcella, mit ihm zunächst nach Frankreich zu reisen, um nach dem Rechten zu sehen. Schon bald stellt sich heraus, dass Tristand keinem seiner Mitarbeiter trauen kann. Damit nicht genug: Ein frommer Bürger findet einen verfrühten Tod - und die Suche nach dem Betrüger und Mörder führt das Paar ausgerechnet in Marcellas Heimatdorf, das sie als Kind so überstürzt verlassen musste. Als die beiden sich in dem alten Ketzernest nach ihrer Schwester Jeanne erkundigen, die auf mysteriöse Weise ums Leben kam, stoßen sie auf eine Mauer des Schweigens. Und dann wird nicht nur ihre alte Amme, die Licht ins Dunkel bringen könnte, im Badehaus ermordet; auch Tristand entgeht einem Mordanschlag nur um Haaresbreite. In ihrem früheren Elternhaus erkennt Marcella schließlich, wer damals die Fäden zog - jemand, der vor nichts zurückschreckt. '
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Herbst 1328: Die Safranhändlerin Marcella Bonifaz ist mit Damian Tristand, der Liebe ihres Lebens, auf dem Weg nach Venedig, um zu heiraten. Da erhält Damian die Nachricht, dass sein Handelskontor in Narbonne schwere Verluste erleidet – offenbar das Werk eines Betrügers. Sie reisen nach Frankreich, aber es fällt schwer, den Schuldigen zu entlarven. Auf der Suche nach ihm gelangt Marcella in die Nähe des Dorfes, in dem ihre Schwester Jeanne viele Jahre zuvor unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Sie lässt sich verleiten, dem Ort einen Besuch abzustatten und wird zunächst freundlich empfangen. Doch bald schlägt die Stimmung um …
Die Autorin
Helga Glaesener, 1955 geboren, hat Mathematik studiert, ist Mutter von fünf Kindern und lebt heute in Aurich, Ostfriesland. Safran für Venedig ist die Fortsetzung ihres großen Erfolgsromans Die Safranhändlerin.
Von Helga Glaesener sind in unserem Hause bereits erschienen:
Du süße sanfte Mörderin Die Rechenkünstlerin Die Safranhändlerin Der singende Stein Der Weihnachtswolf (nur als E-Book) Wer Asche hütet
Helga Glaesener
Safran für Venedig
Roman
List Taschenbuch
Neuausgabe bei Refinery
Refinery ist ein Digitalverlag
der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Juni 2018 (1)
© 2004 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Covergestaltung: zero-media.net, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
ISBN 978-3-96048-202-4
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Für meine Eltern, die sich in ihrem Glauben, sechs großartige Kinder zu haben, nie irre machen ließen. Danke.
Prolog
Montaillou, im Februar 1312
Guillaume stolperte und fiel der Länge nach in die mit geschmolzenem Schnee durchtränkte Furche, die seinen Rübenacker vom Feld der Benets trennte. Er trug keinen Mantel, denn den hatte er in der Aufregung am Haken hängen lassen. Darum sog sich sein dünner, knielanger Wollkittel sofort mit Wasser voll, und er war innerhalb eines Atemzugs durchnässt.
Dreckskälte.
Dreckskälte, fluchte er still. Aber der Schmerz, mit dem die Haut sich zusammenzog, hatte auch sein Gutes. Guillaume begann wieder zu denken. Zitternd erhob er sich, wischte Dreckklumpen von Bauch und Beinen und fragte sich, was geschehen wäre, wenn er mit seiner Wut einfach in ihre Häuser gestürmt wäre. Er war ein Mann ohne Phantasie. So brachte ihm seine Überlegung keine schrecklichen Bilder, sondern nur ein schweres Gefühl im Magen, als hätte er sich an rohem Teig überfressen. Er hob den struppigen Bauernkopf und blickte zum Himmel.
Es war diese verhexte Zeit zwischen Tag und Nacht, die er nicht leiden konnte. Über den Berggipfeln hing ein kreisrunder Mond, grell wie ein Tropfen aus Feuer. Er färbte den Schnee auf den Kuppen, aber nicht gelb, sondern violett – der Teufel mochte wissen, wie das zuging. Die Baumwipfel auf den Berghängen waren klarer gezeichnet als bei Tag und sahen aus wie die Lanzenspitzen eines Geisterheeres, das in die Täler marschierte. Guillaume bekreuzigte sich. Die Welt, die richtige Welt, bestand aus steiniger Erde, in die man seinen Spaten schlug, und aus blutigem Fleisch, das man vom Fell eines Schafes kratzte. Er wünschte, er könnte sich in seinem Haus verschanzen, wie es jeder anständige Mensch um diese Zeit tat.
Aber da war die Zunge. Er hatte sie in ein Stück Leder eingewickelt und in seinen Gürtelbeutel getan, und obwohl er sich nicht bewegte, schlug sie gegen seine Schenkel und gemahnte ihn an seine Pflicht. Widerwillig setzte er sich erneut in Bewegung.
Nicht durchs Dorf, du einfältige Strohnase, zischelte es aus dem Beutel. Denkst du, sie geben nicht Acht? Denkst du, sie schlafen?
Ich tu, was ich will, sagte Guillaume trotzig.
Dann stirb.
Aber er würde nicht sterben. Denn inzwischen war der Retter gekommen. Am späten Nachmittag hatte er ihn, umgeben von bewaffneten Reitern in prächtigen roten Gewändern mit Kreuzen auf dem Rücken, von Comus herüberreiten sehen. Selbstverständlich musste er trotzdem vorsichtig sein. Sie schliefen nie. Und die Nacht war die natürliche Zeit für ihre Untaten. Der Weg durchs Dorf war ihm also genommen.
Mit diesem Entschluss verließ Guillaume kurz vor dem Haus von Onkel Prades den Weg und kletterte einen Trampelpfad hinab, der zum Ufer des Hers führte. Er würde dem Flüsschen durch die Schlucht folgen und dann an dem künstlichen Kanal entlanggehen, der den Halsgraben der Burg mit Wasser versorgte. Von da waren es nur noch wenige Schritte.
Sein Pfad verlor sich rasch in dem wucherndem Gestrüpp, das abseits der Felder die Hänge bedeckte. Guillaume verhedderte sich in Dornen, und er fluchte erneut. Die Ernte war schlecht gewesen, zwei seiner Ziegen an Ausfluss gestorben. Er würde sich keinen neuen Kittel leisten können.
Je tiefer der Bauer in die Senke stieg, umso dunkler wurde es, bis nicht mehr der kleinste Mondstrahl den Boden erhellte. Guillaume blieb stehen, oder vielmehr: Er wollte stehen bleiben. Doch das Gras war plötzlich glitschig wie die Tenne nach dem Schlachttag. Er rutschte aus, schlitterte ein Stück auf dem Hintern, fasste in heillosem Schreck nach allem, was sich bot, und konnte sich gerade noch an ein paar Zweigen halten, da hing er schon bis zu den Waden in eiskaltem Wasser. Hölle! Der Hers musste weit über seine gewohnte Höhe angestiegen sein. Er gurgelte wie ein wütendes Tier, dem die Beute zu entwischen droht. Zitternd suchte Guillaume nach einem stärkeren Halt, fand einen Stamm, zog sich daran aus dem Wasser und kauerte sich zusammen.
Wie dumm von ihm, einfach loszustürzen. Es gab einige im Dorf, denen man trauen konnte. Philippe, die alte Raymonde … Er hätte sich Verbündete suchen und mit ihnen gemeinsam …
Du warst immer ein Idiot, lästerte die Zunge.
Sie trieb ihn zurück auf die Füße. Mühselig kletterte er den Hang hinauf.
Nicht durch das Dorf.
Ja, beeilte er sich zu sagen. Er erreichte Onkel Prades’ Hütte – und dort hätten sie ihn fast erwischt. Sie lauerten hinter den Johannisbeerbüschen, aus deren Früchten seine Schwester im Sommer Sirup kochte. Zwei Schatten, die im Mondlicht wie schwarze Riesenkürbisse wirkten.
Ohne nachzudenken warf Guillaume sich flach auf den Boden. Die Dreckskerle waren ihm also tatsächlich auf den Fersen, und wahrscheinlich hatten sie Messer und Knüppel dabei. Die Zunge pochte an seinen Schenkel. Er lag neben dem Misthaufen von Onkel Prades, hatte einen kotverkrusteten Strohhalm in der Nase und konnte vor lauter Furcht nicht einmal die Hand heben, um ihn zu entfernen.
Alles, was ihm einfiel, war ein Fluch für seine Mutter, die ihn in diese üble Lage gebracht hatte. Was würden sie tun, wenn sie ihn nicht erwischten? Zu seinem Haus gehen? Plötzlich fiel ihm Grazida ein, die ihr Lager neben den Ziegen hatte und sicher schon schlief. Er mochte seine Frau nicht sonderlich, aber jetzt tat sie ihm Leid.
Nur konnte er ihr nicht helfen.
Wie ein Krebs kroch Guillaume rückwärts und brachte sich hinter dem Misthaufen in Sicherheit. Er wusste, er musste jetzt genau nachdenken. Die Schlucht war überflutet und der Weg durchs Dorf versperrt. Also blieben nur die Klippen, die die westliche Grenze der Burg bildeten. Unsicher fasste er nach dem Beutel, doch das graue Stück Muskel blieb diesmal stumm. Dann war seine Entscheidung gut. Wenn seine Mutter nichts sagte, hieß das: gut.
Er brauchte lange, um von Onkel Prades’ Hütte fortzukommen. Und als er nach zahllosen Kletterpartien und zwei schweren und mehreren leichten Stürzen endlich über das letzte Stück Fels kroch und die Burgmauer vor sich sah, mussten sie im Dorf schon in tiefem Schlaf liegen. Erleichtert hob er den Kopf zu dem steinernen Wohnturm, dem Donjon, in dem der Kastellan lebte und in dem nun sein Retter wohnte. Warmes Licht fiel durch zwei Fenster im oberen Teil des Turms, was ihm wie ein freundlicher Gruß vorkam.
Entschlossen hinkte Guillaume – er hatte sich den Fuß verstaucht – auf die Pforte zu. Der Mond, dieser verhexte Bundesgenosse der Nacht, ließ das Wasser im Halsgraben aufglitzern. Irgendwo schrie ein Käuzchen. Guillaume beschloss, die Nacht in der Burg zu verbringen. Keine Macht der Welt würde ihn noch einmal aus den Mauern bringen, ehe es hell war. Grazida mit ihrem Großmaul musste für sich selbst sorgen.
Er pochte an das Holztor und erhielt unverzüglich Antwort. Aber nicht der alte Pons ließ ihn ein, sondern einer der Ritter des edlen Herrn. Guillaume sah das weiße Kreuz auf seinem Mantel. Er hätte den Fremden am liebsten an die Brust gedrückt, doch gleichzeitig packte ihn die Scheu seines Standes, und so trug er stotternd sein Anliegen vor. Der Mann nickte, zog die Kapuze tiefer und deutete zur Treppe hinauf, wo ein zweiter Ritter wartete. Wahrscheinlich hatte er kein Wort verstanden. Unten, im Tiefland von Pamiers, sprachen sie einen anderen Dialekt.
Guillaume griff nach dem Beutel mit der Zunge. »Wenn Ihr begreifen wollt – sie sind …«
Der Mann schob ihn weiter, um das Tor verriegeln zu können.
»… wahrhaftig böse«, murmelte Guillaume. Er stapfte hinter dem anderen Ritter die Pferdetreppe hinauf. Sie sind wahrhaftig böse – das war es, was er dem Bischof erklären musste. Er war glücklich, die richtigen Worte gefunden zu haben.
Der Ritter führte ihn in den Burghof. Seltsam, obwohl der Platz durch die Mauern geschützt war, schien der Wind hier noch eisiger zu wehen. Aber das lag vielleicht daran, dass Guillaume wegen seiner nassen Kleider inzwischen völlig durchfroren war. Er beneidete den Ritter um den dicken Mantel, in dem er fast verschwand.
»Wahrhaftig böse«, murmelte Guillaume, um diesen wichtigen Teil seiner Botschaft nicht zu vergessen. In einem der Ställe wieherte ein Pferd. Eine Gestalt schlüpfte aus der Stalltür und ging zur Pferdetränke, um dem Tier Wasser zu bringen. Guillaume musste an seine verendeten Ziegen denken.
Dann fiel ihm etwas auf: Der Kerl dort vorn, das war gar kein Bursche, sondern eine Frau. Hier, im Hof der Burg von Montaillou, färbte der Mond weder violett noch gelb. Ihre Hände und ihr Gesicht waren weiß. Es kam ihm schrecklich und unheimlich vor. So hatten die Gebeine der Ketzer unten in Ax ausgesehen, die sie aus den Gräbern geholt hatten, um sie zu verbrennen. Das Weib starrte ihn an.
Guillaumes Verstand arbeitete schleppend. Es dauerte mehrere Atemzüge, bis er sie erkannte. Und dann war er so bestürzt, dass er kaum wahrnahm, wie sein Führer ihn packte und zur Tränke drängte. Unablässig stierte er in das weiße Gesicht und versuchte zu begreifen, was die verzerrten Züge bedeuteten. Hasste sie ihn etwa? Aber warum?
Ihre Züge waren ihm vertraut bis hin zu der Brandwunde am linken Augenlid, die sie sich kürzlich beim Backen zugezogen hatte. Dennoch war ihm, als hätte er nie ein fremderes Wesen gesehen. Über die Lippe der Frau rann Speichel. Ja, sie hasste ihn, und zwar so leidenschaftlich, dass sie unfähig war, die eigene Spucke zu beherrschen. Guillaume wollte einen Laut des Abscheus herausbringen. Erst jetzt merkte er, dass man ihm den Mund zuhielt. Er wollte protestieren, aber ein Tritt in die Kniekehlen zwang ihn auf die Knie. Sein Kinn knallte auf die Kante der Tränke.
Ihn packte die Furcht. Er verdrehte den Hals und wollte einen Schrei ausstoßen, doch die Hand hielt ihn eisern fest. Jemand griff in sein Haar. Im nächsten Moment tauchte sein Kopf in eiskaltes Wasser.
Er kam nicht an gegen die vielen Hände, die ihn hielten. Sie klammerten sich sogar an seine Beine, und jemand stemmte gegen die Zunge im Beutel. Aber erst, als etwas Hartes seinen Nacken traf, hörte er auf, sich zu wehren.
Und selbst da war er noch nicht tot. Sie schleppten ihn an den Rand des Hofs, hievten ihn über die Mauer und warfen ihn in den Halsgraben. Das Letzte, was er sah, waren ihre Gesichter, die, immer noch weiß, auf ihn hinabstarrten, als er ins Wasser eintauchte.
1. Kapitel
Augsburg, im Oktober 1328
Liebste Elsa, all deine Sorgen waren umsonst. Ich bin gut umsorgt und … glücklich.
Marcella stellte sich vor, wie Elsa mit dieser Nachricht zu Bruder Randulf von St. Maximin ging und sich in dem staubigen Raum hinter der Klosterküche die Worte entziffern ließ. Fünfzehn Heller, werte Frau, und ich hoffe, es ist akkurat geschrieben. Bruder Randulf war keiner, der über die Belange seiner Besucher tratschte, aber er hatte eine widerwärtige Art, beim Lesen die Augenbrauen hochzuziehen – als wäre er Richter über Israel. Sie ist also glücklich, die Dame, die mit diesem venezianischen Wucherer davongelaufen ist? Und es kümmert sie gar nicht, dass ihr Onkel aus Gram um ihr schlimmes Treiben starb? Ach Elsa, warum hast du nicht lesen gelernt? Und warum hast du dir nicht ein Herz gefasst und mich begleitet? Seufzend glättete Marcella das Wachs ihrer Schreibtafel und begann von vorn.
Liebe Elsa, ich bin glücklich. Damian Tristand ist so rücksichtsvoll, wie ein Mensch nur sein kann. Er kümmert sich um alles …
Sie schaute zum Fenster hinüber, hinter dem ein trister Nachmittag einen verregneten Vormittag ablöste. Augsburg war eine hässliche Stadt, in der es selbst nach einem Regenguss stank wie in einem Abort. War Trier genauso gewesen? Fiel ihr diese Trostlosigkeit nur auf, weil sie zur Untätigkeit verdammt in dieser Herberge saß und mit der Zähigkeit der Stunden kämpfte? Sie hörte, wie unten auf der Gasse etwas schepperte und ein Rindvieh muhte. Jemand begann zu keifen, ein Mann, dem offenbar von dem Tier etwas niedergerissen worden war.
Deine Ratschläge zu befolgen, Elsa, kritzelte Marcella, fällt mir schwer. Ich bin schlecht gelaunt, und wenn Tristand jetzt den Raum beträte, würde ich ihn fragen, warum er gerade dieses Haus in gerade dieser Gasse aussuchen musste. Und warum er mir gerade dieses schreckliche Weib aufschwatzen musste, das nebenan schon wieder Honig in viel zu süßen Wein rührt und nörgeln wird, bis ich ihn trinke. Ach Elsa. Er ist so geduldig, aber er wird mich erschlagen, bevor wir Venedig nur von weitem sehen. Oder ich ihn.
Das Weib war mit dem Honigrühren fertig. Es stieß mit der Hüfte die angelehnte Tür auf und schob schwatzend eine Schale mit Birnen beiseite, um auf dem Tisch Platz für ihren Becher zu schaffen.
»Maria, glaubt mir, ich habe nicht den geringsten …«
»Es geht nicht um Durst, Herrin, oder den lieblichen Geschmack, sondern um Gesundheit. Zuerst ist es ein leichter Husten, dann röcheln die Lungen, und am nächsten Tag trägt man Euch zu Grabe.«
»Ich habe keinen Husten, Maria.«
»O doch, ich bin davon erwacht, heute Nacht, von Eurem Husten.« Maria blies die Wangen auf und imitierte das Geräusch. Sie war nicht schrecklich. Sie gehörte zu den bewundernswerten Menschen, die anderer Leute Nöte behandelten, als seien es ihre eigenen. Damian hatte sie von einem Geschäftspartner empfohlen bekommen. Man musste dankbar sein, von einem solchen Schatz umsorgt zu werden.
»Ich habe gehustet, weil die Luft stickig war.«
»Gewiss doch. Das ist der Anfang, und dann …«
… die Lungen und das Grab. Die Schwaden, die aus dem Becher aufstiegen, drehten Marcella den Magen um. Aber Maria würde nicht nachgeben. Ihre Güte war von der Art, die das Ziel der Fürsorge eher erschlug, als es Schaden nehmen zu lassen.
Liebe Elsa, ich sterbe vor Sehnsucht nach dir, kritzelte Marcella quer über sämtliche Worte und warf die Tafel auf ihr Bett.
»Nun nehmt schon, Herrin.« Maria schob den Becher näher.
Marcella fand, es sei an der Zeit, endlich einmal deutlich zu protestieren, aber die Worte erstarben auf ihren Lippen, als sie sah, wie die Frau plötzlich zu lächeln begann. Das Lächeln hatte nichts mit ihrer Unterhaltung zu tun. Maria horchte zum Fenster. Ihre Wangen röteten sich. Es war, als hätte sie ein Zauberstab berührt, der sie mit einem Schlag um Jahre verjüngte. Man vergaß, dass ihr Busen fast zur Taille reichte und die Natur sie mit bläulichen, stark geäderten Wangen versehen hatte.
»Ich glaube, er ist heimgekommen.«
Marcella spitzte die Ohren, hörte aber nur den Gassenlärm und irgendwo eine Tür schlagen.
»Er ist so freundlich. Herr Tristand, meine ich. Ist Euch aufgefallen, dass er niemals laut wird? Also, das kann man sonst nicht von Männern sagen. Ich glaube, sie ahnen nicht, wie uns Frauen das einschüchtert. Und daher ist es umso angenehmer, wenn jemand …« Marias Gesicht glühte auf. Ungeschickt strich sie ihren Rock glatt und stopfte die Haarsträhnen ins Gebende zurück.
»Er ist wirklich freundlich.«
»Und stets guter Laune.«
»Und stets guter Laune«, wiederholte Marcella. Es stimmte nicht, weder im Allgemeinen noch gerade in diesem Augenblick. Sie hörte an dem Poltern auf der Holzstiege, dass er sich über etwas aufregte. Verdrossen kam er ins Zimmer, kümmerte sich weder um die Schmutzspuren seiner Stiefel noch um die Tür, die er mit dem Absatz zuknallte, und ließ sich auf den Stuhl fallen, der neben dem Fenster stand.
»Eine widerliche … eine laute, schmutzige und widerliche Stadt.«
Maria räusperte sich. »Ich schaue nach einem zweiten Glas Wein.«
»Tut das, ja bitte.« Er kaute auf dem Nagel des kleinen Fingers, eine Unart, die Marcella neu an ihm war. Aus den Falten seines Mantels – eines wunderschönen Mantels, grüner Scharlach, der von einer goldenen Fibel an der Schulter zusammengehalten wurde – tropfte der Regen. Als er es merkte, zerrte er ihn ungeduldig herab und warf ihn von sich. »Was riecht denn hier so scheußlich … süß?«
»Ich frage den Wirt nach dem Met von gestern«, erklärte Maria hastig. »Und nach einer Mahlzeit.«
Damian nickte. Er merkte nicht, dass sie wie ein Hündchen auf seinen Blick wartete. Er hatte sie bereits vergessen. Liebe Elsa, das Leben ist grausam. Maria wird mir in den nächsten Erkältungstrunk Maiglöckchensaft schütten und sich danach in den Lech stürzen, und so wird dieses Abenteuer das Ende nehmen, das ich die ganze Zeit befürchte.
»Willst du mich heiraten, Liebste?«
Marcella wartete, bis die Tür hinter Maria zuklappte, und dann noch einen Augenblick, ehe sie antwortete. »Herr Tristand, ich reite durch knöcheltiefen Matsch, schlafe auf Stroh und trinke klebrigsüßen Honigwein, weil genau dies mein Wunsch ist.«
»Ich meine: heute noch. Wir könnten in die Kirche am Wollmarkt gehen, den Priester umschmeicheln, bis er die Kapelle öffnet, einander das Jawort geben und den Tauben verkünden, dass sie Zeugen eines Wunders waren.«
»Du knallst mit den Türen und planst, dich in der hässlichsten Kirche Deutschlands in die Ehe zu stürzen. Nun wird mir bange. Was um alles in der Welt ist geschehen?«
Er ließ den Arm sinken und begann zu lächeln. Wenn er lächelte, war sie verloren. Seine Augen, die braun und seidig wie Katzenfell waren, bekamen einen feuchten Schimmer, und um seine Augenwinkel bildeten sich winzige Fältchen, von denen jedes einzelne ihr Herz rührte, weil sie in ihm ein böses Schicksal vermutete, dem er getrotzt hatte.
»Vielleicht ist es die Angst, es könnte mir wie Boguslaw, dem Ungarn, ergehen.«
»Was fehlte dem Mann?«
»Er verlor sein Herz an die schönste Herrin, die jemals an den Ufern der Sava schritt. Er folgte ihr in ein Schloss aus Schilf und diente ihr sieben Jahre lang, wie ehemals Jakob. Doch als er nach ihr greifen wollte, fasste er in Nebel. Seither irrt er als klagender Fischotter durch ihr Reich.«
»Das ist in der Tat grausam. Und was, Damian, beschwert dein zählendes, wägendes Krämerherz wirklich?«
»Wie schlecht du mich kennst. Boguslaw erscheint mir in den Träumen und spricht finstere Orakel.«
»Dann lade ihn nach Venedig ein. Unsere Hochzeit wird ihn auf fröhlichere Gedanken bringen.«
Damian lächelte erneut. Er erhob sich von seinem Stuhl und kam zu ihr an den Tisch. Dabei bewegte er sich langsam wie jemand, der einen Schmerz vermeiden will, aber nicht möchte, dass es auffällt.
Besorgt fasste sie nach seinen Händen. »Was also ist los?«
»Geschäftlicher Ärger. Nichts von Bedeutung.«
»Gewiss. Es ist deine Art, dich über Belanglosigkeiten aufzuregen. Nun komm – was verschweigst du mir?«
»Nur eine dumme kleine …«
Diesmal klopfte Maria. Sie trug den Wein herein, und Damian war so offensichtlich erleichtert über die Unterbrechung, dass es Marcella einen Stich gab. Liebste Elsa, ich tue mein Bestes, aber leider habe ich eine größere Begabung zum Inquisitor als zur Ehefrau. Er wird mich nicht erschlagen – er wird mit Maria durchbrennen und mich meinem Schicksal überlassen.
Ihr Verlobter und Maria begannen ein Gespräch über die segensreichen Wirkungen des Honigs. Mit Beifuß vermengt ergab er ein Mittel gegen Geschwüre. Mit Zimt, Ingwer und Honig half er bei Koliken. »Ein Wunder, das der Herrgott uns zum Troste ließ«, sagte Maria, »und am besten ist der Honig aus Nürnberg.«
»Aus Nürnberg!«, wiederholte Damian, der vorbildlich zugehört hatte. Er hielt Maria die Tür auf und verneigte sich höflich, als sie ging, um nach dem Essen zu sehen. Merkte er, dass sie ihn absichtlich mit den Röcken streifte? Marcella hatte keine Ahnung. Sie sah zu, wie er zum Fenster trat und das Geschehen auf der Straße beobachtete.
»Was hast du für Sorgen mit dem Geschäft?«
»Wenn ich das so genau wüsste. Donato Falier hat mir Nachricht aus Venedig geschickt. Ärger in einer unserer Filialen. In Narbonne. Sie schreiben dort … ach, zum Teufel.« Verdrossen schüttelte er den Kopf und starrte weiter in die Gasse hinab. Als er fortfuhr, klang seine Stimme weicher. »In Venedig, in der Nähe des Fondaco dei Tedeschi, gibt es ein Häuschen, Marcella. Es ist zwischen einer Scuola und einem Mietshaus eingequetscht. Nichts Großartiges. Alt wie die Arche Noah. Das Dach ist undicht, und über dem Eingang brüllt der hässlichste Leone andante von ganz Venedig.«
»Und welchen Schatz birgt dieses Haus, dass du dich trotzdem damit befasst?«
»Donato besitzt ein … einen Protz- und Prachtpalast. Das Kontor im Erdgeschoss ist so groß wie die Piazza San Marco, und oben gibt es mehr Zimmer, als er je bewohnen kann, egal, wie viele Mädchen Caterina ihm noch schenkt. Wir wickeln in seinem Haus unsere Geschäfte ab, und wenn wir damit fertig sind, stopft Caterina uns mit Essen voll und setzt uns die Kinder aufs Knie. Ich habe mich nie nach einer eigenen Wohnung umgeschaut. Ich hatte keinen Grund. Donatos Palazzo war für mich kein Zuhause, aber es war auch nicht schlecht.«
Wieder versank er ins Grübeln.
»Einmal hatte ich in der Scuola zu tun, und ich konnte von dort in den Innenhof dieses Häuschens sehen. An den Hauswänden klettern Blumen, die wie gelbe Sterne aussehen, unter dem Fenster steht eine bemooste Steinbank und in der Mitte, fast ganz von Efeu überwachsen, ein Brunnen aus grauem Marmor. Es ist ein ruhiger Ort. Ich glaube, dieser Hof ist der ruhigste Platz in ganz Venedig.«
»Und seit du ihn gesehen hast, träumst du von gelben Sternen?«
Er warf die Hände in die Luft, lachte, kam zu ihr zurück und kniete vor ihr nieder. »Es muss nicht dieses Haus sein, Marcella. Aber ich habe auf einmal etwas, was ich verteidigen und beschützen möchte. Ich bin ungeduldig. Ich will nach Venedig und ein Haus mit Mauern und Zinnen kaufen, die jedem sagen, dass mein Leben einen Wert bekommen hat. Und, jawohl, wenn möglich mit gelben Sternen.«
»Aber nun gibt es Schwierigkeiten in Narbonne.«
»Es ist Donato, der Schwierigkeiten hat. Narbonne gehört zu seinem Gebiet. Es sind seine Probleme, und er versucht, sie mir auf den Buckel zu laden, weil er keine Lust hat, sich die Finger zu verbrennen. Jemand aus dem Kontor plaudert Vertraulichkeiten aus: die Ankunftszeiten unserer Schiffe, die Menge und Art der Waren, die wir kaufen und verkaufen wollen. Wir machen seit Monaten Verluste. Aber darum geht es nicht. Es ist sein Neffe Matteo. Ein grässlicher Kerl, nur Flausen im Kopf. Donato hat ihn nach Narbonne geschickt, damit er dort von der Pike auf das Geschäft lernt und … von einigen unangenehmen Freunden loskommt. Aber Matteo ist leider …«
»Unbelehrbar?«
»Er ist dümmer als ein Ei, Marcella. Der Mensch bekommt sein Maß an Verstand zugeteilt, und ich halte mich nicht für hochnäsig. Aber wenn ich Matteo sehe … Donato hat ihn ein paar Mal in den Hintern getreten, nur kann er nicht viel machen, denn Caterina … Sie ist eine kluge Frau, nicht, dass du einen falschen Eindruck gewinnst. Aber wenn es um Matteo geht, lässt ihr Verstand sie im Stich. Er ist eigentlich nicht Donatos, sondern ihr eigener Neffe, und sie konnte seine Mutter nicht leiden, was für gewissenhafte Menschen eine Bürde sein kann.«
»Ich verstehe.«
»Wir hatten gehofft, dass der Bengel in der Fremde erwachsen wird.«
»Und nun befürchtest du, dass er stattdessen seinen Onkel betrügt?«
»Aber niemals. Was auch immer Matteo getan hat – es wird aus Versehen und kindlichem Unwissen geschehen sein. Da ist Caterina unerbittlich. Als äußersten Ausdruck meines Zweifels dürfte ich ihn am Kragen packen und ihn nach Venedig zurückschleifen. Marcella, Narbonne hieße: Wir müssten über die Pässe nach Genua und von dort mit dem Schiff oder zu Pferde die Küste entlang. Selbst mit einigem Glück wären wir mindestens einen weiteren Monat unterwegs. Ich will das nicht. Ich will nach Hause.«
Sie lachte und nahm sein Gesicht zwischen die Hände. »Und wenn der arme Matteo brav über den Kontenbüchern schwitzt und jemand anderes eure Geheimnisse ausplaudert?«
»Weißt du, worin Matteos Dummheit besteht? Er träumt von Heldentaten. Wehende Fahnen und Schwertergeklirr und des wahren Mannes Glück ist der Schlachtentod. Doch dieser Tod ist nicht nur großartig, sondern auch kostspielig. Er erfordert ein Pferd, Waffen, ein Kettenhemd, wenn nicht eine Rüstung … Matteo besitzt kein eigenes Vermögen. Er bettelt Caterina an, und sie schickt ihm Wechsel in einer Höhe, die Donato zur Weißglut treibt. Trotzdem kommt er mit dem Geld nicht aus.«
»Und wenn er dennoch unschuldig ist?«
Damian stand auf. Es sah aus, als wolle er sich recken, aber dann unterließ er es. Die Wunde, die ihm sein Bruder geschlagen hatte, heilte nicht so, wie sie gehofft hatten. Er sollte einen Barbier aufsuchen, oder besser noch, einen studierten Arzt. Sie sah, wie er die Lippe kraus zog und sich abwandte.
»Donato kann das nicht verlangen. Wenn es sein muss, gehe ich nach Narbonne. Aber nicht jetzt. Und nicht mit dir.«
Marcella betrachtete seinen Rücken. Er hatte endlich ausgesprochen, was er meinte: nicht mit dir. Wie geschickt er den Punkt, der ihm am Herzen lag, in seine Worte eingeflochten hatte.
Liebe Elsa, glaubt mein göttlicher Verlobter, ich hätte niemals eine französische Landkarte studiert? Ich weiß doch, wo Narbonne liegt. Nein, seine wahren Ängste gelten nicht dem Kontor oder diesem Neffen, sondern … Er blickt weiter. Er schaut hinüber nach …
Jetzt, wo sie es benennen wollte, fiel ihr der Name nicht ein. Montaillou? Hieß der Ort Montaillou?
Mein Kopf ist wie ein Plunderhaufen, was Frankreich angeht. Montaillou muss drei oder vier Tagesreisen von Narbonne entfernt sein. Solch eine lange Strecke. Was befürchtet er? Und da mir das Herz bis zum Halse klopft: Was befürchte ich selbst? Montaillou ist Vergangenheit. Ich habe den Ort seit fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen. Jeanne und mein Vater sind begraben. Auf den Scheiterhaufen grasen Schafe. Nein, Elsa, ich werde nicht zugeben, dass Damian wegen irgendwelcher traurigen Gespenster aus der Vergangenheit Narbonne sich selbst überlässt.
2. Kapitel
Narbonne versteckte sich in weißem Nebel. Gelegentlich trieben die Schwaden auseinander und gaben den Blick auf Kreidefelsen frei, auf denen wie durch ein Wunder Büsche und Bäume wuchsen. Oder auf Fischerhütten. Oder auch auf imposante Bauten wie die Burg von Gruissan mit dem runden und dem viereckigen Turm und dem Dorf, das sich wie eine Manschette um den Burghang schmiegte. Gruissan schützt den Zugang zum Hafen von Narbonne, hatte Damian erklärt und hinzugefügt, dass die Burg dem Erzbischof von Narbonne gehörte und mit ihr das Recht zur Steuererhebung auf den Seeverkehr. Außerdem hatte er von Salinen gesprochen, und wenn Marcella ihm besser zugehört hätte, wüsste sie jetzt, wie Salz gewonnen wurde und wer der Besitzer der Narbonner Salinen war.
»Es sieht trostlos aus«, sagte sie zu Hildemut, die seit ihrer Abreise aus Konstanz die aufopferungsvolle Maria ersetzte.
»So kommt einem die Fremde immer vor«, erwiderte Hildemut. Sie war eine wortkarge, schwarz gewandete Frau mittleren Alters, die sich auf das Abenteuer einer Reise nur deshalb eingelassen hatte, weil sie sich Sorgen um ihre Nichte machte. Das Mädchen hatte nach Narbonne geheiratet, und man hatte seit ihrer Erklärung, dass sie schwanger sei, nichts mehr von ihr gehört. Anderthalb Jahre waren seitdem verstrichen. Es gab Männer, die hielten es nicht für nötig, die Familie zu informieren, wenn ein Unglück geschah. Hildemut hatte die Gelegenheit, sich Damian und Marcella anzuschließen, begierig ergriffen.
Eine Weile lauschten sie dem rhythmischen Platschen der Galeerenruder und dem leisen Trommelklang unter ihren Füßen. Sie fuhren in stolzer Begleitung. Zu ihrem Konvoi gehörten fünf Handelsboote und zwei bewaffnete Schiffe. Ein Mann, der wie Damian sein Geld mit dem Verkauf von Sicherheit verdiente, ging kein Risiko ein. Es tut gut, jemanden an der Seite zu haben, der auf alles achtet, dachte Marcella und lauschte, wie so oft in den letzten Wochen, ihren Gedanken nach, als könnte es einen falschen Klang darin geben. Sobald sie sich dabei ertappte, ärgerte sie sich. Natürlich war sie froh, beschützt zu werden. Sie hasste Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Und sie begriff nicht, warum sie ihre eigene Zukunft ständig so misstrauisch beäugte.
Wieder versuchte sie den Nebel mit den Blicken zu durchdringen, aber sie sah nichts als ein Fischerboot, das vor ihrer kleinen Flotte respektvoll floh. Damian würde wissen, wie lange dieser letzte Abschnitt ihrer Reise dauerte, aber er war mit einem Zimmermann aus dem Arsenal von Venedig in den Schiffsrumpf gestiegen und ließ sich irgendetwas erklären, das mit der Steuerung des Schiffs zu tun hatte. Er war ein Mann, der sich für jedes Blatt auf dem Boden interessierte.
»Seid Ihr zum ersten Mal in Frankreich?«, fragte Marcella Hildemut.
Ihre Begleiterin nickte.
»Ich bin hier aufgewachsen. Nicht hier, aber ein Stück weiter im Westen.« Es hörte sich wie eine Lüge an. Dieses Land war für sie ebenso fremd wie für die Frau an ihrer Seite. Sie hatte nicht die leiseste Vorstellung, was sie erwartete. Wie groß oder klein die Häuser waren, womit die Dächer gedeckt wurden, was für Tiere hier lebten, welche Kräuter man in den Gärten zog. Sie wusste nicht einmal, ob sie die Sprache verstehen würde. Da sie ihre ersten acht Lebensjahre in Frankreich verbracht hatte, müsste sie doch ein wenig französisch sprechen, oder nicht?
»Erinnert Ihr Euch an Dinge, die vor Eurem achten Geburtstag geschehen sind, Hildemut?«
»An einiges erinnert man sich, an das meiste nicht.«
»Und glaubt Ihr, dass das, woran man sich zu erinnern meint, wirklich geschehen ist?«
Hildemut schwieg so lange, dass Marcella schon dachte, sie hätte die Frage überhört.
»Ich erinnere mich, dass meinem Onkel auf dem Sterbebett ein Kakerlak übers Gesicht lief, der in seiner Nase verschwand. Aber er kam wieder raus.«
»An mehr nicht?«
»Doch, an unsere Werkstatt. Dass ich buttern musste und meine Großmutter wütend wurde, wenn die Hühner nicht ordentlich gerupft waren, an das Alltägliche. An so was erinnert man sich immer.«
»Ich erinnere mich an einen Krug im Zimmer meiner Schwester, als sie starb.«
»Ans Sterben in der Familie erinnert man sich auch.«
»Ich glaube nicht, dass ich dabei war, als sie wirklich starb. Aber wir hatten damals einen Bischof im Haus.«
»Einen Bischof?«, fragte Hildemut.
»Er hieß Jacques Fournier.«
»An die Namen von Leuten, die nicht aus unserer Familie waren, kann ich mich gar nicht besinnen«, sagte Hildemut, es klang skeptisch. Wahrscheinlich nahm sie an, dass Marcella aufschneiden wollte. Einen Bischof im Haus – das gab es nur, wenn Hochgeborene starben.
»Da vorn ist der Kai. Wir werden seitwärts anlegen, und es ist ein kleines Kunststück, auch wenn es täglich ein Dutzend Mal geschieht.« Damian war hinter die beiden Frauen getreten. Marcella hörte an seiner Stimme, dass er lächelte. Und weil sie die Nuancen seines Lächelns kannte, wusste sie, dass er sich dieses abrang. Schweigend sahen sie zu, wie sich aus dem Nebel helle Mauern schälten. Davor lag ein düster wirkender Platz, auf dem sich Fässer und Säcke stapelten. In der Mitte stand ein hölzerner Tretkran, dessen Rad von zwei Arbeitern in Bewegung gehalten wurde. Außerdem Sackkarren. Und braun gebrannte, dunkelhaarige Männer, die trotz des kühlen Wetters mit nacktem Oberkörper Lasten schleppten.
»Ich frage mich, wie sieben Schiffe hier an der … an dieser Mauer Platz haben sollten«, meinte Hildemut.
»Die Kriegsgaleeren ankern in der Hafenmitte.«
»Aha«, sagte Hildemut, dann schwiegen sie und sahen den Wendemanövern zu, mit denen die Schiffe ihren Platz zu finden suchten. Hildemut und Damian sahen zu. Marcella hielt sich an der Reling fest und grübelte über ihre Vergangenheit. Über diese verfluchten Erinnerungen, die leider nichts mit Hühnerrupfen und Butterstampfen zu tun hatten. Wie zum Beispiel über den Krug, aus dem Jeanne trinken sollte, weil sie dabei war zu verdursten. Hatte sie getrunken? Nein, hatte sie nicht. Oder doch?
Verdammt, dachte Marcella. Es war, als angele sie in einem trüben Teich. Manchmal biss ein Fisch in den Haken, aber meist trieb der Köder dahin. Was wusste sie überhaupt verlässlich von diesen acht Jahren, die sie in Montaillou zugebracht hatte? Jeanne hatte existiert. Ihr Name war in der Bibel des armen Onkel Bonifaz und auf diesem verdammenswerten Dokument, das Marcella fast das Leben gekostet hätte, niedergeschrieben gewesen. Jeanne war eine Ketzerin gewesen. Und sie war gestorben, weil sie sich geweigert hatte …
Ich bilde mir ein, dass sie starb, weil sie nicht trinken wollte. Aber wenn es Jeanne – aus welchem Grund auch immer – sündig vorgekommen war zu trinken, warum war sie dann nicht früher verdurstet? Wie konnte es einmal in Ordnung sein zu trinken, und dann wieder nicht? Wie konnte überhaupt jemand auf den Gedanken kommen, es sei eine Sünde, seinen Durst zu stillen? Auf alle Fälle hätte Jeanne es missbilligt, dass ihre kleine Schwester heiraten wollte. Denn Damian und später auch der Erzbischof Balduin hatten gesagt, dass Katharer die Fleischeslust verabscheuten, weil sie glaubten … wie hatte Damian das erklärt? Sie glaubten, Satan nehme die neugeborenen Körper als Gefängnisse für Seelen, die vom Himmel gefallen waren. Also war jeder Akt, bei dem ein Kind gezeugt wurde, ein Dienst an Satan.
»Woher sind die Katharer gekommen?«, fragte Marcella.
Damian, der immer noch hinter ihr stand, legte die Hände auf ihre Schultern.
»Weißt du, ob es heute noch welche gibt?«
Er berührte ihr Haar mit seinen Lippen. »Sie sind ausgerottet worden.« Er wartete, bis einer der Trommelwirbel einsetzte, mit denen die Schiffe einander Signale gaben. Dann flüsterte er, während er sich über sie beugte und mit dem Mund ihr Ohr berührte: »Wenn du Fragen über die Katharer hast oder über sie sprechen möchtest, dann nicht hier, Liebste. Lass es uns tun, wenn wir allein sind.«
Doch zunächst einmal bot sich keine Gelegenheit. Nachdem ihr Schiff – als Letztes der fünf Handelsboote – angelegt hatte, setzte ein unglaublicher Trubel ein. Der teure Begleitschutz rentierte sich natürlich vor allem für kostbare Güter mit geringem Volumen: Gewürze, die für die Apotheken, die Färberei und vor allem für die Küche gebraucht wurden, und kostbare Stoffe. Jetzt drängten sich die Faktoren der Handelsgesellschaften auf dem Kai, um in einer Mischung aus Erleichterung – schließlich erreichte nicht jedes Schiff den Hafen – und Nervosität die Qualität der georderten Waren zu überprüfen.
Als Marcella über einen wackligen Behelfssteg festen Boden erreichte, wurde sie angerempelt. Ein feister Mann mit einer Pelzmütze über der Gugel, der seine Unhöflichkeit gar nicht bemerkte, brüllte erregt: »Là-bas! Là-bas!«, wobei er mit dem Finger auf die Galeere deutete und sich verzweifelt nach jemandem umsah. Er hatte eine böse Entzündung am Kinn, nach der er alle Augenblicke fasste. Aufgeregt redete er auf einen der venezianischen Galeerenruderer ein, bekam aber keine Antwort.
»Lieber Himmel, was für ein Durcheinander«, klagte Hildemut, die sich an Marcellas Seite geflüchtet hatte.
Damian, der noch einmal ins Schiff zurückgekehrt war, sprang nun ebenfalls auf den Kai. Er berührte den Mann mit der Pelzmütze an der Schulter. Der Feiste fuhr zusammen. Er riss sich die Fellmütze vom Kopf, und Marcella sah ihn nacheinander erröten, erblassen, stottern und lächeln. Er deutete auf die Galeere und überschüttete Damian mit einem Schwall besorgter Fragen.
Das also war Monsieur …? Marcella kam nicht auf den Namen. Sicher der Mann, der Damians Niederlassung in Narbonne betreute. Damian fragte ihn etwas, und beide wandten sich an den Capitano der Galeere, der das Ausladen überwachte. Hatte Damian ebenfalls Waren geladen? Es wäre vernünftig gewesen, da er das Schiff sowieso begleitete. Aber warum wusste sie nichts davon? Warum wusste ihr Verlobter alles über ihre Vorhaben und sie nichts über die seinigen?
»Dann werde ich mich mal auf dem Weg machen. Paul Possat, marchand du vigne«, sagte Hildemut. Sie blickte auf das wuchtige Tor, durch das man in die Stadt gelangte, und schaute noch verwaister drein. Marcella seufzte, als ihr klar wurde, wie einsam die Arme sich fühlen musste, allein als Frau in einem fremden Land, in dem sie nicht einmal die Sprache beherrschte. Das schlechte Gewissen packte sie. Es war noch gar nicht lange her, da hatte sie sich selbst allein durchschlagen müssen. Sie warf einen kurzen Blick zu Damian, der sich immer noch mit dem Capitano unterhielt.
»Es kann nicht schwer sein, herauszufinden, wo Euer Weinhändler wohnt. Und hier scheint es noch zu dauern. Kommt mit … dort drüben.« Sie nahm Hildemuts Arm und dirigierte sie zu einem der Lagerhäuser, vor dem ein offiziell aussehender Mann mit einem Wappen auf dem Rock und einer Wachstafel in der Hand das Treiben am Kai beobachtete.
»Bonjour, Monsieur.« Na bitte, sie hatte ihn begrüßt. »Nous … nous cherchons un marchand du vigne. Paul … Wie war sein Zuname, Hildemut?«, fragte Marcella, begeistert über ihre neu entdeckte Fähigkeit, sich auf Französisch zu verständigen.
Um zu Paul zu kommen, müsse man zunächst zur Kathedrale, zumindest sei es so am einfachsten, erklärte der Hafenbedienstete. Von dort die breite Straße hinunter und hinter dem Gasthaus mit dem grünen Esel im Schild rechts abbiegen und dann …
Ich verstehe jedes Wort! Marcella war begeistert. Die Worte rollten ein wenig fremd über ihre Zunge, als sie genauer nachhakte, und sie stockte und musste überlegen, aber es war, als hätte sie eine nur wenig verschüttete Gabe wieder ans Licht gebracht. Sie fragte, ob das Quartier im Gasthaus mit dem Esel gut für seine Gäste sorge, und gab noch einen Satz über die Tristesse des Reisens von sich, der den Mann zum Gähnen brachte.
Dann wandte sie sich an Hildemut. »Es ist zu schwierig, den Weg zu erklären. Ich begleite Euch. Nein, kein Widerwort. Das dauert hier noch Jahre. Herr Tristand unterhält sich gern.«
Die Frau in den schwarzen Kleidern folgte ihr erleichtert durch das Hafenportal in das Gewirr der Gassen, das sich dahinter auftat.
Nous cherchons un commerçant du vigne. Es war so einfach. Elsa, ich würde auch überleben, wenn Damian auf der Stelle der Schlag träfe. Gewürz hieß … épice? Ja. Und Safran? Keine Ahnung, konnte man aber in einem Moment herausfinden. Ich überlebe immer, Elsa. Ich bin stark. In letzter Zeit hatte ich das fast vergessen. Sie hatte in Konstanz einen Wechsel auf die Gewürze eingelöst, die sie vor ihrer Abreise noch hatte verkaufen können. Sie besaß sechzig Pfund Heller. Dafür könnte ich dreihundert Pfund Pfeffer kaufen, was ich nicht vorhabe, oder siebenundfünfzig Lot Safran. Kannst du dir diese Menge vorstellen?
Nicht Paul, sondern ein schmächtiges Mädchen mit Sommersprossen und übernächtigten Augen stand in dem düsteren Kontor und fegte hinter einem Stehpult Abfälle zusammen. Es brach in Tränen aus, als Hildemut die Arme ausbreitete, und Marcella machte sich still davon.
Der Rückweg kostete sie mehr Zeit als erwartet. Schon nach kurzer Zeit verlief sie sich, und dann, als sie bereits den Ausleger des Tretkrans hinter den Mauerzinnen der Hafenbefestigung auftauchen sah, traf sie auf einen klapprigen Wagen mit leeren Fässern, der die Gasse blockierte. Merdeux hieß … nun, solche Worte kannte eine Dame nicht. Aber gut, trotzdem ihre Bedeutung zu wissen. Also zurück und einen anderen Weg suchen? Sie versuchte abzuschätzen, wie gut ihre Aussichten waren, sich an dem Gefährt vorbeizuzwängen.
Der Fuhrmann starrte über die Schulter und dann zu ihr hinüber. Marcella lächelte ihn an und hätte vielleicht noch ein – französisches – Wort des Trostes angefügt, als sie unvermittelt am Arm gepackt wurde.
Nicht gepackt, nein, sie wurde grob zurückgerissen. Entgeistert blickte sie sich um, während sie gleichzeitig um ihr Gleichgewicht rang. Ein kleiner Mann zerrte an ihrem Mantel. Er sah nicht besonders Furcht erregend aus. Eher wie ein übernervöser Schoßhund.
»Madame, psst …« Er zog sie in eine der dunklen Schluchten, die die Häuser trennten und die so schmal waren, dass man sich kaum drehen konnte. Marcella rutschte das Merdeux, das sie sich eben verkniffen hatte, nun doch heraus. »Was soll das?«, schimpfte sie und machte sich frei. Vage fragte sie sich, wie man auf Französisch um Hilfe rief. Aber das Männchen wirkte so lächerlich …
»Madame!« Der Kleine legte den Finger auf die Lippen und versuchte mit einem übertriebenen Lächeln, sie zu beruhigen. Gleichzeitig lugte er auf die Straße zurück. Er war kein Strauchdieb. Sein Rock war sauber. Ein steifer, wattierter, unerhört korrekter Leinenkragen umschloss seinen Hals. Und dem muschelförmig gefächerten Samthut konnte man Albernheit, aber keinesfalls irgendeine düstere Verwegenheit anlasten.
»Monsieur …«
Er schüttelte, inzwischen ein wenig ungeduldig, den Kopf, und legte erneut den Finger auf die Lippen.
»Monsieur …«
»Wenn Ihr nur … den Mund halten würdet! Ah!«
Ein Schrei gellte durch die Gasse. Grimmig, als hätte sich eine Erwartung bestätigt, schüttelte der kleine Mann den Kopf. Gleichzeitig kam er zu einem Entschluss. Er drängte Marcella noch tiefer in den Häuserspalt und stieß eine niedrige Tür auf, die Marcella in dem Zwielicht zwischen den Mauern gar nicht wahrgenommen hatte. Im nächsten Moment standen sie in einem niedrigen, mit Kannen gefüllten Raum, in dem es durchdringend nach saurer Milch roch.
»Was … zur Hölle, was geht hier vor?« Au diable. Das war gut.
Der Kleine gab keine Antwort, sondern zog sie durch Flure und winzige Räume, in denen er sich selbst nicht auszukennen schien, bis sie in einer Art Werkstatt standen. Es roch nicht mehr nach Milch. Die Luft war satt von Sägemehl. Aber auch hier – kein Mensch. Die Tür zur Gasse stand offen. Mit einer großartigen Gebärde deutete ihr Entführer zum Ausgang und wischte sich dabei den Schweiß von der Stirn.
Als sie auf die Straße zurückkehrten, sah Marcella, dass sich dort inzwischen ein Menschenauflauf gebildet hatte. Einige Männer waren dabei, das gestrandete Fuhrwerk wieder auf die Räder zu stellen, aber die meisten bildeten einen Kreis um etwas, das viel interessanter zu sein schien. Jemand rief nach einem Pfarrer.
Marcella ging auf den Kreis zu.
»Ihr solltet … hört Ihr denn nicht? Madonna, wer rät einer Frau! Es wird Euch nicht gefallen, was Ihr dort seht«, rief der seltsame kleine Herr, der sofort wieder an ihrer Seite war.
Nach dem Schrei war Marcella kaum überrascht, einen Toten zwischen den Menschen zu finden. Dem Mann war so reichlich Blut aus einer Kopfwunde geflossen, dass sein ganzer Oberkörper darin schwamm. Aber es handelte sich nicht um den Fuhrmann, sondern, soweit Marcella es aus der zweiten Reihe erkennen konnte, um einen reich gekleideten älteren Herrn. Sie merkte, wie ihr übel wurde, als sie Spritzer der grauen Gehirnmasse in seinen Haaren entdeckte.
»Genug gesehen?«, fragte der Kleine mit einem Blick voller Schadenfreude. »Also …« Besitzergreifend hakte er sich bei ihr ein und wollte sie weiterziehen.
»Ihr habt das gewusst?«
»Wenn Ihr bitte … könntet Ihr Euch beeilen?«
»Ihr habt gewusst, was hier passieren würde?« Sie ließ es zu, dass er sie mit sich zerrte. Gemeinsam bogen sie um eine Ecke. »Ich kenne Euch gar nicht. Glaubt Ihr nicht, Ihr solltet …«
»Madame! Ihr geht die Straße hinab. Ihr seht einen verkeilten Wagen. Ihr denkt Euch nichts dabei. Naturellement. Frauenart! Ich dagegen bin Noël, und daher werde ich misstrauisch. Ein Wagen, der den Weg blockiert. Ein Wagenführer, der sich verstohlen umschaut. Und schon bläst in meinem Kopf eine Fanfare. Ich schaue mich um …« Er lächelte selbstzufrieden. »Und als der Bursche mit seinen goldenen Klunkern auftaucht, weiß ich, was geschehen wird. Ich habe es tatsächlich gewusst, Ihr habt Recht, Madame.«
»Und Ihr habt es nicht für nötig gehalten, den armen Menschen zu warnen?«
»Bonté divine! Dies ist Narbonne. Was denkt Ihr, wie weit die Mörderbande war, als der Alte hinter der Sperre erschien? Liegt Euch nichts am Leben? Seid Ihr ein Vogel, der solchem Gesindel aus den Händen fliegen kann?«
Marcella wich einigen Jungen aus, die wie eine Hundemeute die Gasse hinabstromerten. »Ihr habt mir geholfen.«
Der Kleine verdrehte die Augen.
»Allein hättet Ihr Euch schneller davonmachen können. Es war knapp, Monsieur.«
»Das weiß ich selbst. Warum nörgelt Ihr? Und warum könnt Ihr nicht hören? Ich habe gesagt: Schaut nicht hin. Schaut nicht hin, habe ich ge… Pfoten weg, du Ausfluss eines Mistkäfers!« Er griff nach einem der Jungen, aber das Kerlchen wieselte davon und war schneller in einer der Seitengassen verschwunden, als Marcella schauen konnte. Noël drohte ihm mit der Faust und brüllte etwas, was sie nicht verstand. »Habt Ihr Euren Beutel noch am Gürtel?«
»Ihr helft mir ein ums andere Mal aus der Patsche, wie es scheint.«
»Nur wegen Monsieur Lagrasse.« Der Kleine schien sich plötzlich auf etwas zu besinnen. Er lüftete den schrecklichen Muschelhut und verbeugte sich. »Noël Dupuy. Das ist mein Name. Ich bin die rechte Hand von Monsieur Lagrasse, wenn’s erlaubt ist. Dem Faktor von Monsieur Tristand. Allerdings ist es nicht mein richtiger Name. Der ist kompliziert. Meine Eltern kamen aus Portugal.« Er wedelte abwehrend mit der Hand. »Sagt einfach: Noël.«
»Tristand? Lagrasse? Kenne ich nicht. Kann es sein, dass Ihr mich verwechselt?«
Sie sah, wie seine Augenbrauen in die Höhe ruckten. Dann merkte er, dass er genarrt wurde. »Frauen meckern ohne Ende«, knurrte er und nahm ihr ungalant den Vortritt, als er durch den Torbogen schritt, der sie auf das Hafengelände zurückführte.
Das Chaos dort hatte sich inzwischen aufgelöst. Nur beim Tretradkran hockten noch einige Galeerenruderer und würfelten – vielleicht darum, wer den Wein bezahlen musste, mit dem sie sich nach der Plackerei voll laufen lassen wollten. Ein schwarz gekräuselter Straßenköter pinkelte gegen ein Unkraut in der Pflasterung. Von Damian war nichts mehr zu sehen.
Doch in einem der Lagerhausfenster tauchte das Gesicht des feisten Mannes auf. Er drehte sich in den Raum zurück und rief mit erschöpfter Stimme: »Monsieur Tristand! Làbas! La belle Madame.«
Keuchend kam er über den Platz gelaufen. Er packte Marcellas Hände und schüttelte sie, als hätte er ein Federkissen in der Hand. Man hatte sie gesucht. Solch eine gefährliche Gegend, der Hafen. Nichts für eine Dame. Pardon, sein Name war Lagrasse. Henri Lagrasse und jederzeit zu Diensten. Seine Hände fühlten sich weich und schwitzig an. Sein Körper war in eine Wolke von Parfüm gehüllt, dessen Konsistenz jede Nase verstören musste. Rosenholz, Jasmin … viel zu süß für einen Mann.
Damian war seinem Faktor wesentlich gemächlicher gefolgt.
»Die Dame hat die andere Dame zum Haus Possat begleitet«, erklärte Noël verdrießlich. »Und man hätte mich gar nicht hinterherschicken müssen, denn Madame weiß genau, was in einer brenzligen Lage zu tun ist. Ich geh und tret Louis in den Hintern, wenn’s recht ist. Wir haben eine Abmachung über halbe Liegegebühren. Wetten, das hat er vergessen? Zeitverschwendung …« Brummelnd machte er sich davon.
»Hchm«, machte Monsieur Lagrasse verlegen. »Ihr müsst verzeihen. Ein guter Mann, dieser Noël – im Grunde. Kennt jeden hier im Hafen und hat immer die Ohren offen und macht und tut und … Na ja. Gosse bleibt Gosse. Aber was soll man tun? Er ist so ungemein nützlich.«
3. Kapitel
Es ist kein Geheimnis«, sagte Camille. »Er war ein Halunke, bevor Monsieur Falier ihm die Arbeit im Hafen bot. Ich rede nicht schlecht über andere Leute, aber Noël hat so viel Ehre, wie ein Spatz in einen Becher pinkeln kann.« Sie raschelte mit ihren bedruckten, bunten Röcken.
Für Camille de Gouzy, die Frau, die Damian und seinem Kompagnon die Räumlichkeiten für die Kanzlei vermietet hatte, war es nicht nur eine Ehre, sondern eine Freude gewesen, auch das zweite Stockwerk des Hauses an ihre wichtigsten Untermieter abzutreten. Monsieur Tristand und seine Braut! Sie hatte die kleinen Hände zusammengeschlagen und nach dem Heer von Dienern Ausschau gehalten, die das Paar gewiss begleiteten. Dass die beiden Herrschaften allein reisten, hatte Camille mit Verwunderung erfüllt, aber auf seltsame Weise auch eine Brücke zu ihrem Herzen geschlagen.
»Ich werde Euch ein Bad richten, Madame«, hatte sie kurz entschlossen verkündet, und nun stand sie hinter dem Trog und kämmte die Knoten aus Marcellas widerspenstigen Haaren.
»Es ist dem Menschen bestimmt, wo er herkommt, und man soll ihm daraus keinen Vorwurf machen, sag ich immer. Aber man muss auch ein wenig schauen. Hab ich nicht Recht?«
»Vermutlich«, sagte Marcella.
»Noël ist in dem Waisenhaus von Saint-Paul aufgewachsen, dort, wo im letzten Jahr das Küchendach einstürzte und Dutzende von den armen Würmern erschlug. Aber ich sag, auch wenn’s jetzt unfreundlich klingt, wer in einem Waisenhaus groß wird … Ich meine, sie sterben dort zuhauf, das ist doch so, und wer nicht stirbt, der muss aus hartem Eisen geschmiedet sein. Man kann sich also denken, mit wem man es zu tun hat, wenn man weiß, einer ist im Waisenhaus erwachsen geworden. Außerdem – seine Familie. Die alte Colette – das war seine Mutter – hat im Hurenhaus gelebt, und einen Vater gab’s natürlich nicht.«
»Ich dachte, seine Eltern waren Portugiesen.«
Marcella spürte, wie Camille abschätzig die Schultern hob. »Heute Portugiesen, morgen Italiener. Er schämt sich halt. Glaubt mir, Noël hat sein Teil an bösen Dingen gelernt. Er hat einem Kerl, der sich hinter den Fischbecken mit ihm prügeln wollte, so kunstgerecht die Kehle durchschnitten, als wäre er ein … wie nennen sie gleich die Juden, die die Tiere so schlachten, dass sie durch den Schnitt ausbluten?«
»Ich weiß nicht.«
»Na, woher auch. Jedenfalls war er’s gewesen, das mit dem Kehledurchschneiden, selbst wenn man es ihm nie nachweisen konnte.« Camille beugte sich zu ihr vor und lachte, und rechts und links auf ihren rosigen Wangen entstanden die niedlichsten Grübchen, die man sich vorstellen konnte. Sie hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit der habgierigen Vettel, als die Damian sie geschildert hatte. War das ein Grund, sie mit Misstrauen zu betrachten? Musste man daraus schließen, dass Damian ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte, als es zwischen Wirtin und Mieter üblich war? Damian liebte es zu baden. Hatte sie ihm das Bad gerichtet? Und ihm Gesellschaft geleistet? Bin ich eifersüchtig, Elsa? Keine Ahnung. Eigentlich spüre ich nur einen wahnsinnigen Appetit auf Lakritzplättchen. Sagt man nicht, dass es ohne Eifersucht keine wahre Liebe gibt? Santa Maria, mir platzt noch der Kopf.
»Ich würde meine rechte Hand abhacken, wenn ich dafür Eure Haare bekäme«, seufzte Camille und fuhr mit beiden Händen durch die Lockensträhnen, die über den Rand des Troges fielen. »Wie ein Wasserfall … jedes Härchen kringelt sich anders. Ihr solltet immer nahe bei den Kerzen sitzen, Madame. Wenn Licht darauf fällt … Eure Haare sind braun, aber das Licht wirft goldene Sprenkel hinein. Ach je … « Sie seufzte und wand sich die Haare um das zarte Handgelenk.
»Ihr seid selbst hübsch«, sagte Marcella, was der Wahrheit entsprach. Camille neigte ein wenig zur Fülligkeit, aber die Grübchen und die leuchtend blauen Augen trugen ihr gewiss die Aufmerksamkeit der Männer ein.
»Das weiß ich. Nur, am Ende: Die Haare verschwinden unter der Haube, sobald man vor dem Priester sein Jawort gegeben hat. Und auch an all dem anderen hat nur noch der Gatte Gefallen, und man kann schon froh sein, wenn es so ist.« Sie löste einige Strähnen und änderte die Frisur.
»Und doch müssen sie … Ich spreche von Monsieur Noël. Seine Dienstherren müssen dennoch gute Eigenschaften an ihm gefunden haben, sonst hätten sie ihn wohl kaum genommen.«
»Es war Monsieur Lagrasse, der ihn eingestellt hat. Und zwar deshalb, weil er mit den Männern vom Hafenzoll und den Arbeitern und den Seeleuten auf gutem Fuß steht, was kein Lob sein soll, aber für das Geschäft bestimmt von Nutzen ist. Noël weiß über alles Bescheid. Keine Ratte frisst dort ein Korn, ohne dass er davon erfährt. Das hat mir Matteo erklärt.«
Zum ersten Mal, seit sie in Narbonne angekommen waren, fiel der Name von Donatos ungeratenem Neffen. Marcella hätte gern mehr über ihn erfahren, aber aus irgendeinem Winkel des Hauses – vermutlich der Küche – wurde Camilles Name gerufen, und sie hatte es nun eilig, Marcellas Haare festzustecken.
Der Geruch von rohem Fisch zog durchs Haus, als die junge Frau durch die Tür verschwand. Sie machte kein besonders glückliches Gesicht, und Marcella erinnerte sich, von Damian gehört zu haben, dass sie nicht die begabteste Köchin war.
Der Raum, in dem gegessen wurde, gehörte zum Kontor. Er war dunkel und mit schweren Möbeln ausgestattet. Über die schmale Seite des Zimmers zog sich ein verschlissener Stoff, auf den eine galante Szenerie gestickt war. Eine adlige Gesellschaft beim Reigentanz. Die gegenüberliegende Seite wurde durch ein Regal besetzt, in dem Bücher und Pergamentrollen gestapelt lagen. Auf einem Tisch in der Raummitte, hübsch bedeckt mit einem Laken und von mehreren Honigwachskerzen erleuchtet, standen Zinngeschirr und – einziges Zeichen von Luxus – grüne Glasbecher. Vielleicht ein Geschenk der venezianischen Brotgeber an die Tochtergesellschaft.
Noël, der dem Waisenhaus entkommene Halsabschneider, hielt eines der Gläser in der Hand und fuhr misstrauisch mit dem Finger über die Rillen. Als Marcella den Raum betrat, setzte er es abrupt ab. Er erwiderte ihr Kopfnicken ohne Lächeln.
Dafür lächelte Monsieur Lagrasse umso mehr. Er eilte auf Marcella zu, um erneut ihre Hände zu ergreifen. »Die Braut, was für eine Freude und Ehre zugleich. Cui fortuna favet, Phyllida solus habebit«, rief er Damian scherzend zu. »Das ist lateinisch, meine Verehrteste, und bedeutet so viel wie … Nun ja, dass unser lieber Monsieur Tristand vom Füllhorn des Glücks überschüttet wurde. Eine so hübsche Dame. Wenn auch …«, er zwinkerte ihr zu, »… ein wenig leichtsinnig. Ach, die Frauen. Sie folgen ihrem Herzen und denken nicht an die Folgen. Aber verehren wir sie nicht gerade um dieser reizenden Torheiten willen?«
Noël starrte ihn mit offenem Mund an. Es reizte ihn zu widersprechen, das merkte man, aber er kam nicht dazu, denn in diesem Moment öffnete Camille die Tür und trug mit Hilfe eines Jungen das Essen herein. Damian hatte sich nicht lumpen lassen. Eine Platte mit Pasteten wurde abgestellt, eine weitere mit Brattäubchen, dazu gab es Weißkrautsalat und anderes Gemüse in Schüsseln und eine weißschwarz gesprenkelte Köstlichkeit, die wie Mandelpudding duftete. Das Gespräch wurde unterbrochen. Damians Gäste rückten sich die Stühle zurecht, und Camille begann, Wein in die grünen Gläser zu gießen.
»Monsieur Tristand«, sagte Marcella, »waren es meine reizenden Torheiten, die Euch dazu verführten, mir die Ehe anzutragen?«
»Aber gewiss.« Er blinzelte ihr zu. »Allen voran Eure Torheit, mir die Verfügungsgewalt über Euren Safran zu übertragen.«
»So etwas habe ich getan?«
»Ihr werdet es tun. Am Tag unserer Hochzeit. Aber da ich fürchte, dass Ihr die dräuende Gefahr bemerken werdet …«
»Ja?«
Damian war nicht wirklich nach einem Geplänkel zumute. Er streifte mit dem Blick den leeren Stuhl neben Noël, auf dem eigentlich der Tunichtgut Matteo hätte sitzen sollen, und sie spürte, dass er sich ärgerte.
»Es ist der natürliche Wunsch der Frau, sich unter den Schutz des Mannes zu stellen«, verkündete Lagrasse und lud einige Pastetchen auf seinen Teller.
Noël grunzte. Er nahm einen Zipfel des Tischtuchs auf und wischte über seinen Mund. »Frauen machen immer Ärger.«
»Nur wenn die Dinge nicht nach ihrem Willen gehen, mein lieber Noël«, sagte Marcella. »Dennoch habt Ihr Recht, es ist eine Unart und lästig dazu – für jeden außer für sie selbst. Ein Wunder, dass sie noch geheiratet werden. Wie war gleich Euer Plan, Monsieur, mit dem Ihr mich vom Verlust meines Safrans ablenken wollt?« Sie schaute zu Damian hinüber und wusste, dass Ihre Worte schärfer klangen, als sie selbst es wünschte. Noël stierte mit gesenktem Kopf zu ihr herüber.
»Ich werde Euch mit Lakritze locken. Das ist meine tückische Absicht. Mit jedem Beutelchen folgt Ihr mir ein Stück weiter nach Venedig, und die letzten werden auf den Stufen von San Vitale liegen.«
Camille, die gerade die Platten verschob, um einen Krug frischen Weins abzusetzen, kicherte.
»Und wenn ich in boshafter Weibermanier vor dem Hochzeitsgang eine Suppe mit siebenundfünfzig Lot Safran würze und mein Vermögen in mich hineinlöffele?«
»Aber nicht doch«, flüsterte Camille. »Tauscht den Safran gegen Schmuck und Kleider. Ist es bei Euch nicht auch so, dass Schmuck und Kleider in der Ehe bei der Frau verbleiben?«
»Einem listigen Plan wird ein wahrhaft teuflischer entgegengesetzt.« Damian hob sein Glas zu Camille, und sie wackelte belustigt mit dem Kopf. »Matteo ist noch nicht aufgetaucht, nein?«
»Die jungen Leute vergessen die Zeit«, erwiderte Camille rasch. Sowohl ihre als auch Noëls Blicke gingen zum Fenster, hinter dem schwärzeste Dunkelheit verriet, dass der Abend längst in die Nacht übergegangen war.
»Er ist ein braver, junger Herr, aber wie die anderen auch«, meinte Lagrasse gutmütig. »Man muss Geduld haben. Eine Zeit lang schlagen sie über die Stränge, dann werden sie sittsam.«
»Weiber und Kinder«, sagte Marcella und tunkte ein Stück Brot in die grüne Soße, die vor Pfeffer beinahe ungenießbar war.
Matteo tauchte den ganzen Abend nicht auf, aber wenn er dadurch irgendwelches Unheil von sich fern zu halten wünschte, hatte er den falschen Weg gewählt. Damian wurde vor Verdrossenheit so einsilbig, dass nicht einmal Lagrasse mit seiner Redseligkeit es schaffte, die Gesellschaft aufzuheitern. Noël verabschiedete sich, sobald er den letzten Bissen in sich hineingestopft hatte, und wahrscheinlich erzählte er seinen Freunden vom Zoll, dass das Speisen mit vornehmen Herrschaften schlimmer als eine Hafenschlägerei war.
»Er ist ein liebenswürdiges Kerlchen.« Es war Camille, die das über Matteo sagte, als sie Marcella nach dem Essen Bettzeug in ihr Zimmer brachte. »Wie verrückt nach allem, was blinkt und blitzt, und damit meine ich diesmal kein Geschmeide, sondern Schwerter und so. Aber dabei höflich und lustig … Wenn Ihr Euch einen Mann von Adel vorstellt, würde Euch sofort Matteo einfallen, obwohl er ja keinen Tropfen edlen Bluts in den Adern hat.«
»Liest er denn auch eifrig seine Bücher über die Praktiken des Handels?«
»Er liest, wenn man ihm das Gesicht aufs Pergament drückt. Nur dürft Ihr deshalb nicht schlecht von ihm denken. Der Gelehrte steckt halt nicht in jedem Menschen. Und das sage ich als jemand, der selbst lesen kann.« Camille freute sich diebisch über Marcellas erstauntes Gesicht. »Ich habe es als Kind durch meine Tante gelernt, die ein wirres Geschöpf war und Reime schrieb.«
»Ihr steckt voller Überraschungen, Camille.«
»Und rechnen kann ich sowieso. Ich muss schließlich dieses Haus vermieten und wissen, wann ich welches Geld bekomme. Die Zimmer hier oben vermiete ich nur an Markt- und Festtagen, und dann immer nur für einige Nächte, aber es bringt mehr ein, als wenn ich einen ständigen Mieter hätte. Das habe ich mir ausgerechnet, und daran seht Ihr, wie nützlich die gelehrten Künste sind, wenn man sie richtig gebraucht. Ich habe in den vergangenen beiden Jahren …« Sie stockte. »Hört Ihr das auch?«
»Was?«
»Die Tür. Wir haben eine Seitentür, in der früher Gemüse und Schlachtvieh hinunter in die Küche gebracht wurden. Ich kenne das Knarren. Ihr sagt’s doch nicht dem Herrn?«
»Was soll ich ihm nicht sagen?«
»Nun ja, wenn es Matteo ist, der dort kommt … Heute Abend tät Monsieur Tristand ihn mit Haut und Haaren fressen.«
»Aber Camille, er ist doch kein …«
»Heut Abend tät er’s«, erklärte Camille bestimmt. »Und was brächte es auch für einen Nutzen, den werten Herrn so spät zu stören?«
»Wahrscheinlich keinen.« Marcellas Gewissen zwickte, als sie zusah, wie Camille durch die Tür verschwand. Feine Ehe, in der man schon in der Verlobungszeit Geheimnisse voreinander hatte.
Aber es gab eine Möglichkeit zu büßen. Der kleine Raum, in dem Camille sie untergebracht hatte, war karg möbliert, besaß jedoch einen Tisch, an dem man schreiben konnte. Marcella holte das Holzkästchen heraus, das Elsa ihr zum Abschied geschenkt hatte, und entnahm ihm die Feder und die Kohlenstofftinte, um endlich ihren Brief zu schreiben. Das Tintenhörnchen war aus Elfenbein.
Ach Elsa, wofür gibst du dein Geld aus, dachte sie seufzend. Ihre Trierer Freundin hatte noch keine einzige Nachricht bekommen, seit sie auf dem Bootssteg voneinander Abschied genommen hatten. Aber nun würde es damit ein Ende haben. Und wenn jeder Satz verkehrt und jedes Wort mit Zweifeln behaftet war – die Nachricht würde geschrieben und morgen noch in Richtung Trier auf den Weg gebracht werden.
Liebste Elsa, es geht mir …
Ein leises, aber heftiges Klopfen ließ Marcella innehalten. Sie schaute zur Tür. Camille öffnete und starrte sie gehetzt an. »Ihr kennt Euch doch mit Gewürzen aus, Madame, ich meine, mit Heilkräutern, mit … mit blutstillenden … bitte Madame! Sein ganzes Hemd ist nass.«
»Ich kenne mich nicht