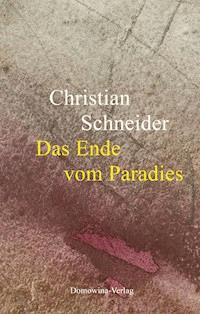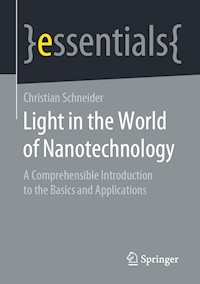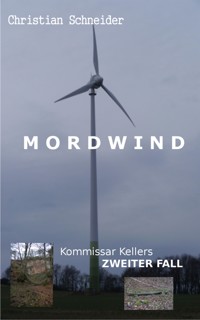Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nahaufnahme Sahra Wer ist Sahra Wagenknecht? Eine der beliebtesten und umstrittensten deutschen Politikerinnen, ein politischer Popstar, dauerpräsent in den Medien, eloquent in Talkshows und dennoch umgeben von einer Aura der Unnahbarkeit. Doch warum ist eine hochbegabte Theoretikerin und promovierte Volkswirtin, die sich selbst das Lesen beigebracht und Goethe und die klassischen Philosophen für sich erobert hat, eigentlich Politikerin geworden? Biograf Christian Schneider hat sich in intensiven Gesprächen mit ihr und ihren Weggefährten ein Bild gemacht. Sie hat ihm Zugang zum engsten Kreis gewährt und Gespräche mit ihrer Mutter, einer Freundin aus Kindertagen und Oskar Lafontaine ermöglicht. - Ein vielschichtiger Blick auf eine der spannendsten Persönlichkeiten des Landes. - Näher werden Sie Sahra Wagenknecht nicht kommen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Schneider
Sahra Wagenknecht
DIE BIOGRAFIE
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Nahaufnahme Sahra Wer ist Sahra Wagenknecht? Eine der beliebtesten und umstrittensten deutschen Politikerinnen, ein politischer Popstar, dauerpräsent in den Medien, eloquent in Talkshows und dennoch umgeben von einer Aura der Unnahbarkeit. Doch warum ist eine hochbegabte Theoretikerin und promovierte Volkswirtin, die sich selbst das Lesen beigebracht und Goethe und die klassischen Philosophen für sich erobert hat, eigentlich Politikerin geworden? Biograf Christian Schneider hat sich in intensiven Gesprächen mit ihr und ihren Weggefährten ein Bild gemacht. Sie hat ihm Zugang zum engsten Kreis gewährt und Gespräche mit ihrer Mutter, einer Freundin aus Kindertagen und Oskar Lafontaine ermöglicht. - Ein vielschichtiger Blick auf eine der spannendsten Persönlichkeiten des Landes. - Näher werden Sie Sahra Wagenknecht nicht kommen!
Vita
Christian Schneider, Dr. phil. habil., Sozialpsychologe und Führungskräftecoach, gilt als Begründer der Disziplin »psychoanalytische Generationengeschichte«. Er lehrte an den Universitäten Hannover, Kassel, CEU Budapest und LMU München. Von 1989 bis 2001 Forschung und psychoanalytische Fortbildung am Sigmund Freud-Institut Frankfurt. Seit 2001 eigene Praxis für psychoanalytisches Coaching. Der Autor zahlreicher sozialpsychologischer und wissenschaftsgeschichtlicher Veröffentlichungen sowie vieler Porträts von Politikerinnen und Politikern lebt in Frankfurt am Main.
Inhalt
Eine Frau mit Widersprüchen
Auftakt mit Vogelgezwitscher
Wahlkampf
»Heilige« und »Stalins Cheerleader« – wer ist Sahra Wagenknecht?
Aufwachsen im Osten
West-östlicher Diwan
Die Chinesin
Eine treue Freundin
Punks, Goethe und Marx – eine Jugend unter Honecker
Der Untergang der DDR und die Folgen
Vom »Besserdenkenkönnen« der Welt zum politischen Handeln
Das Erbe der DDR
Marxismus und Opportunismus: gegen den Strom
Politsprech und der Sound von Weimar
Lichtgestalt und Leitbild: Peter Hacks
Wendezeiten
Wider den falschen Gang des Weltgeistes – im Vorstand der PDS
Auf dem Weg zur Berufspolitikerin
Eine romantische Vorstellung
Widersprüche, Wirtschaft und die »wirkliche Welt«
Im Dialog
Im Westen viel Neues
Europaparlament
Politik als Beruf
Das richtige Leben im falschen?
Ein politisches Märchen
Zweigestirn am Polit-Himmel
Zurück nach Berlin
Hinter den Kulissen
Goethe und die Lust, eine andere zu sein
Ehrgeiz
Bücher machen Leute: Kapitalismuskritik und Gesellschaftsutopie
Übersetzerin mit hellseherischen Fähigkeiten
Sozialistin mit kreativem Potenzial
Demokratieretterin mit konkreter Vision
Linke Politik heute
Im Kreuzfeuer der Partei
Aufstehen?
Die Revolution frisst ihre Kinder
Ein alter linker Traum – wie weiter?
Anmerkungen
Eine Frau mit Widersprüchen
Aufwachsen im Osten
Der Untergang der DDR und die Folgen
Auf dem Weg zur Berufspolitikerin
Das richtige Leben im falschen?
Bücher machen Leute
Linke Politik heute
Bildnachweis
Dank
Eine Frau mit Widersprüchen
Auftakt mit Vogelgezwitscher
In der Ecke des Zimmers, das auf die Terrasse führt, steht neben einem Bücherregal ein kleiner roter Mann. Einige der hier eingestellten Werke kenne ich. Gleich werde ich mit ihrer Autorin sprechen. Sie ist draußen dabei, den Tisch zu richten. Die Vögel zwitschern atemberaubend laut, es ist Sommer.
Der kleine, gerade mal einen Meter große rote Mann, der die Bücher bewacht, ist Karl Marx: die bekannte Skulptur von Ottmar Hörl. Ein Geschenk von Freunden, sagt Sahra Wagenknecht, die mittlerweile in der Küche steht, um den Darjeeling aufzugießen. Am Fenster lehnt das gerahmte Foto eines anderen Bekannten: Che Guevara. Nein, nicht das berühmte Demo-Poster mit dem entschlossen-visionären Gesichtsausdruck des Revolutionärs. Das Küchenbild zeigt einen eher gemütlichen, ja, etwas dicklichen Mann mit einem freundlichen Lächeln, das so gar nicht nach Guerillakampf und Revolution aussieht. Auf meinen ironischen Kommentar erwidert Sahra Wagenknecht, genau das möge sie. Hier wirke der Held der 68er einfach so menschlich. Gerade wegen des Lächelns. Auch dieses Foto sei ein Geschenk von Freunden.
Für einen Moment laufen Szenen durch meinen Kopf, in denen Freunde Karl und Che wie Pralinenpackungen als Gastgeschenke ins Haus bringen. Wo bin ich hier? Schließlich ist seit 1968 ein halbes Jahrhundert vergangen. Damals war Sahra Wagenknecht noch nicht geboren und ihr Mann, Oskar Lafontaine, der Besitzer des Hauses in dem kleinen Dorf Silwingen dicht an der französischen Grenze, noch ein ordentlicher Sozialdemokrat. Treffe ich etwa eine nostalgische Altlinke?
Hält man sich an das, was in den Medien über sie verbreitet wird, ergibt sich kein klares Bild. Und mein persönlicher Kontakt mit Sahra Wagenknecht besteht bislang aus einem 90-minütigen Gespräch, das ich mit ihr 2014 für ein Porträt in der tageszeitung geführt hatte. Ich erinnere noch gut das Gefühl, auf eine außergewöhnlich facettenreiche Frau zu treffen, die sich in den üblichen Netzen des Journalismus nicht fangen lässt.
Wir gehen auf die Terrasse. Das Vogelgeschrei schafft eine Art Grundtaubheit in den Ohren. Ich baue das Mikrofon auf. Eine graue Katze schleicht geschmeidig und scheu an mir vorüber. Gibt es Futter? Meistens, denn wenn Sahra Wagenknecht zu Hause ist, stellt sie etwas für das streunende Tier ins Freie, das regelmäßig vorbeischaut – und macht sich Sorgen, ob vielleicht wieder einmal der viel kräftigere Kater aufkreuzt und die kleine Kostgängerin wegbeißt. Sich um Dinge zu kümmern, die für viele Inbegriff des Nebensächlichen wären, ist ihr ein Bedürfnis. Tiere gehören dazu.
»Sie müssen mir Fragen stellen«, hatte Sahra Wagenknecht vor unserem Treffen gesagt. Ich ahne, dass es selbst für einen Medienprofi wie sie nicht leicht ist, über das eigene Leben Auskunft zu geben. Zumal es sich nicht um ein Zeitungsporträt von einer oder zwei Seiten handelt. Aber sie beginnt mutig, mit der klaren, disziplinierten Sprache, für die sie bekannt ist, zu erzählen. Über lange Strecken wird es dann doch ein Monolog.
Als sie über ihre Kindheit spricht, fällt mir auf, wie jung sie hier im heimischen Umfeld, lässig in Jeans und roter Bluse im strahlenden Sommerlicht, wirkt – und plötzlich packt mich ein Schrecken: Kann man denn die Lebensgeschichte einer noch nicht einmal 50-Jährigen in Buchform niederschreiben? »Biografie« heißt ja im Wortsinn: Beschreibung eines Lebens, das heißt in aller Regel eines gelebten Lebens, von seinem Ende aus betrachtet. Sportler und Schlager-Sternchen mögen da eine Ausnahme bilden. Sie haben tatsächlich oft genug das Leben, das andere interessieren könnte, schon in jungen Jahren abgeschlossen. Aber Politiker?
Und halt, stopp mal! Ist Sahra Wagenknecht wirklich eine Politikerin? Beziehungsweise ist sie nur eine Politikerin? Es gibt nicht wenige intelligente Leute, die sie als scharf analysierende, sozialwissenschaftlich und ökonomisch argumentierende Theoretikerin wahrnehmen. Als Intellektuelle, deren hauptsächliche Fähigkeit darin liegt, kluge Bücher zu schreiben. Manche sehen sie als Philosophin. Andere warten seit Jahren auf ihr abschließendes Werk zu Goethe. Und selbst das Wort vom Popstar taucht bei ihrer öffentlichen Beurteilung immer wieder auf. So viele verschiedene Meinungen und Erwartungen – das deutet für mich auf eine Vielfalt von Begabungen und Möglichkeiten hin, die weit über das hinausgeht, was ein »normales« Leben bereithält.
Sahra Wagenknecht erzählt gerade von ihren frühen Erfahrungen in der Schule, als mir aus dem nachmittäglichen Himmel die Einsicht zufliegt, dass eine Biografie von ihr neben der Bestandsaufnahme des Geschehenen eine Geschichte der Möglichkeiten sein muss. Und eine der Widersprüche. Sicherlich, es gilt aufzuzeichnen, was sich in ihrem Leben ereignet hat. Das, was sie manchmal wie beiläufig erzählt, auf seine Bedeutung hin zu befragen. Dazu die Stimmen von Weggefährten zu hören. Aber im Grunde, das wird mir im schallenden Singsang der deutsch-französischen Vogelschar deutlich, wird die Herausforderung wohl sein, sich einer Frau zu nähern, die wie kaum eine Zweite in der deutschen Politik fasziniert und polarisiert, verehrt und abgelehnt wird. Und dabei derart rätselhaft bleibt.
Was heißt: Ihrem Biografen kommt die Aufgabe zu, im Licht der Spuren und Narben ihrer Vergangenheit ihre Gegenwart zu betrachten. Und ihre bisherige Geschichte auf die Möglichkeiten ihrer Zukunft zu projizieren. Mit dem üblichen Risiko. Niemand weiß, was morgen sein wird. Am wenigsten bei Personen, deren Charakter durch eine so verwirrende Vielstimmigkeit der Lebenspartitur bestimmt wird wie bei Sahra Wagenknecht.
»Gehen wir rein?«, fragt sie nach vielen Stunden Gespräch. Eigentlich ist sie krank, und sie hat sich auf das Interview nur eingelassen, weil schon der erste Termin aus Krankheitsgründen geplatzt ist. Als wir den Sonnenplatz mit Blick auf die sommerliche Landschaft verlassen, habe ich das Gefühl, dass ich den kleinen Marx nun irgendwie anders sehe. Bewacht er wirklich das Bücherregal? Oder die Autorin?
Wahlkampf
Heißer Herbst 2018 in Deutschland. Es brennt an allen Ecken und Enden. Buchstäblich ein ganzes Moor nach einem Bundeswehrmanöver. Andere Brandstellen lodern ohne sichtbare Flammen. Tausende Aktivisten besetzen einen Wald, um dessen Rodung zu verhindern, die den Weg zu neuem Braunkohleabbau freimachen soll. Millionen Autofahrer, die das Pech haben, ein Dieselfahrzeug zu besitzen, wissen nicht, ob sie demnächst noch durch ihren Wohnort fahren dürfen. Klar ist nur: Die Autoindustrie hat mit gefälschten Abgaswerten getäuscht und betrogen, und die Politik geht vor ihr in die Knie.
Die Stimmung ist gereizt. Nicht bloß in der Bevölkerung, sondern auch bei den Volksvertretern. In der regierenden Großen Koalition herrscht offener Krach zwischen den Unionsvorsitzenden Merkel und Seehofer. Das Versagen der SPD bei einer Reihe von fatalen Entscheidungen ist offensichtlich.
Heute ist die »Causa Maaßen«, die Absetzung des Verfassungsschutz-Chefs nach einem schweren Lapsus und seine zwischenzeitliche Beförderung, Schnee von gestern. In diesem heißen Herbst aber provoziert der Skandal die Frage, ob Deutschland überhaupt noch eine funktionierende Regierung hat. Und wenn ja: wie lange noch? Gerade wegen der scharfen Kontroversen zwischen den beiden Parteien mit dem christlichen »C« im Namen werden die kommenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern mit Spannung erwartet. In Bayern steht die CSU vor dem größten Stimm- und Machtverlust seit ihrer Gründung. Der Wahlkampf wird mit harten Bandagen geführt. Zumal durch die Verschiebungen innerhalb der Parteienlandschaft die kleineren Parteien neues Gewicht gewonnen haben.
Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht, der Medienstar und das bekannteste Gesicht ihrer Partei, arbeitet in diesem Wahlkampf als Rednerin die Marktplätze und Säle dieser beiden Bundesländer ab. Meist bestreitet sie zwei Auftritte pro Tag. Morgen wird es der landsmannschaftliche Spagat zwischen dem bayrischen Aschaffenburg und der hessischen Metropole Frankfurt sein. Heute ist Fulda an der Reihe.
Es ist einer der letzten warmen Tage des Jahres. Die Menschen, die sich auf dem Universitätsplatz einfinden, um Sahra Wagenknecht zu hören, sind leicht bekleidet. Direkt links neben der aufgebauten Bühne der Linken bietet ein Café Sitzplätze an. Ich bin früh genug zur Stelle, um mir einen Stuhl zu sichern. An meinem Tisch sitzt ein Paar, beide Mitte 70, beide braun gebrannt, die Frau gertenschlank – und mit Hotpants bekleidet. Ein klassisches Kleidungsstück der 70er-Jahre. Das Gros der Besucher gehört der Generation 65 plus an. Früher hätte man sie Rentner genannt. Viele von ihnen tragen, wie meine Tischnachbarn, jugendliche Outfits. Jeans, die Arme teilweise mit Tattoos versehen, lässig, langhaarig, auch wenn die einstige Hauptpracht meist dünn, weiß und spärlich geworden ist: Es ist die Generation des linken Aufbruchs von ’68. Dazu eine Minderheit von jungen Leuten. Anders als bei den Alten dominiert bei ihnen kein Look. Auffällig allerdings, dass so gut wie keine »ausländischen Mitbürger« auf dem Platz sind. Und: das Fehlen der demografischen Mitte. Die Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen ist hier unterrepräsentiert.
Es sind etwa 300 Leute, die den Universitätsplatz bevölkern und auf den Beginn der Veranstaltung warten. So erfahre ich es von einem der diensthabenden Polizisten, zu deren Aufgaben nicht nur die Gewährleistung der Sicherheit gehört, sondern auch, die Zahl der Besucher fürs Protokoll abzuschätzen. Er läuft durch die Reihen, spricht ab und zu jemanden an, lächelt, bekommt freundliches Feedback: eine »Staatsgewalt«, die zu der Zeit, als die fitten Rentner von heute ihren Protest gegen die als defizitär empfundene Nachkriegsdemokratie auf die Straßen trugen, so nicht denkbar war. Ein bisschen wirkt es wie auf dem Dorfe, in dem jeder jeden kennt.
Die Versammelten hören geduldig den ersten Rednern zu, dem Landesvorsitzenden Jan Schalauske und dem Direktkandidaten der Linkspartei in diesem Wahlkreis. Rechts und links der Bühne stehen zwei Menschen, die eine Armbinde als »Ordner« ausweist. Ein unauffälliger Mann unbestimmbaren Alters und eine junge Frau, die optisch präsentiert, was Die Linke wohl sein will: keine Rentnerpartei, sondern – auch – die der jungen Leute. Sie trägt Jeans und Sneakers, darüber ein dunkles Shirt, das die linke Schulter freigibt und einen Blick auf den Träger ihres schwarzen Unterhemdes erlaubt. In die roten Haare geschoben eine Sonnenbrille. Während der Rede des linken Spitzenkandidaten klatscht die Ordnerin immer wieder kräftig und lächelt auffordernd ins Publikum; sie bewegt sich dabei fast tänzerisch, so, als sei sie bei einem Pop-Konzert. Das Publikum braucht die auffordernden Gesten nicht. Wann immer die einschlägigen Parolen fallen, gibt es zustimmenden Beifall. Etwa, wenn es um das Reichtumsgefälle im Land, das soziale Auseinanderdriften der Gesellschaft, die Fragen von Mieten, Renten und Pflege geht. Aber es ist spürbar: Alle warten. Irgendwann tritt einer der Organisatoren der Veranstaltung zum Redner und flüstert ihm etwas zu. Jedem ist klar, was das bedeutet: Er soll zum Schluss kommen, der Haupt-Act ist eingetroffen. Es ist ziemlich genau 17:00 Uhr, eine halbe Stunde nach Beginn der Veranstaltung. Kurz darauf bricht der Redner ab mit der Aufforderung, doch bitte Die Linke im Oktober zu wählen, und die frohe Botschaft wird verkündet: »Sie ist da!«
Direkt vor der Bühne ist mir ein Mann aufgefallen. Offenbar ein »Bürger mit Migrationshintergrund«, ich tippe auf einen Syrer, an seiner Seite eines der wenigen Kinder, die sich auf dem Platz langweilen. Er hält einen Strauß roter Rosen in der Hand und wirkt ein bisschen nervös.
Und dann kommt sie. Sonnengebräunt, in einem ihrer typischen Kostüme, die so seltsam zeitlos wirken. Ebenso wie die Frisur, die Kette, die Ohrringe. Nichts an Sahra Wagenknecht weist sie optisch als Linke aus. Sie entspricht keinem der üblichen Klischees. Ohne Weiteres könnte man sie für die Vorstandschefin eines DAX-Unternehmens halten. Nicht ohne Ironie, dass zu Beginn ihres Auftritts ein Fenster der rechts vom Podium gelegenen Filiale der Deutschen Bank aufgeht und ein paar Mitarbeiter interessiert Wagenknechts Performance verfolgen. Am warmen Begrüßungsapplaus der Fuldaer beteiligen sie sich freilich nicht.
Auf dem Platz ist die Zeit der erhobenen Arme angebrochen: die Batterie hochgereckter Handys für die private Fotodokumentation. Während dieser Ouvertüre eilt der Rosenkavalier nach vorne und übergibt dem Star der Veranstaltung den cellofanumhüllten Strauß. Es bleibt unklar, warum. Unklar auch, ob es eine bestellte, gestellte Szene ist oder die spontane Handlung eines Fans. Sahra Wagenknecht jedenfalls ist überrascht. Sie freut sich, bedankt sich, erst beim Überbringer der Blumen persönlich, dann via Mikrofon, und legt den Strauß nach einem kleinen Zögern auf das Pult, das ihren Vorrednern als Ablage für ihr Vortragsmanuskript gedient hatte. Sahra Wagenknecht benötigt es nicht. Sie wird – wie immer bei solchen Auftritten – frei reden. Und – nein, nicht genau 30 Minuten. Sondern 31. Der Dank verzögert den Zeitplan.
Sahra Wagenknecht spricht so, wie man es von ihr kennt. Nicht nur ohne Manuskript, sondern auch ohne Fehler, Stocken, Versprecher oder falsche Betonungen. Doch, ein Lapsus ist dabei: »logal« statt »legal« – sofort korrigiert. Jeder, der schon einmal eine Rede, ein Referat, einen Vortrag oder eine Vorlesung gehalten hat, weiß, wie anfällig diese Situation für Fehler ist. Es ist faktisch so gut wie unmöglich, bei einer Redezeit von 30 Minuten fehlerfrei durchzukommen. Klar, wir hören hier eine einstudierte, mit kleinen Variationen mehrmals gehaltene Rede. Und doch ist die Präzision ihres Vortrags überraschend. Ebenso wie das erstaunliche Vortragstempo. Sahra Wagenknecht verpasst es fast systematisch, an dem Punkt innezuhalten, an dem ihre Rede den Beifall hervorlockt. Sie redet über den Beifall hinweg. Jeder Rhetor, jeder Populist zumal, der es darauf anlegt, eine aufgeheizte Stimmung im Publikum zu schaffen, würde ein anderes Timing wählen und den aufkommenden Beifall in die Sprechpausen hinein explodieren lassen.
Nicht so Sahra Wagenknecht. Sie spricht Punkte an, die offenbar die Gefühle ihres Publikums treffen. Aber sie erlaubt sich nicht die Atempause, die allein dem Beifall gewidmet sein sollte. Sie ist schnell. Ein Rhetoriktrainer würde sagen: zu schnell. Stopp, lass Raum für die Aktivität der Zuhörer! Denn der Applaus ist ihr Beitrag, er muss sich entfalten dürfen. Wenn deine Worte zwischenzeitlich in ihm untergehen und das Ende deiner Sätze schon wieder in die Stille fällt, ist ein wesentlicher Effekt verfehlt.
Dabei spricht Sahra Wagenknecht nicht nur fehlerlos, sondern gut: pointiert, nicht agitatorisch, sondern zur Sache. Sie hat eine Botschaft, die ihr wichtig ist. Und offenbar wichtiger als der rhetorische Effekt. Ist es nur der Termindruck – wenige Stunden nach dieser Veranstaltung steht eine Lesung in Erfurt auf dem Programm –, der sie dazu bringt, die Chancen einer emotionalen Steigerung ihres Auftritts und damit ihrer persönlichen Präsenz und Wirkung zu verschenken? Wohl kaum. Und auch ihre Liebe zur gedanklichen Präzision kann es nicht hinreichend erklären. Was aber ist es dann? Mir fällt ein, dass diejenigen, die Sahra Wagenknecht gut und lange kennen, immer wieder davon gesprochen haben, sie sei ein grundschüchterner Mensch. Was niemand glauben mag, der sie als routiniert durch die Medien surfenden Politprofi wahrnimmt, für den Auftritte der unterschiedlichsten Art alltäglich sind. Oder doch …?
Unter den Menschen auf dem Fuldaer Universitätsplatz gibt es zweifellos eine ansehnliche Zahl, die sich das »links« schon als Twens stolz auf die Fahnen geschrieben haben. Mit unterschiedlichen Folgen und Lebensgeschichten. Man kann es an der Kleidung sehen und aus den Gesichtern lesen. Einerseits die aus akademischen Zusammenhängen stammenden Alt-68er, die sich als Pensionäre durch ihr 50. Jubiläumsjahr feiern, und neben ihnen die »abgehängten« Hartz-IV-Empfänger. Was viele über alle Differenzen hinweg vereint, ist die zunehmende Unzufriedenheit mit der von der Kaste der Berufspolitiker dominierten Republik. Sie fühlen sich nicht mehr gesehen, geschweige denn anerkannt, ernst genommen, verstanden. Für sie ist »links« möglicherweise immer noch ein Zauberwort – nicht aber im Munde jener, die es nur als Losung für ihre persönliche Karriere benutzen. Sahra Wagenknecht indes spenden sie Beifall. Denn, das kann ich den Reaktionen und Randbemerkungen, den Kommentaren während und den Äußerungen nach der Veranstaltung entnehmen: sie glauben ihr.
Sie glauben ihr, dass sie nicht zu den Linksgewinnlern gehört, die im Namen einer großen Idee letztendlich nur fürs eigene Portemonnaie und das eigene Image arbeiten. Sie glauben ihr, dass sie tatsächlich versucht, die Lage der Armen und Abgehängten zu verbessern. Obwohl ihr Outfit dem zu widersprechen scheint. Oder – vielleicht sogar deshalb?
Nach genau 31 Minuten ist ihr Auftritt auf dem Marktplatz vorbei. Im Anschluss bildet sich noch die übliche Menschentraube, die die prominente Politikerin umringt. Das Bedürfnis nach Selfies ist groß. Aber die Uhr tickt. Um 19:30 Uhr ist ein weiterer Termin angesagt, 150 Kilometer entfernt. Viele Stunden verbringt Sahra Wagenknecht in diesen Wochen auf der Autobahn, Zeit, in der sie arbeitet oder sich mit ihrem Fahrer unterhält. Nach Tausenden Kilometern kennen sich die beiden mittlerweile gut. Und schon der nächste Tag wird wieder dem Wahlkampf in Bayern und Hessen gewidmet sein – erst Aschaffenburg, dann Frankfurt. Sahra Wagenknecht ist als Stargast beim »Sozialgipfel der Linken« geladen.
Der Frankfurter Saal, in dem die Veranstaltung stattfindet, fasst 800 Besucher. Der Zuspruch ist groß und die Rednerliste prominent besetzt. Nach dem Landesvorsitzenden der Linken, Jan Schalauske, der schon in Fulda aufgetreten war, ist Janine Wissler die zweite Vortragende, ihres Zeichens Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, zudem seit 2014 eine der stellvertretenden Parteivorsitzenden der Linken auf Bundesebene. Beide sind Ende 30, beide haben Politikwissenschaft studiert – er in Marburg, sie in Frankfurt – und mit dem Diplom abgeschlossen. Danach haben sie jeweils eine Zeit lang für Bundestagsabgeordnete der Linken gearbeitet: der klassische Weg politischer Newcomer, die es zu etwas bringen wollen.
Nach ihnen, so kündigt der Moderator an, werde die Parteivorsitzende sprechen, Katja Kipping, einst jugendlicher Shootingstar der PDS mit ostdeutschen Wurzeln, die schon mit Mitte 20 in den Bundestag einzog, schnell in der Partei aufstieg und seit 2012 an der Spitze der Linken steht.
Alle Sitzplätze sind belegt, an der hinteren Wand drängen sich die Spätgekommenen. Auf der rot dekorierten Bühne prangt das Motto der Veranstaltung: »Mehr für die Mehrheit«. Die Stimmung ist, anders als in Fulda, seltsam aufgekratzt, das Publikum aber ähnlich zusammengesetzt, nur dass hier die mittlere Alterskohorte stärker vertreten ist. Und auch die Zahl der »Freaks«, insbesondere aus der 68er-Generation, ist größer.
Unter den vielen langhaarigen Weißhäuptern fällt ein wuchtiger, um nicht zu sagen dicker Mann in Jeans und einem mit Spruchweisheiten bedruckten Sweatshirt auf, der wie Karl Marx frisiert ist, das Haupthaar und der Bart lediglich ein bisschen zotteliger. Er drängt sich auf einen der vorderen Plätze. Später, bei den Reden, wird er dadurch Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass er bei den am stärksten bejubelten Passagen nicht nur – das tun auch andere – die Faust reckt, sondern bei den Aussagen, die ihn offenbar am meisten begeistern, Töne von sich gibt, die an die Laute von Seehunden erinnern: eine Mischung aus Bellen, Japsen und Jaulen. Bei den ersten Reden wird erkennbar, dass nicht nur Parteimitglieder oder Sympathisanten im Publikum sitzen. Einige der Zuhörer verzichten auf jeden Applaus. Offenbar sind es Interessierte, Menschen, die sich ein Bild von der Partei und ihrem politischen Angebot machen wollen. Sie repräsentieren im Saal eine kleine Minderheit. Die lediglich durch eine noch kleinere Minorität getoppt wird: Außer mir gibt es hier bloß noch einen weiteren Schlipsträger. Auch der hört, ohne zu applaudieren, genau zu.
Die Selbstinszenierung der Vortragenden ist so unterschiedlich, dass es fast wie ein geplanter Spannungsaufbau wirkt. Schalauske, der Landeschef, eröffnet die Reden, sachlich, ohne rhetorische Highlights. Zu erleben ist ein gewissenhafter Politikarbeiter ohne Schnörkel und Ausstrahlung. Janine Wissler bietet, einfach und lässig mit Hose und Shirt gekleidet, das Bild einer Studentin auf dem Campus. Sie kommt nicht nur jugendlich daher, sondern will es wohl auch sein. Eine junge Frau, die direkt, ehrlich, scheinbar unprätentiös andere Ehrliche und Unprätentiöse ansprechen möchte. Ihre Rhetorik indes ist deutlich mehr auf beifallheischende Pointen angelegt als die ihres Vorredners. Und tatsächlich beginnt mit ihrem Vortrag ein gewisses Brodeln im Saal. Hier spricht, das ist herauszuhören, eine gelernte Wahlkämpferin.
Katja Kipping tritt im roten Blazer an, der sich vom fast gleichfarbigen Hintergrund und ihren Haaren seltsam kontrastschwach abhebt. Aber sie redet gut. Man merkt ihr die gewachsene Routine an. Die Resultate wohltrainierter Rhetoriklektionen. Anders als früher gibt es einen thematischen und rhetorischen Spannungsbogen und, vor allem, eine temperierte Variation des Affekts. In ihre Rede sind Passagen eingebaut, die nicht nur auf lautstarke, beifallheischende Parolen setzen, sondern Emotionalität einfordern: eher stille Zustimmung und Nachdenklichkeit ins Spiel bringen sollen. Natürlich geht es dabei um die Armen und Abgehängten, eines der Grundthemen ihrer Partei. Nur am Ende ihrer Rede unterläuft ihr ein Lapsus. Sie sei nun beim letzten Blatt ihres Textes, verkündet sie: Sie habe genauso lange geredet wie verabredet, »und wenn jetzt Sahra …«. Der Satz bricht ab, verebbt irgendwo im Nichts. Aber die Botschaft ist klar: Die angekündigte Schlussrednerin ist noch nicht da. Was die Parteivorsitzende damit sagen will, hört sich an wie: Ich halte mich an die Verabredungen. Sie dagegen … An den Reaktionen meiner Sitznachbarn merke ich, dass ich nicht der Einzige bin, der es so wahrnimmt.
Eine ungute Pointe für Katja Kipping, dass just in diesem Moment Sahra Wagenknecht mit ihrer Entourage den Saal betritt. Viele der Anwesenden springen auf, eine Welle der Erregung, ein kleines Rasen geht durch den Raum, Fäuste werden gereckt. Und die begeisterten Rufe: »Sahra, Sahra …« Für ihre Vorrednerin kein Genuss. Man weiß um die nicht nur politisch motivierte Konkurrenz der Partei- und der Fraktionsvorsitzenden. Rivalität, ja Eifersucht ist im Spiel. Jedenfalls ist mit diesem Auftritt einmal mehr klar, wer der Star ist.
Im Unterschied zu Fulda tritt Sahra Wagenknecht hier bei einer Veranstaltung auf, die weniger als Wahlkampfwerbung für Interessierte gedacht ist, sondern stark auf die eigenen Mitglieder zielt. Sie ist insofern auch ein Test, wie man ihr neues Engagement für die außerparteiliche »Aufstehen«-Bewegung wahrnimmt, die von Leuten wie Kipping als Versuch, die Partei zu spalten, eingeschätzt wird. Es geht darum, die Klientel zu organisieren.
Der »Sozialgipfel« sei, so sagte Sahra Wagenknecht im Vorfeld zu mir, sicherlich nicht repräsentativ dafür, wie sie in der Partei wahrgenommen werde. Sie richte sich auf eine eher kritische Stimmung ein. Die Reaktion auf ihr Erscheinen bestätigt das indes nicht. Was in Fulda wie eine grundfreundliche Aufnahme durch das Publikum wirkte, erfährt in Frankfurt eine deutliche Steigerung: Hier wird nicht nur ein Star gefeiert, mit dem man gerne ein Selfie produziert, sondern eine Frau, die Hoffnung bringt. Eine Gestalt, die mit ihren Worten, mit ihrem Auftritt eine Tür öffnet. Die Tür zu einer anderen Welt, in der sich die alten linken Ideale verwirklichen lassen. In der endlich Gerechtigkeit einkehrt. In Frankfurt tritt mit Sahra Wagenknecht im Grunde keine Rednerin, keine Politikerin, keine, wie manche sich gerne selber nennen, Problemlöserin auf, sondern eine Erlöserin.
Was in Fulda zu spüren war, ist in Frankfurt mit Händen zu greifen. Auch hier gilt, dass sie klug und druckreif, eher nachdenklich als agitatorisch redet. Nein wirklich, die Rolle der Scharfmacherin, die die Massen mit ihrer Rhetorik zum Aufstand treibt, liegt ihr nicht. Sahra Wagenknecht ist auch keine Charismatikerin im klassischen Sinne. Und doch auf ihre Weise die wahrscheinlich charismatischste Politikerin der Republik. Ein seltsamer Widerspruch. Oder besser: ein politisches Rätsel.
»Heilige« und »Stalins Cheerleader« – wer ist Sahra Wagenknecht?
Sahra Wagenknechts Auftritte haben den diskreten Charme von paradoxen Botschaften. Sie besagen: Ich bin für euch, für euch da. Auch wenn ich anders bin. Die Leute auf den Marktplätzen, in den Sälen nehmen ihr ab, dass sie meint, was sie sagt – obwohl ihre Ausstrahlung nicht »volksnah« ist. Dem Jargon, der kumpelhaftes Augenzwinkern und das billige Vertrauen des geteilten Ressentiments schafft, passt sie ihre Sprache nicht an. Nicht nur, weil sie eine Frau ist: Sie ist für »locker room talks« à la Trump genauso wenig geeignet wie für den deftigen Stammtischton oder das bei öffentlichen Auftritten gerne gepflegte populäre Bierzeltgedröhn. Das längst nicht mehr eine rein männliche, bayrische Spezialität ist: Genügend Politikerinnen beherrschen es mittlerweile perfekt – regionsübergreifend. Nein, die Leute glauben ihr, weil sie etwas von dem spüren, was sie ihnen – bei allen offenkundigen Unterschieden – ähnlich macht. Zum Beispiel ihre Schüchternheit.
Wie es ein Redner fertigbringt, dass die ihm lauschende Masse freiwillig den Verstand aufgibt und sich in eine aufgeputschte, jedes rationalen Gedankens und Verhaltens beraubte, im Zweifel gewaltbereite Horde verwandelt, ist psychologisch kein Rätsel. Wohl aber das Phänomen, dass mitunter dieselbe Zuhörerschaft so etwas wie eine kollektive Sensibilität für den emotionalen Unterbau der Rede und damit für die innere Spannung des oder der Vortragenden entwickelt, die nicht vom Anspruch auf Souveränität und Omnipotenz lebt, sondern eine Schwäche offenbart. Sahra Wagenknecht ist niemand, der den Platz oder den Saal in eine rauschhafte Stimmung versetzt. Ja, sie kann durchaus überzeugend reden, Pointen setzen, ihre Punkte machen. Aber, sie sagt es selbst, sie ist weit davon entfernt, sich von der eigenen Rede mitreißen zu lassen, in und an ihr trunken zu werden, mit der Masse zu verschmelzen und daraus narzisstische Souveränität zu gewinnen, an der sich wiederum die Zuhörerschaft in omnipotente Höhen katapultieren kann. Ein Manko, das bei ihr zur entscheidenden Stärke wird. Man spürt ihr immer noch die Anstrengung, die Überwindung an, die es sie bei aller Routine kostet, ans Mikrofon zu treten und zu sprechen. Man spürt, tatsächlich, ihre Schüchternheit. Die Zuhörer nehmen an ihr etwas wahr, was sie von sich selbst kennen. Es ist diese Ähnlichkeit, die ein Band zwischen ihnen und der Rednerin bildet. Auf diesem Feld kann der argumentative Samen aufgehen. Glaubwürdigkeit ist das Gegenteil von Routine. Wer überzeugend demonstriert, dass es ihm oder ihr nicht leicht fällt, die erwartete Rolle auszufüllen, kann in ihr reüssieren. Allerdings nur, wenn zu dieser spürbaren, nachvollziehbaren Ähnlichkeit etwas hinzukommt, das darüber hinausragt; etwas, das sie um das erweitert, was einem selbst fehlt, um das, was man haben möchte, aber nicht hat.
Schüchternheit und Wortgewalt: Es ist diese ungewöhnliche Mischung, die Sahra Wagenknecht zu einer Ausnahmeerscheinung in der deutschen Politik macht. Sie fällt damit aus dem Schema der routinierten Berufspolitikerin ebenso heraus wie aus dem der Aufstiegskarrieristin. Schüchternheit und Wortgewalt: Das eine steht für Aufrichtigkeit, Selbstüberwindung und Mut; das andere für das, was das »Volk« seit der Antike von seinen Repräsentanten erwartet: dass sie seine Fürsprecher sind; dass jemand mit der wunderbaren Qualität, unbezweifelbare intellektuelle Kompetenz mit moralischer Unbedingtheit und klarer Sprache zu verbinden, aufsteht. Für sie, die Mehrheit. Die Mehrheit jener, die meint, sich nicht adäquat politisch äußern zu können. Sie wissen um ihre Überzeugung ebenso wie um ihre Ängstlichkeit, ihre Enttäuschung und den mangelnden Willen zum Handeln. Sie finden schon Worte, aber sie zweifeln, ob es die richtigen sind. Es sind die richtigen im Verein, in der Kneipe, beim Geburtstagsfest. Es sind private Worte, und sie wissen das. Genauso, dass von ihnen keine Wirkung ausgeht. Dafür braucht es andere. Solche wie Sahra. Ihre auf den ersten Blick wunderliche Mischung von linker, strikt antikapitalistischer Ausrichtung und grundbürgerlicher Ausstrahlung ist dafür das Markenzeichen: Sie ist wie wir – und anders. Sie denkt an uns – und kann für uns handeln, weil sie anders ist.
Von einem Großteil der Medien wird Sahra Wagenknecht indes weitgehend auf das Format eines politischen Popstars reduziert, der gut für außergewöhnliche Berichterstattungen ist. Nimmt man sie jedoch ernst, nicht nur als Privatperson, sondern als Indexgestalt einer veränderten politischen Realität in Deutschland, dann stellt sich die Frage: Wer ist Sahra Wagenknecht?
Einer, der Sahra Wagenknecht sehr gut und lange kennt, hat diese Frage so beantwortet: »Sahra ist keine Göttin, und das weiß sie auch.«1 So Gregor Gysi, als bekannt wurde, dass sie sich dafür entschieden hatte, die Bewegung »Aufstehen« ins Leben zu rufen. Gregor Gysi zählt, das ist kein Geheimnis, nicht zu Wagenknechts politischen Freunden in der Partei, besser: in den beiden Parteien, deren Mitglieder sie seit dem Ende der SED waren bzw. immer noch sind. Mindestens einmal im Laufe seiner Karriere als Vorsitzender hatte er mit seinem Rücktritt für den Fall gedroht, dass ihrer Forderung nach einer einflussreichen Stellung in der Partei nachgegeben werde. Darf man also vermuten, dass seine negative Charakterisierung augenzwinkernd zu verstehen gibt, sie sei das Gegenteil einer Göttin? Und was wäre das Gegenteil einer Göttin? Man muss es nicht präzisieren, um zu wissen: bestimmt nichts Gutes. Seine vermeintlich harmlos-alltägliche Beschreibung der innerparteilichen Rivalin zeigt ein für Wagenknechts Beurteilung typisches Muster: eine Ambivalenz, in der sich Idealisierung und negatives Ressentiment begegnen.
Ein anderer, der Sahra Wagenknecht ebenfalls sehr gut, ja gewiss besser als Gysi kennt und sie seit vielen Jahren berät und begleitet, ein hoch gebildeter, weder kirchlich noch links orientierter Mann, Thomas Städtler, ein Psychologe und Wissenschaftsstratege zumal, verrät knapp – und ohne Negation – seine ultimative Wahrheit über sie: »Sahra Wagenknecht ist eine Heilige.« Natürlich müsse das verkennen, wer sich des routiniert oberflächlichen Kommentartons der einschlägigen TV- und Print-Journalisten bediene, die Sahra Wagenknecht als eine der umstrittensten, aber auch beliebtesten Politikerinnen Deutschlands vorstellen.
Die Hochglanzmagazine stilisieren sie zur »schönen Sahra«2, eine Perspektive, die nur am Rande etwas mit Politik zu tun hat. Tatsächlich, sie wird von vielen bewundert. Aber sie wird auch – so sagt es Sevim Dağdelen, eine ihrer Parteifreundinnen – bei ihren öffentlichen Auftritten »wie ein Messias verehrt«. Ein Messias in weiblicher Gestalt im politischen Geschäft: Wann hat es das seit Jeanne d’Arc je gegeben?
Sahra Wagenknecht hat sich all diese Zuschreibungen nicht ausgesucht. Klar ist, sie scheint in kein Schema wirklich zu passen, sprengt die Grenzen traditioneller Politikdarstellung, nicht zuletzt dadurch, dass sie immer wieder aus den Grenzen ihrer eigenen Partei ausbricht und angefeindet wird. Als Außenseiterin weckt sie tatsächlich nicht selten messianische Hoffnungen. In der deutschen Politik ist sie für viele heute ebenso sehr Projektionsfläche wie Fragezeichen.
Untergründig spielt dabei sicherlich ihre politische Ausgangsposition eine Rolle, eine theoretische Orientierung, die die Mehrheit in Deutschland ablehnt: der Marxismus. Für die junge Politikerin war er der Leitfaden ihres Engagements und Handelns.
Der Marxismus, aus der Religionskritik geboren und im Selbstverständnis derer, die sich zu ihm bekennen, eine rationale Analyse des Bestehenden, hat sich im Laufe der Geschichte selber zu einer Art Heilslehre entwickelt. Tatsächlich hat der Marxismus eine sprachliche Formel geschaffen, die die Lücke zwischen den biblischen Mühseligen und Beladenen und den Überflüssigen von heute überbrückt. Sein genuines Pathos war stets, den »Erniedrigten und Beleidigten« zu helfen: ihre Stimme zu hören, sie ernst zu nehmen, für sie – und mit ihnen – zu kämpfen. Die moralische Botschaft des Marxismus hat unüberhörbare Anklänge an das christliche Ideal der Nächstenliebe – auch wenn die ethische Substanz dieser Theorie durch die verschiedenen Versuche, sie in politische Praxis zu überführen, weitgehend aufgebraucht zu sein scheint. Weshalb der DDR-Dichter Günter Kunert sie als eine »unbarmherzige Religion« qualifizierte, die »kein Erbarmen und kein Mitleid« kenne.3 Man muss nur den Namen Stalin nennen, um zu verstehen, was er meint: den Absturz einer emanzipatorischen Theorie in die reale Hölle einer terroristischen Politik, die historische Realität einer alle Lebensbereiche durchdringenden Diktatur mit Millionen von Opfern. Die Praxis des Stalinismus ist, als Perversion des Marxismus, die Verkehrung einer messianischen Heilsbotschaft in Massenmord.
Genau dies findet Widerhall in anderen Charakterisierungen Sahra Wagenknechts: Äußerungen wie, sie sei eine »PDS-Stalinistin«4, gehöre zu »Stalins geistige(n) Groß-Neffen«5, sei eine »Neo-Stalinistin«6 und »Stalins Cheerleader«7, sind nicht nur in den 90ern fester Bestandteil der konservativ-liberalen Berichterstattung über die junge Politikerin, sondern bis in die jüngste Gegenwart regelmäßig zu hören und zu lesen. Natürlich, das sind absichtlich plakative, polemische Statements. Was allerdings nicht weniger für die Aussage gilt, sie sei eine Heilige oder der Messias. Auf den ersten Blick scheint klar: Wer sich auf das eine festlegt, kann mit dem anderen nichts anfangen.
Oder doch? Es käme auf einen Versuch an. Das Experiment, Sahra Wagenknecht als Verehrte wie auch als Verachtete zu verstehen. Ein Panorama aus den einander widersprechenden Einschätzungen und Bewertungen ihrer Gegner, Freunde und Feinde zu gewinnen, das es möglich macht, sich ein neues Bild der Politikerin zu schaffen. Ein Bild, zu dem die Selbstauskünfte der Porträtierten selbstredend einen wichtigen Teil beitragen sollen.
Aufwachsen im Osten
West-östlicher Diwan
Angefangen hat alles im legendären Jahr 1967. In der Hauptstadt der DDR lernen sich eine junge Frau und ein Student aus Westberlin kennen. Es ist eine reine Zufallsbegegnung. Sie wartet am Bahnhof Friedrichstraße auf die Ankunft einer Freundin – vergeblich. Irgendetwas mit der Zugverbindung hat nicht geklappt. Er läuft während der Wartezeit zweimal an ihr vorbei – schließlich fasst er sich ein Herz, spricht sie an, und die beiden gehen einen Kaffee trinken. Der Beginn einer Liebe. Er ist Iraner, ein erklärter Schahgegner, der sich im studentischen Milieu der 1960er-Jahre politisiert hat; sie hat die Schule gerade abgeschlossen und wartet auf einen Studienplatz. In Ostdeutschland, denn sie lebt in einem Dorf unweit von Jena. Zwischen den beiden steht die Mauer. Es ist ihr unmöglich, ihren Geliebten zu besuchen. Er dagegen kann mit einem 24-Stunden-Visum jederzeit in den Osten der geteilten Stadt. Ihre Liebe ist ein west-östlicher Diwan eigener Art. Es sind nicht nur zwei Kulturen, die sich treffen, sondern zwei oder besser drei unterschiedliche Systeme, die den Hintergrund dieser Liebesgeschichte bilden.
In jenem Jahr ihrer ersten Begegnung prallen diese Systeme mit besonderer Wucht aufeinander: Der Schah von Persien, Reza Pahlavi, besucht 1967 Westberlin, an seiner Seite die unbestrittene Königin der Gazetten, Farah Diba: ein glamouröses Ereignis der noch jungen zweiten deutschen Republik, von der Regenbogenpresse mit ebenso detaillierter wie begeisterter Berichterstattung über das Leben des Potentaten und seiner Frau in Palästen mit goldenen Wasserhähnen, Scharen von Dienstboten und opulenten, kaviarsatten Festivitäten begleitet. Wichtiger aber ist der politische Kontext. Der Schah ist der einzige westlich orientierte Herrscher des Orients, eine Art Außenposten der US-amerikanisch-europäischen Achse in Zeiten des Kalten Krieges. Und er verfügt über das wichtigste Schmiermittel der Moderne: Öl. Da sieht man in den westlichen Demokratien schon mal über die Not eines großen Teils der Bevölkerung und den innenpolitischen Terror des Despoten hinweg. Tatsächlich ist es eine Schreckensherrschaft finsterster Art: Kritiker und Andersdenkende werden unterdrückt, verfolgt, mit oder ohne Prozess in Gefängnisse geworfen, ermordet. Der Geheimdienst SAVAK ist für seine skrupellose Gewalt berüchtigt und sein Aktionsradius nicht auf Persien beschränkt. Wie einflussreich der Geheimdienst mitten in Deutschland ist, wird am 2. Juni 1967 deutlich, für viele Historiker der Beginn einer Zeitenwende in der neuesten deutschen Geschichte.
Die Bilder dieses Tages jedenfalls sind Dokumente der Zeitgeschichte geworden: von der SAVAK gedungene Perser, die mit meterlangen Latten auf friedliche Demonstranten einschlagen, die auf die prekäre Menschenrechtssituation im Iran aufmerksam machen wollen; deutsche Polizisten, die nicht eingreifen, ihre Mitbürger nicht vor den Angriffen der bestellten »Jubelperser« schützen – und sich dann selber – »Knüppel frei!« – an der Prügelorgie gegen Studenten beteiligen: nicht nur ein hilfloser Rechtsstaat, sondern eine Staatsmacht, die ihre Ordnungshüter wie organisierte Banden gegen jene von der Leine lässt, die ihr demokratisches Recht auf öffentliche Kritik wahrnehmen.
Und natürlich das berühmteste, das bleibende Bild dieses Tages: der tot auf dem Boden liegende Demonstrant. Der von einem Polizisten hinterrücks erschossene Benno Ohnesorg – ein 26-jähriger Lehramtsstudent aus Hannover, der zum ersten Mal an einer Demonstration teilgenommen hat. Das tödliche Pistolenfeuer des Polizeiobermeisters Karl-Heinz Kurras wurde zum Startschuss für das, was später unter der Rubrik »68« als Beginn einer zivilgesellschaftlichen Erneuerungsphase der Bundesrepublik begriffen werden wird. Ein zutiefst verstörender Fall. War es nur ein Westberliner Polizist, der dem Auftrag, einen orientalischen Potentaten zu schützen, allzu eifrig nachkam? Seit einigen Jahren ist bekannt, dass die Ost-West-Gemengelage in diesem Geschehen viel komplexer war. Kurras, durch die westdeutschen Gerichte von allen Vorwürfen freigesprochen, wurde 2009 als Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi enttarnt.
Sahras Vater gehört zu denen, die an den Protesten gegen den Schah, sein Landesoberhaupt, teilnehmen. Ein persönliches Risiko, denn bei aller Kritik an den Zuständen in seinem Heimatland steht für ihn fest, dass er dorthin zurückgehen wird. Er will vor Ort zur Veränderung beitragen, dabei helfen, dass sich aus dem rückständigen, zwischen feudalistischem Erbe und forcierter Verwestlichung schlecht balancierten Land eine moderne, freie Gesellschaft entwickeln kann. Für ihn ist es ein selbst erteilter Auftrag: seine persönliche Herausforderung als künftiger Ingenieur in einem Entwicklungsland, dessen Zukunftsperspektiven nicht zuletzt auf technologischer Innovation beruhen; und als politischer Mensch, der sich ein Ende der Despotie wünscht. Beides ist Teil seines Lebensentwurfs. Der Entschluss, ihn zu realisieren, steht felsenfest.
Anderthalb Jahre nach dem denkwürdigen 2. Juni, Anfang 1969, steht auch etwas anderes fest: Er wird Vater werden. Vater in einer Beziehung mit jener jungen Frau aus dem Osten Deutschlands, mit der er nie wirklich eine längere zusammenhängende Zeit verbringen konnte. Immer ist da die Mauer im Weg. Immer wieder ist ihr Zusammensein unterbrochen, erfordert Grenzwechsel, hängt am bürokratischen Faden der Visalogik. Und ebenso gewiss wie seine Rückkehr in die persische Heimat ist, dass die Mutter seines Kindes – Liebe hin, Liebe her –, ihm dahin nicht folgen will.
Sahras Vater ist von Anfang an ein Vater auf Zeit, auf Abruf. Solange er in den Iran zurückkehren will und Sahras Mutter sich nicht vorstellen kann, ihn in dieses schwierige Land zu begleiten, steht ihrem gemeinsamen Kind ein Leben ohne den leiblichen Vater bevor. Und tatsächlich, der Tag der Trennung kommt schnell. Sahra ist erst zweieinhalb Jahre alt, als ihr Vater Deutschland verlässt. Ein radikaler Einschnitt – mit dauerhaften Folgen.
Sahra Wagenknecht wird am 16. Juli 1969 in Jena geboren. Ihre Eltern schwanken bei der Namensgebung zwischen Rosa und Sahra. Sahra, wohlgemerkt: in der persischen Version, mit einem aspirierten »h« gesprochen. Aber dieser Name ist in der DDR nicht bekannt, er wird von der Standesbeamtin eigenmächtig in die geläufige Form »Sarah« verwandelt. Ein Name, der in das Schema der damaligen Westlinken gepasst hätte, die ihren Kindern gerne jüdische Vornamen gaben: die Daniels, Davids, Benjamins und Leas, Judiths und eben Sarahs sind emblematische, weitgehend unbewusste persönliche Wiedergutmachungsversuche gegenüber den von der Elterngeneration der 68er ermordeten Opfern.
Das gilt nicht für Sahra, die später persönlich dafür sorgt, dass ihr »h« an der richtigen, der vom Vater vorgegebenen Stelle steht. Ohne sich um die DDR-Bürokratie zu kümmern. Denn die hatte – auch wenn sie den erstaunlichsten Vornamen wie Maik oder Mandy den staatlichen Segen gab – keinen Sinn für Eigenwilligkeiten dieser Art: Das Geläufige vermeintlich mutwillig und individuell zu verändern und damit in Frage zu stellen – das hatte den Geruch von «Individualismus«. Derartige Abweichungen waren im ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden nicht gern gesehen.
Wie sehr eine »Sahra« etwas anderes als eine »Sarah« ist, fällt nicht beim Sprechen auf. Aber in jeder schriftlichen Verwendung. Der Name löst Erstaunen aus, ist erklärungsbedürftig: »Nein, nicht Sarah …« Die vermeintlich nebensächliche Korrektur wird zu einem Statement.
Sahra legt immer großen Wert darauf, dass ihr Name richtig geschrieben wird.
Wenige Wochen nach Sahras Geburt, im September, wird ihrer Mutter ein Studienplatz in Berlin zugeteilt. Für Ökonomie. Nicht ihre erste Wahl, denn viel lieber hätte sie, die talentiert malt und zeichnet, Kunst studiert. Aber selbstverständlich ist das Angebot nicht abzulehnen, zumal es sie in die Nähe von Sahras Vater bringt. Der kleine Grenzverkehr zwischen Ost und West bietet – fast – so etwas wie die Möglichkeit einer kontinuierlichen Beziehung: das, was sich jedes verliebte Paar wünscht.
Trotz der nur kurzen Zeitspannen, in denen die junge Familie »vollständig« ist, haben Sahra und ihr Vater ein sehr inniges Verhältnis. Ihre Mutter erzählt, wie spontan, intensiv und selbstverständlich die Tochter den Vater beim ersten Kontakt angenommen hat. Und umgekehrt. Die buchstäbliche Liebe auf den ersten Blick. Allerdings unter erschwerten Bedingungen. Denn die beiden müssen sich ja, anders als es in »normalen Familien« der Fall ist, erst kennenlernen. Der Vater ist nicht einfach da, er muss aus dem Westen der Stadt anreisen. Und immer wieder muss der Abstand überbrückt werden, der durch die Mauer gegeben ist. Trotzdem: Das Gefühl ist stark. Und hinterlässt bei Sahra einen tiefen, einen dauerhaften Eindruck. Gefragt, welche Erinnerungen sie an ihren Vater hat, erzählt sie von dem Gefühl, auf seinen Schultern zu sitzen. Es existiert ein Foto davon. Ob es tatsächlich eine Erinnerung der damals Zweijährigen ist oder eine von der Fotografie ausgehende gefühlsmäßige Rekonstruktion, ist unerheblich. Was sie sich bewahrt hat, ist das wunderbare Gefühl, von einer geliebten Person in den Himmel gehoben zu werden.
Auch wenn die drei einander sehr zugetan sind, für Sahras Mutter wird durch die Geburt der Tochter vieles komplizierter. Ein Baby passt nicht in dieses Leben, diese ungewöhnliche, durch eine Mauer getrennte, komplizierte ost-westliche Liebeskonstellation, bei der der Mann aus dem Orient im Westen und die okzidentale Frau im Osten sitzt. Es passt schon gar nicht in das neue Leben der jungen Mutter als Studienanfängerin, zumal sich ihre Hoffnung auf einen Krippenplatz zunächst nicht erfüllt. Die Familie springt ein. Sahras Großmutter gibt ihre Arbeit als Leiterin einer Lebensmittelverkaufsstelle auf und wird zur wichtigsten Bezugsperson.
Für die junge Oma – bei Sahras Geburt ist sie erst 39 Jahre alt – ist ihre Enkelin wie ein drittes Kind: ein Kind, das, anders als Sahras Mutter, nun in einer Zeit das Licht der Welt erblickt, in der keine materielle Not mehr herrscht. 1948, als ihre Mutter geboren wurde, war selbst das Essen knapp. Damals gab es noch Essensmarken, die der Großvater aber nicht erhielt, weil seine Eltern Bauern waren. Jedoch kam von ihnen keinerlei Unterstützung, sein Vater missbilligte die Verbindung mit seiner Frau, Sahras Großmutter. Diese war mit ihrer Mutter und zwei Schwestern als Vertriebene aus Böhmen in Döbritschen, dem Wohnort der Wagenknechts, einquartiert worden – besitzlos, heimatlos, fremd: keine »gute Partie«. Sahras Urgroßvater wollte, dass sich sein Sohn mit einer wohlhabenden Bauerstochter aus der Gegend zusammentat. Zur Strafe für den unfolgsamen Sohn versagte er dem jungen Paar, beide waren 16 Jahre alt, als sie sich kennenlernten, jede materielle Hilfe. Mit 17 wurde geheiratet, mit 18 kam das erste Kind, Sahras Mutter. Sie wurde in echte Not und Armut hineingeboren.
Sie haben sich bis zum Schluss »unglaublich geliebt«, sagt die Enkelin über ihre Großeltern. »Die sind wirklich das, wo man neidisch werden muss, wenn man idealisiert oder romantisiert über Liebe nachdenkt.« 1952 zog die junge Familie nach Göschwitz. Dort wurde alles besser: eine neue Wohnung mit Bad, der Großvater fand Arbeit bei Carl Zeiss, die Großmutter wurde Verkaufsleiterin im Konsum. Ein privilegierter Zugang zu Lebensmitteln war ihr damit sicher.
Sahra wächst in der 400-Seelen-Gemeinde Göschwitz auf, ursprünglich ein Dorf am Rande Jenas, just in ihrem Geburtsjahr der Stadt eingemeindet. Eine Welt zwischen Vorstadt und Dorf, Industrialisierung und Landwirtschaft. Aber sie hält sich ohnehin zumeist im großelterlichen Haushalt auf, in dem der Großvater, seine Frau und ihre zweite Tochter, die vier Jahre jüngere Schwester ihrer Mutter, leben. Die Mutter reist so oft an, wie es geht. Erstaunt darüber, wie »artig und unkompliziert« Sahra ist. Erneut klappt es nicht, sie in einer Krippe unterzubringen – diesmal aber scheitert es am entschlossenen Widerstand des artigen Kindes. Sahra Wagenknecht erinnert sich daran, dass sie mit allen Mitteln zu verhindern wusste, sie in eine solche Institution zu geben. Sie weigert sich standhaft und lautstark. »Ich war eine kleine Terroristin«, sagt sie mehr als vier Jahrzehnte später. Liegt in dem nach innen gekehrten Lächeln, das die Erinnerung begleitet, etwa eine Spur Stolz?
Die kleine Sahra jedenfalls ist lieber mit sich selber und der unmittelbaren Lebenswelt beschäftigt. Sie ist, in sich zurückgezogen, zufrieden, allerdings sehr oft krank, so dass sie sowieso das Haus nicht verlassen kann. Die Großmutter versucht, daran erinnert sich Sahras Mutter, »Kinder für sie zum Spielen aus der Nachbarschaft« zu holen. »Das lag aber Sahra auch nicht. Sie hat sich wirklich intensiv mit sich beschäftigt und fühlte sich gestört.« Sie ist von klein auf Einzelgängerin, nur das fünf Jahre ältere Nachbarsmädchen Simone wird, so wie die langjährige Freundin Beate, gelegentlich als Spielgefährtin akzeptiert. Weitere Freundschaften mit Gleichaltrigen gibt es lange Zeit nicht. Was vor allem damit zu tun hat, dass sie »anders« aussieht. Später wird sie es drastischer erleben. Aber es fängt schon in Göschwitz an: »Iiiih, wie sieht die denn aus!« Es ist ein Teil des väterlichen Erbes: das optische. Heute sagt Sahra Wagenknecht, dass diese Erfahrung der Hauptgrund dafür war, nicht in den Kindergarten gehen zu wollen.
Als sie zwei Jahre alt ist, fängt die Großmutter wieder an, halbtags zu arbeiten, die Familie kann es sich nicht leisten, auf ihren Beitrag zum Haushaltseinkommen zu verzichten. Mittags bringt der Großvater seiner Enkelin Essen aus der Kantine. Aber Sahra, die nun meist sich selbst überlassen ist, weiß sich zu helfen. Sie arbeitet intensiv daran, sich jene hilfreichen Begleiter zu erwerben, die ihr seither treu geblieben sind: Mit vier Jahren erfährt sie, die schon immer gerne den ihr vorgelesenen Geschichten und Märchen gelauscht und sich von den freundlichen Wörtern hat umspielen und einhüllen lassen, diese nun auf ganz neue Weise. Sie quengelt so lange, bis die Großeltern ihr dabei helfen, lesen zu lernen, und schafft sich damit einen eigenen Zugang zu der unerschöpflichen Lustquelle ihres Lebens. Sahra hat nach wie vor kaum Kontakte zu anderen, allein ist sie von nun an jedoch nie mehr, es gibt ja die wunderbare Welt der Wörter, die Freunde, die in Gestalt von Büchern und Geschichten zu ihr sprechen. Bald kommt ein Faible für Mathematik, Zahlenrätsel und knifflige Logeleien hinzu. Keine Frage, Sahra ist begabt. Sie hat Züge jener Höchstbegabten, die sich von der Welt abkapseln und in ihrem eigenen Kosmos leben. Diese autistische Tendenz, die sich im Rückzug in ihr selbst gestaltetes Buchstabenreich spiegelt, bildet den Untergrund, ja eigentlich die Basis ihrer Lebensgeschichte.
Die ersten Lesestücke, an die Sahra Wagenknecht sich erinnert, die ersten nicht nur passiv gehörten, sondern aktiv wahrgenommenen, aus eigener Kompetenz ins Leben gerufenen Texte, sind Märchen. Sie gehören fortan zur Grundausstattung ihres Rückzugsorts, bestimmen dessen Klima und Interieur. Was immer später an ästhetischen, wissenschaftlichen und politischen Besuchern hinzukommen wird, sie alle erhalten durch die besondere Atmosphäre dieses inneren Salons eine märchenhafte Tönung.
»Wunscherfüllung«, für Sigmund Freud die grundlegende Logik des Traums, ist auch das Gesetz des Märchens. Zum Beispiel in diesem:
»In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer, dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag sehr heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens, und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.«1
So beginnt das Märchen vom Froschkönig