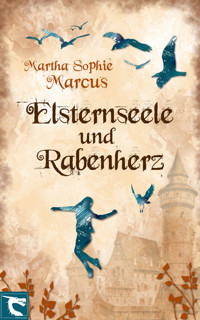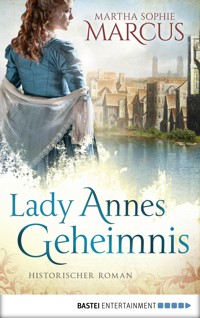4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MSMbooks via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lüneburg 1656: Die siebzehnjährige Susanne Büttner, Tochter eines angesehenen Salzfassmachers, führt seit dem Tod ihrer Mutter den Haushalt der Familie. Doch als in der Stadt ein Mord geschieht, gerät ihr Leben aus den Fugen. Gemeinsam mit ihrer heimlichen Liebe, dem Schmiedegesellen Jan, wird Susanne in die Aufklärung des Verbrechens und die Jagd nach einem Kinderhändler verwickelt. Gleichzeitig beginnt der reiche Patriziersohn Lenhardt Lossius, ihr den Hof zu machen. Am Ende des schicksalsträchtigen Sommers muss Susanne sich entscheiden, ob sie ihrer Familie dienen und ihr Leben in den sicheren Grenzen des Althergebrachten verbringen will oder ob sie sich gegen die gesellschaftlichen Normen auflehnen und den Aufbruch in eine ungewisse Zukunft wagen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Table of Contents
Überblick
Impressum
Titel
1. Die Tote im Fluss
2. Der schöne Lossius
3. Lockende Früchte
4. Ein heimlicher Winkel
5. Der Mann mit den Doggen
6. Im schiefen Haus
7. Der fremde Herr
8. Hoffnung und Sehnsucht
9. Der Diener mit dem Gehstock
10. Albert im Turm
11. Auf der Holzhude
12. Bruderliebe
13. Zu Gast beim Sülfmeister
14. Der Rote Berthold
15. Gefährliche Abschiedsstunde
16. Kurz vor Torschluss
17. Die Kinder der Utopia
18. Erst Asche, dann Salz
19. Der Donner warnt
20. Jeder tanzt, wie er kann
21. Scheidewege
22. Junge Bräute
23. Wohin, Susanne?
24. Weißdorn und Gallapfel
25. Rache
26. Im Exil
27. Die Jagd
28. Heimkehr
Kleines Glossar
Personen
Karte
Nachwort zur Neuausgabe, 2018
Weitere Bücher der Autorin
Überblick
Lüneburg, 1656: Die siebzehnjährige Susanne Büttner, Tochter eines angesehenen Salzfassmachers, führt seit dem Tod ihrer Mutter den Haushalt der Familie. Doch als in der Stadt ein Mord geschieht, gerät ihr Leben aus den Fugen. Gemeinsam mit ihrer heimlichen Liebe, dem Schmiedegesellen Jan, wird Susanne in die Aufklärung des Verbrechens und die Jagd nach einem Kinderhändler verwickelt. Gleichzeitig beginnt der reiche Patriziersohn Lenhardt Lossius, ihr den Hof zu machen.
Am Ende des schicksalsträchtigen Sommers muss Susanne sich entscheiden, ob sie ihrer Familie dienen und ihr Leben in den sicheren Grenzen des Althergebrachten verbringen will oder ob sie sich gegen die gesellschaftlichen Normen auflehnen und den Aufbruch in eine ungewisse Zukunft wagen wird.
Über die Autorin
Martha Sophie Marcus wurde 1972 im Landkreis Schaumburg geboren und verbrachte dort ihre Kindheit zwischen zahllosen Haustieren und Büchern.
Die Autorin studierte in Hannover Germanistik, Pädagogik und Soziologie mit dem Schwerpunkt auf geschichtlichen Aspekten. Anschließend lebte sie zwei Jahre lang in Cambridge, UK, und genoss die malerische historische Kulisse.
Ihre Leidenschaft für Literatur brachte sie früh zum Schreiben. 2010 erschien mit „Herrin wider Willen“, einer Geschichte aus dem Dreißigjährigen Krieg, ihr erster historischer Roman, dem bald weitere folgten.
Heute wohnt Martha mit ihrer Familie in Lüneburg und ist Vollzeit-Schriftstellerin.
Weitere Informationen finden Sie auf www.martha-sophie-marcus.de
Deutsche Erstausgabe November 2010
© 2010 by Martha Sophie Marcus
Gestaltung dieser E-Book-Ausgabe: M.S.Marcus/H.Oltrogge, 2018
MSMbooks
In der Twiete 3, 21365 Adendorf
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung bedarf der ausschließlichen
Zustimmung der Autorin
Weitere Informationen:
www.martha-sophie-marcus.de
Martha Sophie Marcus
Salz und Asche
Historischer Roman
Ein Glossar, eine Personenliste und einen Plan des alten Lüneburgs finden Sie am Ende des Buches.
1
Die Tote im Fluss
»HEXENKIND! Totes Mädchen, Wiedergänger!«
Die Gassengören konnten es wieder einmal nicht lassen. Susanne Büttner bückte sich, hob eine vertrocknete Rübe aus dem Straßendreck auf und warf sie nach den aufkreischenden Kindern. »Wartet, ich helf euch, Lumpengesindel!«
Die meisten von ihnen liefen lachend davon, aber die drei größten Jungen gingen rückwärts und machten rüde Gesten.
Susanne schlüpfte aus ihren Holzpantinen, ließ ihr Bündel auf den Boden fallen und raffte den Rock, um loszulaufen. Das genügte, um auch die letzten Plagegeister in die Flucht zu schlagen. Sie konnte ihre Schuhe wieder anziehen.
Ihre große Schwester stand wie immer mit glühenden Wangen und gesenktem Kopf da. Regine wehrte sich nie selbst, obwohl der Spott ihr galt.
Susanne streckte die Hand nach ihr aus. »Komm weiter, Gine. Die kommen nicht zurück.«
Seit sieben Jahren trieben die Kinder es so. Man hätte meinen sollen, der Reiz hätte im Laufe der Zeit nachgelassen, doch so, wie immer neue Kinder heranwuchsen, wuchs auch die Spottlust nach. Susanne war jederzeit auf einen kleinen Kampf gefasst, wenn sie mit Regine ausging. Dabei waren sie beide inzwischen erwachsen, und zu handgreiflichen Auseinandersetzungen war es schon seit langer Zeit nicht mehr gekommen.
Sie gingen an der Ratsapotheke vorbei bis zum Haus des Scherenschleifers. Susanne hatte eine Schere, ein Messer und eine Abziehklinge für Fassgauben im Bündel.
Der Scherenschleifer hatte Zeit, die Arbeit sofort zu tun. Susanne hätte gern gewartet, um zuzusehen, wie er das Werkzeug schärfte. Regine jedoch zog es zum Wasser, wie es sie immer zum Wasser zog, als hätte diese Anziehung nicht schon genug Schaden angerichtet.
Susanne seufzte und gab nach. »Wir kommen später wieder«, sagte sie dem Scherenschleifer. »Meine Schwester möchte den Fluss sehen.«
Der Handwerker nickte. »Merkwürdig ist das schon. Man sollte meinen …«
»Ja, ja, sollte man. Aber so ist es eben nicht.« Susanne lächelte ihm entschuldigend zu und beeilte sich, Regine einzuholen, die schon zum Ufer der Ilmenau unterwegs war, auf ihre schwebende, deshalb aber nicht weniger zielstrebige Art.
Sie wanderten durch das Rote Tor aus der Stadt hinaus und auf dem Pfad am Flusslauf entlang bis zu den Bleichwiesen. Für Ende Mai war es noch kühl, aber besonders hier roch die feuchte Erde so angenehm nach Sommer, dass man ganz vergaß, wie die Ilmenau in dieser Jahreszeit stinken konnte.
Susanne überlegte, ob sie allmählich umkehren sollten, als sie hörten, dass am Wasser etwas Ungewöhnliches vor sich ging.
Regine stieg die Böschung hinunter, und Susanne folgte ihr gewissenhaft. Unten hatten sich Menschen versammelt, die aufgeregt miteinander redeten, einige standen bis zu den Knien im Wasser auf der kleinen Sandbank, wo sonst Frauen die Wäsche ausspülten. Einen Büttel erkannte Susanne, ein paar Kinder und Wäscherinnen. Noch verdeckten sie Susanne und Regine die Sicht auf den Grund ihrer Aufregung, aber verstehen konnte man sie schon.
»Sie hat einen Stein um den Hals, der Herrgott sei ihr gnädig.«
»Ja, der Herrgott sei’s, der Pastor wird es nicht sein.«
»Wer ist es denn?«
»Eine aus den Schiffergassen.«
Susanne blieb stehen, als sie begriff. Unweigerlich wurde ihr Blick vom fließenden Wasser angezogen. Weiß trieb ein Laken im Fluss, das eine Wäscherin vor Schreck hatte fallen lassen. Es bewegte sich in der Strömung, als wäre es etwas Lebendiges. So hatte sich der Unterrock ihrer Schwester bewegt, als sie damals leblos im Wasser des Hafens trieb. Weiß, weiß wie die offen flatternden Bänder der Haube, die Regine jetzt trug, als sie die Tote betrachtete, die auf der Sandbank lag.
Susanne beobachtete ihre Schwester ängstlich. Mit großen Augen sah Regine hinunter, staunend wie die Unschuld selbst, dann blickte sie wieder aufs Wasser. Weiß glänzte das spiegelnde Sonnenlicht auf den kleinen Wellen des Flusses und lenkte ihren Blick von der Leiche ab, die sie im selben Moment zu vergessen schien. Sie lächelte verträumt.
Woran dachte ihre Schwester bloß? Susanne hatte so oft versucht, sie zum Sprechen zu bringen, aber Regines Gedanken blieben meistens eingesperrt. »Regine? Komm, wir wollen nach Hause.«
Regine schüttelte den Kopf, lächelte lieb und ging einen Schritt näher an die Menschen heran, die sich die Tote ansahen. Einen Moment schaute sie noch, dann drehte sie sich zu Susanne um. »Sah ich so aus?«
Susanne zwang sich, einen Blick auf die ertrunkene Frau zu werfen, die schmutzig und aufgedunsen war. »Nein. Du sahst anders aus. Weiß und rein, wie ein Engel. Komm, Regine. Vater wartet.« Sie streckte ihr die Hand hin.
Regine lächelte nur. »Weiß wie die Gänse. Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh?« Sie fing leise an zu singen, und Susanne fühlte die altbekannte Scham. Energisch griff sie nun die Hand ihrer Schwester und zog sie mit sich. »Gine, da ist ein Mensch gestorben. Man singt kein Kinderlied, wo ein Mensch gestorben ist.«
»Sie wacht nicht wieder auf?«, fragte Regine.
»Nein«, sagte Susanne und fühlte sich alt und müde. »Das weißt du doch. Nur du bist wieder aufgewacht.«
»Warum ist sie ins Wasser gefallen?«
Susanne half Regine die kleine Steigung der Uferböschung hinauf. »Das weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen?«
»Weiß, weiß nicht, weiß«, sang Regine und lachte ein kleines kindliches Lachen. »Suse, liebe Suse …«
Das Haus der Büttners lag im Marktviertel, jedoch nicht weit entfernt vom Sülzviertel und der Saline, denn Salztonnen waren über Jahrhunderte das Hauptgeschäft der Fassmacher gewesen.
An der Vorderfront von Susannes Elternhaus wuchsen Wein, violette Waldreben und rote Kletterrosen, so wie an den Nachbarhäusern. Die Eingangstür war ein Kunstwerk der Holzschnitzerei, dessen filigran durchbrochene Muster Susanne und ihre Geschwister von klein auf fasziniert hatten. Alle Büttnerkinder wussten, wie es sich anfühlte, mit den Fingerchen die Schnitzereien nachzufahren. Benutzen taten sie die Tür selten, fast immer bogen sie in die Durchfahrt seitlich vom Haus ein und liefen zur Hintertür, wo nicht gleich jemand fragte, ob sie saubere Füße hatten.
Außerdem gab es im Hinterhof die Werkstatt. Als Kind hatte es zumindest Susanne eher dorthin gezogen als in die Küche, wo die Mutter jederzeit Arbeit zu verteilen hatte.
Auch als sie nun mit Regine von ihrem etwas unglücklichen Ausflug heimkam, hätte sie gern bei ihrem Vater und ihren Brüdern hereingeschaut. Doch zuvor wollte sie die erschöpfte Regine ins Haus bringen.
Auf dem Tisch neben der Hintertür stand ein Reisigkorb mit trockenen Saaterbsen, und unter der Bank scharrten die Hühner. Jemand musste eben noch hier in der Sonne gesessen und Erbsen verlesen haben.
Regine blieb stehen und sah träumend den Hühnern zu. So konnte sie stundenlang stehen. Susanne seufzte – wenn sie ihre Schwester allein draußen ließ, konnte es geschehen, dass sie davonlief. Oder es kam ihr in den Sinn, auch die guten Saaterbsen an die Hühner zu verfüttern. Sanft fasste sie ihre Schwester am Arm. »Regine, komm, Lene und die Muhme brauchen gewiss Hilfe.«
Die alte Muhme, die in ihrer Küche arbeitete, seit Susanne denken konnte, war dabei, Schmalzbrote zu schmieren. Ihre Base Lene goss Dünnbier durch ein Seihtuch in den Krug. Es würde bald Mittagessen geben.
Auf der Tischkante saß ihr jüngstes Geschwisterkind, Liebhild, und biss bereits in eine Stulle. Sie war sieben Jahre alt, nicht mehr klein also, aber weil sie das jüngste Kind der Büttners bleiben würde, durfte sie vieles, was den Älteren verboten worden wäre. Das war auch zu Lebzeiten ihrer Mutter nicht anders gewesen.
Liebhild blickte auf, als sie hereinkamen, und ihre Augen leuchteten. »Da seid ihr! War es schön?«
Regine ließ es sich gefallen, dass Susanne ihr aus dem Umhang half, und lächelte ihre kleine Schwester an. »Ja. Schön war es. Wir waren am Wasser.«
Schön war es. Susanne sah wieder die tote Frau vor sich. Regine hatte sie schon vergessen, und weil Klein-Liebchen von dem scheußlichen Erlebnis auch nicht brühwarm hören sollte, beschloss sie, es Lene erst später zu erzählen. Die Muhme war ohnehin taub.
Liebevoll sah sie von Liebhilds Gesicht zu Regines. Die beiden sahen ihrer Mutter ähnlich, mit ihren feinen Zügen und den hellen Haaren. Auch Liebhild würde groß und schlank werden, eine jüngere Ausgabe der Mutter, so wie Regine.
Ganz anders als sie selbst. Susanne nahm an, dass sie mit ihren siebzehn Jahren ausgewachsen war und daher immer einen halben Kopf kleiner bleiben würde als Regine. So schön wie ihre Schwester würde sie ebenfalls nie werden. Ihr eigenes Gesicht war rund, die Stupsnase sah nicht edel, sondern frech aus, und ihre staubig-blonden Haare waren unscheinbar.
Sie war die einzige gewöhnliche Person in ihrer Familie, fand sie. Alle sonst waren aus dem einen oder anderen Grund etwas Besonderes.
Sie sah zu, wie Regine sich auf die Küchenbank setzte, ein Schmiermesser zur Hand nahm und angestrengt beobachtete, was die Muhme tat. Ihre Schwester musste viele einfache Tätigkeiten immer wieder neu lernen. Man wusste nie, woran sie sich von einem Tag zum anderen erinnerte.
Mit einem stummen Seufzer trat Susanne an den Küchentisch und schlug dort das Bündel auseinander, das sie getragen hatte. »Das Messer und die Schere, Lene. Ich glaube, der Schleifer hat es gut gemacht. Ich bringe noch die Klinge in die Werkstatt.« Rasch hob sie die Hand, schob Liebhilds lose Haarsträhnen unter ihre kleine Haube und rettete sie damit vor dem Schmalz ihres Brotes. Dann nahm sie die Abziehklinge auf und ging zur Tür. Gedankenverloren wog sie den Geldbeutel in der freien Hand, der neben Messer und Truhenschlüsseln an ihrem Gürtel hing. Am Abend musste sie ihren Vater um neues Haushaltsgeld bitten.
Liebhild sprang vom Tisch und kam ihr zur Tür nachgelaufen. »Suse, wann machst du mir die neuen Puppenhaare?«
»Nachher, wenn es nichts anderes mehr zu tun gibt.«
»Ach, pööh. Du hast immer noch etwas anderes zu tun.«
Susanne lachte. »Da hast du recht, Liebchen. Deshalb hilfst du jetzt und stellst uns Becher auf den Tisch. Und den Käse.«
»Ach, pööh«, meinte Liebhild, aber sie war folgsam.
Als Susanne in die Böttcherwerkstatt kam, fingen die Männer gerade mit dem Aufräumen an. Ihr Vater und der Geselle Thomas stapelten fertige Salztonnen, ihr ältester Bruder Martin legte Dauben, Boden und Setzringe für eine große Bütte bereit. Till, der ein Jahr älter war als sie, ihr aber immer wie der Jüngere vorkam, fegte Späne zusammen, die beim Behauen der Fassdauben abgefallen waren. Es roch würzig nach Buchenholz.
Früher hatte sie sich oft gewünscht, ein Junge zu sein. Sie hätte es großartig gefunden, ein Handwerk zu lernen. Was wäre sie stolz gewesen, so gute Fässer bauen zu können wie Martin! Er beherrschte sein Handwerk im Schlaf, obwohl es kein einfaches war. Eine falsch geformte Daube konnte ein undichtes Fass ausmachen und den Ruf bei den Kunden verderben.
Ihr Vater sah sie und lächelte. Sein Gesicht war so rund wie ihres, sein Bauch noch viel runder. Nun, zumindest wusste sie, wem sie ähnelte. Unwillkürlich erwiderte sie sein Lächeln. »Die Klinge, Vater.«
»Seid ihr also wieder zurück. War es schön am Wasser?«
Susanne legte die Abziehklinge zum Werkzeug und winkte ab. »Ach, hör mir auf! Sie hatten gerade eine tote Frau aus dem Fluss geholt, sie lag noch da. Regine hat es zum Glück schon wieder vergessen.«
Till hörte mit dem Fegen auf. »Eine Tote, wirklich? Wie sah sie aus?«
»Till! Lass sie in Ruh’, du Galgenpilger. Du siehst doch, dass sie sich gruselt.« Martin war fertig mit seinen Vorbereitungen für die Nachmittagsarbeit und klopfte sich den Kittel ab.
Susanne fand es nett, dass Martin sie schützen wollte, glaubte aber, dass er ebenso für sich selbst sprach, denn er ekelte sich leicht.
»Eine aus den Schiffergassen soll es sein. Ich glaube, sie hat sich umgebracht«, sagte sie.
»Gott sei ihr gnädig«, sagte Ulrich Büttner. »Da hat sie sich eine Sünde aufgeladen. Nicht schön, dass ihr das sehen musstet, Kind.«
Till zuckte mit den Schultern. »Na, wenn ihr alle meint, dass das tote Elend so viel schlimmer anzusehen ist als das lebende! Ich habe schon Schifferweiber gesehen, für die das unmöglich stimmen kann. Ehe ich die tagtäglich sehen müsste, würde ich lieber …«
»Till!« Martin drohte spielerisch mit der Faust.
»Mir tut sie leid«, sagte Susanne. »Bevor eine so weit geht, dass sie sich das Leben nimmt, da muss sie doch viel Kummer gehabt haben.«
Ihr Vater war herangekommen und tätschelte ihr den Rücken. »Recht hast du, mein Mädchen. Kummer gibt es bei den Armen heuer reichlich, und manchem mag das den Lebensmut nehmen. Aber eine Sünde bleibt es doch. Ein einziges Leben bekommt jeder – mehr nicht. Das wirft man nicht weg.«
Susanne nickte nachdenklich. Niemand, der ihren tatkräftigen und geschäftstüchtigen Vater kannte, hätte sich vorstellen können, dass er jemals auf den Gedanken käme, sich das Leben zu nehmen. Andererseits war es ihm und seiner Familie auch in Lüneburgs schlimmsten Notzeiten nie so schlecht gegangen, dass er keinen Ausweg mehr gewusst hätte. Er hatte die Fassmacherei erfolgreich durch jede Flaute und jede Abgabenerhöhung gesteuert, den ganzen langen Krieg hindurch.
Martin hob die Arme, streckte und dehnte die Muskeln, die seit dem Morgengrauen tätig waren. »Kummer gibt es heuer nicht nur bei den Ärmsten – wo der Salzhandel so am Boden liegt. Bei den Sülfmeistern und Pfannenpächtern geht es nur noch darum, ob man Pfannen stilllegen sollte oder nicht. Die Siedemannschaften sind dann als Nächste ohne Lohn und Brot. Von uns ganz zu schweigen.«
Sein Vater schnaubte verächtlich. »Nun fang du nicht mit dem Unken an, nur weil du mal mit ein paar Sülfmeistersöhnen ein Bier getrunken hast. So reden sie seit Jahren, und am Ende sieden sie doch. Ich habe gehört, dass dieser von Cölln, den sie jetzt als Unterhändler haben, ein gerissener Kerl ist. Der wird ihr Salz schon verkaufen. Gerade diese Woche will Herr Lossius mit seinem Sohn kommen und über neue Aufträge reden.«
Till lachte. »Oh, was für ein Glanz in unserer bescheidenen Hütte! Der ehrwürdige Ratsherr mit dem verrufenen Sohn. Wisst ihr, dass die Leute schon nicht mehr mitzählen, wie oft die Wachen Lenhardt Lossius im Dunkeln auf der Straße erwischt haben? Und jedes Mal auf einer anderen.«
Der Geselle Thomas, der beinahe so alt war wie Susannes Vater, stimmte in Tills anzügliches Gelächter ein. Ihr Vater dagegen strafte seinen Sohn mit einem finsteren Blick. »Das kann in den besten Familien vorkommen, dass ein Sohn aus der Reihe tanzt. Was meinst du, was die Leute wohl über dich reden?«
Till zuckte frohgemut mit den Schultern. »In meinem Fall dient es dem guten Zweck. Das Volk will unterhalten sein.«
Martin gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. »Ein Dwarsbüddel bist du. Und was Lenhardt Lossius betrifft: So schlimm, wie das Gehechel ihn macht, ist er nicht.«
Till tanzte zwischen Werkbänken und Holz eine Umdrehung mit dem Besen und stellte ihn dann an der Wand ab. »Jawohl ist er so schlimm. Und warum nicht? Ist er doch der schönste Jüngling der Stadt, wenn man den Worten der Lüneburger Gänse trauen darf.«
»Neidischer Ganter«, meinte Martin.
»Nee, nee.« Till schüttelte sich und verzog das Gesicht. »Mit Gänsen habe ich nichts im Sinn.«
Ihr Vater zog finster die Brauen zusammen und erhob den Zeigefinger. »Das will ich hoffen. Höre ich auch noch, dass du tändelst, dann kannst du was erleben!«
Es wirkte ein wenig lächerlich, wenn ihr Vater drohte, weil seine Söhne ihm längst über den Kopf gewachsen waren. Tatsächlich war er ein langmütiger Mensch, der mehr Widerspruch von seinen Kindern duldete als manch anderer Vater. Doch zu weit durfte man auch ihn nicht treiben. Susanne kannte seine Grenzen gut, Till überschritt sie regelmäßig.
Die Glocke von St. Johannis schlug Mittag und beendete ihr Gespräch zur rechten Zeit. »Ihr könnt essen kommen«, sagte Susanne.
Das brachte das Lächeln zurück auf das Gesicht ihres Vaters. »Gut. Denn wollen wir mal Hände waschen, Jungs. Nach dem Essen muss jemand zur Schmiede gehen und Fassbänder bestellen.«
Beinah wäre Susanne ein »Darf ich mit?« herausgerutscht. Sie sah zu Boden, ihre Wangen wurden heiß. In diesem Fall durfte sie nicht zu viel Eifer zeigen. Es gab genug Arbeit im Haus für sie, und ihre Abwechslung für diesen Tag hatte sie schon genossen. Sie hätte sie jederzeit für einen Besuch in der Schmiede eingetauscht. Um das Schmiedehandwerk ging es ihr dabei allerdings nicht, und den wahren Grund sollte lieber niemand erraten.
»Ich nicht. Ich will gleich mit der Mostbütte anfangen«, wehrte Martin ab.
»Muss also Till gehen«, sagte ihr Vater widerwillig.
»Till geht gern«, sagte Till und grinste.
»Und vergisst das Wiederkommen«, knurrte Ulrich Büttner.
»Schick Suse mit. Die passt auf ihn auf«, schlug Martin vor.
In der Schmiede war es neben der Esse besonders an warmen Tagen vor Gluthitze kaum auszuhalten. Jan Niehus hockte draußen im Schatten der Hofmauer, um kurz auszuruhen. Die grau-weiße Katze der Hausherrin ließ sich wonnevoll von ihm kraulen, machte einen Buckel und warf sich vor Begeisterung gegen seine Beine.
Von drinnen gellten die gleichmäßigen, metallischen Schläge von zwei Schmiedehämmern. Sie arbeiteten an einer Reihe von Truhenbeschlägen. Meister Schmitt und der Geselle Rudolf machten gerade die Grobarbeit, Lehrling Albert hütete das Feuer in der Esse und bediente den großen Blasebalg. Der Meister würde Jan rufen, wenn es an die Feinarbeit ging, denn dafür hatte er eine bessere Hand als Rudolf, und die Beschläge sollten schön werden. Sie waren für Hochzeitstruhen bestimmt.
Bald würde auch Albert so weit sein, dass er seine Gesellenprüfung machen und die anspruchsvollen Arbeiten tun konnte. Das Feuer zu bewachen oder Eisen und Wasser zu schleppen, genügte ihm schon lange nicht mehr. Meister Schmitt würde vielleicht einen neuen Lehrling aufnehmen und dann überlegen müssen, ob er einen von ihnen fortschickte. Denn die Aufträge wurden nicht mehr, der Stadt ging es nicht gut. Und die ganze Grapengießerstraße hallte von den Schlägen emsiger Metallarbeiter, die gossen und schmiedeten, was das Zeug hielt, damit sie die ersten und besten im Wetteifern um die Kunden waren.
Wenn nichts geschah, was Albert beim Meister in Misskredit brachte, hatte Jan schlechte Karten. Denn gleichgültig, wie hohe Stücke Schmitt auf seine Arbeit hielt, Albert war für sein Alter ebenfalls gut. Außerdem war er der Sohn eines verstorbenen Lüneburger Hufschmieds. In Alberts Lebenslauf gab es keine Schatten, er konnte vielleicht sogar eines Tages selbst Meister werden und die Schmiede übernehmen, wenn Schmitt kinderlos blieb. Er würde einen geachteten Bürger der Stadt abgeben.
Jan konnte davon nur träumen. Selbst wenn er härter dafür arbeitete und sich noch tadelloser verhielt als Albert, würde er dieses Ziel nicht erreichen. Er würde immer der Fremde mit der anrüchigen Vergangenheit bleiben, dem man keine ehrenvollen Titel antrug.
Warum konnte Albert nicht wenigstens ein bisschen schlicht im Kopf sein, so wie Rudolf?
Jan wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Kundschaft den Hof betrat. Er stand auf, rollte seine Hemdsärmel über die Oberarme herunter und zog den Ausschnitt zurecht.
Es waren zwei von den jungen Büttners, die da auf ihn zu spazierten. Auch sie würden keine Schwierigkeiten haben, zu geachteten Bürgern der Stadt zu werden, obwohl ihre alteingesessene Familie anders war als andere. Von Fassmacher Büttners Geschäftstüchtigkeit und Ehrgefühl sprach man mit Respekt, auch wenn im gleichen Atemzug auf seine merkwürdige älteste Tochter angespielt wurde. Drei Tage lang sei sie tot gewesen, dann wieder erwacht. Manche nannten das ein Wunder, andere nannten es Hexerei, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand. Alle sagten aber, es wäre ein Jammer, dass es nun schwachsinnig wäre, das schöne Kind.
Jan fand sie auch schön, aber er zog ihre Schwester vor, die ihm nun gleich gegenüberstehen würde. Susanne sagte nie viel zu ihm, wenn sie in die Schmiede mitkam, aber mit dem Meister, Albert oder Rudolf wechselte sie gelegentlich ein paar Worte. Deshalb wusste er, dass sie nicht unnahbar war. Es lag an ihm, dass sie sich nicht unterhielten. Was hatte es für einen Sinn, Gespräche mit ihr zu führen, wenn er ihr doch nicht näherkommen durfte?
»Sei gegrüßt, Jan Niehus, Meister der Eisenschnörkel«, begrüßte Till Büttner ihn.
»Sei gegrüßt, Meister des Werkstattbesens. Hast du einen Auftrag, oder kommst du nur, um Spaß mit mir zu haben?«
»Kann man Spaß mit einem haben, der einen Zwölfpfundhammer zum Nüsseknacken benutzt?«
»Unsere Hausherrin nimmt einen zum Teigrühren.«
Sie lachten beide, erst dann nickte Jan Susanne zu. Flüchtig sah sie ihm in die Augen und gleich wieder zu Boden. Sie hatte nicht mitgelacht, lächelte aber. Es war ihrem Gesicht anzusehen, wie gern sie sonst lachte. Fast tat Jan ihr Anblick weh, sie gefiel ihm wirklich. Weiche Rundungen hatte sie, und sie bewegte sich so frei, als könnte sie jeden Moment loslaufen. Manche Mädchen gingen immer verkrampft einher.
Er hätte gern gewusst, welche Farbe ihre Augen genau hatten, aber sie sah ihn nie so lange an, dass er es hätte erkennen können. Und natürlich starrte er sie ebenfalls nicht an. Es führte zu nichts. Vielleicht würde er sich nie erlauben können, überhaupt einem Mädchen den Hof zu machen, und ganz sicher nicht ihr. Er würde für immer Geselle bleiben, und Schmiedegesellen durften in dieser Stadt nicht heiraten.
»Braucht euer Vater nur Fassbänder? Dann kannst du es auch mir sagen«, wandte er sich an ihren Bruder.
»Er will noch einen neuen Spundlochfasslöffel, den sollst du ihm machen«, sagte Till.
Nun lachte Susanne. »Was redest du denn da, du alter Fopphansel? Spundlochfasslöffel!«
Jan grinste. »Warte, ich fasslöffle ihm gleich eins.«
Die Hammerschläge in der Schmiede verstummten, und Meister Schmitt erschien im Tor. »Tach, die Herrschaften. Jan, du kannst jetzt weitermachen, wir sind soweit. Lass aber das Katzenvieh draußen. Das unvernünftige Biest fängt sonst eines Tages noch mal Feuer.«
Minka saß vor Jans Füßen und sah zu ihm hoch. Manchmal glaubte er, dass sie verstand, was Menschen sprachen. »Du bleibst draußen«, befahl er ihr.
»Spar dir die Worte. Wo die Liebe hinfällt, da wächst keine Vernunft«, prustete Till und griff sich die Katze.
Sobald Jan sich abgewendet hatte, drückte Till die Katze, ohne zu fragen, Susanne in die Arme und ging zu Meister Schmitt hinüber.
Das Tier war nicht erfreut darüber, herumgereicht zu werden, und sträubte sich. Susanne hatte Mühe, es festzuhalten, aber immerhin gab ihr das etwas zu tun. Andernfalls hätte sie Jan Niehus nachgegafft, während er zur Hofmauer zurückging, um seine Lederschürze zu holen. Er war ein schöner Mann. Kleiner als ihre Brüder, aber stark. Dunkle Haare, dunkle Augen und ein nachdenkliches, ernstes Gesicht. Er hatte Witz und konnte lachen, auch wenn er nie unbeschwert wirkte.
Wie immer, wenn sie ihn sah, fühlte sie eine seltsame Mischung aus Glück und Furcht. Er konnte nicht viel älter sein als Till, und er benahm sich kaum anders als ihre Brüder, trotzdem schüchterte er sie ein. Sie kannte keinen anderen Menschen, dem gegenüber sie sich so unsicher und unscheinbar fühlte. So musste er sie sehen, denn er hielt es selten für nötig, ein Wort an sie zu richten. Meistens bemerkte er sie kaum.
Die Katze war zu dem Schluss gekommen, dass es auf Susannes Arm doch recht angenehm war, und hielt still. Jan war in die Schmiede gegangen, aus der wieder Hammerschläge zu hören waren, heller und schneller nun als vorher. Till sprach mit Schmitt und brachte ihn zum Lachen.
Susanne wollte sich gerade ein Plätzchen suchen, von dem aus sie besser in die Schmiede spähen konnte, ohne dabei zu sehr aufzufallen, da kam ein Junge auf den Hof. Seinem derben graublauen Kittel und der Kappe nach gehörte er zu den Lastenträgern am Hafen.
»Tach«, sagte er zu ihr. »Ist der Albert to Huus? Ich soll ihn was fragen.«
Sie wüsste es nicht, wollte Susanne sagen, da rief Schmitt schon herüber: »Wat is denn?«
»De Albert. Isser da?«
»Jau.«
Kurz darauf kam der siebzehnjährige Albert aus der Schmiede. Er war stämmiger und plumper gebaut als Jan und hatte einen runden Schädel mit kurz geschorenen blonden Haaren. Verlegen begrüßte er Susanne, bevor er die Hände in die Seiten stemmte und sich unwirsch dem Jungen zuwandte. »Wat is?«
Susanne sah der Miene des Jungen an, dass er Albert auch nicht lieber mochte als umgekehrt. »Wegen der Toten, die sie heut Morgen rausgefischt ham«, sagte er mit gehässigem Unterton. »Dat war die Marianne, wo deine Stiefmutter war. Und die Büttel und alle wolln nu wissen, wo wohl ihr Kerl ist, der Wenzel. Und die Kinner. Ob du’s wüsstest.«
Susanne drückte versehentlich die Katze so fest, dass sie entrüstet aus ihrem Arm sprang und floh.
Noch stärker war die Wirkung der Nachricht auf Albert. Er ließ fassungslos die Arme fallen und starrte den Jungen an, als hätte er nicht verstanden.
»Wat nu? Ja oder Nein?«, fragte der Unglücksbote.
Susanne wollte ihn anfahren, weil er sich so gefühllos benahm, bremste sich aber. Stattdessen holte sie Luft, um Albert ein paar tröstende Worte zu sagen.
Doch da sprach Albert selbst. »Lieber Gott. Was habe ich getan?«
»Du bist blass um die Nase. Hat es dich so mitgenommen, von Alberts Stiefmutter zu hören?«, fragte Till Susanne auf dem Heimweg.
»Ihre Leiche war kein schöner Anblick. Der arme Albert«, sagte sie, obwohl das nicht der Grund für ihre Erschütterung war. Was habe ich getan? Was hatte Albert damit gemeint? Er hatte ohne ein weiteres Wort mit dem Jungen den Schmiedehof verlassen. Vielleicht hatte sie sich verhört, hatte sie gedacht, und den anderen Männern bloß von der schlimmen Nachricht erzählt, die Albert erhalten hatte.
»Ich glaube, er hing nicht an ihr. Nachdem sie wieder geheiratet hatte, war Albert nicht mehr oft bei ihr. Konnte den Kerl nicht leiden, sagte er mal. Mehr weiß ich nicht. Ich unterhalte mich lieber mit Jan Niehus, der macht mir mehr Spaß. Was hast du eigentlich gegen den?«
Susanne sah ihren Bruder überrascht von der Seite an. »Gar nichts. Wie kommst du darauf?«
»Gegen andere bist du nicht so wortkarg.«
Zu Susannes Glück erwartete Till keine weitere Erklärung von ihr, denn seine Aufmerksamkeit wurde bereits auf etwas anderes gelenkt. Sie hatten den Weg durch das Viertel eingeschlagen, in dem seit vielen Jahren nach und nach der Untergrund absackte. Die Häuser, die an den ungünstigsten Stellen standen, veränderten sich zunehmend und wurden immer schiefer, was sie beide gern beobachteten. Einige Gebäude hatten von der Vorderseite zur Rückseite ein Gefälle bekommen. Legte man dort eine Murmel auf den Boden, rollte sie vom einen Ende des Flurs bis zum anderen.
Viele dieser Häuser standen bereits leer, weil es den Leuten über geworden war, mit den schiefen, brüchigen Wänden und Böden zu leben, oder weil der Rat beschlossen hatte, sie zu räumen.
Gerade eben schien es sich wieder um eine solche Räumung zu handeln. Vor einer der schmalen, niedrigen Türen stand ein Karren, der mit einem bescheidenen Hausstand beladen war. Drei Kinder mit bedrückten Mienen hielten sich an seinen Holzsprossen fest, als würden sie fürchten, andernfalls zurückgelassen zu werden. Neben ihnen hatte sich ein Büttel mit einer Hellebarde in der Hand postiert. Sein rotes Wams leuchtete vor den unscheinbaren Farben der Fuhre.
Aus dem Haus drang eine schluchzende Frauenstimme auf die Gasse. »Vier Generationen!«, jammerte sie immer wieder.
Ein Mann murmelte beruhigende Worte. »Es ist nur ein Haus. Nur ein Haus«, hörten sie ihn sagen, als das Paar aus der Tür trat. Hinter ihnen verschloss ein zweiter Büttel in rotem Wams die Tür und nagelte einen Zettel daran. Die gleichen Bekanntmachungen hingen bereits an den Türen zur Rechten und Linken des Hauses.
Sicher würde bald die ganze Straßenseite leerstehen, und dann würde der Rat die Häuser abtragen lassen. Susanne dachte an die Risse, die das Haus ihrer eigenen Familie aufwies. Glücklicherweise schien sich der Untergrund in ihrer Straße beruhigt zu haben.
Till und sie grüßten die Leute im Vorübergehen, doch die waren ganz mit ihren Sorgen beschäftigt und nickten kaum zurück.
»Ich habe mir die leeren Häuser alle schon von innen angesehen«, sagte Till leise. »Es gibt da noch eine Menge gutes Holz. Was meinst du, wer am Ende den Gewinn davontragen wird? Wohl nicht die Besitzer.«
»Es ist verboten, hineinzugehen, Till«, sagte sie. Dabei hatte sie längst vermutet, dass ihr Bruder in den Häusern gewesen war. In der Regel setzte Till die verbotenen Wünsche in die Tat um, von denen auch sie sich verlockt fühlte.
»Ich weiß nicht, was daran gefährlich sein soll. Die Häuser werden nicht plötzlich einstürzen.«
»Warum nicht? Außerdem genügt es ja, wenn dir Steine auf den Kopf fallen. Denk doch an die Marienkirche. Wie oft sind da schon Steine losgebrochen.«
Till lachte. »Ach, Suse! Das ist doch etwas anderes als diese Häuschen. Da fällt dir eher Mäusedreck auf den Kopf. Früher, als du klein warst, wärest du als erste drin gewesen.«
Darauf erwiderte sie nichts. Till wäre nicht weniger unangenehm berührt gewesen als der Rest ihrer Familie, wenn sie sich je so ungezwungen verhalten hätte wie als Kind. Er zog sie auf und wusste doch genau, dass sie als junge Frau anderen Regeln zu gehorchen hatte als ein Kind oder als er selbst.
Zwei Tage nach dem Besuch in der Schmiede ging Martin Büttner, um die bestellten Fassreifen abzuholen, kehrte jedoch mit einem leeren Handwagen zurück. Statt der Reifen brachte er schlimme Nachrichten mit. Man hatte einen weiteren Toten gefunden, und daraufhin war Albert verhaftet und eingesperrt worden.
Der Leichenfund war gerade für die Fassmacher besonders pikant. Obwohl das traditionelle Fest der Kopefahrt seit langer Zeit nicht mehr gefeiert wurde, hatten die Böttcher vor einigen Jahren aus einer Schnapslaune heraus ein riesiges Kopefass gebaut. Damals, zu Kopefahrt-Tagen, wären schwere Pferde vor das mit Steinen gefüllte Fass gespannt worden. Inmitten bunter Feierlichkeiten hätten die Söhne der Sülfmeister es dann triumphal und laut polternd im Galopp durch die Stadt geführt. Doch die jungen Sülfmeister-Anwärter hatten es nicht mehr nötig, sich auf diese Art als würdig zu beweisen. Daher feierten die Böttcher nur ein letztes Mal mit einem Kopefass unter sich ihre Handwerkskunst. Anschließend verkauften sie das Fass an Henrich Visculen, der seinen Hof im Wasserviertel an der Ilmenau hatte und das Riesending ebenso aus Tollerei erwarb, wie es aus Tollerei gebaut worden war.
Das Fass hatte langsam verrottend und wenig beachtet in einem Innenhof der Visculschen Salzspeicher gestanden, bis am Vortag jemand auf den Gestank aufmerksam geworden war, der davon ausging. Die letzten beiden Bretter des bereits zerstörten Deckels wurden herausgebrochen, und man fand in modrigem Regenwasser die Leiche von Wenzel Främcke, dem Mann der toten Marianne. Seit ungefähr Bittsonntag hätte er schon darin gelegen, hatte der Bader und Leichenbeschauer gemeint. Außerdem sei er durch Schläge auf den Kopf zu Tode gekommen.
Obwohl es keine handfesten Hinweise darauf gab, dass Albert mit dem Tod des Mannes zu tun hatte, wurde er nun des Mordes in zwei Fällen beschuldigt. Im Fall seiner Stiefmutter Marianne gründete der Verdacht darauf, dass er am Abend ihres Todes mit ihr gesehen worden war. Er hatte sich auf der Gasse vor ihrer Bude heftig mit ihr gestritten.
Die Büttners waren noch fassungslos, als sie nach dem Abendessen am Küchentisch zusammensaßen. Keiner von ihnen konnte glauben, dass Albert solcher Taten fähig war.
Nur Susanne zweifelte. Was habe ich getan?, hörte sie ihn sagen.
Sie begradigte den schief geschnittenen Brotlaib mit dem Messer und nutzte den dabei abfallenden Brotfetzen, um die Soße von ihrem Zinnteller zu wischen. »Hat man denn die Kinder inzwischen gefunden?«
Martin schüttelte den Kopf. »Die Büttel haben nach ihnen herumgefragt, aber niemand weiß etwas.«
»Zeig mir den Schiffer, der etwas weiß, wenn ein Büttel fragt«, spottete Till.
»Sind die Kinder auch tot?«, fragte Liebhild und brachte damit ihre Familie dazu, erschrocken zu schweigen. Niemand hatte bemerkt, dass ihr Nesthäkchen überhaupt da war, sie hatte an der Wand auf dem Boden gesessen und mit ihrer noch immer haarlosen Puppe gespielt. Jetzt sah sie gespannt zu den Erwachsenen auf.
Ihr Vater fing sich als erster. »Ach was. Sie werden bei Freunden untergekommen sein.«
»Also, ich weiß nicht«, sagte Susanne. »Müsste man da nicht helfen? Diese Leute sind alle so arm.«
»Sie wollen offenbar keine Hilfe«, sagte Martin. »Sonst würden sie ja darum bitten.«
Susanne sah ihn verwundert an. Er schien zu meinen, was er sagte, und teilte damit die Ansicht der meisten bessergestellten Bürger. Dabei würde es gerade ihm sicher besonders schwerfallen, um Hilfe zu betteln, wenn er in eine schwierige Lage geriete. »Vielleicht sollte jemand ins Wasserviertel gehen und nach den Kindern fragen, der kein Büttel ist und nichts mit dem Rat zu tun hat«, sagte sie.
»Komm nicht auf dumme Gedanken«, sagte ihr Vater. »Das ist kein Pflaster für eine ehrbare junge Frau. Es wird sich schon einer um die Kinder kümmern.«
»Ich wüsste gern, warum Albert den Wenzel erschlagen haben soll.« Auch Till beschäftigte sich mit seinem Brot. Er legte auf dem Tisch eine Spur aus Krumen.
Susanne goss der träumenden Regine Wasser in ihren Tonbecher und sprach Liebhild an. »Liebchen, geh schon nach oben und wasch dir dein Gesicht.«
Liebhild stand auf und zog eine Schnute. »Muss ich allein?«
Wie gewöhnlich erhob Susanne sich und nahm sie an die Hand. Während sie mit ihr über die Wendeltreppe auf der Diele nach oben ging, dachte sie über Gründe nach, aus denen Albert den neuen Ehemann seiner Stiefmutter erschlagen haben konnte. Alles, was ihr einfiel, kam ihr unsinnig vor.
Die Bewohner der Schmittschen Schmiede waren erschüttert über das, was Albert zugestoßen war. Auch wenn sie erwarteten, dass seine Unschuld sich erweisen würde, blieben eine Verhaftung und ein Aufenthalt im Turm grausige Erlebnisse.
Doch bei aller Erschütterung mussten Aufträge erledigt werden. Es wurde länger gearbeitet, um für die fehlenden Hände auszugleichen. Deshalb war es bereits Abend, als Jan die Eisenbänder, aus denen später Fassreifen gebogen wurden, zur Böttcherei brachte. Gewöhnlich hätte Albert die Ware ausgeliefert. Jan konnte auf dem Weg nicht aufhören, an ihn zu denken.
Kurz bevor die Büttel ihn abholten, hatte Albert ihm gestanden, dass er sich schuldig am Tod seiner Stiefmutter fühlte. Er hatte geahnt, dass man ihn auch mit dem Mord an Wenzel in Verbindung bringen würde. Es war in den Schiffergassen kein Geheimnis, dass es jedes Mal lautstark Streit gegeben hatte, wenn Albert die Familie besuchte. Er erklärte Jan nicht, worum es in diesen Auseinandersetzungen gegangen war. Ohnehin war es ihm schwergefallen, über die Angelegenheit zu sprechen. Er hätte es vielleicht gar nicht getan und sich einfach verhaften lassen, doch er hatte ein Anliegen gehabt.
Zum einen konnte er es nicht ertragen, dass die Männer in der Schmiede dachten, er hätte einen Menschen erschlagen. Zum anderen war er außer sich vor Sorge um die beiden verschwundenen Kinder. Minna und der kleine Paul waren seine Halbgeschwister. Um ihretwillen hatte er seine Stiefmutter immer wieder unterstützt, wenn sie ihn darum gebeten hatte. Nachdem er von ihrem Tod gehört hatte, war er ohne Zögern ins Wasserviertel gegangen, um sie zu suchen, doch ohne Erfolg. »Wenn sie in guten Händen wären, Jan«, sagte er, »dann hätte ich sie gefunden. Ich weiß, dass es eine große Bitte ist, aber wenn sie mich einsperren … Wirst du die beiden für mich suchen?«
»Der Rat wird sich doch darum kümmern. Außerdem wüsste ich nicht, wo ich sie noch suchen sollte«, entgegnete Jan. Doch Albert wiederholte seine Bitte so eindringlich, dass Jan ihm schließlich versprach, die Augen offen zu halten und sich darum zu bemühen, dass die Kinder nicht vergessen wurden.
Er versuchte noch, aus Albert mehr darüber herauszubekommen, warum er sich für Mariannes Tod verantwortlich fühlte und ob er sie gar tatsächlich umgebracht hatte. Albert schüttelte nur den Kopf. »Ich habe grauenhafte Sachen zu ihr gesagt.«
Was er davon halten sollte, wusste Jan nicht, aber er hatte genug Erfahrung mit skrupellosen Totschlägern, um zu wissen, dass Albert keiner war.
Je näher er dem Böttcherhaus kam, desto mehr wandten seine Gedanken sich von Albert und dem Verbrechen ab. Er fragte sich, ob er den Frauen des Hauses begegnen würde. Unwillkürlich hielt er mit der Schubkarre an, zog seine Strümpfe glatt und rückte das graue Wams zurecht, das er über sein Arbeitshemd gezogen hatte. Nicht, dass er sich etwas erhoffte, aber unangenehm auffallen wollte er auf keinen Fall.
Susanne war auf den Hof gegangen, um Liebhild anzubieten, ihr nun die neuen Haare für ihre Puppe zu knüpfen. Sie fand ihre kleine Schwester an der Ecke zum Gemüsegärtchen, wo sie auf einem Stein an der Regentonne stand und hineinsah. Susanne erinnerte sich, dass sie selbst früher darin gern die grazilen Mückenlarven beobachtet hatte, die vor jedem Schatten davonflitzten. »Sind Fische drin?«, neckte sie ihre kleine Schwester.
Liebhild zuckte schuldbewusst zusammen und sprang vom Stein. »Nein, nein. Ich … ich wollte gießen, guck.« Sie griff nach einem kleinen Holzeimer, der gefüllt neben der Tonne stand, ging zum Möhrenbeet und begann geflissentlich, die Pflänzchen zu bewässern.
Susanne lächelte. »Wir könnten uns jetzt um deine Puppe kümmern, ich hätte Zeit. Wo hast du sie denn?«
Liebhild ließ die Hände mit dem Eimer sinken und sah sie mit so entsetzten großen Augen an, dass Susanne misstrauisch wurde. »Liebchen! Hast du etwa …?« Mit wenigen Schritten erreichte sie die Regentonne und sah hinein. Sie war dreiviertel voll Wasser, und am Grund war es dunkel, trotzdem konnte sie ganz unten schemenhaft die Puppe erkennen. Sie seufzte. »Hol die Harke!«
Liebhild gehorchte und kam mit traurig gesenktem Kopf näher geschlichen. Susanne sah sie tadelnd an. »Warum machst du das immer? Erzähl mir nicht wieder, dass du sie waschen willst. Du weißt, dass sie sich auflöst.«
Liebhild schniefte und zog die Schultern hoch. »Gestern lag ein toter Spatz in der Tonne. Der schwamm oben. Tote Katzen und Leute gehen erst unter und kommen dann wieder hoch, sagt Thomas. Ich wollte mal sehen, ob Lina wieder hochkommt. Tut sie aber nicht.«
»Aber Liebchen, Lina ist doch ohnehin ein totes Ding«, sagte Susanne.
»Wer tot ist, ist doch auch ein totes Ding und kommt trotzdem wieder hoch«, erwiderte Liebhild.
»Was du für Zeug redest.« Susanne beugte sich über die Tonne und fischte mit der Harke darin, bis sie die Puppe an die Oberfläche gebracht hatte. Der mit Kleie gefüllte Körper würde lange brauchen, um zu trocknen, doch sonst hatte das Wasser keinen Schaden angerichtet. Sämtlicher Leim, samt der langen Wollhaare, war schon fortgespült worden, als Liebhild die Puppe zum ersten Mal auf diese Art gebadet hatte. Auch die Bemalung des Holzgesichtes war schon lange verblasst.
»Kleid ausziehen und in die Sonne legen«, wies sie Liebhild schroff an. »Die Haare müssen nun warten.«
Liebhild nahm ihr kleinlaut die Puppe ab. Susanne bedachte sie noch mit einem finsteren Blick, bevor sie sich abwandte. Sie schrak zusammen. Vor ihr stand Jan Niehus. Er hatte seine Kappe in der Hand und sah aus, als wolle er sich gerade wieder davonschleichen.
»Verzeihung«, sagte er. »Ich bringe nur … Ich dachte … Aber ich wollte nicht stören.«
Susanne fragte sich, warum er so rot im Gesicht war. Seine Schweigsamkeit ihr gegenüber war sie gewöhnt, aber verunsichert hatte er nie gewirkt.
»Wobei stören?«, fragte sie.
Jan überlief es heiß. Er war selbst schuld an seiner peinlichen Lage. Warum war er nicht gleich in die Werkstatt gegangen? Weil du SIE aus der Nähe sehen wolltest, du Narr, sagte seine unbarmherzig aufrichtige innere Stimme. Sein Herz schlug immer ein bisschen schneller, wenn er Susanne sah, das war sein heimlicher Genuss. Doch nun schlug es ihm bis zum Hals vor Verlegenheit. Kleid ausziehen und in die Sonne legen. Natürlich hatte sie nicht von sich selbst gesprochen, das wusste er. Doch so schnell konnte seine Vernunft nicht arbeiten, wie er sich Susanne Büttner beim Entkleiden vorstellte. Ebenso rasch reagierte sein Körper. Sein Glück, dass er die Kappe schon vorher vom Kopf genommen hatte und sie nun unauffällig vor seine Mitte halten konnte. Was für ein Fluch das war, ein Mann zu sein, der nicht einmal hoffen durfte.
Eine feuchte Haarsträhne ringelte sich über ihre Wange. Ihre nassen Hände trocknete sie an der Schürze ab. Sie hatte erstaunt geklungen, aber nun fingen ihre Augen an zu lachen. Wie sollte sie auch nicht lachen, wenn er weiter dastand wie eine stumme Vogelscheuche? Er räusperte sich. »Ich bringe die Fassbänder. Es ist spät geworden, weil Albert uns fehlt.«
Sie trat näher zu ihm, und er musste sich zusammenreißen, damit er nicht zurückwich. Immerhin schien sie nun nicht mehr belustigt, ihre Miene zeigte Betroffenheit. »Das mit Albert ist eine schlimme Sache. Glaubst du, dass er ein Totschläger ist?«
Jan schüttelte den Kopf. Es war schwierig, über Albert zu sprechen und gleichzeitig zu bemerken, wie nass das dünne Tuch ihres Kleides über der einen Brust war. Doppelt beschämend, dass er sich selbst bei dem furchtbaren Thema noch mit seinem sündigen Verlangen herumschlagen musste. »Er hat den Wenzel nicht erschlagen, da bin ich sicher. Mit seiner Stiefmutter hatte er Streit, aber dass er eine Frau umbringt … Jähzorn habe ich an ihm nie gesehen, und bei Verstand hätte er’s schon wegen der Kinder nicht getan. Es sind von väterlicher Seite seine Geschwister.«
»Sind die Kinder wieder da?«
»Nein. Albert hat mich gebeten, sie zu suchen. Aber ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll.«
»Und wenn der Mörder sie hat?« Sie sah ihm sorgenvoll in die Augen.
Er erwiderte ihren Blick schweigend und fühlte, dass er verloren war. Die hübsche Susanne sorgte sich um die Kinder. Wie konnte er die zwei nicht suchen, wenn auch sie darauf hoffte, dass er es tun würde? Auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, warum der Mörder die Kinder festhalten sollte. Es sei denn, sie wüssten etwas, das ihm schaden konnte. »Ich werde mich umhören«, sagte er.
Sie lächelte. »Ich kann helfen. Wo …«
»Einen gesegneten Abend wünsche ich!« Das war die Stimme ihres Vaters, die laut über den Hof schallte. Büttner klang scharf, und Jan wusste sofort, was ihn ärgerte. Mit einem kurzen Nicken verabschiedete er sich von Susanne und ging eilig zu seinem Schubkarren zurück, um seine Lieferung abzugeben, wo er sie gleich hätte abgeben sollen.
Susanne teilte im Obergeschoss ihres Elternhauses eine Kammer mit ihren Schwestern. Regine und Liebhild schliefen gemeinsam im Alkoven. So fühlte Liebhild sich nachts nicht einsam, und gleichzeitig war sichergestellt, dass Regine nicht unbemerkt aufstehen und verschwinden konnte. Manchmal kam sie auf solche Ideen.
Susannes schmales Bett stand vor dem Alkoven. Wenn Liebhild aufs Nachtgeschirr musste, dann kletterte sie aus dem Schrankbett über Susanne hinweg zu Boden, und in der Dunkelheit trat sie ihr dabei gelegentlich auf die Beine. Susanne hatte in der Regel einen so festen Schlaf, dass sie es kaum bemerkte. Sie ging später zu Bett als die anderen beiden und stand mit dem ersten Hahnenschrei auf.
Auch an diesem Abend musste Susanne noch in der Küche ihre letzten Pflichten erledigen, während ihre Schwestern bereits im Bett lagen.
Die alte Muhme hatte sich schon in ihr Kämmerchen in der Werkstatt zurückgezogen. Susanne setzte sich nach dem Hühnerfüttern noch mit Flickarbeiten auf die Küchenbank. Lene wusch das Geschirr und bereitete für den nächsten Tag das Herdfeuer vor. Ihre Base schwatzte, wie meistens bei der Arbeit. Obwohl sie von Kind an als Magd bei den Büttners im Haus lebte, nahm sie das Abendessen nie mit der Familie ein, sondern mit ihrer Mutter und ihrem bettlägerigen Großvater. Da ihre Mutter als Dienstmagd bei einer Lüneburger Patrizierfamilie angestellt war, brachte Lene immer reichlich Geschwätz mit, wenn sie nach dem Essen zurückkehrte. Sie wusste, um welche Frau der verwitwete Herr von Dassel anhielt, für wann die Beerdigung der alten Mutter vom Ratsherrn Witting angesetzt war und wessen Söhne die Büttel nun wieder nachts auf der Straße aufgegriffen hatten.
»Der schöne Lossius war mal nicht dabei«, kicherte sie. Das erinnerte Susanne an das Gespräch in der Werkstatt. Sie biss den Nähfaden ab und ließ sich seufzend gegen die Lehne der Bank zurücksinken. »Herr Lossius will morgen kommen und mit Vater sprechen. Gleich in der Früh müssen wir die Dornse lüften. Sie kommen am Nachmittag. Da wäre wohl auch ein bisschen Kuchen richtig.«
»Hoffentlich gibt er deinem Vater einen ordentlichen Auftrag. Er kauft zum ersten Mal bei ihm, nicht wahr?«, fragte Lene.
»Ja. Er hat früher mit Marquart Geschäfte gemacht. Aber der ist ihm zu tüdelig geworden.«
»Das kommt davon, wenn einer seine Werkstatt nicht rechtzeitig an Jüngere abgibt. Aber der Alte hat eben keinen Sohn mehr, da fiel ihm die Entscheidung wohl zu schwer.«
»Töchter hat er«, murmelte Susanne.
Lene gluckste vergnügt. Sie steckte inzwischen mit dem halben Arm im Aschefach des Herdes. »In der Tat. Und wenn es nach deinem Bruder geht, dann hat er bald wenigstens einen Schwiegersohn.«
»Erzähl nichts herum, was noch nicht wahr ist.« Susanne unterstrich ihre Worte mit dem erhobenen Zeigefinger.
Lene schüttelte den Kopf. »Das würde ich nicht. Ist doch mit Martin eine andere Sache als mit einem wie Lenhardt Lossius, den die Leute jede Woche mit einer anderen verloben. Bei dem macht es keinen Unterschied.«
»Da siehst du. Gerade weil die Leute so denken und sinnlos daherreden, ist wahrscheinlich nur wenig davon wahr. Ein Urteil soll man nur fällen, wenn man die Wahrheit kennt.«
»Aber dass Lossius sich nachts herumtreibt, ist keine Erfindung«, wandte Lene ein.
»Wenn ein junger Mann nachts durch die Straßen läuft, heißt das noch nicht, dass er verdorben ist. Glaub nicht, ich wollte ihn dafür in Schutz nehmen. Er weiß gewiss, was für ein Eindruck entstehen muss. Trotzdem soll man seine Meinung nur aus dem bilden, das man sicher weiß.«
Lene kicherte wieder. »Sicher weiß ich, dass er auf dem Schützenfest schon mehr als ein Mädchen geküsst hat. Und ein großes Geheimnis hat er nicht daraus gemacht. Da muss ich doch denken …«
»Nun reicht es. Morgen ist er unser Gast, und wir werden höflich und freundlich sein, wie zu jedem anderen. Und jetzt zu Bett.« Susanne räumte das Nähzeug zusammen und half Lene noch dabei, ihr Nachtlager auf der Küchenbank herzurichten, dann ging sie nach oben.
Sie fühlte sich beunruhigt und wusste nicht genau, warum. Vielleicht war es die Aussicht auf Martins Verlobung oder der hohe Besuch am nächsten Tag. Ihr war, als stünden ihr große Veränderungen bevor, als würde ein Bogen gespannt, um in Kürze loszuschnellen. Sie spürte nicht nur Besorgnis, sondern auch eine süße Aufregung, die sie zuletzt als Kind an den Tagen vor dem Weihnachtsfest erlebt hatte.
Als sie etwas später unter ihre Bettdecke schlüpfte, gestand sie sich ein, dass ihre Unruhe auch mit Jan Niehus zu tun hatte. Zum ersten Mal hatte er sie heute auf dem Hof so angesehen, als würde er sie bemerken. Sein Blick war ihr durch und durch gegangen. Selbst bei der Erinnerung daran wurde ihr wieder heiß.
2
Der schöne Lossius
LENHARDT Lossius war ein auffallend großer, kräftiger junger Mann. Er überragte seinen Vater um eine halbe Haupteslänge. Susannes Vater musste sogar zu ihm aufschauen. Lenhardts Gesicht war lang und schmal, seine Züge scharf und ebenmäßig geschnitten. Er strahlte aus, dass er von seinem guten Aussehen wusste und es ebenso genoss wie seine hohe Stellung in der Gesellschaft. Unter den jungen Männern, die ihn von den Wehrübungen, Zunftversammlungen oder aus dem Wirtshaus kannten, galt er dennoch als umgänglich und frohsinnig.
Susanne hatte ihn schon oft gesehen, allerdings nur im Vorübergehen auf der Straße oder auf dem Markt, auf Festen oder auf der Bank vor Lossius’ Anwesen. Aus der Nähe hatte sie ihn noch nie betrachtet und sich schon gar nicht mit ihm unterhalten.
Der Unterschied zwischen seinem und ihrem Stand zeigte sich bereits in der Kleidung deutlich. Allein die feinen Kniestrümpfe, die er an seinen langen, wohlgeformten Beinen trug, und der schmucke, schmale Hut kosteten wohl so viel wie Susannes gesamte Garnitur. Sein grüner Rock mit den gekordelten Tressen und schönen Besätzen und die Kniehose aus Samt hatten Susannes Vermutung nach den gleichen Wert wie die Alltagskleidung ihrer ganzen Familie zusammengenommen.
Einschüchtern ließ sie sich von dem Standesunterschied nicht, denn ihr Vater war als unbescholtener und erfolgreicher Böttchermeister kaum weniger angesehen als Sülfmeister Lossius. Dennoch konnte sie mit den hohen Gästen nicht ganz unbefangen umgehen, da ihre Gunst für die Böttcherei viel bedeutete.
Während ihr Vater und Martin mit Hinrik Lossius und seinem Sohn am Tisch ins Gespräch vertieft waren, saß sie gemeinsam mit Regine, adrett gekleidet, abseits vom Tisch und beschäftigte sich mit kleinen Nadelarbeiten. Sie sollte bei der Hand sein, um Apfelmost oder Wein nachzuschenken, Kuchen oder Brot aus der Küche nachzuholen, je nach den Wünschen der Herren.
Regine an solchen Gelegenheiten teilhaben zu lassen, war eine Entscheidung ihrer Eltern, der eine Mischung aus Stolz, Trotz und Klugheit zugrunde lag. Regine schmückte den Raum mit ihrer Schönheit und bewies durch ihr sanftes Benehmen, dass sie keine Monstrosität war, die man verstecken musste. So wurde den bösen Gerüchteköchen das Feuer im Herd erstickt, und Regine hatte gleichzeitig eine Abwechslung. Sie liebte solche Tage, an denen es für alle Kuchen gab.
Susanne ließ ihre Hände mit der Säumarbeit für einen Moment in den Schoß sinken und warf einen Blick auf ihre Schwester. Auch Regine hatte in ihrer Stickerei innegehalten. Unverblümt starrte sie Lenhardt Lossius an. Susanne konnte es ihr nicht verdenken. Womöglich hatten die »Lüneburger Gänse« recht, und er war tatsächlich der prächtigste junge Mann der Stadt. Ihre Schwester lächelte verzückt, als würde sie einen geschmückten Erntewagen bestaunen. Susanne schmunzelte. »Regine, was stickst du als Nächstes?«, fragte sie leise und lenkte sie damit erfolgreich vom jungen Lossius ab.
Regine blickte zurück auf ihre Stickerei. »Oh. Eine Rose. Eine weiße Rose.« Sie hielt Susanne kurz ihr Arbeitsstück entgegen, dann vertiefte sie sich wieder in die Gestaltung ihres Werks. Sie stickte seit Jahren an einer Vielzahl von weißen Blüten auf dem grünen Grund eines Schals. Alle sollten Rosen sein und sahen doch ganz unterschiedlich aus.
Susanne nickte. »Schön.« Prüfend sah sie zum Tisch hinüber. Die Gläser waren noch gefüllt, und der Sülfmeister biss mit sichtlichem Wohlbehagen in den buttrigen Topfkuchen, während er ihrem Vater zuhörte, der sein Angebot beschrieb. Sein verrufener Sohn musterte jedoch zu Susannes Erschrecken nicht etwa Ulrich Büttner, sondern Regine. Sein Gesichtsausdruck war dabei kaum weniger verzückt, als Regines es kurz zuvor gewesen war. Ein beunruhigendes Gefühl überfiel Susanne. Regine war äußerlich eine schöne Frau, würde jedoch innerlich wohl nie erwachsen werden. Auch wenn Susanne nicht wollte, dass jemand ihre Schwester für schwachsinnig hielt, machte es ihr Sorgen, wenn ein Mann sie ansah, als wäre sie ein gewöhnliches Mädchen.
Unwillkürlich zog sie die Brauen zusammen und betrachtete angestrengt die Saumnaht zwischen ihren Fingern. Sülfmeister Lossius und Martin lachten über einen Scherz ihres Vaters. Als sie aufblickte, erwischte sie Lenhardt dabei, wie er nun sie selbst betrachtete. Er lächelte sie an, und sie spürte, wie sie errötete.
»Susannchen, was haben wir noch anzubieten? Der junge Herr Lossius scheint keinen Kuchen zu mögen«, sagte ihr Vater gut gelaunt.
Susanne erwiderte höflich Lenhardts Lächeln und erhob sich. »Da finden wir sicher etwas. Mögt Ihr lieber geräucherte Hammelkeule, Fleischbällchen oder Kirschkompott?«
»Das ist mir alles so lieb wie der Kuchen. Wenn ich noch nicht zugegriffen habe, so liegt es daran, dass ich vorher um etwas anderes bitten möchte. Ich bin neugierig und würde gern Eure Werkstatt ansehen, Meister Büttner. Ihr müsst Euch dadurch nicht stören lassen. Vielleicht führt mich Euer Sohn oder eine Eurer Töchter, während Ihr mit meinem Vater die wichtigsten Dinge beredet?«
Ulrich Büttner lachte. »Ihr wollt doch wohl nicht zum Handwerk wechseln, mein Herr? Aber bitte, gebt Eurer Neugier nach. Mein zweiter Sohn und der Geselle sind bei der Arbeit und können Euch alles zeigen. Susanne führt Euch hinüber.«
»Dank Euch.« Lenhardt stand auf und sah so zufrieden aus, als er mit Susanne die gute Stube verließ, dass sie stutzig wurde. Sie sah selbst gern Handwerkern zu, konnte sich aber nicht vorstellen, dass Lossius das ebenso wichtig war. Schon im Flur bestätigte er sie darin.
»Ich verrate Euch ein Geheimnis«, sagte er. »Mein Vater und ich waren mit einem Gast unseres Hauses bei Herrn Bürgermeister Witzendorff zum Mittagsmahl geladen. Ich konnte seine Gastlichkeit nicht ausschlagen, obwohl es mir nicht geschmeckt hat. Und nun kann ich nichts mehr herunterbringen, obwohl ich sicher bin, dass es mir hier ausgezeichnet schmecken würde.«
Susanne sah ihn ungläubig an. »Also wollt Ihr die Werkstatt sehen, damit Ihr nicht essen müsst?«
Er lachte. »Manche Leute können sehr beleidigt sein, wenn man ihr Essen ablehnt. Appetitlosigkeit ist zumeist keine Entschuldigung. Aber nein, ich wollte die Werkstatt sehen, damit ich einen Augenblick allein mit Euch sprechen kann.«
Er sprach in einem heiteren Tonfall, klang aber nicht, als würde er sich über sie lustig machen, daher fasste Susanne seine Worte als scherzhaft auf. »Dann wäret Ihr frech«, sagte sie und öffnete für ihn die Tür zum Hof.
»Der Ruf hängt mir an.«
»Und Ihr tut Euer Bestes, um ihn zu behalten, wie ich sehe. Was hättet Ihr mit mir zu reden?«
Er ging neben ihr, wandte den Blick dabei nicht von ihr ab und strahlte sie an. »Über den warmen Frühling und die Kirschsorte in Eurem Kompott und darüber, mit wem du wohl zum Schützenfest gehen wirst. Sei nicht so streng. Ich erinnere mich, wie du einmal meinen kleinen Vetter verhauen hast, weil er deine Schwester geärgert hatte. Da warst du nicht so vornehm.«
Eigentlich sollte sie sich beschämt fühlen, dachte sie, doch er meinte es offenbar freundlich. »Würdet Ihr meine Schwester ärgern, wäre ich auch heute nicht vornehm mit Euch. Daran hättet Ihr aber keine Freude. Also sprechen wir lieber höflich über die Kirschen.«
Seine Augen funkelten belustigt. »Nein, über das Schützenfest. Deine Familie wird doch hingehen? Ich weiß, dass dein Vater ein guter Musketenschütze ist, und dein Bruder … Hat er nicht letztes Jahr mit der Armbrust den Papagoy von der Stange geschossen?«
Susanne hatte noch vor Augen, wie die bunten Federn des ausgestopften Vogels herabgeschwebt waren, nachdem Martins Armbrustbolzen ihn von der hohen Stange gerissen hatte. Sie hatte eine davon aufbewahrt. Die ganze Familie war in Jubel ausgebrochen und hatte bis spät in den Abend zu Martins Ehre gefeiert. Sie lächelte. »Wir gehen bestimmt hin.«
»Vielleicht tanzen wir dann einmal zusammen?« Das sagte er so offen und unbefangen, als wäre er die Unschuld selbst.
Susanne sah ihm nachdenklich in die Augen, die so schön blau waren wie die von Regine. »Wisst Ihr eigentlich alles über den Ruf, der Euch anhängt?«, fragte sie leise.
»Und glaubst du alles, was die Leute reden?«, fragte er ebenso leise zurück.
Sie schüttelte den Kopf. »Das wäre schlimm. Ich weiß, wie schnell die Leute sich ein falsches Bild machen. Aber gerade deshalb werde ich lieber nicht mit Euch auf dem Schützenfest tanzen. Über meine Familie wird schon genug gesprochen.«
»Wegen deiner Schwester, meinst du? Ich höre nie etwas anderes als Respekt für deinen Vater. Früher mag es anders gewesen sein.«
»Es hat viel Mühe gekostet, die bösen Zungen zum Schweigen zu bringen.«
»Neid bringt die Leute dazu, sich die Mäuler zu zerreißen. Deine Schwester ist hübsch.«
Aus dem weit geöffneten Tor der Werkstatt kam ihnen Till entgegen, in der Hand einen der kleinen Bottiche, die sie in der Vorratskammer verwendeten. Es war für Susanne nicht zu übersehen, wie sich seine sonst immer heitere Miene verdunkelte, als er Lenhardt bemerkte.
»Tag, Büttner«, sagte der Sülfmeistersohn fröhlich.
Tills Blick wanderte von ihm zu Susanne und wieder zurück. »Guten Tag, Herr Lossius«, erwiderte er dann ungewöhnlich nüchtern.
»Herr Lossius möchte sich die Werkstatt ansehen«, sagte Susanne.
Till nickte abschätzig. »Natürlich. Gern. Dann kannst du ja der Muhme das hier bringen.« Er drückte Susanne den Bottich in die Hände und zeigte nachdrücklich auf die Küche.
Unter anderen Umständen hätte sie sich das von ihrem Bruder nicht bieten lassen, doch vor Lenhardt wollte sie nicht mit ihm streiten, und außerdem kam ihr die Ausflucht gelegen. »Also dann, viel Vergnügen. Sollte der Appetit noch kommen, dann meldet Euch nur.«
Lenhardt deutete lächelnd eine Verbeugung an. »Das werde ich gern.«
Es war kein Wunder, dass Frauen sich von ihm küssen ließen, dachte Susanne auf dem Weg in die Küche. Er verstand es, ein Mädchen mit seiner Freundlichkeit einzuwickeln. Seinem offenherzigen Wesen traute man nichts Übles zu. Till allerdings schien anderer Ansicht zu sein. Sie musste ihn unbedingt ausfragen. Wer wusste, bei welcher Art nächtlichen Unfugs sich die beiden schon über den Weg gelaufen waren?
Der nächste Tag war ein Sonnabend, und weil das Wetter weiterhin trocken und mild blieb, beschloss Susanne, die Sonntagskleidung hinauszubringen. Sie wurde gebürstet, ausgebessert und gebügelt und dann zum Lüften draußen aufgehängt. Wo sie schon einmal dabei waren, wurden gleich auch die Schränke aufgeräumt und nachgeprüft, ob sich keine Motten in den guten Wollsachen eingenistet hatten.
Zusammen mit den gewöhnlichen Haushaltspflichten beschäftigte das Unternehmen alle Frauen des Hauses den ganzen Tag lang. Susanne war am Abend zu müde, um eine Gelegenheit für das Gespräch mit Till zu suchen.
Erst als die Familie am Sonntag nach dem Gottesdienst aus der Nicolaikirche kam, fiel es ihr wieder ein. Martin und ihre Eltern sprachen auf dem Kirchvorplatz mit dem alten Marquart und seinen beiden Töchtern. Regine war bei ihrem Vater untergehakt, Liebhild spielte mit den anderen Kindern, und Lene hatte sich zu ihrer Mutter gesellt.
Till zog es zu einer Gruppe von jungen Männern, die sich in Hörweite einiger junger Frauen zusammengefunden hatten. Susanne fasste ihn am Ärmel und hielt ihn zurück.
Er wandte sich ihr ungeduldig zu. »Nur einen Augenblick, Suse. Vater redet doch auch noch. Geh hin und guck dir Dorothea Marquart mal genauer an. Vielleicht leben wir bald mit ihr unter einem Dach.«
Er wollte ihr seinen Arm entziehen, doch sie ließ ihn noch nicht los. »Ich muss mit dir sprechen. Kommst du nach dem Mittag hinter den Hühnerstall?«
»Ach so. Heckst du etwas aus?« Er grinste, weil er das selbst für unwahrscheinlich hielt. Es war lange her, dass sie sich wegen kindlicher Streiche mit ihm hinter dem Stall versteckt hatte.
»Kommst du?«, beharrte sie.
»Ja, ja, sicher. Nach dem Mittag.«
Sie sah ihm nach, als er zu den anderen schlenderte. Er war mit seinen achtzehn Jahren einer der jüngsten von ihnen. Sie begrüßten ihn mit den üblichen gutmütig-spöttischen Bemerkungen, auf die er schlagfertig antwortete. Seine flinke Zunge verschaffte ihm Respekt, wenn auch nicht nur Freunde.
Auch Till hatte damit zu kämpfen, dass seine Familie als seltsam galt. Die Blicke der jungen Leute wurden häufig dahin gezogen, wo die Büttners standen. Sie hatten alle lernen müssen, das nicht zu beachten.
Für Susanne war es der Grund, warum sie sich an diesem Tag nicht den jungen Frauen anschloss. Wenn sie ihnen einzeln begegnete, wich sie keiner von ihnen aus, doch in der Gruppe stellte sie sich ihnen nicht gern.