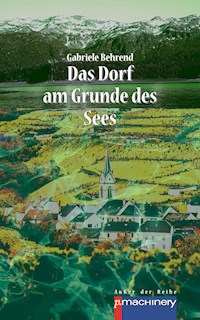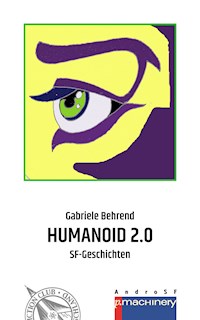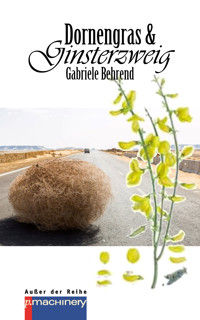8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als Douglas den Tod eines Menschen verschuldet, stellt ihn die Strafverfolgung vor eine scheinbar einfache Wahl – entweder lebenslange Haft oder die Implantierung einer multiplen Persönlichkeit, so wie sie jeder andere um ihn herum bereits besitzt. Diese Persönlichkeitssets ermöglichen es den Menschen, auf jede Situation angemessen zu reagieren. Das oberste Ziel? Effizienz. Dass dieser Eingriff bei einem "Wilden" Risiken birgt, verdrängt Douglas und lässt sich auf die Therapie ein und damit auch auf seine medizinische Patin Kaynee. Gabriele Behrend entwickelt ein faszinierendes Szenario, in dem die Weiterentwicklung psychischer Fähigkeiten industrielle Ausmaße angenommen hat. Der gewohnt ausgefeilte Stil der Kurd-Laßwitz-Preisträgerin und ihr Einfallsreichtum packen den Leser von der ersten bis zur letzten Seite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gabriele Behrend
Salzgras&Lavendel
Außer der Reihe 48
Gabriele Behrend
SALZGRAS & LAVENDEL
Außer der Reihe 48
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: September 2020
p.machinery Michael Haitel
Titelabbildung: Gabriele Behrend
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Korrektorat & Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 208 9
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 883 8
1.
Douglas wartet auf die Einfahrt der Linie 03, Nord-Süd-Achse. Er steht auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Station, halb im Schatten eines Rundpfeilers verborgen, und tut so, als sei er viele. Er übt es heimlich, dieses Zucken im Gesicht, die subtilen Veränderungen der Körperhaltung. Er versucht, ein Gefühl dafür zu bekommen, mehr zu sein, als er ist.
Da baut sich ein Hüne vor ihm auf. »Mach ihn nicht an, Alter.«
Douglas weicht einen Schritt zurück. Er kann keinen Ärger gebrauchen, das kann niemand hier.
»Du machst dich lustig über ihn, stimmt’s?« Der Riese schiebt sich vor Douglas. »Ich kann es nicht leiden, wenn sich jemand über ihn lustig macht, verstanden? Also entschuldige dich, und zwar dalli!«
Douglas räuspert sich. »Entschuldigen Sie, Sir. Soll nicht wieder vorkommen.« Seine Augen sind zu Boden gerichtet. Nur niemals so einem Kerl in die Augen sehen. Die sind reizbar, allesamt. Er wartet. Einen Herzschlag lang, zwei.
Der Hüne verliert plötzlich an Größe, als ob einem Luftballon die Luft ausgehen würde. »Schon gut, Sir. Ich muss mich entschuldigen. Mein Wachhund hat sich vorschnell dazwischen geschaltet. Er macht sich manchmal selbstständig.«
Douglas nickt vage, als ob er’s verstünde.
Der Hüne, der kein Riese mehr ist, sondern ein durchschnittlich grauer Mann in grauem Trenchcoat, wendet sich ab, schlurft ein paar Schritte nach rechts.
Douglas kann sehen, wie der Typ dabei mit sich selber redet, ohne einen Laut von sich zu geben. Es scheint ein heftiges Streitgespräch zu sein. Wer wohl gewinnen mag?
Douglas macht unbeteiligte Miene zum verwirrenden Schauspiel. Er greift nach dem Riemen seiner quadratischen Officebag, in dem auf kleinem Raum Datenwürfel, Laptop, Agenda und Smartphone zusammengepackt sind, und hält sich daran fest. Wenn doch nur die Bahn käme!
Ein Blick auf die elektronische Anzeige verrät ihm, dass es noch drei Minuten dauern wird. In drei Minuten kann viel passieren. Douglas sieht sich verstohlen um. Überall stehen Menschen, perfekt eingepasst in die persönliche Distanz. Keiner nimmt einem anderen den Platz. Überall maskenhafte Ruhe. Über den Köpfen baumeln in regelmäßigen Abständen Schilder:
»Halte deine Meute in Schach! Dein Nachbar wird’s dir danken!«
»Hier herrscht Gelassenheit!«
»Nehmt nichts persönlich!«
Dazwischen Smileys.
Douglas hat etwas gegen diese verordnete Fröhlichkeit. Die lachenden Rundgesichter sind zu grell, zu fröhlich, springen ihn an wie neongelbe Baseballbälle. So einer ist hart, wenn er mit voller Wucht geschleudert wird, sehr hart. Douglas zuckt zurück. In seinem Kopf erklingt ein meckerndes, ein hämisches Lachen. Schon formen sich Gesichter aus dem Nebel seiner Seele, Unwesen, schemenhaft, aber durch und durch bösartig. Douglas reißt die Augen auf. Bloß nicht allein sein, mit sich und dem inwendigen Gejohle. Seine Augen heften sich auf eine Videowall, die in die Tunnelwand eingelassen ist. Ferien in Norfolk, blühende Lavendelfelder. Sanftes Licht, sanfte Farben. Er sieht sich daran satt. Dann wird die Wall dunkel. Die U-Bahn fährt ein.
Ein Weckton zirpt durch den Raum. Etwas bewegt sich in der Tiefe der Bettdecken. Ein dunkelbrauner, lockiger Schopf rutscht tiefer zwischen das Weiß der Laken, dann wiederum strecken sich zwei schmale Arme darunter hervor. Mit einem ausgiebigen Gähnen folgt der dazugehörige Mensch. Es ist eine junge Frau, die gerade in diesem Moment unwillig das Gesicht verzieht und sich herumdreht. Nun liegt sie bäuchlings auf der Matratze und steckt den Kopf unter das Kissen. Der Weckruf wird lauter.
»Scheißding«, tönt es dumpf unter dem Kissen hervor, »hör endlich auf, ich bin ja wach!« Der Alarm macht weiter. Da schiebt die junge Frau das Kissen beiseite und bellt entnervt. »Stopp!« Der Weckton erstirbt. Die junge Frau aber dreht sich herum und setzt sich auf. Sie schlingt die Arme um die Beine und stützt ihr Kinn auf das Knie. »Jeden Morgen das gleiche«, murmelt sie. »Ist doch scheiße. Kann sich da keiner was anderes einfallen lassen?« Sie seufzt. Dann führt sie die rechte Hand an die Stelle hinter dem rechten Ohr, wo das Socket in den Schädelknochen eingelassen ist, und legt den Schalter um. Einen Moment später schwingt sie ihre Beine über die Bettkante, stützt sich mit den Händen auf der Matratze ab und scheint zu überlegen.
Etwas hat sich verändert. Die junge Frau hat ihren kindlichen Trotz überwunden und wirkt auf einmal reifer. Vernünftiger. Und das ist auch richtig so, denn Kaynee hat ihren Organisator ins Spiel gebracht. Wie jeden Morgen nach dem Aufwachen übernimmt Kora den Geist der Gesamtheit.
Sie überprüft die Dateien. Katy hat nichts Weltbewegendes geträumt, Kora findet nur eine kurze Notiz in dem Wechsellog. Sanders ist dort vermerkt, ohne nähere Erklärung. Aber Grund genug, sich den Techniker noch einmal genau anzusehen. Das ist eine Aufgabe für Karen, die Fürsorgerin. Kora trägt es gleich in deren persönlichen Kalender ein.
Danach sieht sie in der Hausgemeinschaft nach dem Rechten. Karl ist wach, hält sich aber zurück. Der Wachhund der Entität schläft kaum, ständig lauert er im Hintergrund, um sich vor die Gemeinschaft zu stellen, falls die persönliche Grenze überschritten oder Kaynee gar angegriffen wird. Kora wünscht sich manchmal, dass er entspannter wäre, aber das widerspräche seiner Natur und seiner Effizienz.
Keira und ihre Gruppe ruhen noch. Sie sind eindeutig zu gechillt in den letzten Tagen. Kora will sich das in der nächsten Zeit genauer anschauen. Sollte sich das so weiterentwickeln, dann muss sie über eine Nachprägung nachdenken. Die Entität ist auf das Sozial-Ich angewiesen, denn es ist die längste Zeit am Tag im Einsatz. Auch wenn Kay mit den ihren manchmal Sturm dagegen läuft. Aber Kaynee verbringt nun einmal mehr Zeit mit ihren Kollegen als mit sich selbst. Da kann sie sich keine Fehler leisten, da darf sie es nicht.
Der letzte Blick gilt der ungestümen Kay, deren Gruppe das Privat-Ich bildet. Es ist typisch für Kay, dass sie Katy den Schlaf überlassen hat. Einmal noch so unbeschwert spielen wie ein Kind, das wollte doch jeder. Um der Effizienz willen verschieben die meisten Menschen diesen Wunsch in die Nachtzeit. Im Traum kann man toben und tollen, ohne dass das Leben davon beeinflusst wird. Katy hat sich nach ihrem nächtlichen Einsatz bereits zurückgezogen, sie muss müde sein. Kora lächelt kurz. Alles ist so, wie es sein soll. Nun kann sie sich in ihr Büro zurückziehen, die Verbindung mit dem Internet herstellen und den Officekalender abrufen. Keira muss wissen, wann sie wo zu sein hat und wen sie aus ihrem Team wann einsetzen muss.
Auf dem Weg zu sich selber, treppauf, treppab im Gefüge von Kaynees Verstand, kommt Kora an der Tür zum Keller vorbei, ihr fährt ein leichter Schauer über den Rücken. Die Tür ist Ken. Ken ist der Türsteher am geistigen Abgrund. Hinter Ken steckt das Chaos, die Dämonenschar, die in dem geordneten Geist der Entität keinen Platz hat. Die inneren Dämonen, die der Effizienz wegen verbannt werden. Ausschalten darf man sie nicht, sonst gerät der komplexe Geist aus dem Gleichgewicht, aber durch die Kartografie der neuronalen Strukturen kann man sie herausfiltern und abscheiden und hinter einem festen Schloss sicher verwahren. Trotzdem ist da immer dieser Hauch der Ungewissheit. Was könnte alles passieren, wenn einmal der Riegel aufgestoßen würde? Wenn Ken versagte?
Kora flüchtet in die Sicherheit ihres Büros.
Es ist kaum eine Minute verstrichen, seitdem sich die junge Frau auf die Bettkante gehockt hat. Nun steht sie auf, dehnt und streckt sich ausgiebig. Noch hat sie Kora als vorrangiges Ich in ihrem Geist aktiviert. Das Job-Team um Keira hat inzwischen alle nötigen Instruktionen für den Tag erhalten, aber solange Kaynee nicht ihren Fuß aus der Tür ihres Zimmers setzt, solange wird sie ihr Arbeits-Ich nicht die Führung übernehmen lassen.
Also geht sie unter die Dusche, wie jeden Morgen. Spürt das Wasser auf ihrem Körper und stellt sich vor, dass es ein feinfädiger Landsommerregen ist. Mit ausgebreiteten Armen tanzt sie unter dem Strahl herum und singt dabei ein Erntelied. Bevor Kora das unterbinden kann, schreitet Karen ein. Alles, was Kaynee guttut, liegt in ihren Händen. Und wenn Kaynee singen will, egal, ob das einen Zweck erfüllt oder nicht, dann sorgt Karen dafür, dass sie die Zeit dafür bekommt.
Nach dem Kaynee frisch geduscht und geföhnt das Bad verlassen hat, folgt der Sonnengruß. Zwölf Mal fließend hintereinander absolviert und Kaynee fühlt sich bereit für den Tag. Karen zieht sich zurück.
Kaynee schlüpft in die Uniform von Zenith. Ein hellblauer Kasack über weißen Hosen, kein Schmuck, nur das Logo des Instituts auf der linken Brusttasche eingestickt, so geht Kaynee zur Cafeteria. Ihr Magen knurrt. Wie jeden Morgen zur gleichen Zeit. Alles hat sich in den täglichen Rhythmus eingefunden, alles ist konditioniert. Das bildet einen verlässlichen Rahmen, in dem es sich gut leben lässt. Keira und ihr Team sind jetzt für die nächsten zwölf Stunden am Start. Ein Knopfdruck am Socket hat Kora in den Hintergrund verbannt.
Jeder Tag gleicht dem anderen. Douglas Hewitt, 32, hat sich in den Ablauf einsortiert, hat sich eine Nische gesucht und findet Zuflucht in ihr. Jeden Morgen steht er um 08:45 am Bahnsteig in der Vorstadt, fährt von dort aus in die City, passiert den Kontrollposten und verschwindet in dem Glasturm der Acodis Inc. Er nimmt den Aufzug in den dritten Stock, gerade oberhalb der Etagen für Sicherheit und Housekeeping, verschwindet dann in seinem Box Office und vertieft sich in die Arbeit.
Er ist für die Sicherheit des Datenflusses zuständig, er hält die Dinge am Laufen. Dafür braucht man nur eine Persönlichkeit und die kann er bereitstellen. Er nennt sie sein Arbeits-Ich. Die offizielle Bezeichnung lautet Sozial-Ich, aber was soll’s. Eine andere Facette seiner Persönlichkeit hat er seinen Kollegen noch nie gezeigt, aber das ist anscheinend ganz okay. Jeder von ihnen hat sein eigenes Sozial-Ich, nur manchmal blitzen ihre anderen Seiten hervor. Die meisten lassen ihn in Ruhe, übersehen ihn gar. Konzentrieren sich auf die Dinge, die es zu tun gilt. Nur Josh, der Kollege aus der Nebenbox, scheint ein beiläufiges Interesse an Douglas zu hegen.
Josh ist gerade frisch von der Uni rekrutiert worden. Ein fünfundzwanzigjähriger Milchbubi, der einen unentschlossenen Bartwuchs züchtet und jeden Tag ein anderes Mottoshirt trägt. Josh ist die Notfallpolizei, spezialisiert auf kreative Problemlösungen und Denkprozesse. Da kann es dann mitunter passieren, dass es kleinkindhaft zornig aus seiner Box tönt, wenn er in einer Aufgabe feststeckt oder – was noch schlimmer ist – Userdienst hat. Da ist es egal, ob man ein Wunderkind oder nur ein durchschnittlicher ITler ist, an keinem geht der unliebsame Kelch vorüber. Josh allerdings hasst es geradezu, Passwörter für Typen zurückzusetzen, die zu blöd sind, sich eine einzige Ziffernfolge zu merken. Er nennt es eine Beleidigung seines IQs und rächt sich bisweilen auf kindliche Weise dafür. Dann ist es ihm egal, dass er auf der Arbeit ist, und wechselt ungebremst in sein Privat-Ich.
Douglas hat ihn einmal mit seinem Freund telefonieren hören und weiß seitdem, dass der Kasper von nebenan Jack heißt. Oder Jackass. Douglas fragt sich bisweilen, wie lange Sue dieses Benehmen noch tolerieren wird. Egal, ist nicht seine Sache. Aber weil er ihn mag, übernimmt Douglas manchmal Joshs Userdienst. Ihm ist es egal, was er macht, Hauptsache, er macht etwas, Hauptsache, sein Kopf ist abgelenkt.
Auf diese Weise hat sich Douglas bisher durch sein Leben geackert. Immer am Denken, immer am Arbeiten. Immer ein Ziel vor den Augen. Das aktuelle Ziel heißt –
»Hey, Douglas.« Josh steckt seinen Kopf in Dougs Quader. »Ist langweilig heute.« Er quengelt. Die schwarzen Haare strubbeln in alle Richtungen. Auf seinem Shirt steht »Nerds sind purer Sex«. »Lass uns in der Kantine ein paar Schnecken klarmachen.«
Douglas schüttelt den Kopf. »Lass mal. Ich muss das hier bis heute Mittag fertig bekommen.« Er wedelt mit der Hand in der Luft herum, als wenn er ›das da‹ damit beschleunigen könnte.
»Soll ich mal drüber schauen?« Josh nörgelt nicht mehr, seine Hand ist unwillkürlich zu seinem Socket gehuscht und hat den Schalter umgelegt. Jetzt klingt er interessiert, seine Stimme ist tiefer, die Haltung verändert. Das Sozial-Ich hat übernommen. Er stellt sich neben Douglas und starrt auf den Bildschirm. Nach einem Moment der Stille fliegen seine Hände über die Tastatur, vier Minuten später streckt er sich und tritt zurück. »Bitte schön, Problem gelöst.«
»Danke, Mann.« Douglas lehnt sich in seinem Stuhl zurück und betrachtet seinen Kollegen, der gegen die Abtrennung zur Nachbarbox lehnt, die Arme verschränkt. »Willst du immer noch Schnecken angraben?«
Josh schüttelt den Kopf. »Wie kommst du denn auf diese schiefe Ebene? Da drüben wartet noch ein kleines fieses Programm auf mich. Ich habe keine Zeit für …« Er hebt eine Braue. »… Schnecken. Bloß gut, dass Sue das nicht mitbekommen hat.«
Ein ungemütliches Schweigen breitet sich zwischen den beiden aus. Douglas sieht auf seinen Monitor. »Lass gut sein, Josh. Viel Erfolg.«
»Klar. Ebenso.« Damit zieht Josh sich in seine Box zurück.
Douglas bleibt alleine zurück, wieder einmal kalt erwischt von der Wandlungsfähigkeit seines Officenachbarn. Wie kann er damit leben?, fragt er sich. Vom Quengelbalg zum Arbeits-Ich in Nullkommanix und das scheinbar von ihm selber unbemerkt.
Douglas schließt die Augen. Was tun? Dadurch, dass Josh seine Arbeit gemacht hat, kann er einen ganzen Vormittag für andere Dinge nutzen. Nur – welche? Vielleicht doch erst einmal in die Kantine gehen, einen doppelten Espresso trinken.
Er sperrt den Rechner, steht auf. Geht an den Reihen der Box Offices vorbei, Richtung Fahrstuhl. Die Kantine liegt im einundzwanzigsten Stock, man hat einen freien Blick über die City. Ein freier Blick, ein klarer Kopf – den kann Douglas jetzt gebrauchen. Der Twin-Lift lässt auf sich warten. Douglas sieht den Gang hinunter. Aber da ist niemand, weder Postdienst, noch Sue, die Floor-Verantwortliche. Sue. Er verzieht das Gesicht.
›Was machen Sie hier, Douglas? Warum sind Sie nicht in Ihrem Office?‹ Er hat ihre Stimme im Ohr, diese strenge, kalte Stimme, die nicht zu dem zierlichen Körper mit den sanften Kurven passen will. Dabei kann sie ganz anders. Das weiß er, weil er sie einmal draußen gesehen hat, in der Mittagspause. Es war im letzten Sommer gewesen und ihr Sozial-Ich war anscheinend so entspannt, dass sich eine andere Sue in den Vordergrund geswitcht hat. Eine kleine Sue hatte mit Piepsstimme nach Eis am Stiel verlangt und lief einem Schmetterling hinterher, der sich in den weitläufigen Innenhof verirrt hatte.
Das Spiel hatte ein jähes Ende gefunden, als sie in den Abteilungsleiter der Abrechnung gerannt war. Der, ansonsten jovial und umgänglich, hatte innerhalb eines Wimpernschlags seinen Wachhund von der Leine gelassen, Sue angeschnauzt und abgekanzelt. Die begann zu greinen. Dem Abteilungsleiter rutschte daraufhin ganz privat die Hand aus. Die Ohrfeige schallte über den Innenhof, sodass auch die letzten Mitarbeiter ihre Gespräche unterbrachen und sich umdrehten. Doch da gab es schon nichts mehr zu sehen. Sue verschluckte sich an einer letzten Träne, stand aber wieder gerade und stählern an ihrem Platz. Sprach leise mit ihrem Gegenüber. Danach hatte sie sich freigenommen.
Eine weitere Entgleisung hatte Douglas nicht mehr gesehen. Dabei fragt er sich manchmal, ob sie auch eine durch und durch feminine Seite hat. Gibt es in ihrem Persönlichkeitsfundus einen Vamp? In seiner Vorstellung: ja. Klar.
Der Lift tönt leise. Die Türen gleiten auf. Douglas tritt in die Kabine. Auf der kurzen Fahrt ins einundzwanzigste Stockwerk prüft er sein Spiegelbild. Ein ernstes, längliches Gesicht unter albernen blondbraunen Kräusellocken, ein Geschenk der Natur, das er nicht loswird, egal, wie sehr er es versucht – die Locken kehren zurück wie ein Bumerang. Braune Augen, zusammengezogene Brauen, prägnante Wangenknochen. Er lächelt probeweise. Es gelingt ihm nur halb, es erreicht seine Augen nicht. Die sind immer überschattet. Der Rest von ihm? Leidlich ansehnlich. Er ist nicht klein, aber gleichzeitig nicht so groß, wie er’s gerne wäre. Da ist aber immerhin kein Bauch, wie bei anderen Kollegen.
Der Lift tönt wieder, die Türen schieben sich auf. Douglas reißt sich von seiner Betrachtung los und geht schnurstracks zum Kaffeeautomaten.
Es ist nicht viel los hier oben. Es ist 10:32, die Meetings sind all überall überlaufen oder man trifft sich in den kleinen Kaffeeküchen auf den verschiedenen Ebenen, dort, wo man sich die schnelle Pause zwischendurch leisten kann.
Die Servicekraft mit den blonden Locken und dem üppigen Dekolleté, die an der Kasse sitzt, langweilt sich augenscheinlich. Sie bläst einen Kaugummi auf, lässt ihn zerplatzen, kaut, bläst erneut auf. Ihre Augen sind halb geöffnet. Für mehr lohnt sich die Mühe nicht. Als Douglas sich mit seinem Espresso nähert, richtet sie sich nur minimal auf.
»Alles, Sir?«, quäkt sie widerwillig.
»Bitte, wie?« Douglas ist abgelenkt. Die Uniformjacke der jungen Frau ist tief ausgeschnitten. Der mittlere Knopf hat sich gelöst und bietet einen interessanten Einblick.
»Ob das alles ist, Sir.« Sie nickt zu seiner Tasse.
»Ja, sicher.« Douglas stottert beinahe, fängt sich aber rechtzeitig. Dann wird er kühn. »Darf ich dich auf einen Kaffee einladen?«
Sie stiert ihn verblüfft an, fährt sich unbewusst durch das Haar. Klemmt sich eine Strähne hinter das rechte Ohr und legt dabei den Schalter um. Da kräuselt sich ihr Gesichtsausdruck, als ob Wind über eine glatte Wasserfläche rippelt. Sie steht langsam auf, legt ihren Körper in erregende Kurven und beugt sich zu Douglas hinüber. »Wenn du aus dem Kaffee einen Piccolo machst, dann gerne doch.« Ihre Stimme ist um eine Oktave gefallen, sie schnurrt mehr, als sie spricht. Douglas hebt die Brauen. So einfach ist das? Das muss er Josh erzählen. Schnell greift er in die Kühltheke gleich neben der Kassenzone und holt das Gewünschte.
Er stellt die Flasche vor sie hin.
Ein Zittern geht durch das Mädchen. Wieder streicht es sich durch die Haare, dann richtet sie ihre Uniform mit ein, zwei Handstrichen. Dabei verändert sich ihr Gesichtsausdruck erneut.
Douglas entgeht es. Zu sehr hängt er mit den Augen an ihrem Vorbau und mit der Hoffnung an dem Versprechen, das dieser darstellt. »Jetzt brauchen wir nur noch einen Ort, an dem wir ihn vernichten. Hast du eine Idee?« Er versucht, harmlos zu klingen, beiläufig. Cool. Dabei ist er alles andere als das.
»Das macht dann genau siebenzwanzig, der Herr.«
Es ist eine professionelle Freundlichkeit, die Douglas entgegenschlägt. Er schaut der Kassiererin endlich wieder ins Gesicht und weiß, dass er den Piccolo umsonst gekauft hat. Das war’s dann wohl. Er bezahlt eilends. Nimmt Tasse und Flasche und zieht sich an einen Tisch am Fenster zurück. Verdammte Kiste, beinahe hätte es geklappt. Er wischt sich über das Gesicht.
Das ist die Welt, in der er lebt. Alle sind wandelbar. Die Menschen verhalten sich situationsgerecht. Effizient. Nur wenn sie sich unbemerkt fühlen, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Doch welches ist das? Douglas blinzelt. Die Sonne scheint in das Panoramafenster, viel zu perfekt für seinen Tag.
Das Mädchen an der Kasse befindet sich nach dem kleinen Intermezzo immer noch in seinem Arbeits-Ich. Sie wirbelt durch ihren Bereich, wischt, putzt, ordnet. Der Kaugummi ist verschwunden, stattdessen spielt ein freundliches Lächeln um die Lippen. Mit dieser Freundlichkeit ausgestattet, taucht sie neben Douglas auf.
»Wünschen Sie noch etwas?« Dabei tauscht sie den halb leeren Zuckerstreuer auf dem Tisch gegen einen frisch gefüllten aus.
Douglas bemüht sich, seine Enttäuschung nicht durchblicken zu lassen. »Nein, danke.«
»Ich wünsche einen schönen Aufenthalt hier oben. Ein herrlicher Tag, nicht wahr?« Damit dreht sie sich um und verschwindet wieder hinter ihrem Tresen. Douglas sieht ihr nach. Scheinbar erinnert sich ihr Arbeits-Ich nicht an das Geschehen vor fünf Minuten. Beneidenswert.
Er kippt seinen Espresso hinunter, steht auf und ist für einen Moment unschlüssig, was er als Nächstes machen soll. Dann entscheidet er sich für den Lift. Die Arbeit wartet auf ihn.
Unten angekommen öffnen sich die Lifttüren mit einem leisen Klingen. Douglas macht einen Schritt auf den Flur hinaus, sieht sich um. Niemand da. Kein Wunder. Alle sitzen vor ihren Rechnern und machen das, weswegen sie jeden Tag hierher kommen und wofür sie am Monatsende entlohnt werden.
Sein Socket juckt. Unwillkürlich wandert seine Rechte an die Stelle hinter dem Ohr und reibt dort, wo sich die Haut vor dreißig Jahren über dem Implantat geschlossen hat. Es nutzt natürlich nichts, denn das unangenehme Gefühl entsteht an der Stelle, wo das Socket sich nach innen gewandt ans Hirn schmiegt. Er versucht aber trotzdem immer wieder aufs Neue, es abzumildern.
Während Douglas den Gang hinunter trottet, zählt er im Geiste nach, wie oft er sich in letzter Zeit hinter der Ohrmuschel gekratzt und gerieben hat und kommt zu dem Schluss, dass es zu oft war. Soll ihm das ein Zeichen sein? Er sollte das überprüfen lassen. Er hat nur kaum Geld für sein normales Leben, wie soll er da die Kosten für ein neues Implantat plus der zusätzlichen OP begleichen? Die üblichen Kontrollen hat er schon vor langer Zeit aufgegeben. Auch die waren zu teuer. Also versucht er es mit der Vogel-Strauß-Methode: Solange er nicht darüber nachdenkt, solange ist alles in Ordnung. Dabei weiß Douglas ganz genau, was es mit den Sockets auf sich hat. Er weiß auch, dass sie zwischendurch ausgetauscht werden müssen, wenn sie Ärger machen.
Douglas erreicht seine Box und setzt sich erst einmal. Mechanisch entsperrt er den Rechner, schaut auf den Monitor. Alle Systeme laufen so, wie sie es sollen.
Wieder wandert seine Hand hinter das Ohr. Er war schon fast fünf Jahre alt gewesen, als man es ihm eingepflanzt hatte. Fünf Jahre. Normalerweise bekam man so ein Interface gleich nach der Geburt verpasst, aber sein Leben war nicht normal verlaufen, jedenfalls nicht in den ersten Jahren.
Aus der Nachbarbox dringt ein leises Fluchen herüber. Josh spielt wieder und scheint gerade zu verlieren. Auch heute kann er das Kind in sich nicht verbergen, will es ja auch gar nicht. Damit nimmt er eine Sonderstellung ein im Heer der Arbeiterameisen. Douglas denkt weiter. Weiß Josh, dass es Leute wie er waren, die die ganze Geschichte mit den Sockets und den multiplen Persönlichkeiten in Gang gebracht hatten?
Es waren Gamer gewesen, die sich zuerst die Interfaces installieren ließen. Damit konnten sie ihre Spielfähigkeit potenzieren. Nur hatte das irgendwann zu dem Phänomen geführt, dass die Spielcharaktere ein Teil von ihnen wurden, ein eigenständiger Teil. Die meisten der neuen Persönlichkeiten waren Krieger, gaben dem ursprünglichen Ich mehr Stärke, mehr Schutz.
Da schaltete sich schnell die Forschung ein. Zuerst entdeckte man verschiedene neuronale Muster. Dann gelang es, diese Muster isoliert und in einer personalisierten Cloud abzuspeichern. Als es später glückte, ein derartiges Muster wieder herunterzuladen und in einen bereits bestehenden Geist zu implantieren, war der Run auf die neue Technik nicht mehr zu bremsen. Schon fragte man sich, wie und wozu man sie einsetzen könnte. Herausgekommen war ein wild florierendes Gewerbe, in dem sich Personality-Designer, Psychologen und Techniker die Hände reichten und die ersten Menschen nach Maß schufen. Auf Knopfdruck ein anderer sein – das war das Ziel.
Das Ganze nahm solche Formen an, dass die Regierung reagieren musste. So wurde das Chippen der Neugeborenen zur Pflicht, ebenso wie die Basisabspaltung des allgemeinen Arbeits-Ichs. Alle sollten die gleichen Chancen bekommen. Wer dann mehr haben wollte – mehr Persönlichkeiten, mehr Kreativität, mehr Schutz, mehr Macht –, der sollte es sich selber verdienen.
Douglas will mehr. Er will vor allem mehr Macht über sich selber haben. Aber da er nur über die Basisausstattung verfügt, gibt es nichts, das ihn vor seinen Dämonen schützt. Sobald er aus dem Arbeitsmodus wechselt, sind sie wieder da. Manchmal, wenn es wirklich schlimm wird, kann er sie auch innerhalb seines Arbeits-Ichs hören. So wie heute Morgen. Als er wissentlich seinem Nachbarn in die Augen gestarrt und dessen Wachhund bis aufs Blut gereizt hat.
Douglas nimmt die Hand, die immer noch hinter dem Ohr ruht, wieder herunter. Er sollte vielleicht doch nicht länger den Kopf in den Sand stecken.
»Denk daran, du bist jetzt gut eingestellt. Aber vergiss nicht die Übungen. Sie werden deine Persönlichkeiten stabil halten.« Keira lächelt das warme professionelle Lächeln der medizinischen Patin, und umarmt die Frau vor ihr. »Ich wünsche dir alles Gute, Santana. Pass auf dich auf.« Sie löst die Arme von schmächtigen Schultern, dreht die schwarzhaarige, stocksteife junge Frau herum und winkt dem Taxifahrer zu. »Hey, Joe! Bring Mistress Cruz nach Suburbia, Quadrant II, 63 Elvenbrook, bitte.«
Joe verfrachtet erst das Gepäck und danach seinen Fahrgast in den Wagen, dann verschwindet er in einer Staubwolke und lässt die Patin in der Uniform des Instituts für angewandte Diversität und Stabilisierung am Bordstein zurück. Die kritzelt sich mechanisch einen Vermerk auf das E-Pad in ihrer Rechten und legt dann den Schalter hinter ihrem Ohr um.
Sie zittert in der warmen Sommerluft, einen Augenblick nur. Dann hat sie sich wieder gefangen. Löst den strengen Dutt und wirft dabei einen Blick auf das E-Pad.
»Santana ist weg. Weine jetzt, später hast du keine Zeit mehr dazu. K.«
Kaynee schlingt gehorsam die Arme um sich, wiegt sich hin, wiegt sich her. Nach ein, zwei Atemzügen kommen die Tränen. Einzeln zunächst, dann immer mehr, bis der ganze Mensch erschüttert wird von Kummer und Weh. »Ich habe sie gemocht. Katy und Santana. Beste Freundinnen. Forever! Was mach ich nur ohne sie?« Das Schluchzen kommt aus tiefstem Herzen. Die dunkelbraunen Locken fallen um das schmale Gesicht, verdecken es beinahe, nehmen Katy die Sicht auf den Highway, auf dem das Taxi schon lange hinter dem Horizont verschwunden ist.
Es sind exakt vierzehn Minuten, die Katy so verbringt. Doch sie ist nicht alleine in dieser Zeit. Im Hintergrund überwachen Karen, Kora und Karl die innere Schar, immer bereit, einzuspringen. Keira hat sich vollkommen in den Hintergrund zurückgezogen, denn keiner ihrer Anteile wird in diesem Moment gebraucht. Kerry und Keith pausieren, sind zwischengelagert im Upload. Dieser Augenblick des Abschieds gehört Kay – oder vielmehr Katy, dem jugendlichen Anteil des Privat-Ichs. Denn es ist Katy gewesen, die den Kontakt zu der eben verabschiedeten Patientin hergestellt hatte. Und Katy hat alles Anrecht, den Verlust zu betrauern. Sie darf – nein, sie muss weinen, um loszulassen. Denn erst wenn sie loslässt, ist sie bereit für den nächsten Besucher, dessen Patin sie werden wird. Katy steht an der Schwelle zur Hysterie. Karen ordnet den Gebrauch eines Taschentuches an, Kora lässt Katy das E-Pad zücken und einen Vermerk darauf schreiben.
Danach schaltet sich Kassy ein, schickt Katy in den Schlaf und übernimmt die Führung. Sie bindet sich das Haar zu einem schlichten Pferdeschwanz auf, dreht sich herum und geht mit federndem Schritt die lang gezogene Auffahrt hinauf. Auf halber Strecke bleibt sie stehen, hebt die Hand, um ihre Augen vor der gleißenden Sonne zu schützen, und blickt auf das Gebäude, das sich auf einer leichten Anhöhe duckt.
Das Dach zieht sich bis zum Boden hinab, dünne Kunststoffbahnen mit integrierten Sonnenkollektoren, die den Hunger nach Energie decken, den das Institut Tag für Tag entwickelt. Es ist ein Kokon, denkt Kassy. Wir sind Raupen, wenn wir ihn betreten, und verlassen ihn als Schmetterlinge. Ein Energiegespinst, vollgepackt mit Technik, und die Menschen mitten darinnen. Wir entwickeln uns immer weiter.
Sie lächelt. Ein letztes Mal schnupft sie in das Taschentuch, dann steckt sie es weg, streicht sich die letzten Tränen aus den Augenwinkeln und nimmt ihren Weg wieder auf.
Als sie unter das Vordach tritt, gleiten die Türen automatisch auf und eine angenehme Kühle richtet ihr jedes einzelne Härchen an den Unterarmen auf. Kassy geht hinein, lauscht auf das hydraulische Seufzen hinter ihr und schlendert dann zum Empfangstresen.
Sie legt ihr E-Pad auf die Theke. »Hi, Barb, hast du Lust, meine Handschrift zu entziffern?«
Die Empfangsdame erhebt sich, zwinkert Kassy dabei zu und beugt sich über den elektronischen Notizblock. Sie liest laut vor. »Santana ist auf dem Weg in die Stadt, Keira nimmt sich für den restlichen Tag frei. Katy braucht noch Zeit.« Danach schmunzelt sie kurz. »Der Handschrift nach ist Kora mindestens ein Oberarzt«, stellt die Empfangsdame trocken fest, während sie das E-Pad zu Kassy zurückschiebt. »Danke für die Infos, ich werde Professorin Paulson in Kenntnis setzen.« Sie hält inne. »Katy hat wirklich einen fantastischen Job gemacht. Das konnte sogar ich hier sehen, und du weißt, ich habe nicht viel Ahnung von den Dingen, die ihr so treibt. Aber Santana war so … zerrissen, als sie ankam.« Barbara schüttelt den Kopf. »Ich schwatze zu viel. Sag Katy einfach nur, dass ich stolz bin auf sie. Machst du das?«
»Schreib es ihr doch. Das wird sie freuen.« Kassy schiebt Barbara wieder das E-Pad zu und hält ihr den Stift hin. »Aber bitte mit Unterschrift, sonst verwirrst du uns.«
Kassy grinst frech, dreht sich dann schwungvoll herum und sieht sich in der Halle um. Ihr Blick fällt auf einen kleinen Flachbildfernseher, der stumm in der Besucherlounge an der Wand hängt. Es läuft ein Nachrichtenkanal. Normalerweise notiert er auf dem Laufband Aktienkurse, doch heute scheint es nicht um trockene Wirtschaftsdaten zu gehen. Kassy löst sich vom Tresen und geht näher ran.
Auf einmal füllt ein großer Smiley das Bild aus. Es ist ein Plakat, wie man es hundertfach an öffentlichen Plätzen vorfindet, überall dort, wo sich viele Menschen wenig Platz teilen müssen. Das Bild wechselt. Jetzt sind es die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die auf irgendeinem chromblitzenden U-Bahnhof installiert ist. Sie zeigen einen Mann, der einen anderen zusammenschlägt. Der Angriff kommt aus dem Nichts. Eben noch stehen sie friedlich hintereinander, eingepasst in die privaten Distanzen. Dann, völlig unmotiviert, tritt der eine dem anderen in die Kniekehlen. Der lässt seine Tasche fallen und sackt in sich zusammen. Der Angreifer lässt ihn nicht in Ruhe, attackiert ihn mit Handkantenschlägen in den Nacken, tritt ihm in Rippen und Nieren. Schließlich zerrt er sein Opfer an den Haaren in eine aufrechte Position, nimmt es in den Schwitzkasten und schlägt mit der rechten Faust auf den Kopf ein.
Kassy hat so einen Ausbruch von Gewalt noch nicht mit angesehen. Sie hebt verschreckt die Hände vor das Gesicht, verfolgt das Geschehen durch das Geflecht ihrer Finger. Als sie es nicht mehr aushalten kann, verändert sich das stumme Ballett des Grauens. Zwei Mitglieder der Medical Control bahnen sich einen Weg durch die Menge, die sich, so weit es geht, von dem Schläger und seinem Opfer entfernt haben, dorthin, wo sie sich in Sicherheit wähnen. Die MedCons setzen den Angreifer mit ein paar gezielten Handgriffen außer Gefecht. Die Hände hinter dem Rücken zusammengezurrt, wird er aus dem Bild geführt. Zwei weitere MedCons kommen mit einer Bahre und transportieren das Opfer ab. Die Menschenmenge fließt danach wieder auf den Bahnsteig, als ob nichts geschehen wäre.
Keiner von ihnen hat eingegriffen, denkt Kassy, sie schützen sich, ja – aber es fröstelt sie trotzdem.
»Ein Wilder«, hört sie da hinter sich.
»Sanders!« Kassy löst sich von dem Monitor und dreht sich herum. Ihr Pferdeschwanz hüpft dabei auf und ab.
Sanders sieht es und grinst. »Hi, Kaynee. Vertritt Kassy heute die Meute?«
»Ja. Katy braucht Ruhe. Ich habe genug getan in den letzten Wochen. Da steht mir ein gestohlener freier Tag wohl zu.«
Kaynee kraust die Nase und lächelt. Bei jedem anderen hätten diese Worte den Eindruck eines zänkischen Wesens hinterlassen, ihr jedoch hört man weder Stress noch Ungemach an. Das ist Kaynees große Kunst: Sie scheint das Leben mit einer beispiellosen Leichtigkeit zu meistern, in dem sie es einfach nicht persönlich nimmt. Sie hat diese Art, Hindernisse mit einem Lachen auszuräumen. Und sollte sie einmal die Hürde nicht nehmen können, dann sucht sie den Weg darum herum.
Sanders grinst dämlich, bis er sich selbst dabei ertappt. Schon schreitet sein Fürsorger ein und stellt die Gesichtszüge auf die gewünschte Coolness ein. Er sieht wieder zu dem stummen Bildschirm hinüber.
»Ein Wilder«, wiederholt er. »Dass es immer noch welche von ihnen gibt …« Er schüttelt den Kopf.
»Was meinst du damit?« Kaynee sieht wieder zum Fernseher.
Die Bilder laufen in einer Endlosschleife. In diesem Augenblick geht der Angegriffene erneut in die Knie. Kaynee schließt die Augen und wendet sich lieber Sanders zu. Sie stößt ihn leicht am linken Oberarm an. »Nun sag schon. Ich möchte nicht dumm …«
Sie bricht ab. Irgendwie erscheinen ihr die Worte in der Gegenwart der Geschehnisse hinter ihr auf einmal unpassend. Wer weiß schon, ob das Opfer den Angriff überleben würde? Kaynee nicht, so viel steht fest.
Sanders bemerkt ihr Unbehagen. »Lass uns in die Kantine gehen. Ich brauche einen Kaffee. Und dabei kann ich dir etwas von fehlgeschlagenen Aufspaltungen erzählen. Wenn du das an deinem freien Tag überhaupt hören möchtest.« Er zieht spielerisch an ihrem Pferdeschwanz.
»Lass das!«, ertönte es prompt, dann hakt sich Kaynee bei ihm ein und lacht ihn an. »Erzähl mir alles, was du weißt. Solange ich meinen Chilishake dabei trinken kann, ist mir alles recht.«
Ein paar Augenblicke später sitzen beide im Außenbereich der Kantine. Kaynee rutscht in ihrem Stuhl ein Stück hinunter, bis der Kopf auf der Rückenlehne Halt findet. Die Beine werden kurzerhand in die Höhe gestreckt und auf der Brüstung abgelegt, die die freischwebende Terrassenkonstruktion umgibt. Sie faltet die Hände über der Magengrube, schließt die Augen und wendet ihr Gesicht der Sonne zu.
Sanders beobachtet sie dabei. Wieder schleicht sich ein Lächeln auf seine unscheinbaren Züge. »Fertig?«, fragt er schließlich.
Kaynee hebt einen Daumen. »Ich höre.«
Sanders hebt die Hand zum Ohr und switcht sich in den Arbeitsmodus. Einen Moment später tritt Dozent Sudresh in den Vordergrund.
»Die Wilden also.« Sudresh starrt auf den sanft abfallenden Hang und denkt nach. Dann lehnt er sich zurück, streckt die Beine von sich und fängt an. »Du weißt ja, dass die Entität im postnatalen CADIAS in das Privat-Ich und das Arbeits-Ich aufgespalten wird. Dort werden die Grundlagen für das spätere Persönlichkeitsset gelegt. Die beiden neuronalen Hauptcluster, die dann später weiter gesplittet werden können, ganz nach Wunsch. Bevor die Kiddies in die Krippe kommen, bekommen sie ihr erstes Implantat und werden darauf geschult, den Schalter umzulegen und damit vom Sozialmodus in den Freizeitbereich zu wechseln und umgekehrt. Das war bei dir so, bei mir auch. Bei allen, die du kennst.«
Kaynee nickt leicht. Das ist Grundlagenwissen. Dass Sudresh immer denkt, dass alle anderen nur Idioten seien. Sudresh scheint ebenfalls davon auszugehen, dass all die Minderbemittelten um ihn herum schwerhörig sind. Er spricht stets lauter als nötig und immer in einfachen Sätzen. Kaynee hebt eine Braue und spürt, wie sich Widerstand in ihr breitmachen will. Da greift Kora sanft ein und erstickt Kassys Aufbegehren im Keim.
Sudresh bekommt derweil von den widersprüchlichen Gefühlen seines Einpersonenpublikums nichts mit – wie üblich. Er ist eine emphatische Niete, ein kleiner Asperger, nichts, was ihn selber aus dem Tritt bringt. Also fährt er ungerührt fort: »Normalerweise ist dies die Grundversorgung, die der Staat übernimmt. Aber es gibt immer wieder Eltern, die meinen, dass sie alles besser können. Oder, die ihre Kinder vor den postnatalen CADIAS’ schützen wollen. Individuen, die am Rande der Gesellschaft leben, versuchen immer wieder, sich dem System zu entziehen. Was sie dabei vergessen, ist Folgendes: Wird eine Aufspaltung nicht oder fehlerhaft durchgeführt, dann wird das Kind, oder besser gesagt, der Heranwachsende allein von den sozialen Umständen geprägt. Das kann gut gehen – tut’s aber oft nicht. Irgendwann kommt es zu Gewaltausbrüchen. Dabei ist es unerheblich, ob sich die Gewalt gegen andere oder den eigenen Körper richtet. Eines ist ihnen gemeinsam – sie sind Zeichen einer ungezügelten Seele, die sich in ihrer Hilflosigkeit nicht anders zu helfen weiß.«
»Und darum geben wir ihnen einen Rückzugsort? Aber ist das nicht eigentlich ein Einsperren, was wir hier machen?« Kaynee öffnet die Augen und sieht zu Sudresh hinüber. »Die Seelen. Warum lassen wir ihnen nicht allen Raum, den sie brauchen, und geben ihnen eine andere Art von Hilfe an die Hand? Etwas Langfristiges, etwas Begleitendes?«
»Weil der Raum für Individuen knapp geworden ist.« Sudresh bleibt nüchtern. »Die demografischen Fakten sprechen für sich. Wir sind zu viele geworden. Damit jeder so gut wie möglich leben kann, sind wir auf feste soziale Regeln angewiesen. Wo aber der Kompromiss regiert, kann es keine persönliche Freiheit geben.«
»Aber warum geht es uns denn dann trotzdem so gut? Warum kann ich dann glücklich sein?« Kaynee richtet sich in ihrem Stuhl wieder auf und schwingt die Füße von der Brüstung.
»Das liegt eben daran, dass du nicht nur mehr nur eine bist, sondern viele. Und jede deiner Persönlichkeiten verarbeitet die Realität anders, geht mit Enttäuschungen und anderen Erlebnissen verschieden um. Du nutzt dich auf so viele unterschiedliche Arten, dass man schon sagen kann, deine Freiheit liegt in dir selbst. In deiner Entität.«
Kaynee sieht Sudresh aus großen Augen an. Sie hat ihre Meute immer als selbstverständlich angesehen, aber niemals als Schlüssel zur Freiheit. »Ich glaube, ich bin nicht ganz mitgekommen.« Sie nimmt einen Schluck des Chilishakes. Die Schärfe in ihrer Kehle tut gut.
Sudresh setzt zu einer Erklärung an. Weiß aber nicht, wie er weiter machen soll. Bei so viel Begriffsstutzigkeit fehlen ihm einfach die Worte. Saul schaltet sich ein, Sanders’ Fürsorger. Er sorgt dafür, dass Sanders sich wieder in den Privatmodus stellt. Sanders’ Twen sitzt zwei Sekunden später Kaynee gegenüber, geschlagen mit aller Zuneigung, die er für die junge Frau hegt. »Wo sind wir stehen geblieben?« Er klingt etwas verwirrt, Saul hat so schnell eingegriffen, dass Sudresh keine mentale Notiz vornehmen konnte.
»Die Freiheit liegt in der Entität«, souffliert Kaynee. »Willkommen, Steve.«
»Ah, gut.« Steve zwinkert Kaynee zu. Dann räusperte er sich: »Nimm doch einmal den Abschied heute Morgen.«
Kaynee nickt leicht.
»Hättest du nicht deine fest umrissenen Persönlichkeiten, dann hätte Katys Trauer Keiras Professionalität beeinträchtigt. Du hättest Santana vielleicht die falschen Worte mit auf den Weg gegeben. Du hättest sie aus deiner eigenen Befindlichkeit heraus mit deiner Trauer belastet. So konntest du erst das eine machen – nämlich deinen Job. Und das andere kam danach. Ich hab dich doch gesehen, als du zurückgekommen bist. Katy hat geheult wie ein Schlosshund – was gut ist! Was so sein muss!« Sanders schiebt den Kaffeebecher beiseite und streckt Kaynee seine Rechte hin. »Wenn Katy noch jemanden zum Reden braucht. Sag ihr, ich bin da.«
Kaynee sieht auf seine Hand, streicht dann leicht mit den Fingerspitzen über seinen Handteller. »Danke für das Angebot. Aber ich glaube, sie will alleine mit sich sein.« Sie zieht ihre Hand zurück und sieht Sanders offen an. »Ist das die Freiheit, die du meinst? Nicht getrieben zu sein?«
Er nickt.
»Dann liebe ich meine Freiheit.« Kaynee sieht den Abhang hinunter, auf dem ihr Arbeitsplatz ruht. »Es wird ein heißer Tag werden. Ich werde mich lieber zurückziehen.« Sie erhebt sich. »Danke für deine Zeit, Sanders. Wir sehen uns spätestens, wenn ich mein nächstes Patenkind bekomme.«
Als Kaynee fort ist, greift Sanders sich hinter das Ohr und switcht Sudresh wieder in den Vordergrund. Denn Sudresh kann nicht nur gut erklären, er kann auch am besten alleine arbeiten. Und da Sanders noch Datenpflege betreiben muss, eine einsame und an sich verhasste Arbeit, gibt es niemand besseren dafür als eben Sudresh.
Außerdem hält es sein Fürsorger für notwendig, ihn von Kaynee abzulenken. Die ungeklärte Situation zwischen ihnen beiden macht Sanders schon seit einiger Zeit zu schaffen. Während ihm immer klarer wird, dass es mehr als Freundschaft auf seiner Seite ist, auf Steves Seite, weiß er nicht, was sie in Bezug auf ihn denkt oder fühlt. Er hat sich sogar schon dabei ertappt, eine flüchtige Abspaltung herbeiführen zu wollen, eine Persönlichkeit zu formen, die nichts anderes machen soll, als Kaynee endlich zu fragen, was Sache sei. Ein Nein könnte er auf diese Weise schneller verarbeiten. Und dann, wenn man die neuronale Clusterverschiebung nicht weiter verfolgte, könnte das verlorene Ich in die Cloud eingehen und niemals wieder reaktiviert werden. So eine saubere Lösung, denkt Sanders.
Nur machbar ist sie nicht. Niemand wird ihm die Energie genehmigen, die die Maschinen verbrauchen würden. Zudem wäre das Ganze ohne Überwachung eine ungesicherte Abspaltung und die Gefahr ist zu groß, dass etwas schiefläuft. Er will nicht als Wilder enden. Als Lost Soul, eingesperrt in einer Forschungseinheit, oder, was noch schlimmer wäre, in einer öffentlichen Verwahrstelle.
Sanders steht auf, bringt das Tablett mit seinem Becher und Kaynees Glas zurück zur Theke, bedankt sich förmlich und macht sich auf den Weg zu seinem Labor. Dabei muss er das Entree erneut durchqueren.
Als er am Panoramafenster vorbeikommt, sieht er kurz nach draußen. Er stockt. Vor dem Tor fährt gerade ein Wagen des MedCon weg. Das dunkelblaue Gefährt mit dem weißen Dach verschwindet in einer Staubwolke, wie das Taxi zuvor, das Santana in eine neue, friedlichere Welt gebracht hatte. Kaynee hat recht, es würde in der Tat ein heißer Tag werden.
Als Sanders im linken Flur verschwindet, der zu den Laborräumen und Traumakapseln führt, denkt er nüchtern über den Fall Santana nach.
Das schwarzhaarige, dünne Mädchen hatte ein defektes Implantat gehabt. Der Schalter hatte einen Wackelkontakt, was dazu führte, dass sich die Hauptcluster nicht mehr voneinander lösen ließen. Ihre Persönlichkeiten waren immer mehr miteinander verschmolzen, letztlich hatten nur noch Fürsorger, Organisator und der allgegenwärtige Wachhund ihren Dienst getan. Allerdings hatten sie sich gegenseitig blockiert, sodass sich das Mädchen zum Schluss in seinem Kleinraumapartment verschanzt hatte, voll Angst, ohne Vertrauen zu sich oder der auf einmal bedrohlich wirkenden Umwelt, ohne Lebensmittel. Nachbarn hatten die Medical Control gerufen, nachdem sie das Mädchen über Stunden schreien hörten. Man hatte sie vorgefunden, mit blutigen Händen, wie sie versuchte, sich das nutzlos gewordene Implantat aus dem Schädel zu graben.
Man hatte sie hierher gebracht, nach Zenith, zu Professorin Paulson. Und damit zu Kaynee und auch zu ihm. Das Team ist perfekt aufeinander eingespielt und genießt bei MedCon eine hohe Wertschätzung, Professorin Paulsons wegen. Daher bekommen sie von den Notfalldiensten nur noch die interessanten Fälle. Keine herkömmlichen Aufspaltungen zur Vollendung des Persönlichkeitssets oder Notfall-Cloud-Absicherungen.
Dazwischen aber nimmt Professorin Paulson immer wieder Patienten an, die mit sehr viel Geld versehen sind und die unbedingt noch eine weitere Persönlichkeit haben wollen. Diese schlummert dann in der Meute – schlummert, bis sie auf Knopfdruck zum Einsatz kommt. Die Männer wollen zumeist einen juvenilen Anteil ihres Sexual-Ichs generieren. Das kommt immer besser als irgendein potenzsteigerndes Mittelchen und hat keine Nebenwirkungen. Die Frauen scheinen in der Masse zufriedener mit dem, was sie haben.
Sanders überlegt kurz. Nein, er hatte noch keine reiche Lady auf dem Stuhl. Seltsam, dass ihm das nie aufgefallen ist. Sanders geht weiter. Die Professorin finanziert mit den Reichen die Pro-bono-Fälle wie Santana.
Pro bono. Sanders schnaubt. Tue Gutes und schweige darüber. Schweige laut und medial, damit es alle mitbekommen. Es funktioniert. Zenith hat lange Wartelisten.
Sanders verdrängt die Listen und konzentriert sich wieder auf Santana. Er muss ihre runderneuerten Daten sichern, verkapseln und Maggie Finch übergeben. Er mag Maggie nicht. Oder gilt seine Abneigung der Institution, die sie verkörpert?
Dabei gibt es an dem Amt für Identitätsschutz, der IPA, nichts auszusetzen. Es ist notwendig geworden, nachdem anfänglich reichlich Schindluder mit Identitätsdiebstahl und Persönlichkeitsschmuggel getrieben worden war. Auf dem Schwarzmarkt hatte es bald nach Erfindung der Persönlichkeitsspaltung einen florierenden Handel mit Sexualsplits gegeben. Dabei waren das meist Hinterhofproduktionen, die, schlecht und stümperhaft gemacht, nur Schaden anrichteten. Die Ursprungsmenschen, denen das gewünschte Muster für den unbekümmerten Playboy, das nymphomanische Weib oder das, was man sich unter einer leidenschaftlichen Hure vorstellte, aus dem Kopf geraubt wurde, waren hinterher kaum lebensfähig. Als »Lost Souls« wussten sie nicht mehr, wer sie waren oder wohin sie gehörten. Diejenigen, die sich die fremden Muster aufspielen ließen, wurden die Geister nicht mehr los, die sie sich aufgeladen hatten. Die Technik war damals noch nicht so raffiniert wie heute. Man konnte anfänglich noch nicht kopieren. Man konnte zunächst nur stehlen. Und nicht wieder zurückgeben. Damals war die Identity Protection Agency aus einer Sondereinheit der Polizei heraus entstanden. In kürzester Zeit wuchsen die über das ganze Land verteilten Einheiten zu einem übermächtigen Wesen heran.
Neben den mobilen Einsatzkräften, die immer noch tagtäglich die Bezirke überwachen, teilt die IPA auch jedem CADIAS wenigstens einen stationären Beobachter zu. Denn in den heutigen, komplett vernetzten Zeiten, ist ein Neuronalmuster der Schlüssel zu jeder Art von Konto, zu Informationen. Zu Computerprofilen. Das Verbrechen hat sich verlagert. Daher wird nach jedem neuen Splitting, Refurbishing oder Back-up das neuronale Muster abgespeichert, eingekapselt und zur Verwahrung an die Datenkrake übergeben. Es dient dem Schutz der Privatsphäre, so sagt man. Man. Man. So sagt man.
Sanders bleibt vor der Tür zu seinem Labor stehen und zückt die ID-Card.
Eine nüchterne Stimme ertönt da in seinem Rücken. Ein Hauch von Tadel schwingt darin mit, aber nicht so offensiv, dass Sanders’ Wachhund anschlägt. »Da sind Sie ja, Sanders. Ich warte schon seit heute Morgen auf die Daten.«
»Miss Finch. Ich habe eben an Sie gedacht.« Er dreht sich zu ihr herum. »Sie bekommen, was Sie wollen. Geben Sie mir zwei Stunden.«
»Nicht eine Minute mehr. Sie wissen, dass ich jede Verzögerung begründen muss. Und ich würde Ihrem Ruf nur ungern … schaden.« Maggie hebt die rechte Braue ein Stück und schürzt die kirschroten Lippen. Dann tritt sie einen Schritt auf Sanders zu und legt dabei ihren Körper in eine dezente S-Kurve. »Ich bekomme also, was ich will, ja? Halten Sie Ihr Wort, Sanders?«
Sanders runzelt die Stirn. Sudresh weiß nicht, wie er auf Maggie reagieren soll. Seine Hilflosigkeit aktiviert Sanders’ Wachhund. »Ich glaube, Sie sollten wieder in Ihren Arbeitsmodus wechseln«, sagt der kühl. »Bevor Ihr guter Ruf Schaden nimmt.« Damit hat der Wachhund genug Laut gegeben, er zieht sich in den Hintergrund zurück, während sich Sudresh wieder zur Tür dreht, die ID-Card vor den Sensor hält und in seinem Labor verschwindet. Die Tür schließt sich mit dem gleichen leisen hydraulischen Seufzen, wie es beinahe allen Türen in dem Gebäude gemein ist.
Maggie Finch wechselt das Standbein, tut so, als ob sie sich den kurzen blonden Bob richten würde, und legt dabei dezent den Schalter hinter ihrem Ohr herum. Dann dreht sie sich abrupt um und geht den Flur hinunter, zu ihrem eigenen Büro. Die Ablehnung ist drei Meter weiter schon vergessen, jetzt hat sie sich um Zeitpläne, Berichte und Sicherheitsstufen zu kümmern.
Als Douglas am Abend wieder in die U-Bahn einsteigt, hat er den guten Vorsatz, sein Socket überprüfen zu lassen, wieder vergessen. Sue hatte ihn aus seinen Überlegungen gerissen, hatte ihm ein Extraprojekt zusätzlich zum Reporting aufgehalst.
Jetzt ist er müde und erschöpft. Die Augen schmerzen von der Bildschirmarbeit, der Kopf ist leer. Womit wird er sich die Zeit vertreiben, wenn er zu Hause ankommt? Er weiß es nicht. Vielleicht etwas lesen, vielleicht etwas zocken. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass er mit einem Bier vor der Videowall einschlafen wird, nur um mitten in der Nacht aufzuwachen und ins Bett zu gehen.
Douglas hat keine Freunde. Im Höchstfall sind es Bekannte, im Regelfall Typen, die er auf seinen eingefahrenen Wegen immer wieder sieht. Sei es der Besitzer des Imbissstandes, der Wachmann seines Blocks oder die Putzfrau in der Firma. Man grüßt sich, wünscht sich einen guten Tag, das war es aber auch schon. Die Sozialpersönlichkeiten sind allesamt mit einer Grundfreundlichkeit ausgestattet, ansonsten aber auch mit einer gehörigen Portion Distanz zum Gegenüber.
Jetzt ist allerdings Feierabend. Die Distanz schwindet, die Menschen drängen sich in der Bahn, die Stimmung ist heiter oder gereizt. Douglas hat seine Hand in eine der Halteschlaufen gehängt und die Augen geschlossen. Er will sie nicht sehen, die anderen. Da wird er angerempelt.
»Hey, Mann, mach Platz. Die Lady muss zur Tür durch.«
Douglas macht einen Schritt zur Seite, die Augen sind noch immer geschlossen. Er will gar nicht wissen, wer da was von ihm fordert. Das ist seine Form des Protestes.
Ein Mensch presst sich an ihm vorbei, und nein, was Douglas da fühlt, ist nicht weiblich. Für einen Moment kotzt ihn die Welt an, in der er lebt. »Lady!« Er schnaubt verächtlich.
Douglas hat Glück, der Wachhund des fetten Typs hat es nicht gehört. Beschwingt verlässt der die Bahn und wendet sich dem Ausgang zu. Mit einem verruchten Lächeln auf den wulstigen Lippen fährt der Fremde auf dem Rollband der Oberfläche entgegen. Die Lady ist ein Vamp.
Douglas steigt eine Station später aus. Die Mauern des Gettos kann man von hier aus nicht mehr sehen, aber sie sind dennoch nahe und manchmal, wenn der Wind von Süden kommt, kann man es riechen. Es ist Douglas immer eine Mahnung, noch härter zu arbeiten, damit er niemals wieder dort landen wird. Denn es ist wahr – er wurde dort geboren.
Douglas wischt sich über die Augen. Er will nicht an das Getto denken. Er will vor allem nicht an seine Eltern denken. Ohne ihren Tod wäre er vielleicht niemals in Suburbia gelandet. Müsste jeden Morgen um den streng reglementierten Einlass in die City kämpfen, um irgendeinen Job zu machen. Douglas sperrt diese Gedanken endgültig aus.
Er schließt die Tür auf, tritt in das Halbdunkel seiner halbwegs komfortablen Einraumvierzonenwohnung. Es geht eine Stufe hinunter, schon steht er im Wohnzimmer, eine Couch, ein Sessel, ein Tisch auf einem verschlissenen Läufer. Sechs Schritte geradeaus ist er am Arbeitsplatz vorbei in der Küche angelangt. Diese besteht aus einer Spüle, einem halbhohen Schrank, auf dem zwei Induktionskochplatten und ein kleiner Ofen stehen, sowie einigen Regalen, mit Lebensmitteln gefüllt. Rechter Hand liegt die Schlafnische mit Bett und Kleiderschrank, mit einem halbhohen Bücherregal vom Rest der Wohnung abgetrennt. Von dort aus geht es ins angrenzende, schlauchförmige Badezimmer.
Douglas hat seine Tasche auf dem Schreibtischstuhl abgelegt, seine Jacke auf das Bett gepfeffert und wäscht sich nun im Badezimmer das Gesicht mit kaltem Wasser ab.
Wie soll es weitergehen? Er würde gerne reden. Aber mit wem? Wer wird zuhören wollen, wenn er von Programmen erzählt, die Zahlen und Informationen verwalten?
Er trocknet sich ab, geht zum Arbeitsplatz. Er nimmt sein Smartphone aus dem Office-Bag und steckt es in die Dockingstation. Mit einem Brummen erwacht es zum Leben. Der gläserne tischbreite Monitor schnurrt in die Höhe, bis er mit einem leisen Klacken in der Endposition einrastet. Einen Moment später erscheint die Benutzeroberfläche auf der Scheibe. Douglas greift hinter sich und öffnet den Kühlschrank. Tastet im Türregal herum, erwischt einen kalten Flaschenhals, zieht das Bier heraus und tritt mit dem linken Fuß hinter sich. Die Kühlschranktür ist wieder geschlossen.
Auf dem Bildschirm tummeln sich Werbung und eine KI-generierte Übersicht über Themen, die Douglas interessieren könnten. Heute jedoch will er nicht einem einzigen Link folgen. Mechanisch öffnet er sein Bier und nimmt den ersten Schluck. Setzt die Flasche ab und lauscht in sich hinein. Noch ist alles still. Zu still.
2.
Der Sturm treibt mich vor sich her, ich taumle durch die Dunkelheit. Ein Brausen umgibt mich, es tost, es rauscht. Der Atem wird mir von den Lippen gerissen. Ich schnappe nach Luft, laufe, renne. Reiße die Augen auf, doch es bringt nichts. Um mich herum ist alles tintenschwarz. Irgendwann verliere ich die Schuhe, erst den linken, ein paar Stolperer später den rechten. Festgebackener Sand scheuert an den nackten Sohlen. Ich bleibe stehen, stemme mich gegen den Wind. Schmerz schießt mir ins rechte Knie und ich schreie ihn in den Sturm hinaus.
Als beides vergangen ist, Schmerz und Schrei, weggefegt von einer Böe, verändert sich die Geräuschkulisse. Der Sturm nimmt ab, dafür höre ich jetzt Wellen, die donnernd an den Strand schlagen. Salz legt sich auf die trockenen Lippen, verkrustet dort. Alles wird klamm und kalt, ich zittere. Meeresschaum und Sand fegen über den Boden und brechen sich nass und körnig an meinen Knöcheln.
Dieses Aufatmen währt nicht allzu lange, schon gewinnt der Wind wieder an Stärke und schiebt mich über den Strand. Der Sand wird feuchter, die Brandung klingt näher. Wenn ich mich nicht endlich aufbäume, werde ich ins Meer gejagt. Werde zum Spielball der Wellen, die mich über den nassen rauen Sand schleifen, solange bis nichts mehr von mir übrig bleibt. Zerrieben, zerstört, vernichtet.
Inmitten des Tohuwabohus erklingt ein Lachen. Ein hämisches, keckerndes Lachen.
Ich erkenne es wieder und frage mich für einen Moment, auf welchem Weg es an diesen verfluchten Ort gefunden hat.
Sollte es nicht in mir eingesperrt sein?
Der Wind flaut ab. Die Wellen ziehen sich zurück. Die Dunkelheit reißt auf und gibt den Blick auf einen einsamen Strand frei. Das Lachen springt über Muschelschalen und angelandetes Treibgut. Es flieht einen schmalen Pfad hinauf, der sich über Felsen windet und bis zum Scheitelpunkt der Steilklippen hinaufführt. Dort verliere ich es aus den Ohren.
Ein Hauch von Lavendel weht mir um die Nase und ich weiß, dass ich den gleichen Weg werde nehmen müssen. Wer weiß schon, was mich hinter den Klippen erwartet …
Als Douglas am Morgen in die Bahn steigt, ist er unruhig. Noch immer spürt er den Sand an den Knöcheln, ein Mitbringsel des verwirrenden Traumes der letzten Nacht. Das Lachen beunruhigt ihn. Es hat sich fortgestohlen, ist verschwunden. Er weiß nicht, was er davon halten soll, ob er sich befreit fühlen darf oder ob er besorgt sein soll. Was wird es ohne ihn anstellen. Wird er Dinge tun, an die er sich nicht erinnern kann? Hat er die Kontrolle verloren?
Abwesend starrt er aus dem Fenster. Die Bahn taucht in die Tiefe ab, rast an den inzwischen verwaisten Stationen vorbei, mit denen das Getto einst an die Strecke angeschlossen war. Die Namen sind ausradiert worden, jetzt sind es nur noch römische Ziffern, die die Abfolge kennzeichnen. Bei VI schreckt Douglas auf. Sie befinden sich unter dem Herzen des Gettos. Seine Eltern haben hier gelebt, genau hier. Mommy? Douglas beißt die Zähne zusammen. Er will sich nicht an sie erinnern. Das hat noch nie gutgetan.
Schon will er die Augen verschließen vor den ungewollten Bildern, als ihm jäh bewusst wird, dass dies zwar ein probates Mittel ist, um der Außenwelt zu entfliehen, den Erinnerungen aber Tür und Tor öffnet. Also zieht er die Augenbrauen hoch, damit die Lider nur ja nicht zueinanderfinden und ihn in der Dunkelheit mit sich selbst allein lassen. Übelkeit überfällt ihn. Die Regung, einfach auszusteigen, um die nächste Bahn zurück zu nehmen, wird schier übermächtig.
Aber die Bahn rast weiter durch die Dunkelheit, vorbei an den vernagelten Stationen. Ein simples Umsteigen ist hier schon lange nicht mehr möglich. Er wird diesen Druck aushalten müssen, bis zum bitteren Ende. Seine Hand verkrampft sich um den Haltegriff, er schaukelt mit der Bahn, die sich in die Kurve legt. Irgendjemand hat weiter vorne das Fenster aufgemacht, Fahrtwind springt ins Abteil, zieht mit kalten Geisterfingern über Dougs Gesicht. Er wird diese Berührung den ganzen Tag spüren.
Kaynee liebt ihr Bett, an freien Tagen sogar mehr als üblich, denn niemand zwingt sie aus den Federn. Das ist ihr ganz persönlicher Luxus in den Zeiten, in denen sie keinen Besucher zu betreuen hat. Heute ist Freitag – und es fühlt sich an wie Sonntag. Kaynee blinzelt aus den Federn in die helle Sonne und lächelt.
Nach Santanas Abschied gestern hat ihr die Professorin noch keinen neuen Menschen an die Seite gestellt. Professorin Paulson ist es wichtig, dass man die Seelen, die sich hier einfinden, niemals als Nummer oder als Fall sieht. Sie betont immer, dass es sich hier um Menschen handelt – Menschen mit Wünschen, Sorgen, Nöten.
Für Kaynee war das eine Umgewöhnung gewesen. Bevor sie nach Zenith gekommen war, hatte sie für ein kleineres städtisches CADIAS gearbeitet, in dem sie kaum eine Minute für sich gefunden hatte. Dort musste sie bisweilen drei Fälle gleichzeitig betreuen. Irgendwann hatte Karen gestreikt und Kora die Kündigung schreiben lassen. Als Kaynee sich unverhofft auf der Straße wiedergefunden hatte, war ihr dann die Anzeige von Zenith in die Hände gefallen. Was hatte sie schon zu verlieren gehabt? Nichts. Also war sie mit ihrem Koffer hierhergekommen, bereit, alles auf eine Karte zu setzen.
Kaynee schiebt den Arm unter das Kissen, dreht sich auf die Seite und schließt die Augen. Ihre Gedanken kehren wieder in die Vergangenheit zurück.
Als sie damals dem Taxi entstiegen war, das sie von der Bahn hierher ins Nirgendwo gebracht hatte, stolperte sie förmlich über einen Bär von Mann, der sich in blanker Wut gegen die gläserne Eingangstür warf. Kaynee konnte es sich selbst jetzt, drei Jahre später nicht erklären, warum ihre Meute so gehandelt hatte, aber letztlich hatte Katy, die jüngste unter ihnen, den Hünen an der Hand genommen und war mit ihm losgegangen. Sie umkreisten einmal den gesamten Komplex und Max, der Bär, redete, schwieg. Redete wieder. Katy hörte zu oder machte Witze. Max entspannte sich zusehends in ihrer Gegenwart. Sie funktionierten gut miteinander, und als sie wieder am Haupteingang eintrafen, wartete Professorin Paulson bereits auf das ungleiche Paar. Sie nickte Kaynee kurz zu, deutete an, dass sie doch bitte im Entree warten solle und verschwand an Max’ Seite in den Tiefen von Zenith.
Kaynee lächelt, als sie sich an Max erinnert. Das erste Patenkind in einem neuen Zentrum vergisst man nie, heißt es, und da ist was Wahres dran.
Da geht ein Zucken durch Kaynees Geist, es ist, als ob sich da jemand anderes in den Vordergrund schieben will.
»Er war ein toller Kerl«, raunt es in ihrem Kopf. »So stark und so willig.« Ein dunkles Lachen folgt.
»Oh nein«, murmelt Kaynee. »Halt dich zurück. Mach mir nicht den Morgen kaputt.«
Ein missbilligendes Schnalzen klingt in ihr wider.
Kaynee beschließt, es zu ignorieren. Schon seit einiger Zeit muss sie immer wieder zu diesem Trick greifen. Es ist, als ob Nachbilder ihrer verschiedenen Anteile durch ihren Geist ziehen oder, was schlimmer wäre, ein Eigenleben entwickeln.
Sie streckt sich ausgiebig. Ein paar Tage Freizeit würden ihr und der Meute sicherlich guttun, einfach mal unbeschwert vor sich hinleben und sich dabei nur um sich selbst kümmern. Das wär’s!
Kaynee schüttelt ihre Haare zurück. Die Sonne steht inzwischen kurz vor dem Zenit und ein lauer Wind lässt die Markise leise knattern. Es ist ein heißer Tag, ein trockener Tag, so wie der Tag zuvor und so wie wohl auch der nächste Tag sich zu werden anschickt. Tage, die das Leben ausdorren.
Kaynee wirft sich wieder ins Kissen zurück, dreht sich auf den Bauch und greift sich hinter das Ohr. »Kora«, denkt sie kurz, dann switcht ihr Bewusstsein bereits in das der allgegenwärtigen Organisatorin.