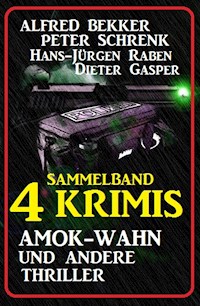
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sammelband 4 Krimis: Amok-Wahn und andere Thriller von Alfred Bekker & Peter Schrenk & Dieter Gasper & Hans-Jürgen Raben Der Umfang dieses Buchs entspricht 896 Taschenbuchseiten. Krimis der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre. Mal provinziell, mal urban. Mal lokal-deutsch, mal amerikanisch. Und immer anders, als man zuerst denkt. Dieses Buch enthält folgende drei Krimis: Hans-Jürgen Raben: Das Gesetz in die eigenen Hände genommen Peter Schrenk: Die Konferenz von Reading Dieter Gasper: Cremeschnitten sind aus Alfred Bekker: Amok-Wahn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1196
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Sammelband 4 Krimis: Amok-Wahn und andere Thriller
Alfred Bekker et al.
Published by Cassiopeiapress/Alfredbooks, 2018.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Sammelband 4 Krimis: Amok-Wahn und andere Thriller
Copyright
Das Gesetz in die eigenen Hände genommen: N.Y.D. - New York Detectives
Copyright
Die Hauptpersonen des Romans:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Die Konferenz von Reading
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Cremeschnitten sind aus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
AMOK-WAHN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Also By Alfred Bekker
Also By Peter Schrenk
Also By Dieter Gasper
Also By Hans-Jürgen Raben
About the Author
About the Publisher
Sammelband 4 Krimis: Amok-Wahn und andere Thriller
von Alfred Bekker & Peter Schrenk & Dieter Gasper & Hans-Jürgen Raben
Der Umfang dieses Buchs entspricht 896 Taschenbuchseiten.
Krimis der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre.
Mal provinziell, mal urban. Mal lokal-deutsch, mal amerikanisch. Und immer anders, als man zuerst denkt.
Dieses Buch enthält folgende drei Krimis:
Hans-Jürgen Raben: Das Gesetz in die eigenen Hände genommen
Peter Schrenk: Die Konferenz von Reading
Dieter Gasper: Cremeschnitten sind aus
Alfred Bekker: Amok-Wahn
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2018 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Das Gesetz in die eigenen Hände genommen: N.Y.D. - New York Detectives
Krimi von Hans-Jürgen Raben
Der Umfang dieses Buchs entspricht 125 Taschenbuchseiten.
Alle Opfer hatten eins gemeinsam: Sie waren Verbrecher und Gauner, aber sie wurden nie verurteilt, weil man ihnen nie etwas nachweisen konnte. Bis ein Unbekannter, den die Presse den „Henker“ nennt, das Gesetz in die eigene Hand nahm und sie mit dem Tode bestrafte. Als Ken Woods getötet wird, beauftragt sein Vater den Privatdetektiv Bount Reiniger, den Mörder seines Sohnes zu finden. Denn er traut der Polizei nicht, schließlich deutet alles darauf hin, dass der Killer einer aus den eigenen Reihen ist ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2018 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Die Hauptpersonen des Romans:
Der „Henker“ - Er nahm das Gesetz in die eigene Hand und wurde damit selbst zum Verbrecher.
Lieutenant John O’Keefe - Er musste ein Phantom jagen, das über jeden seiner Schritte informiert war.
Ken Woods - Er war nur durch eine Dummheit auf die schiefe Bahn geraten, aber der „Henker“ kannte kein Erbarmen.
Jonathan Woods - Er beauftragte Bount, den Killer seines Sohnes zu finden.
Giacomo Angelo - Der Gangsterboss hatte auf der Abschussliste des „Henkers“ einen Ehrenplatz.
Lee Hall - Er war den Gangstern im Weg und ein ideales Opfer, das sie dem „Henker“ unterschieben konnten.
June March - unterstützt Bount Reiniger bei seinen Ermittlungen.
Bount Reiniger - ist Privatdetektiv.
1
Denny Layton sah nur kurz nach unten in die nachtschwarze Tiefe, stützte sich an der Mauer ab und sprang von dem schmalen Sims. Federnd ging er in die Knie, drehte sich zu der Hausfassade herum und grinste. Die Nachtarbeit hatte sich wieder gelohnt.
Sein Grinsen erstarb plötzlich, als er den schwarzen Schatten bemerkte, der bisher reglos an der Mauer gelehnt hatte und nun auf ihn zutrat. Die entfernte Straßenbeleuchtung schimmerte in Hüfthöhe matt auf dem Lauf eines Revolvers, der genau auf ihn gerichtet war.
Denny Layton spürte, wie er anfing zu zittern. In einer abwehrenden Bewegung streckte er die Hände vor und sagte heiser: „Was wollen Sie?“
„Polizei!“, antwortete eine leise Stimme. Eine Marke blitzte für einen Moment in der Linken des Mannes auf. Das Gesicht blieb im Schatten, nur die Augen waren zu sehen. Wie zwei Lichtpunkte, dachte Denny, und gleichzeitig hatte er Angst vor ihnen.
„Sie können mir nichts beweisen, Mann“, sagte Denny. Er breitete seine Arme aus. „Ich habe nichts bei mir.“
Der andere nickte leicht. „Das ist es eben. Nie kann man dir etwas beweisen. Weil wir nicht wissen, wie du deine Beute verschwinden lässt. Aber ich bin sicher, dass auf dein Konto mindestens fünfzig Einbrüche gehen. Und das ist genug.“ Er hob den kurzläufigen Revolver und drückte die Mündung unter Dennys Kinn.
Der Einbrecher versuchte zurückzuweichen, aber die Linke des anderen Mannes schoss vor und hielt ihn fest.
„Nein!“, flüsterte Denny entsetzt. „Das können Sie doch nicht ...“ Die Explosion zerriss die Stille der Nacht, und Denny Layton hatte plötzlich keinen Hinterkopf mehr.
Die Hand ließ ihn los, und die Leiche schlug dumpf auf das Pflaster.
Der Schütze griff in seine Tasche und warf einen winzigen, metallisch glänzenden Gegenstand auf den Toten. Dann drehte er sich um und verschwand mit langen Schritten in der Nacht.
In der Ferne erklang eine Trillerpfeife.
2
Mario di Socca verließ das Gerichtsgebäude als strahlender Sieger. Er trat auf die breite Freitreppe und winkte seinen zahlreichen Freunden zu, die sich am Fuße der Treppe versammelt hatten und ihm begeistert zujubelten.
Die Blitzlichter der Reporter zuckten, und Mario zeigte sein weißes Gebiss. Er hatte gelernt, sich mit den Reportern gut zu stellen, denn er las seinen Namen gern in der Zeitung. Vor seinem Auge sah er schon die Schlagzeilen des nächsten Tages: Wieder Freispruch für mutmaßlichen Gangsterboss - Mario di Socca ist nichts nachzuweisen.
Seine Freunde drängten sich um ihn, und er musste viele Hände schütteln. Da war Geno Vecchio, der alte Capo der Familie, Überlebender von zahlreichen Gangsterschlachten; Vito Savoia, sein engster Vertrauter und Herr über Dutzende von illegalen Spielhöllen. Stefano Bernardo drückte ihm die Hand - er kontrollierte Prostituierte und Wettbüros.
Dino d’Annunzio war da, Schmuggel und Erpressung war sein Metier; und selbst der alte Bonnanzone war gekommen, der immer noch an vielen Fäden zog.
Mario di Socca war glücklich. Er sonnte sich in der Bewunderung seiner Freunde, die nicht alle immer so viel Glück hatten wie er. Mancher von ihnen hatte mehrere Jahre seines Lebens in Gefängnissen verbracht. Nur di Socca war noch niemals verurteilt worden. Die Anklagen hatten von Erpressung über Steuerhinterziehung und Rauschgiftschmuggel bis zu Mord gereicht.
Aber zu beweisen war es nie.
Auch diesmal hatte er keine Befürchtungen gehabt. Er leistete sich die besten Anwälte, und sie hatten ihn wieder herausgepaukt. Er konnte sich jetzt in Ruhe wieder seinen Geschäften widmen. Nachdenklich glitt sein Blick über die Reporter, die inzwischen ihre Fotos geschossen hatten. Er war gespannt auf die Berichte am nächsten Tag.
Mario di Socca konnte nicht wissen, dass es sich um eine Art Nachruf handeln würde. Er stieg in den weißen Lincoln, seine Freunde verteilten sich auf die anderen Autos, und dann setzte sich die ganze Kolonne in Bewegung. Der Sieg über die Justiz sollte zunächst gefeiert werden. In einem guten italienischen Restaurant war alles vorbereitet worden.
Die Fahrt dauerte nicht sehr lange. Nacheinander bogen die schweren Limousinen in einen schmalen Hof ein, von dem ein direkter Gang zu dem Restaurant führte. Es lag in einer wenig belebten Straße im östlichen Manhattan.
Die jeweiligen Leibwächter der Bosse spritzten aus den Wagen und rissen die Türen auf. Aufmerksam beobachteten sie die Umgebung, aber es war nichts Verdächtiges zu sehen. Einige blieben bei den Wagen stehen, die anderen folgten ihren Bossen ins Innere des Hauses.
Mario di Socca hatte zu einem Essen im kleinen Kreis geladen. Er machte eine weit ausholende Handbewegung, und unter Stimmengemurmel und Stühlescharren setzten sich die zehn Männer an den großen runden Tisch in der Mitte des Lokals. Die Leibwächter setzten sich etwas abseits. Auch für sie war gedeckt.
Di Socca war stehen geblieben. Er stützte sich auf das blütenweiße Tischtuch und sah befriedigt in die Runde. „Meine Freunde“, begann er, „ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Ihr alle wisst, was der Anlass für diese Feier ist. Es gibt nur ein kleines Essen mit einem guten Wein aus unserer alten Heimat.“ Unauffällig winkte er dem Kellner, der sofort an den Tisch eilte und den Wein einschenkte.
„Ich habe nur einen bescheidenen Wunsch“, sagte di Socca. „Lasst uns für die kurze Zeit die Geschäfte vergessen, mit denen wir uns gleich wieder befassen müssen. Ich möchte auch kein Wort hören über irgendwelche Streitigkeiten, die es vielleicht während meiner kurzen Abwesenheit gegeben haben könnte. Dafür ist später noch genügend Zeit.“
Der Kellner trug eine riesige Schüssel mit dampfenden Spaghetti herein und stellte sie mitten auf den Tisch. Beifälliges Murmeln wurde laut. Mario di Socca runzelte leicht die Stirn. Er wusste nicht, ob der Beifall seinen Worten galt oder den Spaghetti.
Er griff nach seinem Glas und hob es hoch. Die anderen taten es ihm nach und sahen ihn erwartungsvoll an.
„Ich trinke auf gute Gesundheit und gute Geschäfte für uns alle“, sagte Mario di Socca und setzte das Glas an die Lippen.
Der Schuss krachte wie eine Explosion. Das Weinglas zersplitterte in tausend Stücke, Rotwein vermischte sich mit Blut und färbte das blütenweiße Tischtuch rot. Di Soccas Oberkörper kippte vornüber, sein Kopf schlug in die Spaghettischüssel, deren Inhalt über den Tisch und die darum sitzenden Männer verteilt wurde.
In der sekundenlangen Stille, die darauf folgte, flog wie von Geisterhand geworfen ein kleiner, metallisch blitzender Gegenstand durch die Luft, klirrte gegen einen Teller und sprang dann im Bogen in Savoias Weinglas, das dieser immer noch in der Hand hielt.
Dann brach die Hölle los.
Alle sprangen gleichzeitig auf. Stühle stürzten um, Geschirr klirrte zu Boden. Einige rannten in Deckung, andere zerrten ihre Pistolen aus den Holstern und versuchten den unsichtbaren Schützen zu entdecken. Die Leibwächter benahmen sich wie aufgescheuchte Hühner und behinderten sich gegenseitig.
„Der Schuss kam von der Empore!“, schrie eine Stimme und übertönte das Durcheinander. Einige der Leibwächter rannten zu der Treppe, die zu der Empore führte. Dort oben standen weitere Tische, die aber jetzt unbesetzt waren. Die Empore war mit einem dichten Vorhang vom übrigen Lokal getrennt.
Die Männer rissen den Vorhang zur Seite und fluchten. „Der Kerl ist weg! Durch den Nebenausgang. Aber er kann noch nicht weit sein.“
Einige nahmen die Verfolgung auf. Da die Gangster selbst Lokale schätzten, die über diverse Ausgänge verfügten, hatte sich natürlich auch der heimtückische Schütze diese Tatsache zu eigen gemacht und war auf einem dieser Wege geflohen.
Vito Savoia starrte fassungslos in sein Weinglas, das er immer noch in der Hand hielt. Mit spitzen Fingern fischte er schließlich den kleinen Gegenstand heraus, der in dem dunklen Rotwein lag.
Stefano Bernardo sah entsetzt auf die 38er Patrone, die Savoia zwischen Daumen und Zeigefinger in die Höhe hielt. Dann stellte er sie mit einer vorsichtigen Bewegung auf den Tisch. Die abperlenden Rotweintropfen sahen aus wie Blut.
„Die Geschossspitze ist eingekerbt mit einem Kreuzschnitt“, brach Savoia das Schweigen.
„Ein Dum-Dum-Geschoss“, sagte d’Annunzio.
Sie starrten auf den toten di Socca, der mit ausgebreiteten Armen auf der Tischplatte lag. Das tödliche Geschoss war im Hinterkopf eingedrungen, hatte ihm das halbe Gesicht weggerissen, das Weinglas zerschmettert und war im Tisch stecken geblieben.
„Was für eine Schweinerei“, meinte Vecchio leise und schnippte ein Stück Spaghetti vom Ärmel. Er sah die anderen an. „Wir verschwinden jetzt besser. Unsere Jungs können hierbleiben, bis die Polizei kommt. Wir sollten auch gleich unsere Anwälte verständigen. Ich schlage vor, dass wir uns heute Abend bei mir treffen und unsere weiteren Maßnahmen beratschlagen. Irgendjemand hat uns den Krieg erklärt.“
Alle nickten beifällig, und dann verschwanden sie sehr schnell durch die Hintertür. Jeder von ihnen würde bestreiten, heute in diesem Lokal gewesen zu sein. Auf Wunsch hatten sie auch Zeugen dafür. Diesen Mord würden sie nicht allein der Polizei zur Aufklärung überlassen.
Die Kriegserklärung war angenommen.
3
Dave Braddock war ein Einzelgänger. Sein Vorstrafenregister las sich wie ein Auszug aus dem Strafgesetzbuch. Man hatte ihn verurteilt wegen Diebstahl, Einbruch, Raub, Banküberfall und einem Dutzend anderer Straftaten. Nur Mord fehlte. Bis jetzt!
Aber bei seinem letzten Ausbruch hatte er einen Wächter getötet. Dave Braddock war nämlich auch ein Ausbrecherkönig. Siebenmal hatte er es bisher geschafft. Zwischen den einzelnen Verhaftungen lagen immer nur wenige Monate, in denen er neue Verbrechen beging.
Er war ein Berufsverbrecher und hatte auch nicht die Absicht, das zu ändern. Man hatte nur einmal versucht, ihm einen Bewährungshelfer zu geben. Braddock hatte den Mann gründlich verprügelt und galt seitdem als hoffnungsloser Fall. Er wusste, dass er irgendwann im Gefängnis sterben würde oder irgendwann bei einer Schießerei mit der Polizei draufgehen musste.
Aber er wusste nicht, dass diese Stunde schon so nahe war.
Mit fieberhaften Bewegungen riss er sich die Häftlingskleidung vom Leib. Seit dem Ausbruch waren noch keine zwei Stunden vergangen. Langsam dämmerte der Morgen. Er war noch viel zu dicht am Gefängnis!
Aber diesmal war alles schiefgegangen. Sein Plan war todsicher gewesen, und dann hatte sich ihm plötzlich ein Wächter in den Weg gestellt, als er es schon fast geschafft hatte. Im Handgemenge bekam er den Revolver des Wächters zu fassen und drückte ab. In diesem Augenblick heulten auch schon die Sirenen.
Mit knapper Not war er über die Mauer entkommen, aber die Verfolger waren dicht hinter ihm. Nach einiger Zeit hoffte er, sie abgeschüttelt zu haben und versteckte sich im Garten einer Villa.
Nach einiger Zeit hatte er gemerkt, dass niemand im Haus war. Er hatte eine Scheibe eingeschlagen und war hineingeklettert. Jetzt saß er vor einem Schlafzimmerschrank und probierte Kleidungsstücke an. Das war zunächst das Wichtigste.
Er streifte eine dunkelblaue Hose über. Die Sachen passten ihm einigermaßen. Er schob den Revolver in den Hosenbund. Mit den Schuhen hatte er Schwierigkeiten, sodass er seine eigenen anbehielt. Sie passten zwar nicht zu dem Anzug, aber darauf würde niemand achten.
Er betrachtete sich vor dem großen Spiegel und war zufrieden mit sich. Dann wühlte er schnell die anderen Schränke durch, um nach Geld oder Wertsachen zu suchen.
In diesem Augenblick hörte er die Sirenen der Streifenwagen, die sich von verschiedenen Seiten näherten. Er stürzte zum Fenster, aber es war zu spät. Dunkelblaue Uniformen hasteten durch den Garten und versteckten sich hinter Bäumen und Büschen.
Er war umstellt. Braddock knurrte wütend. Man war ihm also doch auf den Fersen geblieben. Jetzt war er nur noch ein gehetztes Wild.
Da kam auch schon die Lautsprecherstimme: „Wir wissen, dass Sie da drin sind, Braddock. Werfen Sie die Waffe durchs Fenster und kommen Sie mit erhobenen Armen heraus. Jeder Widerstand ist sinnlos. Das Haus ist umstellt. Sie haben keine Chance mehr.“
Braddock rannte die Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Vielleicht gab es doch noch eine winzige Chance! Ein Fenster, das nicht bewacht war. Oder ein Kellerausgang, den die Polizisten übersehen hatten. Bis sie sich zum Sturm entschlossen, hatte er noch Zeit. Er musste jetzt sehr genau überlegen. Denn wenn sie ihn jetzt schnappten, würde er für sehr lange Zeit hinter Gitter wandern.
Er überlegte fieberhaft, dann hatte er eine Idee.
Mit dem Haus verbunden war eine Doppelgarage. Es musste einen direkten Zugang geben. Er lief in die Küche und probierte alle Türen durch. Eine davon führte in eine Art Hobbyraum, dort befand sich auf der gegenüberliegenden Seite eine grau gestrichene Stahltür.
Er riss sie auf und strahlte. In der Garage stand ein Station Car älterer Bauart. Der andere Stellplatz war leer.
Draußen erklang wieder die Lautsprecherstimme, aber er hörte gar nicht hin. In der Garage befand sich genügend Werkzeug, und es dauerte mit seinen geübten Fingern keine halbe Minute, bis er das Türschloss geöffnet hatte. Auch die Zündung kurzzuschließen war kein Problem. Er musste jetzt nur sehr präzise vorgehen.
Er musterte das Garagentor. Es war eine ziemlich stabil aussehende Stahltür. Es war unmöglich, sie zu durchbrechen. Sie wurde mit einem Elektromotor geöffnet. Der Schalter befand sich neben dem Eingang zum Haus. Wenn er den Arm ausstreckte, konnte er ihn vom Wagen aus erreichen. Wenn es ihm gelang, das Garagentor zu öffnen und gleichzeitig den Motor anzulassen, hatte er doch noch eine Chance. Es kam darauf an, wie schnell beides ging.
Dave Braddock schloss die Augen und versuchte, sich die Umgebung der Villa ins Gedächtnis zu rufen. Vom Garagentor führte ein leicht geschwungener Kiesweg zur Straße. Dort war nur ein leichtes Holztor. Kein Problem für den schweren Wagen.
Als er die Augen wieder öffnete, merkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Im Bruchteil einer Sekunde registrierte er, dass ein Schatten auf ihn gefallen war, wo vorher keiner gewesen war.
Automatisch drehte er den Kopf und erstarrte. Das schwarze Loch der Revolvermündung war weniger als einen halben Meter von seinem Kopf entfernt. Dazwischen befand sich nur die dünne Scheibe der Wagentür.
Eine Hand griff zur Tür und zog sie ein Stück weiter auf. Der Revolver näherte sich und berührte jetzt fast die Scheibe.
„Die Hände auf das Lenkrad!“, befahl eine leise Stimme.
Braddock gehorchte und spürte, wie seine Angst wuchs. Im ersten Augenblick hatte er den anderen für einen Polizisten gehalten, der ihn überrumpelt hatte, aber jetzt war er sich nicht mehr so sicher. Jedenfalls trug der Mann keine Uniform.
„Ich gebe auf“, sagte Braddock.
„Ein Typ wie du gibt nie auf“, sagte der andere. „Deswegen habe ich beschlossen, dich ein für allemal aus dem Verkehr zu ziehen. Du hast das Recht zu lange zum Narren gehalten. Dein Maß ist übervoll.“
Auf Braddocks Stirn perlten Schweißtropfen. „Was soll das heißen?“ Seine Augen waren weit aufgerissen. Er versuchte, sich aus dem Wagen zu werfen.
Das Letzte, was er in seinem Leben sah, war eine spitze rote Flamme, die genau auf seine Augen zustach. Die Explosion des Schusses hörte er schon nicht mehr. Das Geschoss hatte die Seitenscheibe zerschmettert und warf ihn auf den Beifahrersitz. Ein Regen von Glassplittern überschüttete Dave Braddock, der bereits tot war.
Ein kleiner glänzender Gegenstand flog durch das offene Fenster und rollte in den Schoß des Toten. Der Schütze schaltete mit einem raschen Handgriff das Garagentor ein und verschwand im Haus.
Summend sprang der Elektromotor an, und mit einem leichten Quietschen schob sich das stählerne Tor in die Höhe. Draußen wurden aufgeregte Rufe laut, blau uniformierte Männer mit kugelsicheren Westen rannten durcheinander. Die Verwirrung war perfekt. Es dauerte fast drei Minuten, bis die Polizisten in die Garage eindrangen und den Toten fanden. Als sie dann anfingen, nach Spuren zu suchen, war bereits alles zertrampelt.
4
Polizei-Lieutenant John O’Keefe war ein alter irischer Dickschädel. Seine kurz geschnittenen rötlich blonden Haare standen wie Getreidestoppeln von seinem Kopf ab. Er war etwa fünfzig Jahre alt und von gedrungener Statur.
Er riss sich die Dienstmütze vom Kopf und schleuderte sie mit einer jahrelang geübten Bewegung auf den Kleiderständer, der immerhin ein paar Meter entfernt war. Der Lieutenant blickte über die Schar seiner vor dem Schreibtisch versammelten Mitarbeiter. „Also los! Ich will die Tatsachen hören.“
Sergeant Harrison räusperte sich. „Wir wissen noch nicht sehr viel, Lieutenant.“
„Erzählen Sie schon, was wir wissen“, bellte O’Keefe und ließ sich in seinen Sessel fallen.
„Bis jetzt sind uns drei Fälle bekannt, die offensichtlich zusammengehören“, sagte Harrison. „In allen drei Fällen wurden Gangster, mit denen die Polizei schon lange Schwierigkeiten hatte, durch einen einzigen Revolverschuss getötet. Die drei Morde wurden innerhalb der letzten vierzehn Tage verübt, bei den Leichen wurde immer eine Patrone vom Kaliber .38 special gefunden.“
„Fingerabdrücke?“, fragte O’Keefe.
Sergeant Harrison schüttelte den Kopf. „Nicht einer, der vom Täter stammen könnte. Auch die Patronen waren blankgeputzt, als ob sie frisch aus der Schachtel kämen.“
„Was sagen die Leute vom Labor?“
Harrison hob die Schultern. „Nicht viel. Beim ersten Fall - ein Einbrecher, der unmittelbar nach einem Einbruch auf der Straße erschossen wurde - gibt es so gut wie keine Spuren. Nur das Geschoss, das ihn getötet hat. Es ist vom selben Kaliber wie die anderen auch. Eine häufig vorkommende Munition, die Polizei benutzt sie auch.“
„Ich weiß, welche Munition wir benutzen“, sagte O’Keefe mürrisch. „Hat man Vermutungen über die Waffe?“
Harrison nickte. „Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Smith & Wesson 38 special mit kurzem Lauf. Die Waffe, die von den meisten Polizisten getragen wird. Aber sie ist sowieso sehr häufig. Eines steht jedenfalls fest: Alle Patronen stammen aus derselben Waffe. Wir haben es also mit Sicherheit mit einem einzigen Täter zu tun.“
Der Lieutenant nickte bedächtig. „Das ist klar. Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten bei den drei Fällen? Irgendeine Verbindung?“
Harrison sah seine Kollegen an, die nur bedauernd mit den Achseln zuckten. „Der Täter war ziemlich genau über seine Opfer informiert. Er kannte ihre Gewohnheiten und wusste, wo er ihnen auflauern konnte. Besonders rätselhaft ist der letzte Fall. Wir begreifen nicht ganz, wie der Ausbrecher praktisch unter den Augen von einigen Dutzend Polizisten erschossen werden konnte, ohne dass es die geringste Spur gab.“
„Was sagt der Arzt?“, fragte O’Keefe.
Johnston, ein anderer Sergeant, beantwortete die Frage. „Zwei sind aus nächster Nähe erschossen worden, di Socca wurde aus einer Distanz von etwa acht Metern ermordet. Alle drei sind durch Kopfschüsse getötet worden. Der Täter benutzte Dum-Dum-Geschosse, damit ging er sicher, dass keines seiner Opfer den Schuss überlebte. Der Arzt meinte, die Toten hätten ziemlich schlimm ausgesehen, Sir.“
O’Keefe starrte den Sergeant an. „Ich kann mir vorstellen, wie sie ausgesehen haben. Im Übrigen war ich beim letzten Fall dabei. Diese Einzelheiten können Sie uns ersparen. Wenn es keine weiteren Fakten gibt, möchte ich jetzt Ihre Schlüsse hören, meine Herren.“
Für einen Moment herrschte Schweigen. O’Keefe hatte den Kopf gesenkt und kritzelte auf seiner Schreibunterlage herum. Johnston zündete sich mit bedächtigen Bewegungen eine Zigarette an. Schließlich ergriff Sergeant Harrison wieder das Wort. „Wir haben alle Möglichkeiten diskutiert, Sir. Es gibt unserer Meinung nach nur einen möglichen logischen Schluss: Der Täter ist ein Polizist.“
Das Schweigen breitete sich fast fühlbar aus. Dann sah der Lieutenant mit unbewegter Miene auf. „Daran habe ich auch schon gedacht, meine Herren. Denn es passt alles sehr gut zusammen. Einer unserer Kollegen ist offensichtlich nicht damit zufrieden, mit welcher Langmut Berufsverbrecher von unserer Justiz behandelt werden und wie andere der Gerechtigkeit ständig ein Schnippchen schlagen.“
„Damit ist wohl keiner von uns zufrieden“, warf Harrison ein.
„Nein. Aber deshalb können wir noch lange nicht das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Irgendjemand spielt gleichzeitig Ankläger, Richter und Henker. Was wir auch immer von seinen Opfern halten, wir müssen diesen Mann finden. Und zwar schnell. Ich fürchte, diese drei reichen ihm noch nicht. Wenn ein solcher Mann erst einmal mit seiner Methode Erfolg hat, hört er nicht wieder auf.“
„In der Unterwelt wird es Unruhe geben“, sagte Sergeant Johnston. „Wir sollten das für unsere Zwecke ausnützen.“
O’Keefe nickte. „Selbstverständlich. Wir werden alle Informanten auf diesen Fall ansetzen. Im Übrigen wird eine Sonderkommission gebildet, die sich nur mit diesem Fall beschäftigt. Ich erwarte, dass wir schnell Erfolg haben.“
„Das wird schwierig werden“, sagte ein jüngerer Kriminalbeamter, der sich bisher noch nicht an der Unterhaltung beteiligt hatte.
„Das weiß ich“, meinte der Lieutenant. „Aber genau das ist unser Beruf.“ Er stand auf. „Ich werde Sie innerhalb der nächsten zwei Stunden über die Zusammensetzung der Sonderkommission unterrichten.“
5
Ken Woods hatte Angst, wollte sich das aber nicht eingestehen. Er verkaufte zum ersten Mal in seinem Leben Rauschgift. Seine Freunde hatten ihn dazu gedrängt. Sie lebten davon, und Ken war von ihrem Lebensstil fasziniert. Er war Halbwaise und wohnte mit seinem Vater in einer großen Wohnung mitten in Manhattan. Er hatte zwar keine finanziellen Sorgen, fühlte aber einen unbestimmten Drang, aus den üblichen Gewohnheiten auszubrechen. Das war auch kein Wunder, denn er war erst 23 Jahre alt.
Ken hatte seine Freunde bedrängt, ihn an ihren Geschäften teilhaben zu lassen. Schließlich hatten sie ihn in ihre Verteilerorganisation aufgenommen. Trotzdem hatte er keine Ahnung, wie und von wem sie den Stoff bezogen. Man hatte ihm ein bestimmtes Quantum gegeben, ihm die Adressen genannt und die Preise, die er dafür fordern musste.
Zuerst hatte Ken es sehr aufregend gefunden, aber nach dem ersten Besuch in einer Art Kommune fühlte er sich abgestoßen von dem, was er sah. Er wünschte, er hätte die Runde bereits hinter sich. Das Haus, vor dem er stand sah ziemlich verkommen aus. Er verglich die Adresse mit dem Zettel, den man ihm gegeben hatte, aber die Adresse stimmte. Er zögerte noch, das Haus zu betreten und verspürte wieder das unbestimmte Angstgefühl. Es war später Nachmittag, und viele Leute beeilten sich, von ihrem Arbeitsplatz nach Hause zu kommen.
Kens Hand umkrampfte das Päckchen mit den kleinen Tüten und ihrem weißen pulverigen Inhalt. Dann entschloss er sich und betrat das Haus. Es ging eine Treppe hoch, und dann sollte es die erste Tür rechts sein. Sein Herz klopfte, als er die Treppe hochschlich. Im Haus war es still, als sei das Gebäude verlassen.
An der Tür stand kein Name. Ken Woods streckte langsam die Hand aus und drückte auf den Klingelknopf. Er zuckte zusammen, als er das Schrillen hörte. Er trat zurück, um sofort die Treppe hinunterlaufen zu können, wenn irgendetwas nicht stimmte. Aber man hatte ihm gesagt, dass es bei den Adressen, die man für ihn ausgesucht hatte, keine Schwierigkeiten geben würde.
Er hörte Schritte hinter der Tür und spürte, wie sein Herz klopfte. Die Tür öffnete sich einen Spalt, und ein Gesicht erschien in der Öffnung. Es sah nicht aus wie das Gesicht eines Rauschgiftsüchtigen.
Es war kantig mit scharf geschnittenen Zügen und gehörte zu einem hochgewachsenen Mann, der ihn aufmerksam betrachtete. Dann erschien ein Lächeln auf dem Gesicht, ohne dass die dunklen Augen mitlächelten, die Tür öffnete sich weiter, und der Mann streckte die Hand aus. „Du bringst sicher den Stoff“, sagte eine leise Stimme.
Ken wich unwillkürlich ein Stück zurück, aber schon schoss ein Arm vor und packte ihn am Handgelenk. Der Griff war fest wie ein Schraubstock. „Komm ein paar Minuten herein, mein Junge. Ich möchte mit dir reden.“
Ken schüttelte den Kopf. „Tut mir leid, Sir“, stammelte er. „Ich habe keine Zeit. Ich habe noch ziemlich viel zu tun. Ich soll nur etwas abgeben und dafür fünfzig Dollar kassieren.“
Der Mann nickte grimmig und zog ihn mit einem heftigen Ruck in die Wohnung. „Dann bist du hier genau richtig.“ Er gab Ken einen kräftigen Stoß zwischen die Schulterblätter, und der Junge taumelte gegen eine Wand. Mit schreckgeweiteten Augen sah er den Mann an.
Der andere grinste böse und trat mit dem Fuß gegen die Wohnungstür, die sich mit lautem Knall schloss. „So, mein Junge, jetzt zeig’ mir mal, was du mitgebracht hast.“ Er streckte fordernd die Hand aus.
Ken sah, dass er dünne schwarze Lederhandschuhe trug. Er sah keine andere Möglichkeit, als zu tun, was der Mann verlangte. Langsam zog er das Päckchen aus der Tasche und hielt es dem Mann entgegen. Der nahm es mit einer fast nachlässigen Handbewegung und riss es auf. Er öffnete eine der Tüten, befeuchtete einen Finger und steckte ihn in das weiße Pulver. Dann probierte er mit der Zungenspitze.
„Du bietest eine verdammt schlechte Qualität an, mein Junge. Der Stoff ist mit Traubenzucker gestreckt. Ich glaube nicht, dass du für eine solche Tüte fünfzig Dollar bekommst.“
Ken verzog das Gesicht. „Davon verstehe ich nichts. Ich verteile den Stoff nur. Und man hat mir gesagt, dass eine Tüte fünfzig Dollar kostet und nicht einen Cent weniger. Wenn Ihnen die Qualität nicht passt, geben Sie mir die Tüten zurück.“
Der Mann lachte kurz auf. „Du bist also ein kleiner schmutziger Dealer, der selbst gar nicht weiß, was er verkauft. Du verdienst dein Geld am langsamen Tod deiner Mitmenschen. Du bist ein mieses kleines Schwein.“ Der Mann starrte ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen an, und in seinen Augen war ein fanatisches Glimmen.
„Nehmen Sie denn kein Rauschgift?“, stammelte Ken, der immer noch nicht begriffen hatte.
„Nein!“, sagte der andere hart und stieß Ken weiter vorwärts. Sie gelangten in eine total verdreckte Küche. Der Mann öffnete alle Tüten und schüttete ihren Inhalt in den Ausguss. Dann spülte er das weiße Pulver in den Abfluss. Ken sah ihm fassungslos zu.
Der Mann drehte sich herum und betrachtete den jungen Mann. „Der Kerl, dem du den Stoff bringen wolltest, wurde heute Vormittag verhaftet. In seinem Zustand hat er uns alles verraten, was wir wissen wollten - auch, wann er seine Lieferung erhält. Und so habe ich einfach auf dich gewartet.“
„Sie sind also von der Polizei?“, fragte Ken und verspürte eine Art Erleichterung, dass sein Job so schnell beendet wurde.
„Zurzeit bin ich außer Dienst“, sagte der andere, „und in dieser Zeit erledige ich immer ein paar Sachen, zu denen ich sonst nicht komme. Die Polizei ist nämlich total überlastet.“
„Bin ich verhaftet?“
Der Mann schüttelte den Kopf. „Das lohnt sich nicht.“
„Also wollen Sie mich laufen lassen? Ich habe das heute auch zum ersten Mal getan. Ich wollte sowieso die Finger von dieser Sache lassen. Kann ich dann gehen?“
Der Mann saß ein bisschen traurig aus. „Das Problem mit euch ist, dass ihr immer Versprechungen macht, die ihr nicht haltet. Und deshalb sorge ich dafür, dass Typen wie du keine Gelegenheit mehr haben, ihr Versprechen zu brechen.“
Ken spürte wieder, wie die Angst in ihm hochstieg. Eine eisige Hand griff nach seinem Herzen. Von dem Mann ging eine Bedrohung aus, die er nicht begriff. „Ich verstehe nicht, was Sie meinen.“
Der Mann griff in seine rechte Jackentasche und zog einen Revolver mit aufgesetztem Schalldämpfer heraus. „Es gibt nur eine Möglichkeit, euch die Verbrechen auszutreiben. Wenn das Recht versagt, müssen wir es selbst in die Hand nehmen. Früher hat das auch funktioniert.“ Ken schrie auf und wich bis zur Wand zurück. „Aber das dürfen Sie nicht! Das ist Mord! Ich habe doch nichts getan. Sie können mich doch nicht einfach umbringen!“
Der Mann verzog das Gesicht zu einem dünnen Lächeln und hob den Revolver. „Ich hoffe, meine Maßnahmen sprechen sich allmählich in euren Kreisen herum. Stirb jetzt wenigstens wie ein Mann.“
Ken schrie und weinte gleichzeitig und versuchte, sich mit einem Satz aus der Schusslinie zu bringen. Er stolperte über einen Küchenstuhl und rutschte über den schmutzigen Fußboden.
Die beiden Schüsse kamen so schnell, dass sie wie ein einziger klangen. Sie waren nicht lauter als das Knarren einer Diele.
Die Kugeln erwischten Ken noch mitten im Fall. Als er über den Boden rutschte, zog er eine blutige Spur hinter sich her. Er prallte gegen den Küchenherd, der seine Bewegung stoppte, dann lag er still. Die erste Kugel hatte ihn in die Brust getroffen, die zweite zerriss seine Halsschlagader. Die rote Lache wurde schnell größer.
Der Mann steckte seine Waffe ein und ging auf den Toten zu, wobei er es sorgfältig vermied, in die Nähe der Blutpfütze zu treten. Er bückte sich, öffnete die Finger der rechten Faust des Toten und ließ einen kleinen glänzenden Gegenstand in die Handfläche gleiten.
Dann schloss er die Hand wieder.
6
Lieutenant O’Keefe kippte langsam seinen Sessel zurück und legte die Füße auf die Tischplatte. Nachdenklich knabberte er an seinen Daumen. Dann sah er die drei Männer an, die vor seinem Schreibtisch standen: die beiden Sergeants Harrison und Johnston und der Neuling Stevens, der erst vor wenigen Wochen zu der Abteilung versetzt worden war.
„Diesmal ist er zu weit gegangen“, sagte O’Keefe.
Die anderen nickten, sie wussten, von wem die Rede war.
„Die öffentliche Meinung wird außer sich sein“, fuhr O’Keefe fort. „Ich kann mir schon gut vorstellen, was die Zeitungen morgen schreiben werden. Man wird mit allem Nachdruck die Verhaftung des wahnsinnigen Killers fordern, der vermutlich ein Polizist ist. Bis jetzt hat der Kerl abgebrühte Berufsverbrecher erschossen, bei denen sich niemand sonderlich aufgeregt hat. Aber diesmal war es ein junger Mann, der mal über die Stränge geschlagen hat. Wir werden uns jetzt verdammt Mühe geben müssen.“
O’Keefe musterte die anderen drei einen nach dem anderen. „Sie sind Mitglieder der Sonderkommission. Gibt es einen neuen Stand der Ermittlungen?“
Sergeant Harrison zuckte mit den Schultern. „Der letzte Mord unterscheidet sich ein wenig von den anderen. Das Opfer ist kein Gewaltverbrecher wie die anderen und wurde mit zwei Schüssen getötet, nicht nur mit einem wie die anderen. Außerdem hat der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Schalldämpfer benutzt. Aber es gibt keinen Zweifel, dass es sich um denselben Täter handelt, die Kugeln stammen alle aus derselben Waffe.“
O’Keefe nickte nachdenklich. „Und was schließen Sie aus diesen Tatsachen?“
„Der Täter ist vorsichtiger geworden“, warf Johnston ein. „Er weiß sehr genau, was er tut. Und er kann sich sicher gut vorstellen, was für ein Apparat auf seiner Spur ist.“
O’Keefe stand auf. „Also los, meine Herren. Finden Sie heraus, welche Gemeinsamkeiten es zwischen diesen Morden gibt. Irgendeine Verbindung muss existieren. Prüfen Sie die Personalakten sämtlicher Polizisten New Yorks. Benutzen Sie den Computer. Ich möchte zweimal täglich einen Bericht über den Stand der Ermittlungen. Wir haben nicht viel Zeit, denn dieser Kerl kann in jeder Minute wieder zuschlagen.“
7
Bount Reiniger saß in seinem Büro hinter dem Schreibtisch, las die Morgenzeitung und rührte gedankenverloren in einer Tasse Kaffee. Er runzelte die Stirn, als er die Schlagzeilen der ersten Seite überflog. Sie mussten von einem Redakteur namens Hiob stammen. Es war immer dasselbe. Irgendwo auf dieser Welt mussten sich Menschen ständig gegenseitig den Schädel einschlagen. Aber warum wunderte er sich? In seinem Job konnte er auch ein Lied davon singen.
Die Tür zum Vorraum öffnete sich einen Spalt, und das blond umrahmte Gesicht von June March erschien in der Öffnung. „Da ist ein Mann, der sich nicht abweisen lässt. Ich habe ihm gesagt, dass er sich telefonisch anmelden soll, aber er sagt, es sei sehr dringend und wenn Sie seinen Fall gehört hätten, würden Sie ihn sofort übernehmen.“
Bount lächelte schwach. „Der Mann scheint sich seiner Sache aber sehr sicher zu sein. Wie heißt er?“
June sah auf einen kleinen Zettel, den sie in der Hand hielt. „Er heißt Jonathan Woods.“
In Bounts Gehirn schrillte eine Alarmklingel. Den Namen hatte er erst kürzlich irgendwo gelesen. „Schicken Sie ihn in fünf Minuten herein“, sagte Bount Reiniger. Dann blätterte er hastig die Zeitung durch.
Auf der ersten Seite der Lokalnachrichten aus Manhattan fand er, was er suchte. Er hatte die Geschichte bereits flüchtig überflogen, aber sich nicht weiter damit beschäftigt. Der Killer, der Gangster umlegte und ihnen eine Dum-Dum-Patrone hinterließ, ging ihn bis jetzt nichts an. Interessant war nur, dass man ihn in Polizeikreisen vermutete.
Die Journalisten hatten für den Killer bereits den abenteuerlichen Namen „der Henker“ erfunden und schrieben, dass die Unterwelt praktisch vor dem Unbekannten zittere. Bount lächelte: So schnell war die Unterwelt nicht von einem einzelnen Mann zu beeindrucken. Und das Syndikat würde sich schon etwas einfallen lassen, nachdem man einen ihrer wichtigsten Leute getötet hatte.
Sein Besucher trat ein. Er mochte an die fünfzig sein, sah sehr kräftig aus, hatte ein offenes Gesicht mit hellen blauen Augen und dichtes graues Haar. Bount bot ihm mit einer Handbewegung einen Stuhl an, und Jonathan Woods setzte sich:
„Ich kann mir vorstellen, weshalb Sie zu mir kommen“, begann Bount das Gespräch.
Woods deutete auf die Zeitung. „Das ist auch nicht so schwer, mein Name steht schließlich in jeder Zeitung, die über diesen Gangster-Killer berichtet. Ja, der Letzte, den er umgebracht hat, ist mein Sohn. Und deswegen bin ich bei Ihnen.“
„Wie kommen Sie gerade auf mich?“
Woods winkte ab. „Das tut nichts zur Sache. Ein Bekannter hat mir Ihren Namen genannt und mir gesagt, dass ich mich auf Sie verlassen kann - und das genügt mir. Vielleicht genügt es Ihnen auch als Begründung?“
Bount nickte. Sein Besucher war nicht zu unterschätzen. Er wusste, was er wollte. Ein Mann mit klaren Vorstellungen.
„Der Mörder wird von der Polizei gejagt“, sagte Bount. „Und ich glaube, dass der Aufwand in diesem Falle recht hoch ist. Die sind doch selbst daran interessiert, den Kerl zu fangen.“
„Das gerade glaube ich nicht“, warf Woods ein. „Ich meine, dass sie versuchen werden, ihn zu decken, selbst wenn sie wissen, wer es ist. Die halten doch zusammen. Und vielen ist es doch auch gleichgültig, ob ein paar Gangster mehr oder weniger umgelegt werden. Wen interessiert das schon?“ Seine Stimme klang bitter. Und so ganz unrecht hat er nicht, dachte Bount Reiniger.
„Und Sie glauben, dass ich als Einzelner eine Chance habe, den Mörder zu finden?“, fragte Bount.
„Ich will mir nicht vorwerfen, eine Chance ausgelassen zu haben. Das bin ich meinem Jungen schuldig.“ Er machte eine kurze Pause. „Übernehmen Sie den Fall?“
Bount nickte langsam. „Ja. Ich übernehme ihn. Aber ich muss Ihnen gleich sagen, dass ich wenig Hoffnung habe. Ich stehe in Konkurrenz zum gesamten Polizeiapparat.“
„Das tun Sie doch öfter.“
„Ich tue, was ich kann. Aber jetzt erzählen Sie mir von Ihrem Sohn. Was hat er getan? Wie geriet er in Rauschgiftkreise?“ Bount klopfte auf die Zeitung. „Das steht wenigstens hier.“
Woods nickte. „Das ist auch richtig. Er hatte viel Freizeit. Meine Frau ist tot, schon seit vielen Jahren. Ich hatte wenig Zeit, mich um ihn zu kümmern. Sie wissen, wie das heutzutage ist. Er hatte eine Art Rebellionsphase, wie es so oft heute zu beobachten ist. Ich hatte mir nichts weiter dabei gedacht, es würde schon vorübergehen ...“
„Sie kannten seine sogenannten Freunde nicht?“, fragte Bount.
Woods schüttelte den Kopf. „Ich wusste, dass er ein paar Kerle kannte, die ich nicht unbedingt in meine Wohnung einladen würde, aber ich habe mir nichts weiter darunter vorgestellt. Dass sie mit Rauschgift handelten, erfuhr ich erst aus der Zeitung.“
„Hatte man Ihren Sohn schon einmal verhaftet?“
Woods blickte entrüstet auf. „Nein! Noch nie. Dann hätte ich ja sofort etwas unternommen. Er hat sich sonst auch ganz normal verhalten. Es war auch nicht so, dass er jeden Abend unterwegs war. Vielleicht ein- bis zweimal die Woche und am Wochenende. Wir haben zwar nicht viel miteinander gesprochen, aber er machte nicht den Eindruck, als ob er Sorgen hätte.“
„Hat er genügend Geld verdient? Wo hat er gearbeitet?“
„Er war technischer Zeichner bei einer großen Baufirma. Seinen gesamten Verdienst konnte er behalten. Er hat auch viel gespart. In dieser Beziehung gab es überhaupt keine Probleme. Es war eben alles ganz normal. Er hat halt eine Dummheit gemacht. Aber das ist doch noch lange kein Grund, ihn einfach abzuknallen. Ohne Gerichtsurteil - einfach so.“
„Es kommt öfter vor, dass irgendjemand sagt: Das Gesetz bin ich. Wir haben da mit unserem Wilden Westen eine lange Tradition.“
„Finden Sie ihn“, sagte Woods. „Und sorgen Sie dafür, dass er keine Gelegenheit mehr hat, junge Leute umzubringen, die mal einen Schritt zu weit gehen.“
Bount erhob sich und streckte ihm die Hand entgegen. „Sie können sich auf mich verlassen. Wo kann ich Sie erreichen?“
„Ich habe Ihrer Mitarbeiterin meinen Namen und die Anschrift aufgeschrieben. Ich habe ihr auch einen Scheck mit einer Vorauszahlung für die erste Woche gegeben.“
„Da wussten Sie aber noch nicht, ob ich Ihren Fall übernehme.“
„Ich war mir ziemlich sicher. Und halten Sie mich auf dem Laufenden.“ Damit war er draußen.
Bount vertiefte sich wieder in seine Zeitung. Dann rief er seine Assistentin. „June, besorgen Sie mir sämtliche New Yorker Zeitungen. Ich brauche alles, was über den Gangster-Killer geschrieben wurde.“
8
Die Versammlung der ehrenwerten Herren fand in einem Landhaus außerhalb New Yorks statt. Es war sehr abgelegen und überdies mit einer hohen Mauer umgeben. Im Garten liefen zwei deutsche Schäferhunde hin und her. Zwei Männer mit schlecht sitzenden Jacketts und breiten Schultern lümmelten sich am Tor herum.
Auf dem kiesbestreuten Weg zum Haus standen ein halbes Dutzend Limousinen, vorwiegend schwarz. Die Chauffeure standen in einer Gruppe zusammen und unterhielten sich. Es sah aus wie ein Treffen von Industriebossen. Und so etwas Ähnliches war es auch. Nur die Industrie, die die Herren vertraten, war bei keiner Handelskammer registriert. Man liebte kein Aufsehen.
Dino d’Annunzio biss die Spitze einer dicken Havanna-Zigarre ab und spuckte sie gezielt in den Aschenbecher. Er sah sich um. „Hat jeder zu trinken? Dann können wir wohl anfangen.“
Er war der Gastgeber, denn dieses war sein Landhaus. Man hatte sich dafür entschieden, weil es so abgelegen war. Niemand der Versammelten schätzte es, wenn die Polizei davon Wind bekam, dass sie so vertrauliche Gespräche führten. Offiziell kannten sie sich kaum. Sie würden notfalls jederzeit beschwören, sich noch nie gesehen zu haben.
Vito Savoia nippte an seinem Drink. „Es sieht ganz so aus, als sei dieser verrückte Killer ein Polizist. Die Presse ist dieser Ansicht, und die Polizei selbst glaubt es auch - wenn sie es auch nicht offiziell zugeben. Aber mein Verbindungsmann hat es mir erzählt.“
„Nach allem, was wir bis jetzt wissen, sieht es ganz so aus“, meinte Stefano Bernardo. „Wir haben inzwischen sämtliche Kanäle eingeschaltet. Die Polizei arbeitet angeblich mit Hochdruck, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es eine ganze Reihe Bullen gibt, die es am liebsten sähen, wenn dieser Killer noch lange Zeit weiter ungestört arbeiten könnte. Sie sind der Ansicht, er nimmt ihnen die Arbeit ab.“
„Der letzte Mord an diesem jungen Rauschgifthändler hat aber einen leichten Stimmungsumschwung bewirkt“, warf Geno Vecchio ein. „Wenn der Killer noch einen fast Unschuldigen umlegen würde, sähe das ganz anders aus. Bis jetzt hält man ihn bei der Polizei für einen ganz normalen Mann, der nur aus irgendwelchen Gründen ein bisschen durchgedreht ist und das Gesetz in die eigene Hand genommen hat. Vielen Bullen geht es doch ähnlich. Sie würden das auch gerne tun und bewundern wahrscheinlich insgeheim diesen Kollegen, der sich traut, solche Gedanken in die Tat umzusetzen.“
Der alte Bonnanzone meldete sich zu Wort. „Wie ist unsere Interessenlage? Der Killer hat unseren Freund di Socca umgelegt, gut. Aber sind wir nicht aus dem Alter heraus, wo es um kindische Rache geht?“
„Darum geht es auch nicht“, meinte Savoia sanft. „Aber wir glauben, dass auch noch andere von uns auf der Killer-Liste stehen. Die Gründe dafür sind bei jedem von uns so gut oder so schlecht wie bei di Socca. Ich persönlich habe keine Lust, solange zu warten, bis er mich erwischt. Ich bin nicht ohne Initiative so groß geworden.“
Die anderen nickten. Sie waren der gleichen Ansicht. Bonnanzone hob die Hände. „Also gut. Welche Chancen haben wir, den Kerl aufzuspüren?“
„Kaum eine Chance“, sagte Bernardo. „Er sitzt mitten im Polizeiapparat, und so weit reichen unsere Verbindungen nun auch wieder nicht, dass wir sämtliche Ergebnisse der Nachforschungen erfahren. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Killer von seinen Kollegen gedeckt wird, selbst wenn sie wissen, wer es ist.“
„Was können wir also tun?“, fragte Vecchio. „In knapp drei Wochen wurden vier Leute umgelegt. Wir müssen damit rechnen, dass der nächste bald fällig ist. Und wir haben keine Ahnung, wer der Nächste auf seiner Liste ist. Wir müssen uns Gegenmaßnahmen einfallen lassen. Denn es ist ausgeschlossen, dass wir uns Tag und Nacht mit einer großen Leibwache umgeben. Das würde die Polizei nur neugierig machen und uns bei unseren Geschäften empfindlich stören.“
„Du hast noch gar nichts gesagt“, wandte sich d’Annunzio an den Jüngsten in ihrem Kreis, Giacomo Angelo, der die Nachfolge di Soccas angetreten hatte. Er hatte zwar noch nicht viel Erfahrung, aber eine Menge einflussreicher Freunde, darunter auch zwei Staatsanwälte und einen Senator.
„Ich bin für Gegenmaßnahmen“, sagte Angelo. „Wir müssen uns wehren. Und wenn die Polizei ihre Nachforschungen nicht mit dem nötigen Nachdruck betreibt, müssen wir sie dazu zwingen.“
Für einen Augenblick herrschte Schweigen. Dann sagte Savoia: „Wie stellst du dir das vor? Die Polizei zu zwingen! Wir haben zwar gute Verbindungen, aber sie reichen nicht gerade zum Polizeipräsidenten.“
Angelo lächelte leicht. „So direkt geht das auch nicht. Es ist ein Plan, für den man Fantasie braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr die nicht habt.“
Vecchio knurrte unwillig. Angelo war seiner Meinung nach zu weit gegangen. Er war noch nicht lange genug in dieser Versammlung, um so einen Ton zu riskieren.
Nur Bonnanzone lachte plötzlich laut auf. „Ich glaube, euch allen trocknet schon das Gehirn aus. Zu meiner Zeit haben wir auch fantasievolle Dinge gemacht. Aus Giacomo wird ein großer Mann werden. Ich weiß, was er meint. Es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und sie ist so gut, dass sie von mir sein könnte.“ Der alte Mann gluckste in sich hinein.
Die Gesichter der anderen waren einzige Fragezeichen. Alle Köpfe drehten sich zu Angelo. „Nun mach’s nicht so spannend“, sagte Vecchio ungeduldig.
Angelo beugte sich vor und zündete sich eine Zigarette an. Er genoss die Situation, im Mittelpunkt des Interesses der wichtigsten Leute der Organisation zu stehen. „Geno Vecchio hat vorhin selbst das Stichwort gegeben“, sagte er schließlich. „Der letzte Mord an einem fast Unschuldigen hat einen Stimmungsumschwung bewirkt. Wenn noch so ein Fall passiert, werden die Bullen anders über ihren Kollegen denken. Also muss ein solcher Fall geschehen.“
Jetzt redeten alle durcheinander. D’Annunzio hob die Hand. „Einer nach dem anderen. Giacomo, wie ist dein Plan?“
„Wir imitieren einen Mord des Gangster-Killers mit allen Einzelheiten, also mit Dum-Dum-Geschoss und so weiter. Nur das Opfer ist kein Verbrecher, sondern ein Unbeteiligter.“
„Ganz unschuldig geht nicht“, sagte Bernardo, „sonst ist es unglaubwürdig. Es muss jemand sein, der ein paar Kleinigkeiten ausgefressen hat, wofür er höchstens ein paar Monate Gefängnis bekommen würde, und die noch auf Bewährung. Er muss die Sympathie der Presse haben. Der Killer muss als Wahnsinniger dargestellt werden, der jeden umlegt, der auch nur entfernt mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Und dann bleibt der Polizei nichts anderes übrig, als mit allen Mitteln zu reagieren, die sie hat.“
„Das klingt verdammt gut“, meinte Vecchio. „Aber jede Einzelheit muss genau überlegt werden. Die Polizei muss sicher sein, ein neues Opfer des Gangster-Killers vor sich zu haben. Wir brauchen alle Einzelheiten über die bisherigen Morde, damit wir uns genau an das Muster halten können. Jemand muss die Planung übernehmen.“
„Das mache ich“, warf Angelo ein. „Ich habe mir schon alles ziemlich genau überlegt. Es wird keine Fehler geben. Ich brauche nur noch ein Opfer.“
Bernardo hob die Hand. „Dafür könnte ich sorgen. Wir schlagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Da gibt es jemanden, der uns ständig Schwierigkeiten macht. Dieser Mann steht schon lange auf der Liste. Und er ist bei der Polizei bisher kaum aufgefallen.“
Bonnanzone rieb sich die Hände und kicherte. „Das wird immer besser. Ein verdammt guter Schachzug - wie in den alten Zeiten. Die Sache gefällt mir.“
„Nur noch der Form halber“, sagte d’Annunzio. „Wir müssen noch abstimmen, ob Giacomos Plan angenommen ist. Wer ist also dafür, das Problem mit dem Gangster-Killer in der besprochenen Form zu regeln, um die Polizei zu zwingen, den Kerl schnellstens zu fassen und um keine Sympathien mehr für ihn zu wecken?“
Es gab weder Gegenstimmen noch Enthaltungen. Die Organisation begann zurückzuschlagen. Auf ihre Art.
9
Bount Reiniger ließ sich mit einem alten Freund verbinden, der im Polizeipräsidium im Archiv tätig war. Von ihm hatte er schon oft nützliche Tipps und Hinweise erhalten, wenn er sonst nicht weiterkam. Er musste ein paar Minuten warten, bis Sam Mercer ans Telefon gerufen wurde. Endlich hörte er die tiefe Stimme. „Ja, bitte?“
„Sam, hier ist Bount, Bount Reiniger. Ich brauche ein paar Auskünfte über den sogenannten Gangster-Killer. Ich möchte vor allen Dingen wissen, ob ...“
„Tut mir leid, ich weiß nicht, wer dort spricht“, antwortete Sam und legte auf.
Bount starrte auf den Hörer in seiner Hand und legte ihn dann auch langsam auf die Gabel. So kannte er seinen Freund gar nicht. Er musste doch gewusst haben, wer am Apparat war, schließlich hatte Bount sich deutlich gemeldet. Es war klar, dass Sam nicht mit ihm sprechen wollte. Aus welchen Gründen auch immer. Sicher gab es dafür eine Erklärung.
Achselzuckend beschäftigte Bount sich wieder mit den Zeitungen, die June March ihm besorgt hatte. Im Wesentlichen stand in allen fast das Gleiche. Die Polizei war mit ihren Informationen offenbar sehr vorsichtig, und die Journalisten mussten Spekulationen anstellen. Der Verdacht, dass der Killer von der Polizei kam, war aber nicht dementiert worden, das hieß, die Polizei war selbst dieser Ansicht. Es gab ja auch genügend Gründe, die dafür sprachen.
In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Bount nahm ab und meldete sich.
„Hier ist Sam Mercer“, meldete sich eine tiefe Stimme. „Du musst entschuldigen, dass ich dich vorhin so einfach abgehängt habe, aber jetzt spreche ich von einem anderen Apparat. Das Stichwort mit dem Gangster-Killer wirkt bei uns wie ein rotes Tuch, und ich bin mir nicht sicher, ob so ein Gespräch nicht mal abgehört wird. Und dann hätte ich eine Menge unangenehme Fragen zu beantworten.“
Bount lachte. „Das verstehe ich, alter Junge. Etwas Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Ich wollte von dir nur wissen, ob es bei euch schon konkrete Verdachtsmomente gibt, irgendwelche Hinweise in einer bestimmten Richtung.“
Sams Stimme klang misstrauisch. „Was hast du denn mit diesem Fall zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Privatdetektiv an einen solchen Fall gerät.“
„Das ist ganz einfach“, sagte Bount. „Wenn einem Vater der einzige Sohn erschossen wird und die Polizei im Verdacht steht, den Täter zu schützen, dann muss dieser Mann andere Wege gehen.“
„Verstehe“, sagte Sam nach einer kurzen Pause. „Aber meine Kollegen wollen den Täter durchaus nicht schützen, obwohl ich nicht abstreiten will, dass es ein paar Leute gibt, die sein Vorgehen insgeheim billigen. Aber die Mehrzahl will diesen Verrückten ebenso schnell hinter Gittern sehen wie die Betroffenen.“
„Und die Unterwelt“, fügte Bount hinzu.
Sam lachte. „Die muss allerdings auch großes Interesse daran haben, den Killer unschädlich gemacht zu wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute ganz schön zittern.“
„Sie werden besser aufpassen müssen“, sagte Bount. „Aber zu meiner Frage zurück. Wie sieht es aus bei euch?“ Sam wurde wieder reserviert. „Tut mir leid, Bount. Trotz unserer Freundschaft, in dieser Sache kann ich dir nicht weiterhelfen. Das ist viel zu heiß. Du hast ja keine Ahnung, was bei uns los ist. Wenn jemand nur den Verdacht hat, dass ich ausgerechnet über diesen Fall Informationen weitergebe, bin ich fällig. Ich stehe kurz vor der Pensionierung, Bount. Ich kann jetzt keinen Fehler mehr riskieren.“
„Das verstehe ich, Sam. Vielleicht kannst du mir nur eine einzige Frage beantworten: Gibt es einen Verdacht in einer bestimmten Richtung oder auf eine bestimmte Person?“
„Auch das kann ich dir nicht sagen, denn ich weiß es nicht. Für die Bearbeitung dieses Falles wurde eine Sonderkommission gebildet, und diese Jungs sind verschlossen wie die Austern. Außerhalb der Kommission weiß keiner meiner Kollegen, in welchem Stand sich die Ermittlungen befinden. Und das ist auch gut so, denn jeder kann schließlich der Täter sein.“
„Ist klar, Sam. Ich danke dir trotzdem, dass du mich angerufen hast. Ich muss versuchen, selbst weiterzukommen, wenn ich auch noch nicht weiß, wie.“
„Alles Gute, Bount. Und meld dich mal wieder.“
Langsam legte Bount auf. Es sah so aus, als sollte dieser Fall sehr schwierig werden. Es könnte sein, dass er sich daran die Zähne ausbiss. Aber so leicht gab er nicht auf.
June March trat ins Zimmer. „Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich habe den ganzen Papierkram fertig. Alle Rechnungen sind bezahlt, alle Briefe beantwortet.“
„Tüchtig, tüchtig“, murmelte Bount Reiniger geistesabwesend.
„Ich habe gefragt, ob ich helfen kann“, wiederholte June ihre Frage etwas lauter.
Bount blickte auf, als hätte er jetzt erst ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. „Das wird schwierig werden“, meinte er tiefsinnig.
„Was?“, erkundigte June sich.
Bount stand auf und ging zum Fenster. „Ein wahnsinniger Killer, der sich seine Opfer aus der Kartei heraussuchen kann und den ganzen Apparat der Polizei zur Verfügung hat. Das ist eine seltene Kombination.“
„Aber es muss doch eine Verbindung zwischen den einzelnen Fällen geben“, sagte seine Assistentin. „Ein einzelner Polizist, selbst an höherer Stelle, kann nicht über alle Verbrechen in New York informiert sein. Es muss Gemeinsamkeiten geben. Vielleicht ist es jemand, der mit allen vieren bereits zu tun hatte. Irgendwie muss er die Hinweise ja bekommen haben.“
Bount schüttelte den Kopf. „So einfach ist das nicht. Der Killer wird nicht so dumm sein, eine so klare Spur zu legen. Dann hätte ihn der Computer in fünf Minuten herausgefunden. Die können doch sämtliche Daten einspeisen und feststellen, welcher Beamte mit den Verbrechern in Berührung gekommen ist. Es muss eine andere Verbindung geben. Denn ganz so wahllos kann es auch wieder nicht sein.“
„Gehen wir doch methodisch vor, und zählen wir die Fakten auf, die wir haben“, meinte June. Ihr Gesicht glühte vor Eifer.
Bount sah sie erstaunt an. „Wieso sind Sie über den Fall bereits informiert?“
„Ich kann auch Zeitung lesen“, antwortete sie kurz.
„Na schön, dann schießen Sie mal los“, sagte Bount belustigt.
„Erstens: die Opfer. Sie sind sehr verschieden. Ein Einbruchspezialist, ein Mafiaboss, ein altgedienter Berufsverbrecher und Ausbrecherkönig und ein kleiner Rauschgifthändler. Hier dürfte es wohl kaum Gemeinsamkeiten geben. Zweitens: die Tat selbst. Sie ist immer ähnlich. Der Täter kennt die Gewohnheiten seiner Opfer genau. Er weiß, wo sie sich wann aufhalten. Er tötet sie mit einem Revolverschuss und Dum-Dum-Munition. Er hinterlässt keine Spuren. Drittens: der Täter. Er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Polizist.“
„Sehr gut“, sagte Bount. „Viel mehr wissen wir tatsächlich nicht. Die Presse jedenfalls nicht. Und ich habe keine andere Quelle, die ich anzapfen kann.“
June zog ihre hübsche Stirn kraus. „Was ist eigentlich Dum-Dum-Munition?“
„Das ist Munition, die von allen Nationen geächtet wurde. Man kann sie aus normaler Munition selbst herstellen. In der Regel genügt eine kreuzförmige Einkerbung an der Geschossspitze. Dadurch deformiert sich die Kugel beim Aufprall stark. Die furchtbaren Wunden, die entstehen, sind normalerweise tödlich.“
Sie schüttelte sich. „Das ist also etwas für Leute, die unbedingt sichergehen wollen?“
„So kann man es auch ausdrücken. Ich glaube in unserem Fall aber nicht, dass das der Grund ist. Unser Killer schießt sehr präzise, das beweist der Schuss auf di Socca, den er mit einem Revolver immerhin aus einiger Entfernung getroffen hat, und das ist gar nicht so einfach.“
„Aber was könnte dann der Grund für diese Munition sein?“
„Er will Angst und Schrecken damit verbreiten, glaube ich. Diese Munition ist zu recht von allen gefürchtet, die etwas vom Schießen verstehen. Er will allen anderen andeuten, dass seine Opfer keine Chance haben.“
„Was mag das für ein Mensch sein?“, sagte June leise.
Bount zuckte mit den Schultern. „Er sieht wahrscheinlich aus wie die meisten Mörder. Sie würden ihn nicht erkennen. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass er sich im Recht fühlt. Er ist mit Sicherheit der Ansicht, dass durch seine Aktionen die Menschheit von Schädlingen befreit wird. Er glaubt, dass die Justiz machtlos ist gegen viele Verbrecher, und da ist ja auch was dran. Aber Psychopathen wie er erkennen ihre Grenzen nicht mehr. Nach den ersten Morden wurde er in seinen Ansichten wahrscheinlich noch bestärkt, und jetzt schlägt er immer wahlloser zu. Vielleicht fühlt er sich auch als Werkzeug Gottes. Das soll es schon oft gegeben haben.“
„Gibt es eine Chance, ihn zu fassen?“
„Eine Chance gibt es immer. Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass er sich praktisch selber jagt. Wahrscheinlich hat er die Möglichkeit, zu erfahren, in welche Richtungen die Ermittlungen gehen. Dann kann er rechtzeitig Gegenmaßnahmen treffen.“
„Vielleicht ist er sogar ein höherer Polizeioffizier“, sagte June.
„Womöglich Mitglied der Sonderkommission!“ Bount lachte kurz auf. „Das wäre allerdings ein Witz.“
10
Lee Hall hatte eine kleine Kneipe in der 28. Straße. Sie war nicht gerade eine Goldgrube, aber sie sicherte ihm einen ausreichenden Lebensstandard. Er hatte keine Angestellten, sondern machte alles allein. Nur an den Samstagabenden, wenn es besonders voll war, half ihm eine Bekannte, die in seiner Nähe wohnte.
Die Kneipe war gemütlich eingerichtet. Die Wände waren getäfelt, der Raum mit Zwischenwänden unterteilt. Es gab eine Musik-Box und einen Geldspielautomaten. Man konnte bei Lee in Ruhe sein Bier oder seine Cola trinken und auch eine Kleinigkeit essen. Das Publikum war sehr gemischt, es gab Arbeiter darunter sowie Angestellte oder Studenten. Die meisten verkehrten schon lange bei Lee und er kannte sie.
Lee Hall hatte die Figur eines Kleiderschranks. Er war stark wie ein Bär und wusste das auch. Unter seiner Theke lag ein Holzknüppel von sechzig Zentimeter Länge und so dick wie ein stabiles Tischbein. Er konnte damit umgehen, hatte aber kaum Verwendung dafür.
Seine Gäste waren ruhig. Es gab mal einen lautstarken Streit, aber nie eine ernsthafte Schlägerei. Sie hatten alle Respekt vor dem Wirt. Einige hatten versucht, mal einen Streit vom Zaum zu brechen, aber Lee hatte sie sehr schnell zur Vernunft gebracht, und sie versuchten das nie wieder.
Mit dem Gesetz hatte er kaum Schwierigkeiten. Es hatte vor Jahren mal eine Razzia wegen Rauschgift gegeben, sie war aber erfolglos geblieben. Lee hatte die beiden Siebzehnjährigen schnell in seinen Privaträumen versteckt, wo sie nicht entdeckt wurden. Als die Polizei wieder abgezogen war, hatte er den beiden auf seine Art sehr ernsthaft ins Gewissen geredet. Sie konnten sich zwar ein paar Tage nicht in der Öffentlichkeit sehen lassen, versuchten aber nie wieder, in seiner Kneipe mit Rauschgift zu handeln. Ob sie es anderswo taten, interessierte ihn nicht. Er behauptete auch nicht, ein Heiliger zu sein.
Er hatte zwei Vorstrafen, die beide zur Bewährung ausgesetzt waren. Es handelte sich in beiden Fällen um geringfügige Körperverletzungen. Manchmal rutschte ihm die Hand halt ein bisschen aus. Wobei hinzugefügt werden muss, dass die beiden, die ihn anzeigten, eine sehr viel größere Tracht Prügel verdient hätten.
Lee Hall war eingefleischter Junggeselle und ging jede Woche zum Football, eines der wenigen Vergnügen, die er sich gönnte. Sein zweites Hobby waren schnelle Autos. Dabei gab es nur eine Schwierigkeit: Die Sportwagen, die er in raschem Wechsel fuhr, waren meistens zu klein für ihn, und er hatte beim Ein- und Aussteigen immer ziemliche Mühe.
Und dann gab es da noch ein kleines Problem. Eines Tages waren zwei schmierige Typen erschienen und hatten von seiner Sicherheit gefaselt, für die sie gegen Zahlung eines geringen Beitrages sorgen würden.
Lee verstand erst nicht, was sie eigentlich von ihm wollten, bis er begriff, dass er es mit Abgesandten eines Rackets zu tun hatte, die ihn schlicht erpressen wollten. Dann aber reagierte er sehr schnell. Mit einer Geschwindigkeit, die niemand seiner massigen Gestalt zutraute, zauberte er seinen Holzknüppel unter der Theke hervor und schwang ihn mit einer kreisenden Bewegung gegen die beiden Typen.
Sie waren so verblüfft, dass sie sich im ersten Augenblick nicht rührten. Der kleinere von ihnen wurde am Kopf getroffen und stolperte kreischend zu Boden. Der andere versuchte seine Waffe zu ziehen.
Lee Hall war wie der Blitz um seinen Tresen geschossen, und der Knüppel sauste mit voller Wucht gegen den Unterarm des Gangsters. Er heulte auf und ließ die Waffe fallen, die er schon halb aus dem Holster gezogen hatte. Jetzt kam der erste leicht schwankend wieder hoch. Mit tückischem Grinsen zog er ein Klappmesser heraus, aber Lee hatte keine Lust, sich auf einen längeren Kampf einzulassen.
Sein Knüppel pfiff durch die Luft, und die Messerhand des Gangsters wurde auf einem hölzernen Barhocker fast zu Brei gequetscht. Mit einem tierischen Schrei brach der Gangster ohnmächtig zusammen. Sein Kumpel hatte ihn wortlos aus dem Lokal geschleift. Und an der Tür drohte er, sie würden wiederkommen.
Das war drei oder vier Monate her, und Lee Hall hatte den Zwischenfall fast vergessen, als er den Mann bemerkte, der eben den Gastraum betreten hatte. Lee hatte ein Gespür für die Gefahr, und er wusste sofort, dass von diesem Mann eine tödliche Gefahr ausging. Schwach erinnerte er sich an die Drohung, dass die Gangster wiederkommen wollten. Er wusste plötzlich, dass es heute so weit war.
Lee warf einen Blick in die Runde. Das Lokal war fast leer. An der Bar saß niemand, an der Wand waren nur zwei Tische besetzt. Ein verliebtes Pärchen und ein einzelner Mann, der still ein Bier nach dem anderen Trank. Von den Gästen war keine Hilfe zu erwarten.





























