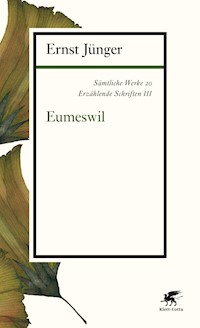
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Doch keine Sorge: ein moraltheologischer Traktat ist nicht beabsichtigt«, zerstreut der Ich-Erzähler sogleich die Bedenken: der utopische Roman »Eumeswil«. Der vorliegende Band entspricht Band 17 der gebundenen Ausgabe. Wie bereits in »Heliopolis« entwirft Jünger eine Utopie in der Stadt Eumeswil, in der sich zwei unterschiedliche Machtgruppen gegenüberstehen. Einst von dem Diadochen Eumenes gegründet, liegen sich nun die Anhänger des derzeitigen Tyrannen Condor und die der gestürzten Tribunen gegenüber. Zwischen Historie und Zukunft changierend, ist die Welt ebenso vertraut wie unbekannt, wenn etwa das »Luminar«, eine Zeitmaschine, zum Einsatz kommt. Der Ich-Erzähler Martin »Manuel« Venator scheint dabei die liberalen Ansichten für überholt zu halten – eine Reaktion Jüngers auf die Kritik an seinem Werk?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ERNST JÜNGER – SÄMTLICHE WERKE
Tagebücher I-VIII
Band 1 Der Erste Weltkrieg
Band 2 Strahlungen I
Band 3 Strahlungen II
Band 4 Strahlungen III
Band 5 Strahlungen IV
Band 6 Strahlungen V
Band 7 Strahlungen VI, VII
Band 8 Reisetagebücher
Essays I-IX
Band 9 Betrachtungen zur Zeit
Band 10 Der Arbeiter
Band 11 Das Abenteuerliche Herz
Band 12 Subtile Jagden
Band 13 Annäherungen
Band 14 Fassungen I
Band 15 Fassungen II
Band 16 Fassungen III
Band 17 Ad hoc
Erzählende Schriften I-IV
Band 18 Erzählungen
Band 19 Heliopolis
Band 20 Eumeswil
Band 21 Die Zwille
Supplement
Band 22 Verstreutes – Aus dem Nachlaß
Ernst Jünger
Sämtliche Werke 20
Erzählende Schriften III
Eumeswil
Klett-Cotta
Die 22 Bände der Sämtlichen Werke, die zwischen 1978 und 2003 bei Klett-Cotta erschienen sind (1–18: 1978–1983; Supplemente 19–22: 1999–2003), enthalten Ernst Jüngers Fassung letzter Hand. Ihr folgt diese Taschenbuchausgabe in Seiten- wie Zeilenumbruch. Offensichtliche Fehler wurden korrigiert, die posthum erschienenen Supplementbände integriert. Der vorliegende Band entspricht Band 17 der gebundenen Ausgabe.
Impressum
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Reihengestaltung Ingo Offermanns, Hamburg, unter
Verwendung von Illustrationen von Niklas Sagebiel, Berlin
Gesetzt von pagina, Tübingen
Datenkonvertierung: Lumina Datamatics GmbH
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96320-5
E-Book: ISBN 978-3-608-10920-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
EUMESWIL
INHALT
Eumeswil
Die Lehrer
Abgrenzung und Sicherheit
Nachtbar-Notizen
Ein Tag auf der Kasbah
Ein Tag in der Stadt
Vom Walde
Epilog
EUMESWIL
ERSTDRUCK 1977
DIE LEHRER
1
Mein Name ist Manuel Venator; ich bin Nachtsteward auf der Kasbah von Eumeswil. Mein Äußeres ist unauffällig; ich kann bei Wettkämpfen auf einen dritten Preis rechnen und bin der Frauen wegen nicht in Verlegenheit. Ich bin bald dreißigjährig; mein Charakter wird als angenehm empfunden – das setzt schon mein Beruf voraus. In politischer Hinsicht gelte ich als zuverlässig, wenngleich nicht als besonders engagiert.
Soviel kurz zur Person. Meine Angaben sind aufrichtig, obwohl noch ungenau. Ich werde sie allmählich präzisieren; insofern enthalten sie den Ansatz zu einer Disposition.
*
Das Ungenaue zu präzisieren, das Unbestimmte schärfer und schärfer zu bestimmen: das ist die Aufgabe jeder Entwicklung, jeder zeitlichen Anstrengung. Daher treten im Lauf der Jahre die Physiognomien und Charaktere deutlicher hervor. Das gilt auch für die Handschriften.
Der Bildhauer steht zunächst dem rohen Block, der puren Materie gegenüber, die jede Möglichkeit umschließt. Sie antwortet dem Meißel; er kann zerstören oder Wasser des Lebens, geistige Macht aus ihr befreien. Das liegt im Unbestimmten, selbst für den Meister; es hängt nicht gänzlich von seinem Willen ab.
Das Ungenaue, das Unbestimmte, auch der Erfindung, ist nicht das Unwahre. Es mag unrichtig, doch es darf nicht unaufrichtig sein. Eine Behauptung – ungenau, doch nicht unwahr – kann Satz für Satz erläutert werden, bis endlich die Sache ins Lot kommt und ins Zentrum rückt. Beginnt jedoch die Aussage mit einer Lüge, so muß sie durch immer neue Lügen unterstützt werden, bis schließlich das Gebäude zusammenbricht. Hierher mein Verdacht, daß schon die Schöpfung mit einer Einfälschung begann. Wäre es ein simpler Fehler gewesen, so ließe sich das Paradies durch Entwicklung wiederherstellen. Aber der Alte hat den Baum des Lebens sekretiert.
Das streift mein Leiden: irreparable Unvollkommenheit, nicht nur der Schöpfung, sondern auch der eigenen Person. Es führt zur Götterfeindschaft auf der einen Seite und auf der anderen zur Selbstkritik. Vielleicht neige ich darin zur Übertreibung, jedenfalls schwächt beides die Aktion.
Doch keine Sorge: ein moraltheologischer Traktat ist nicht beabsichtigt.
2
Zu präzisieren ist zunächst, daß ich zwar Venator heiße, jedoch nicht Manuel, sondern Martin; das ist, wie es bei den Christen heißt, mein Taufname. Bei uns wird er durch den Vater verliehen; er nennt den Geborenen, indem er ihn aufhebt, bei Namen und läßt ihn die Wände beschreien.
Manuel dagegen ist mein Rufname während der Zeit, in der ich hier auf der Kasbah Dienst leiste; er wurde mir durch den Condor verliehen. Der Condor ist mein Dienstherr als derzeitiger Machthaber von Eumeswil. Er residiert seit Jahren auf der Kasbah, der Hochburg, die etwa zwei Meilen jenseits der Stadt einen kahlen Hügel krönt, den man seit jeher den Pagos nennt.
Dieses Verhältnis von Stadt und Festung findet sich an vielen Orten wieder; es ist nicht nur für die Tyrannis das bequemste, sondern für jedes persönliche Regiment.
Die vom Condor gestürzten Tribunen dagegen hatten sich unauffällig in der Stadt gehalten und vom Municipio aus regiert. »Wo nur ein Arm ist, wirkt er stärker am langen Hebel; wo Viele zu sagen haben, bedarf es der Gärung: sie durchsetzen die Bestände wie Sauerteig das Brot.« So Vigo, mein Lehrer; von ihm wird noch die Rede sein.
*
Warum nun hatte der Condor gewünscht und damit befohlen, daß ich Manuel genannt werde? War ihm der iberische Anklang lieber, oder war Martin ihm nicht genehm? So hatte ich zunächst vermutet, und in der Tat gibt es eine Abneigung oder zum mindesten eine Empfindlichkeit gewissen Vornamen gegenüber, die wir nicht genug berücksichtigen. Manche behaften ein Kind für sein Leben mit einem Namen, der ihren Wunschträumen entspricht. Ein Gnom tritt ein und stellt sich als Cäsar vor. Andere wählen den Namen des Herrn, der gerade das Ruder führt, so wie es auch hier bei arm und reich schon kleine Condore gibt. Auch das kann schädigen, besonders in Zeiten ohne sichere Erbfolge.
Zu wenig, und das gilt für die meisten, wird auch beachtet, ob der Vor- mit dem Familiennamen harmoniert. »Schach von Wuthenow«: das ist anstrengend, fast eine phonetische Zumutung. Dagegen: »Emilia Galotti«, »Eugénie Grandet« – das schwebt leicht und ausgewogen in den akustischen Raum. Natürlich ist »Eugenie« gallisch und nicht germanisch zu betonen: Öjénie, mit abgeschwächtem Ö. Ganz ähnlich hat das Volk hier den Namen des Eumenes abgeschliffen: es wohnt in Ömswil.
Jetzt kommen wir der Sache näher: der ausgesprochenen Musikalität des Condors, der »Martin« widerspricht. Das ist verständlich, denn die Mittelkonsonanten klingen hart und schartig, sie kratzen im Ohr. Mars ist der Namenspatron.
Merkwürdig freilich ist dieses Zartgefühl bei einem Herrn, der seine Macht den Waffen verdankt. Den Widerspruch begriff ich erst nach längerer Beobachtung, obwohl er auf jeden seinen Schatten wirft. Jeder nämlich hat seine Tag- und seine Nachtseite, und mancher wird mit der Dämmerung ein anderer. Beim Condor ist dieser Unterschied in ungewöhnlicher Schärfe ausgeprägt. Im Äußeren bleibt er zwar derselbe: ein Hagestolz mittlerer Jahre in der leicht vorgebeugten Haltung des Mannes, der oft zu Pferde sitzt. Dazu ein Lächeln, das viele gewonnen hat – verbindliche Jovialität.
Doch das Sensorium ändert sich. Der Tagraubvogel, der Greifer, der weithin späht und ferne Bewegungen verfolgt, wird nächtlich; die Augen erholen sich im Schatten, das Gehör verfeinert sich. Es ist, als ob ein Schleier vor das Gesicht fiele und neue Quellen der Wahrnehmung sich öffneten.
Der Condor legt Wert auf Fernsicht; selten wird ein Bewerber bei ihm Glück haben, der eine Brille trägt. Das gilt besonders für Kommandostellen bei der Truppe und der Küstenwacht. Wer dazu heransteht, wird zu einem Plauderstündchen eingeladen, bei dem der Condor ihm auf die Zähne fühlt. Sein Kabinett überhöht das flache Dach der Kasbah durch eine runde, drehbare Glaskuppel. Während des Gespräches pflegt der Condor sich der Sehkraft des Aspiranten zu versichern, indem er auf ein Schiff oder ein sehr fernes Segel hinweist und nach dessen Art und Richtung fragt. Gewiß sind sorgfältige Prüfungen dem vorausgegangen; das eigene Urteil soll sie bestätigen.
*
Mit der Verwandlung vom Tag- in den Nachtraubvogel wendet sich auch die Neigung vom Hund zur Katze, die beide auf der Kasbah gehegt werden. Der Raum zwischen der Burg und der ringförmigen Außenmauer ist der Sicherheit wegen unbepflanzt und flach gehalten, also zum Schußfeld bestimmt. Dort schlummern starke Doggen im Schatten der Bastionen oder spielen auf der Fläche umher. Da die Tiere leicht lästig werden, ist eine Brücke vom Platz, an dem die Wagen halten, bis zum Eingang der Kasbah geführt.
Wenn ich auf der Fläche zu tun habe, betrete ich sie nie ohne einen der Wärter; ich staune über die Gelassenheit, mit der sie die Tiere anfassen. Mir ist es schon widrig, wenn die Schnauzen mich anstoßen oder die Zungen mir die Hand lekken. Die Tiere sind in vielem klüger als wir. Offenbar wittern sie meine Befangenheit, die sich zur Angst steigern könnte ––– dann würden sie über mich herfallen. Wo das Spiel aufhört, weiß man bei ihnen nie. Das haben sie mit dem Condor gemein.
Die Doggen, dunkle Tibeter mit gelben Schnauzen und gelben Brauen, dienen auch zur Jagd. Sie rasen vor Freude, wenn sie in der Frühe das Horn hören. Man kann sie auf die stärksten Gegner loslassen; sie greifen den Löwen und das Nashorn an.
Diese Meute ist nicht die einzige. Entfernt von der Kasbah, doch von der Höhe aus einzusehen, dehnt sich am Strande eine Anlage von Ställen, Remisen, Volieren, offenen und gedeckten Reitbahnen. Dort sind auch die Zwinger der Windhunde. Der Condor liebt es, mit seinen Mignons hart am Meer zu galoppieren; dabei umschwärmt sie das Rudel fahlgelber Steppenhunde; sie sind für die Gazellenjagd bestimmt. Ihr Lauf erinnert an die Rennfahrer und Balltreter, die hier in der Arena triumphieren: Intelligenz und Charakter sind der Hetze zum Opfer gebracht. Die Schädel sind schmal, mit abgeflachten Stirnen, die Muskeln spielen nervös unter der Haut. Sie hetzen ihr Opfer in langer Jagd zu Tode, unermüdlich, als ob ein Spiralwerk in ihnen abrollte.
Die Gazelle könnte oft noch entrinnen, wenn sie nicht durch den Falken gestellt würde. Der Stößer wird abgehäubelt und in die Luft geworfen; die Hunde und hinter ihnen die berittenen Jäger folgen seinem Fluge, der sie zum Wild leitet.
Diese Jagd auf den weiten, nur mit Halfagras bestandenen Flächen bietet ein großes Schauspiel; die Welt wird einfacher, während die Spannung wächst. Das zählt zum Besten, was der Condor seinen Gästen bietet; er selbst genießt sie festlich, und ein Vers vom Rand der Wüste scheint eigens für ihn erdacht:
Ein guter Falk, ein schneller Hund, ein edles Pferd
Sind mehr als zwanzig Weiber wert.
Es versteht sich, daß dabei die Falknerei mit allen Finessen des Fanges, der Haltung und Abrichtung in Ehren steht. Jagd- und Würgfalken werden im Lande mit dem Schlagnetz erbeutet; andere, darunter schneeweiße Tiere aus dem Hohen Norden, kommen weither. Der Gelbe Chan, sein höchster Jagdgast, bringt sie dem Condor alljährlich zum Präsent.
Die Falknerei zieht sich weiträumig am Ufer des Sus entlang. Die Lage am Fluß ist günstig für die Abrichtung. In den Auwäldern nisten zahllose Wasservögel; sie sammeln sich, um zu fischen, auf den überschwemmten Sandbänken. Vor allem der Reiher eignet sich zur Schulung von Falken, die zur Jagd auf Federwild bestimmt werden. Dabei sind wiederum andere Hunde nötig: langohrige Spaniels, die gern ins Wasser gehen; ihr Fell ist weißfleckig, damit der Schütze sie im Schilf erkennt.
Der Hauptfalkner ist Rosner, ein studierter Zoologe, der sich aus Passion der Jagd zuwandte. Und er tat recht daran, denn Professoren findet man hier in beliebiger Menge, während ein solcher Falkner zu den Glücksfunden zählt.
Professor ist er außerdem. Ich sehe ihn häufig auf der Kasbah und in seinem Institut, begegne ihm auch zuweilen auf einsamen Gängen im Revier. Einmal begleitete ich ihn während des Wanderfalkenzuges zu einem seiner Ansitze. Die Steppe grenzt dort an einen Bestand haushoher Ginsterbüsche, in deren Schatten der Vogelsteller sich verbarg. Eine Taube an langem Faden diente als Lockvogel. Wenn ein Falk sich näherte, gab Rosner der Taube einen Ruck, damit sie aufflatterte. Wurde sie nun vom Räuber gegriffen und gehalten, so ließen beide sich ohne Mühe bis zu einem Ringe ziehen, durch den der Faden lief und bei dem das Schlagnetz niederfiel.
Der Vorgang war spannend als ein Muster intelligenter Nachstellung. Es kamen Umstände hinzu, die über die Grenzen der menschlichen Sicht hinausreichten und magisch anmuteten. So muß die Taube schon aufsteigen, wenn ein Falk vorbeizieht, den selbst das schärfste Auge nicht entdeckt. Dem Falkner dient dabei als Späher ein gescheckter Vogel von Drosselgröße, den er neben der Taube fesselt und der den Stößer in unglaublicher Ferne vielleicht eher ahnt als erkennt. Dann warnt er mit schallendem Geschrei.
Magisch wirkt diese Jagd insofern, als sie die Welt zu fiedern scheint. Die Jäger einen sich mit ihrer Beute in der Berückung; sie schwingen sich in ihre Listen ein. Nicht nur der dunkle Fallensteller, der sein Leben bei dem Geschäft verbracht hatte, auch der studierte Ornithologe verwandelte sich zum Papageno, war als Traumtänzer dabei. Mich selber überkam das schnelle und tiefe Atmen der Passion.
Dabei ist anzumerken, daß ich kein Jäger bin, ja daß mir ungeachtet meines Namens die Jagd zuwider ist. Vielleicht sind wir alle zum Fischen und Vogelstellen geboren, und Töten ist unsere Aufgabe. Nun gut, dann habe ich die Lust transformiert. Bei der Reiherbeiz fühle ich eher mit dem Opfer als mit dem Falken, der es schlägt. Immer wieder sucht der Reiher an Höhe zu gewinnen, und immer wieder wird er überflogen, bis endlich das Gefieder stiebt.
Die Gazelle ist eines der zärtlichsten Wesen: schwangere Frauen halten sie gern in ihrer Nähe, das Auge wird von den Dichtern gerühmt. Ich sah es brechen am Schluß der Hetze, während der Falk im Staube flatterte, die Hunde hechelten. Die Jäger töten das Schöne besonders gern.
*
Doch nicht vom Auge der Gazelle ist jetzt die Rede, sondern von dem des Condors und seiner Tagessicht. Allerdings werde ich mich mit der Jagd noch befassen müssen, und zwar in verschiedenen Dimensionen, doch nicht als Jäger, sondern als Beobachter. Die Jagd ist ein Regal, ein Vorrecht der Fürsten; sie erfaßt das Wesen der Herrschaft nicht nur symbolisch, sondern auch rituell, durch das vergossene Blut, das die Sonne bescheint.
*
Mein Amt bringt es mit sich, daß ich mehr an der Nachtseite des Condors teilhabe. Dann sieht man Blaßgesichter mit Brillen, oft wie im Eulennest beisammen ––– Professoren, Literaten, Meister brotloser Künste, reine Genießer, die zum Behagen beitragen. Der Scharfsinn hat sich nun auf das Ohr verlegt. Anspielungen liegen nicht mehr in den Worten, sondern nur im Ton noch oder selbst in der Mimik – dann muß ich aufhorchen. Es werden andere, vor allem musische, Themen abgehandelt, und die Jagd, wie es scheint, nur auf seltsam verschlüsselte Art. Das ist zu beobachten.
Der Raum ist gut gegen Schall gesichert; ihn abzustimmen, fällt in meine Pflicht. Lautes und hartes Sprechen ist dem Condor dann zuwider, schmerzt ihn sogar. Daher hat er den ständigen Conviven und Offizianten zum Teil andere Rufnamen gegeben und auch darauf geachtet, daß sie miteinander einen Euphon bilden. Attila etwa, sein Arzt, der kaum von seiner Seite weicht, wird dann von ihm »Aldy« genannt. Will der Condor mich etwa auf eine Attila betreffende Dienstleistung hinweisen, so heißt es: »Emanuelo ––– : Aldy«; das klingt gut.
Als ich, wie jeder, der in seiner Nähe zu tun hat, dem Condor vorgestellt wurde, suchte er diesen Namen für mich aus. »Manuel, Manuelo, Emanuelo« – je nach dem Zusammenklang. Seine Art, zu unterscheiden und zu modulieren, vertieft die Wirkung seiner Ansprachen. Auf der Agora ist das Wie noch wichtiger als das Was, der Vortrag stärker als die Tatsachen, die er zu verändern, ja zu schaffen vermag.
»Um die Gunst buhlen«: das ist auch eine Kunst. Die Redensart ist vermutlich von einem erfunden, dem es wie dem Fuchs mit den Trauben ging. Allerdings, wenn der Buhler erst im Kabinett sitzt, ändern die Dinge sich. Die Masse erkennt dann, wie die Liebste, freudig ihren Herrn, nachdem sie ihn ins Kämmerlein gelassen hat.
*
Ich wurde im Dienstanzug vorgestellt, einem knapp anliegenden Zeug aus blaugestreiftem Leinen, täglich erneuert, da keine Wäsche darunter getragen wird. Dazu maurische Pantoffel aus gelbem Saffian. Die weichen Sohlen sind bequem und lautlos, wenn ich mich hinter der Bar bewege, wo der Teppich fehlt. Endlich das lächerliche Mützchen, ein Schiffchen, das schief aufzusetzen ist. Im ganzen ein Mittelding zwischen Uniform und flottem Dreß; es kommt darauf an, daß meine Erscheinung gefälligen Diensteifer mit Heiterkeit vereint.
Bei der Vorstellung nahm der Condor, um die Frisur zu prüfen, mir das Schiffchen ab. Dabei nannte er meinen Namen mit einem Wortspiel, dessen Formulierung mir entfallen ist. Dem Sinn nach hielt er es für möglich und zu hoffen, daß eines Tages aus dem Venator ein Senator hervorginge.
*
Über die Worte der Mächtigen muß man nachdenken. Dieses ließ verschiedene Auslegungen zu. Der Sache nach wollte er mich vielleicht auf die Bedeutung meines Postens hinweisen. Bedenke ich freilich Rang und Ehren, zu denen manche seiner Mignons aufsteigen – und warum sollten sie es nicht? – so würde man auch mit einem Nachtsteward nicht zimperlich sein. Schließlich hat Sixtus IV. aus seinen Epheben Kardinäle gemacht.
Er konnte aber auch die Person gemeint haben. Die Neigung der Venators, wenigstens meines Vaters und meines Bruders, für die Tribunen ist in Eumeswil bekannt. Zwar sind beide politisch nicht aktiv gewesen, doch stets Republikaner aus Überzeugung und Sympathie. Der Alte ist noch im Amte, der Bruder wegen vorwitziger Reden abgesetzt. Vielleicht war die Anspielung auf den Senator in diesem Sinn gemeint: die Sippe sollte auf mich nicht abfärben.
Manuelo: damit begründet sich eine Art von Patenschaft. Zugleich bekam ich den Phonophor mit dem schmalen Silberstreif, der einen zwar subalternen, doch unmittelbaren Dienst für den Tyrannen kennzeichnet.
3
Soviel über meinen Namen und seine Spielarten. Zu präzisieren ist ferner mein Beruf. Es ist zwar richtig, daß ich als Nachtsteward auf der Kasbah wirke, doch füllt das nur gewisse Lücken meiner Existenz. Darauf läßt wohl schon meine Diktion schließen. Sie könnte einen aufmerksamen Leser bereits vermuten lassen, daß ich im Grunde Historiker bin.
Neigung für die Geschichte und Hang zur Geschichtschreibung sind in meiner Familie erblich; das beruht weniger auf zunftmäßigen Traditionen als auf unmittelbar genetischer Veranlagung. Ich verweise hier nur auf meinen berühmten Ahn Josiah Venator, dessen Hauptwerk »Philipp und Alexander« als wichtiger Beitrag zur Milieutheorie seit langem Ansehen genießt. Das Opus wird immer wieder und wurde noch kürzlich hier von neuem aufgelegt. Die Vorliebe für die Erbmonarchie ist darin nicht zu übersehen; die Historiker und Staatsrechtler von Eumeswil preisen es daher nicht ohne Verlegenheit. Zwar soll der Ruhm des großen Alexander auch auf den Condor strahlen, doch soll sein Genie wie der Vogel Phönix aus der Asche erstanden sein.
Mein Vater und mein Bruder, typische Liberale, gehen aus anderen Gründen behutsam mit dem Josiah um. Zunächst, und das ist verständlich, stört sie die Zurechtschneidung des Ahns auf die politische Aktualität. Außerdem ist hohe Personalität ihnen unheimlich. Alexander erscheint ihnen als Elementarereignis, als Blitz, den die Aufladung zwischen Europa und Asien hinreichend erklärt. Es gibt merkwürdige Übereinstimmungen der liberalen mit der heroischen Geschichtschreibung.
*
Wir bringen also seit Generationen Historiker hervor. Als Ausnahme kommt ein Theologe zum Vorschein oder auch ein Gammler, dessen Spur sich im Obskuren verliert. Was mich betrifft, so habe ich es auf normale Weise zum Magister gebracht, war Assistent bei Vigo und beschäftige mich jetzt als seine rechte Hand mit kollektiven und eigenen Arbeiten. Dabei halte ich Vorlesung und nehme mich der Doktoranden an.
Das mag noch einige Jahre in Anspruch nehmen; es eilt mir weder mit dem Ordinarius noch mit dem Senator, weil ich mich in meiner Haut wohl fühle. Von zeitweiligen Depressionen abgesehen, bin ich im Gleichgewicht. Da kann man die Zeit bequem an sich vorüberziehen lassen ––– sie selbst schenkt Genuß. Hier ist das Geheimnis des Tabaks zu vermuten, leichterer Drogen überhaupt.
*
An meinen Themen kann ich zu Haus in meiner Wohnung oder in Vigos Institut arbeiten, auch auf der Kasbah, was ich der unübertrefflichen Dokumentation wegen vorziehe. Ich lebe hier wie der Fink im Samen, und es würde mich nicht in die Stadt ziehen, wenn der Condor Frauen auf der Burg duldete. Die findet man bei ihm nicht einmal in der Küche, und es darf auch kein Wäschermädchen, mit dem man unter der Hand seinen Zeitvertreib hätte, die Wache passieren; es gibt keine Ausnahme. Die Ehemänner haben ihre Familien in der Stadt. Der Condor meint, daß die Anwesenheit von Frauen, ob jung oder alt, nur die Kabale begünstige. Indessen sind die reiche Kost und das müßige Leben schwer mit der Askese zu vereinigen.
*
Der Vater sah es ungern, daß ich bei Vigo hörte und nicht bei ihm, wie es der Bruder getan hatte. Doch weiß ich aus den Tischgesprächen, was der Alte zu bieten hat, und außerdem halte ich Vigo für den weitaus besseren Historiker. Unwissenschaftlichkeit, ja Feuilletonismus hat mein Erzeuger an ihm auszusetzen; damit verkennt er die eigentliche Wurzel von Vigos Kraft. Was hat Genie mit Wissenschaft zu tun?
Damit will ich nicht bestreiten, daß der Historiker auf Fakten angewiesen ist. Nachlässigkeit ihnen gegenüber kann man jedoch Vigo nicht vorwerfen. Wir leben hier an einer windstillen Lagune, wo enorme Mengen von Strandgut versunkener Schiffe angetrieben sind. Wir wissen besser als je zuvor, was jemals irgendwo auf dem Planeten vorgegangen ist. Der Stoff ist Vigo bis in die feinsten Züge gegenwärtig; er kennt die Fakten, und er weiß seinen Schülern beizubringen, wie man sie auswertet. Auch darin habe ich viel von ihm gelernt.
*
Ist nun Vergangenes auf diese Weise an die Gegenwart herangerückt und wiederaufgerichtet wie die Mauern von Städten, deren Namen selbst vergessen wurden, so darf man sagen, daß saubere Arbeit geleistet worden ist.
Dabei ist zu bemerken, daß Vigo nichts in die Geschichte hineinzaubert. Er läßt vielmehr die letzten Fragen offen, indem er vor die Fragwürdigkeit des Geschehens führt. Wenn wir den Blick zurückwenden, so fällt er auf Gräber und Ruinen, auf ein Trümmerfeld. Wir selber unterliegen dabei einer Spiegelung der Zeit: indem wir vor- und fortzuschreiten meinen, bewegen wir uns auf diese Vergangenheit zu. Bald werden wir ihr angehören: die Zeit geht über uns hinweg. Und diese Trauer überschattet den Historiker. Als Forscher ist er nicht mehr als ein Wühler in Pergamenten und in Gräbern, doch dann stellt er die Schicksalsfrage, den Totenkopf auf der Hand. Vigos Grundstimmung ist fundierte Trauer; ich fühlte mich von ihr angesprochen in meiner Überzeugung von der Unvollkommenheit der Welt.
*
Vigo hat eine besondere Methode, querbeet, also nicht chronologisch, durch die Vergangenheit zu gehen. Sein Auge ist weniger das des Jägers als des Gärtners oder des Botanikers. So hält er unsere Verwandtschaft mit den Pflanzen für tiefer gegründet als die mit den Tieren und meint, daß wir zur Nacht in die Wälder, ja bis zu den Algen der Meere zurückkehren.
Unter den Tieren habe die Biene diese Verwandtschaft wiederentdeckt. Ihre Begattung mit den Blumen sei kein Fortschritt und auch kein Rückschritt der Entwicklung, sondern eine Art von Supernova, ein Aufleuchten des kosmogonischen Eros in einer Sternstunde. Darauf wäre kein noch so kühner Gedanke verfallen; wirklich sei nur, was nicht erfunden werden kann.
Erwartet er im humanen Bereich Ähnliches?
*
Wie in jedem gewachsenen Werk ist auch in dem seinen mehr unausgesprochen als formuliert. In seiner Rechnung bleibt eine Unbekannte; das setzt ihn jenen, bei denen alles restlos aufgeht, auch seinen Schülern, gegenüber in Verlegenheit.
Gut entsinne ich mich des Tages, der mich ihm nahe brachte; es war im Anschluß an eine Vorlesung. Das Thema war »Pflanzstädte«; es zog sich über zwei Semester hin. Die Streuung von Kulturen über Land und Meere, über Küsten, Archipele und Oasen verglich er Samenflügen oder der Anschwemmung von Früchten am Gezeitensaum.
Vigo pflegt bei seinem Vortrag kleine Objekte vorzuweisen oder auch nur in der Hand zu halten – nicht als Belege, sondern als Träger bezüglicher Substanz: manchmal nur eine Scherbe oder ein Bröckchen Ziegelstein. An jenem Vormittag war es ein Fayenceteller mit einem Arabeskenmotiv von Blüten und Schriftzeichen. Er wies auf die Farben: ein Muster von ausgeblaßtem Safran, Rosa, Violett, darüber ein Schimmer, den weder die Glasur noch der Pinsel, sondern den die Zeit erzeugt hatte. So träumen Gläser, die aus dem Römerschutt geborgen wurden, oder auch Ziegeldächer von Einsiedeleien, die in tausend Sommern ausloderten.
Auf verschlungenem Anweg war Vigo hierher gekommen ––– ausgegangen war er von der Küste Kleinasiens, die diesem Wurzelfassen auf neuem Boden so günstig ist. Das war an den Phönikern, den Griechen, an Tempelrittern, Venezianern und anderen demonstriert worden.
Für Händlerkulturen hat er eine Vorliebe. Früh schon hatte man für das Salz, den Bernstein, das Zinn, die Seide, später auch für Tee und Gewürze durch Wüsten und Meere Wege gebahnt. Auf Kreta und Rhodos, in Florenz und Venedig, in lusitanischen und niederländischen Häfen hatten sich wie Honig in den Waben die Schätze gehäuft. Sie setzten sich in höhere Lebensführung, in Genüsse, Bauten, Kunstwerke um. Das Gold verkörperte die Sonne, dank seiner Hortung begannen die Künste sich zu entfalten und zu blühen. Ein Hauch von Verfall, von herbstlicher Sättigung mußte hinzukommen. Dabei hielt Vigo den Teller auf der Hand, als ob er eine Spende erwartete.
Wie war er auf Damaskus verfallen und dann auf den Sprung nach Spanien, durch den Abd-ur Rahman der Ermordung entronnen war? Fast dreihundert Jahr lang blühte zu Córdoba ein Zweig der in Syrien ausgerotteten Omajjaden nach. Neben den Moscheen zeugten auch die Fayencen für diesen längst versiegten Seitenarm arabischer Hochkultur. Dann gab es noch im Yemen die Burgen der Beni Taher. Ein Korn fiel in den Sand der Wüste und brachte dort vier Ernten noch hervor.
Ein Vorfahr von Abd-ur Rahman, der fünfte Omajjade, hatte den Emir Musa zur Messingstadt entsandt. Der Zug führte von Damaskus über Kairo durch die große Wüste in die Westländer bis an die Küste von Mauretanien. Er galt den kupfernen Flaschen, in die der König Salomo aufsässige Dämonen gesperrt hatte. Die Fischer, die ihre Netze im Meer el-Karkar auswarfen, zogen hin und wieder eine dieser Flaschen mit ihren Fängen empor. Sie waren mit dem Siegel Salomonis verschlossen; wenn man sie öffnete, fuhr der Dämon heraus als Rauch, der den Himmel verfinsterte.
Emire mit dem Namen Musa finden sich auch später in Granada und anderen Residenzen des maurischen Spaniens. Dieser hier, der Eroberer Nordwestafrikas, mag als ihr Prototyp gelten. Westliche Züge sind unverkennbar; freilich ist zu bedenken, daß auf den Gipfeln die Unterschiede der Rassen und Regionen einschmelzen. Wie im Moralischen die Menschen sich ähnlich, ja fast identisch werden, wenn sie der Vollkommenheit sich nähern, so hier im Geistigen. Der Abstand von der Welt und vom Objekt wird größer; es wächst die Neugier und mit ihr die Lust, sich letzten Geheimnissen zu nähern, selbst unter großer Gefahr. Das ist ein aristotelischer Zug. Er stellt die Rechenkunst in Dienst.
Es ist nicht überliefert, ob der Emir Bedenken gegen die Öffnung der Flaschen empfand. Wir wissen aus anderen Berichten, daß sie gefährlich war. So hatte einer der gefangenen Dämonen bei sich gelobt, den Menschen, der ihn befreien würde, zum Mächtigsten der Sterblichen zu machen; er hatte Hunderte von Jahren über dessen Beglückung nachgedacht. Dann aber war die Laune umgeschlagen; Gift und Galle hatten sich in seinem Kerker konzentriert. Als nun wiederum nach Hunderten von Jahren ein Fischer die Flasche geöffnet hatte, entging er dem Schicksal, vom Dämon zerrissen zu werden, nur durch eine List. Das Böse wird um so fürchterlicher, je länger ihm nicht Luft gegeben wird.
Daß Musa nicht vor der Entsiegelung zurückgeschreckt wäre, versteht sich auf jeden Fall. Das bezeugt schon die ungemeine Kühnheit jenes Zuges durch die Einöden. Der greise Abd-es Samad, der das »Buch der verborgenen Schätze« besaß und sternkundig war, führte die Karawane in vierzehn Monaten zur Messingstadt. Sie rasteten in verlassenen Schlössern und zwischen den Gräbern verfallener Friedhöfe. Zuweilen fanden sie Wasser in Brunnen, die Iskander hatte graben lassen, als er nach Westen zog.
Auch die Messingstadt war ausgestorben und durch eine Ringmauer verschlossen; es währte weitere zwei Monde, bis Schmiede und Zimmerleute eine Leiter gebaut hatten, die bis an die Krone hinanreichte. Wer sie erstiegen hatte, wurde durch einen Zauber verblendet, so daß er in die Hände klatschte und sich mit dem Rufe »Du bist schön!« hinabstürzte. Derart verdarben nacheinander zwölf von Musas Gefährten, bis es endlich dem Abd-es Samad glückte, der Berükkung zu widerstehen, indem er, während er hinanstieg, unablässig den Namen Allahs ausrief und oben die Verse der Rettung betete. Er sah unter dem Trugbild wie unter einem Wasserspiegel die zerschmetterten Leiber der Vorgänger. Musa: »Wenn so ein Vernünftiger handelt – was wird dann ein Irrer tun?«
Der Scheich stieg dann durch einen der Türme hinab und öffnete von innen das Tor der Totenstadt. Doch nicht diesen Abenteuern, obwohl sie ihre Hintergründe haben, galt die Erwähnung des Emir Musa, sondern seiner Begegnung mit der historischen Welt, die vor der Wirklichkeit des Märchens zum Scheinbild wird.
Der Dichter Thâlib las dem Emir Inschriften von Grabmälern und Wänden der verödeten Paläste vor:
Wo sind sie, deren Kraft dies alles hier erbaut
Mit hohen Söllern, wie kein Mensch sie je erschaut?
Wo sind der Perser Herrscher in der Burgen Wehr?
Ihr Land verließen sie – es kennet sie nicht mehr!
Wo sind sie, die in allen Ländern herrschten,
In Sind und Hind, die stolze Herrenschar?
Die Sendsch und Habesch ihrem Willen fügten
Und Nubien, als es rebellisch war?
Erwarte von dem Grabe keine Kunde;
Von dort wird keine Kenntnis dir zuteil.
Im Zeitenumschwung traf sie das Verhängnis;
Aus Schlössern, die sie bauten, kam kein Heil.
Diese Verse erfüllten Musa mit solcher Trauer, daß ihm das Leben zur Last wurde. Als sie die Säle durchwanderten, kamen sie an einen Tisch, der aus gelbem Marmor gemeißelt oder, nach anderen Berichten, aus chinesischem Stahl gegossen war. Darin stand eingeritzt in arabischen Zeichen:
»An diesem Tische haben tausend Könige gespeist, die blind waren auf dem rechten Auge, und tausend andere, die blind waren auf dem linken Auge ––– sie alle sind dahingegangen und bevölkern die Gräber und Katakomben.«
Als Thâlib das gelesen hatte, wurde es Musa dunkel vor den Augen; er schrie auf und zerriß sein Gewand. Dann ließ er die Verse und Inschriften aufschreiben.
*
Kaum jemals wurde der Schmerz des Historikers mit solcher Heftigkeit erfaßt. Es ist der Schmerz des Menschen, der längst vor aller Wissenschaft gefühlt wurde und ihn begleitet, seitdem er die ersten Gräber grub. Wer Geschichte schreibt, möchte die Namen und ihren Sinn erhalten, ja möchte Namen von Städten und Völkern wiederfinden, die längst verschollen sind. Das ist, als ob man Blumen auf ein Grab legte: »Ihr Toten und auch ihr Namenlosen ––– Fürsten und Krieger, Sklaven und Missetäter, Heilige und Huren, seid nicht traurig: es wird eurer in Liebe gedacht.«
Doch auch dieses Gedenken ist befristet, es fällt der Zeit zum Raube; jedes Denkmal verwittert, und mit den Toten verbrennt auch der Kranz. Wie kommt es, daß wir trotzdem von diesem Dienst nicht ablassen? Wir könnten uns mit Omar, dem Zeltmacher, zufrieden geben, mit ihm den Wein von Schiras bis zur Neige kosten und dann den irdenen Becher fortwerfen: Staub zu Staub.
Wird je ein Wächter ihre Gräber öffnen, ein Hahnenschrei sie zum Licht wecken? Dem muß so sein, und die Trauer, die Qual des Historikers zählt zu den Hinweisen. Er ist der Totenrichter, wenn längst der Jubel verstummt ist, der die Mächtigen umrauschte, wenn ihre Triumphe und ihre Opfer, ihre Größe und ihre Schande vergessen sind.
Und doch ein Hinweis nur. Die Qual, die Unruhe des historischen Menschen, seine unermüdliche Arbeit mit unvollkommenen Mitteln in einer vergänglichen Welt ––– das könnte nicht empfunden, nicht geleistet werden ohne eine Weisung, die diesen Hinweis schafft. Der Verlust des Vollkommenen kann nur empfunden werden, wenn Vollkommenes besteht. Ihm gilt der Hinweis, das Zittern der Feder in der Hand. Die Kompaßnadel zittert, weil ein Pol existiert. In den Atomen ist sie ihm verwandt.
Wie vom Dichter das Wort, ist vom Historiker die Tat zu wiegen – jenseits von Gut und Böse, jeder erdenklichen Moral. Wie vom Gedicht die Musen, sind hier die Nornen zu beschwören; sie treten vor den Tisch. Da wird es still im Raume; die Gräber öffnen sich.
Auch hier gibt es Grabräuber, die dem Markt zuliebe Gedicht und Taten fälschen ––– da ist es besser, mit Omar Chajjam zu zechen, als mit ihnen an den Toten sich zu vergehen.
4
An dieser Stelle gab es ein Scharren im Auditorium. Ich hörte es schon halb auf dem Flure, denn ich hatte leise die Tür geöffnet, um hinauszugehen. Nachher, in der Bibliothek, sprach Vigo mich darauf an:
»Ihnen war es wohl auch zu antiquiert, was Sie vorhin gehört haben?«
Ich schüttelte den Kopf. Es war vielmehr so, daß mich der Vortrag zu stark ergriffen hatte; er traf mein eigenes Anliegen, meine eigene Qual. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig skizziert habe. Vigo verfügt über einen ungemeinen Vorrat an Bildern, die er in die Rede einflicht, als ob er sie aus der Luft griffe. Sie umhüllen die Gedankenfolge, ohne sie zu stören, und erinnern so an Bäume, die ihren Flor unmittelbar aus dem Stamm treiben.
Ich begnügte mich, wie gesagt, damit, den Kopf zu schütteln; es ist besser, vor allem unter Männern, daß Gefühle erraten, als daß sie erklärt werden. Ich spürte, daß er mich verstand. Das war der Augenblick, der unsere Freundschaft gründete.
Offenbar hatten die Kommilitonen das, was mich ergriffen hatte, gar nicht bemerkt. Das kommt vor, wenn sich zwischen zwei Menschen ein Stromkreis schließt. An einigen Stellen hatten sie gelacht – so, als das Wort »Monde« fiel. Sie sind schnell bei der Hand mit dem Gelächter, das ihnen ein Gefühl der Überlegenheit verleiht.
Sie hielten »Monde« wie überhaupt Vigos Vortrag für antiquiert. Das Zeitmoment spielt die Hauptrolle für sie. Entgangen war ihnen ohne Zweifel, daß es ein alter Text war, aus dem Vigo zitierte, fußend auf Gallands Übersetzung aus dem Arabischen. Davon abgesehen, ist »Monde« natürlich phonetisch, grammatisch, logisch besser als »Monate«. Das Wort hat einen Stich bekommen, weil flache Dichter es strapaziert haben. Ich würde es daher nicht anwenden. Vigo ist über solche Bedenken erhaben; er könnte das Ansehen der Sprache wiederherstellen. In jeder anderen Zeit als heute, wo man einander nicht mehr ernst nimmt, wäre er trotz mancher Eigenheit in seinem Rang erkannt worden.
Ist er nun in der Sache streng und unnachgiebig, so doch persönlich von großer Empfindsamkeit. Er könnte freilich reden, was und wie er wollte, selbst gröbsten Unsinn, wenn er sich up to date hielte. Daran hindert ihn die Substanz; sie zwingt zur Redlichkeit. Er könnte, selbst wenn er wollte, die Sache nicht zu seinem Vorteil umbiegen.
Daß ein Mensch von hoher Kultur mit dem Zeitgeist harmoniert, war schon von jeher ein Glücksfall, eine seltene Ausnahme. Heut hält man es am besten mit dem alten Weisen:
Soll man dich nicht aufs schmählichste berauben,
Verbirg dein Gold, dein Weggehn, deinen Glauben.
Das tun selbst die Machthaber; sie legen das Allerweltskittelchen an. Auch der Condor, obwohl er sich viel herausnehmen kann, ist hier behutsam; ein Nachtsteward kann das beurteilen.
*
Ein Lehrer beschränkt sich, so wie die Dinge liegen, am besten auf die Naturwissenschaften und den Bereich ihrer praktischen Anwendung. In allem, was darüber hinausgeht, etwa in der Literatur, der Philosophie, der Geschichte, betritt er gefährlichen Boden, besonders wenn er des »metaphysischen backgrounds« verdächtigt wird.
Mit solchen Verdächtigungen operieren bei uns zwei Sorten von Dozenten: entweder Ganoven, die sich als Professoren verkleidet haben, oder Professoren, die sich, um Popularität zu schinden, als Ganoven aufspielen. Sie suchen sich im Wettlauf der Infamie zu überholen, doch hacken sie sich gegenseitig kein Auge aus. Falls aber Geister wie Vigo sich in ihren Kreis verirren, so sind das weiße Raben; man vereint sich gegen sie. Es ist merkwürdig, wie sich dann, als ob Vernichtung drohte, alle zusammentun.
Die Studenten, obwohl an sich gutartig, erhalten von dort ihre Schlagworte. Ich will nicht auf Quisquilien eingehen. In der Geschichtsbetrachtung lösen sich vor allem zwei Perspektiven ab, von denen die eine auf Männer, die andere auf Mächte ausgerichtet ist. Das entspricht auch einem Rhythmus in der Politik. Hier Monarchien, Oligarchien, Diktaturen, die Tyrannis – dort Demokratien, Republiken, der Ochlos, die Anarchie. Hier der Kapitän, dort die Besatzung, hier der große Führer, dort das Gemeinwesen. Für Eingeweihte versteht sich, daß diese Gegensätze zwar notwendig, doch zugleich illusionär sind – es sind Motive, die dazu dienen, die Uhr der Geschichte aufzuziehen. Nur selten strahlt ein Großer Mittag, an dem die Gegensätze sich in Glück auflösen.
*
Nach dem Triumph des Condors über die Tribunen stehen bei uns wieder einmal »die Männer« hoch im Kurs. Der Condor selbst verhält sich in dieser Hinsicht liberaler als die Professoren, die sich bei ihm um jeden Preis anbiedern wollen ––– die jüngeren aus reiner Dummheit, die älteren, die schon während des Tribunats im Amt waren, aus begründeten Rücksichten.
Man kann hier Studien machen wie im Panoptikum. Etwa: an einen jungen Dozenten wird eine Theorie herangetragen, die ihm fremd, vielleicht sogar unsympathisch ist. Die Mode zwingt ihn, sich damit zu beschäftigen. Sie überzeugt ihn – dagegen wäre nichts einzuwenden, obwohl bereits das nicht recht sauber ist. Dann aber beginnt er sich zu benehmen wie ein Pubertärer, der nicht unterscheidet, wo geschwärmt werden darf und wo gedacht werden muß. Er nimmt autoritäre und bald auch gefährliche Züge an. Die Universität ist von solchen Halbgeistern erfüllt, die einerseits schnüffeln, andererseits stänkern und einen widrigen Stallgeruch ausdünsten, wenn sie beisammen sind. Wenn sie das Heft in der Hand haben, verlieren sie, der Macht unkundig, jedes Maß. Endlich kommt der Kommißstiefel.
Zur Zeit werden sie durch den Condor und seinen Majordomo im Zaum gehalten und beschränken ihre Jagd auf Opfer, von denen sie glauben, daß sie in Mißkredit stehen. Vigo gehört dazu. Da jetzt wieder »Männer Geschichte machen«, gelten seine Vorlieben, etwa für Händler, die sich Soldaten halten, als dekadent. Dabei wird übersehen, daß sein Leitbild die kulturelle Leistung ist. So sind die Karthager, obwohl auch sie mit Söldnern fochten, nicht nach seinem Sinn. Im Grunde ist es die Schönheit, der er dient. Ihr sollen Macht und Reichtum zu Gebote stehen. Vielleicht ist er darin dem Condor, wenigstens dessen Nachtseite, verwandter, als er ahnt.
*
Vigo ist, wie gesagt, empfindlich und nimmt diese Professorenhändel tragisch, obwohl sie seine Sicherheit nicht bedrohen. Allerdings gedeihen in unserer fauligen Lagune Verfolgertypen von besonderer Penetranz. »Mit jedem Schüler hegt man eine Schlange am Busen« – so Vigo einmal zu mir in einer dunklen Stunde über Barbassoro, der freilich eher zur Spezies der Edelratten zählt.
Die Edelratte ist hochintelligent, gefällig, arbeitsam, geschmeidig und von subtiler Einfühlung. Das ist die Zierde ihres Wesens, die sie zum Lieblingsschüler prädestiniert. Leider – das liegt in ihrer Art begründet – kann sie der Lokkung des Rudels nicht widerstehen. Sie hört den Pfiff – und gälte er selbst dem verehrten Meister, so gesellt sie sich den vielen, die über ihn herfallen. Besonders gefährlich wird sie durch ihr Wissen und die intime Kenntnis, die sie sich in seinem Umgang erworben hat. Sie wird zur Leitratte.
*
Vigos Kritik am Zeitgeist ist so verschlüsselt, daß sie schwer zu durchschauen ist. Übrigens ist »Kritik« nicht ganz zutreffend. Eher ist es sein Wesen, das so empfunden wird. Wo alles sich bewegt, dazu noch in der gleichen Richtung, sei es nach rechts, nach links, nach oben oder unten, da stört der Ruhende. Er wird als Vorwurf empfunden, und da man sich an ihm stößt, gilt er für jenen, der verletzt.
Die Bewegung sucht die Sache in Meinung und dann in Gesinnung zu transformieren, und wer noch zur Sache hält, gerät wider Willen in ein schiefes Licht. Das ist in einer Fakultät leicht möglich, in der die Weltgeschichte nach jedem Umsturz dem Augenblick zuliebe umgeschrieben werden soll. Die Lehrbücher verschleißen, sie veralten nicht mehr.
Um einen Geist wie Vigo angreifbar zu machen, bedarf es gewisser Einsichten. Als lästig wird er unmittelbar empfunden, allein durch seine Existenz. Die Dummköpfe haben dafür einen sicheren Instinkt. Es kommt nun darauf an, nachzuweisen, daß dieser Lästige einerseits zwar unbedeutend, andererseits aber auch gefährlich ist. Dieser Nachweis wird durch Gelehrte vom Schlage Kessmüllers geführt. Das sind die Trüffelschweine, die den Leckerbissen ausgraben. Die Ratten fallen dann darüber her.
*
Kessmüller, ein kahler Schwuler, hat Vigo gründlich studiert. Seine Gedanken sind platt wie seine Glatze; er ist Lebemann, Feinschmecker und verfügt über Humor. Als Eumenist ist er »unumstritten«; er könnte auch als Conférencier im »Calamaretto« sein Geld verdienen und macht den Unterhalter bei akademischen Abenden. Sein Talent hat ihn schon durch verschiedene, auch gegensätzliche, Regime hindurchgeschleust als Heringskönig, der auf der Oberfläche glänzt. Er hat einen Instinkt für das Konforme und für unwiderstehliche Gemeinplätze, die er anspruchsvoll stilisiert. Er kann sie auch umdeuten, je nach der Windrichtung. Ein Genießer; materiell fühlt er sich beim Condor, materialistisch bei den Tribunen besser zu Haus.
In seinen Vorlesungen versäumt er selten, Vigo zu zitieren, wobei sein Antlitz sich genüßlich verklärt. Ein guter Komiker wirkt bereits durch die Erscheinung – durch das Komische an sich. Kessmüller kann sich wie ein Chamäleon verwandeln, schlüpft aus der Tracht des Pädagogen in die des Pantalone ohne anderen Übergang als den eines kurzen Stillschweigens. Das ist, als ob er in die Bütt träte. Erwartungsvolle Einstimmung verbreitet sich im Auditorium, bevor er noch den Mund auftut. Schon können einige das Lachen kaum zurückhalten.
Ich ging in sein Kolleg, allein schon um diese Volte zu studieren; merkwürdig ist, daß er dabei kaum das Gesicht verzieht. Die Hörer lachen; man möchte an Telepathie denken. Kessmüller ist ein Redner, der das Geheimnis der Pause kennt.
Dann beginnt er, Vigo zu zitieren, einen Satz oder auch einen Absatz, auswendig. Manchmal tut er auch so, als ob ihm etwas Witziges einfiele; er zieht ein Buch hervor, um daraus vorzulesen ––– das klingt dann, wie die Apotheker sagen, als ob es exfaustiert wäre, ist aber wohl präpariert. Er fährt mit dem Finger hin und her, scheint die Stelle zu suchen, die er sorgfältig angestrichen hat. Vigos Name wird dabei nicht erwähnt, doch jeder im Auditorium weiß Bescheid.
Die Stellen sind zwar aus dem Zusammenhang gerissen, doch wortgetreu. Kessmüller weiß, was er der Wissenschaft schuldig ist. Er tut auch nicht so, als ob er einen komischen Text zitierte; höchstens werden Wörter wie »Monde« behaglich betont. Auch »hoch« und »höher« betont er gern auf diese Weise, und »schön« wie ein Clown, der die rote Nase aufsetzt.
Das berührt das Gebiet der Persiflage, die sich von der leichten Imitation bis zur groben Gemeinheit erstreckt. Kessmüller betreibt sie als Kunst. Daß er dazu Stellen von Vigos Texten auswählt, die ich besonders liebe, ist nicht zufällig. In einem Kabarett am Hafen tritt ein Parodist auf, der Gedichte auf skurrile Weise vorträgt, etwa vom Rabbi Teiteles, gemauschelt oder herausgepreßt von einem, der auf dem Abtritt hockt. Er wählt dazu klassische Texte und verzieht den Mund ähnlich wie Kessmüller. Wunderlich ist dabei, daß den Zuhörern die Gedichte geläufig scheinen; sie müssen sie noch auf der Schule gelernt haben, sonst entfiele der Anlaß zur Heiterkeit.
*
Vigo verdanke ich eine der geologischen Ortungen von Eumeswil: fellachoide Versumpfung auf alexandrinischer Grundlage. Die Schicht darunter war alexandrinisches Wissen auf klassischer Grundlage.
Die Werte haben sich also weiterhin verflacht. Erst waren sie gegenwärtig, dann noch geachtet, schließlich ein Ärgernis. Für Kessmüller ist schon das Wort suspekt.
Vor uns gab es immerhin noch ein Nachleuchten. Doch der Ofen ist kalt; er wärmt selbst die Hände nicht mehr. Von exhumierten Göttern kommt kein Heil; wir müssen tiefer in die Substanz dringen. Wenn ich ein Fossil, etwa einen Trilobiten, auf die Hand nehme – man findet hier in den Steinbrüchen am Fuß der Kasbah vorzüglich erhaltene Exemplare – dann bannt mich der Eindruck mathematischer Harmonie. Zweck und Schönheit sind, frisch wie am ersten Tage, in einer von Meisterhand gestochenen Medaille noch lückenlos vereint. Der Bios muß in diesem Urkrebs das Geheimnis der Dreiteilung entdeckt haben. Sie findet sich dann vielfach wieder, auch ohne natürliche Verwandtschaft; Gestalten, im Schnitt symmetrisch, hausen im Triptychon.
Vor wieviel Millionen Jahren mag dieses Wesen ein Meer belebt haben, das nicht mehr besteht? Ich halte seinen Abdruck, ein Siegel unvergänglicher Schönheit, in der Hand. Auch dieses Siegel wird einmal verwittern oder in künftigen Weltbränden verglühen. Der Prägstock, der es formte, bleibt im Gesetz verborgen und aus ihm wirksam, von Tod und Feuer unberührt.
Ich fühle meine Hand warm werden. Wenn das Wesen noch lebte, würde es meine Wärme spüren wie die Katze, deren Fell ich streichele. Doch auch der Stein, in den es sich verwandelte, kann sich dem nicht entziehen; die Moleküle dehnen sich. Ein wenig mehr, ein wenig stärker: es würde sich wie im Wachtraum regen in meiner Hand.
Zwar kann ich die Schranke nicht überspringen, doch fühle ich, daß ich auf dem Wege bin.
5
Diese Verfolgungen waren widrig, doch Vigo tat ihnen zuviel Ehre an, indem er darunter litt. Manchmal, wenn ich ihn in der Bibliothek traf oder ihn in seinem Garten aufsuchte, fand ich ihn blaß und lichtscheu wie einen Kauz, der sich in seiner Höhle versteckt. Kommt er ans Licht, so fallen die Krähen über ihn her. Ich bemühte mich dann, ihn zu remontieren, indem ich ihn auf seine Kraft und seine Aufgabe verwies. An Gründen fehlte es mir nicht.
Vigo mußte doch sehen und wußte es auch dank seiner eminenten Kenntnis der Geschichte, daß diese Art der billigen Verfolgung die Schwäche der Gegner und seine Stärke unterstrich. Seine Freiheit ist ein Vorwurf, ein Dorn im Fleische dieser Halbkadaver, die daher nicht müde werden, sich mit ihm abzugeben, obwohl ihm jede Aggressivität fehlt. Er ist nicht bei den Tribunen gewesen und steht jetzt auch nicht zum Condor; beides ärgert sie. Er läßt sich in kein Regime einordnen. Staatsformen sind ihm wie dünne Häute, die unaufhörlich abblättern. Der Staat als solcher, unabhängig von der Verwandlung, ja sie bewirkend, ist eine große Sache, ein Maßstab für ihn.
Er hat Vorliebe für gewisse Formen, ohne sich für eine, besonders nicht für eine aktuelle, zu engagieren; dagegen fesselt ihn die Art, in der sie von innen, aus der Substanz der Geschichte heraus, einander ablösen. Männer und Mächte folgten sich, als ob der Weltgeist bald der einen und bald der anderen überdrüssig würde, nachdem sie sich an ihm, stets ungenügend, erschöpft hatten. Hier Lehren, Ideen, Ideale, dort mehr oder minder profilierte Einzelne. Hohe Kultur – Windstille, als ob der Wille erlahmte – war immer wieder und hier wie dort möglich: kosmische Schönheit durchbrach das Gefüge, vor allem wenn es noch nicht erhärtet oder nachdem es rissig geworden war. Die Ouvertüre wie das Finale verdichten das Motiv.
Die zweite Möglichkeit scheint Vigo stärker anzuregen, weil die Götter nicht mehr so mächtig sind. Deren Vielfalt, auch die der Staaten, ist günstiger. Hier die Palette, dort die Monotonie. Die Römer sind für den Staat, die Griechen für die Kultur vorbildlich. Hier das Kolosseum, dort der Parthenon.
»Wie wollen Sie damit Kessmüller imponieren, ja auch nur debattieren mit ihm? Dem gibt das Stoff für seine Heiterkeit.«
Der Materialismus des Domo ist realistischer, der seiner Vorgänger war rationalistischer Natur. Beide sind oberflächlich, für den politischen Gebrauch bestimmt. Für Rabulisten war bei den Tribunen mehr herauszuholen; Kessmüller hat daher mit ihnen besser harmoniert.
Beachtlich sind aber die raffinierten Klimmzüge, mit denen er sich auch dem Condor anpaßte. Meinem Bruder und meinem Erzeuger gelang das weniger gut. Das streift den Unterschied zwischen dem abgewetzten Liberalen und dem platten Doktrinär, der von Verheißungen lebt. Alles wird Entwicklung, Progreß zum irdischen Paradies. Es läßt sich endlos auswalzen.
»Sie sollten solche Figuren auch als Tempelwächter betrachten, die Ihnen mit ihren Fratzen wenigstens die ärgsten Dummköpfe fernhalten. Möchten Sie denn, daß sich auch in Ihren Kollegs diese süffisante Zufriedenheit ausbreitet? Solche Geister muß man dort, wo sie glauben, bei ihren Göttern, aufsuchen. Da wird der aufgeschminkte Alltag, werden die tönernen Füße offenbar.«
Vigo setzt, wie übrigens auch mein Erzeuger, noch Achtung vor dem objektiven Wissen voraus. Wie sollte das inmitten des allgemeinen Achtungsverlustes möglich sein? Er lebt noch in Zeiten, in denen ein Theater, eine Parade, eine Ehrung, ein Parlamentsakt, auch eine Vorlesung zum Fest werden konnten ––– wie wäre das möglich ohne Festfreude? Dazu kommt Vigos pädagogische Leidenschaft, die mir, obwohl ich vermutlich auch einmal Ordinarius werde, völlig fehlt.
Nicht, daß ich es mir nicht zutraute. Ich könnte es leisten wie einer, der General wird, weil das in seiner Familie seit jeher üblich gewesen ist. Er kennt die Technik, weiß, wie man die Truppe abrichtet, hat das im Griff. Daher kann er den Posten in jedem Regime ausfüllen, selbst in durchaus konträren, und erscheint plötzlich auf der Feindseite, wie das bei Revolutionsgeneralen fast die Regel ist. Die Passion bleibt davon unberührt – wie bei Jomini, der mitten in der Schlacht ausrief: »Donnerwetter, jetzt möchte ich drüben kommandieren: das gäbe ein Fest!« Ähnliches gilt für den Historiker. Je weniger er engagiert ist, um so unbefangener wird sein Urteil; Eumeswil ist ein guter Boden dafür.
Ein Mann, der sein Handwerk versteht, wird immer und überall geschätzt. Hier ist auch eine der Überlebenschancen für den Aristokraten, dessen diplomatischer Instinkt kaum zu ersetzen ist. Ich muß das mit Ingrid für ihre Habilitation durchsprechen, nach einer unserer isländischen Umarmungen.
*
Der Fachmann ist um so stärker, je unbestimmter das Substrat wird, auf dem er sich bewegt. Keine Bindung, kein Vorurteil mehr; die Potenz steigt aus der Basis in den Exponenten auf. Wer ethisch und ethnisch am wenigsten Gepäck mitbringt, ist Matador der schnellen Wendung und der chamäleonischen Verwandlungen.
Der große Spion verkörpert das am reinsten; das ist nicht zufällig. Mit jedem Meisterspion wird auch der Gegenspion geboren; das steckt tiefer als Rasse, Klasse und Vaterland. Man spürt es und gibt dem auch Ausdruck, wo die Dinge noch halbwegs intakt sind ––– Schwarzkoppen betrachtete Esterhazy nur durch das Einglas, und Fürst Urussow weigerte Asew die Hand.
*
Innere Neutralität. Man ist beteiligt, wo und wie lange es beliebt. Ist es im Omnibus nicht mehr behaglich, so steigt man aus. Wenn ich nicht irre, war Jomini Schweizer, ein Condottiere wie in der Renaissance, Reisläufer auf hoher Ebene. Ich will die Einzelheiten im Luminar fixieren oder Ingrid damit beauftragen.
Der General ist Spezialist insofern, als er sein Handwerk beherrscht. Darüber hinaus und außer dem beliebigen Für und Wider hält er ein Drittes intakt und in Reserve: die eigene Substanz. Er weiß noch mehr, als was er darstellt und unterrichtet, kennt andere Künste als jene, für die er besoldet wird. Das behält er für sich; es ist sein Eigentum. Es bleibt für seine Muße, seine Selbstgespräche, seine Nächte reserviert. Im günstigen Augenblick wird er es in Aktion umsetzen, die Maske abwerfen. Bislang hat er sich im Rennen gut gehalten; im Anblick des Zieles schießen die Grundreserven ein. Das Schicksal fordert ihn heraus; er antwortet. Der Traum wird, auch in der erotischen Begegnung, realisiert. Doch flüchtig auch hier; jedes Ziel bleibt ein Durchgang für ihn. Der Bogen soll eher brechen, als daß er Endliches visiert.
»General« steht hier für den Einzelnen, der in Aktion tritt, sei es aus eigenem Willen, sei es, daß er dazu gezwungen wird. Da Anarchie ihm einen besonders günstigen Anlauf bietet, ist heute der Typus permanent. Das Wort hat also keinen speziellen, sondern einen generellen Sinn. Es kann nach Belieben ersetzt werden. Mit ihm ist kein Stand, sondern ein Zustand gemeint. Er kann auch im Kuli auftreten, wird dann sogar besonders brisant.
*
Vigo verfügt über große Reserven, doch setzt er sie nicht richtig ein. Er verzettelt sie, indem er sie an den Mann zu bringen sucht, und erwartet, daß sie honoriert werden. Zeigt man denn Gold in obskuren Wirtschaften? Das macht verdächtig, doch ein Trinkgeld wird freudig angenommen; ein Obolos genügt.
Es fehlt ihm nicht an Bewußtsein des eigenen Wertes, doch kann er ihn nicht in gängige Münze umsetzen. Ein Fürst im Reich des Geistes durchwühlt die Taschen nach Wechselgeld.
Als ich sein Assistent und dann sein Freund wurde, sah ich meine Hauptaufgabe nicht in der Bedienung des Luminars, sondern darin, um Vigo einen Kreis zu bilden, in dem nicht alles unter den Tisch fiel ––– ein Gremium, das seiner würdig war.
Wer sucht, der findet; es fehlt auch in Eumeswil nicht an Naturen, die unter geistigem Heimweh leiden, und wenn nur eine auf hundert oder auf tausend kommt. Drei, fünf, auch sieben Hörer genügten für einen Nachmittag im Garten oder für ein Symposion am Abend, bei dem Vigo sich wohl fühlte. Auch Ingrid, die mir im Amte folgte, war dabei.
Wir trachteten, das geheim zu halten ––– Einladungen zum Tee, zu einem Ausflug, ein zufälliges Treffen bei den Gräbern, nicht einmal als Privatissimum gedacht. Daß sich Gerüchte daran knüpften, konnte dennoch nicht ausbleiben, wie immer, wenn einige sich absondern. Ich wurde von Neugierigen, doch auch von Wissensdurstigen angegangen und konnte auswählen.
*
Es kam zu Stunden, in denen die Tore der Geschichte aufsprangen, die Gräber sich öffneten. Die Toten kamen mit ihren Leiden, ihren Wonnen, deren Summe stets die gleiche bleibt. Sie wurden heraufbeschworen zum Licht der Sonne, die ihnen leuchtete wie uns. Ein Strahl traf ihre Stirne; ich fühlte die Wärme, als ob sich der Trilobit in meiner Hand regte. Wir durften an ihrer Hoffnung teilnehmen; es war die stets enttäuschte Hoffnung, die sich von Geschlecht zu Geschlecht vererbt. Sie saßen zwischen uns; oft waren Freund und Feind kaum noch zu unterscheiden, wir konnten ihre Händel durchsprechen. Wir wurden ihre Anwälte. Und jeder hatte recht.
Wir reichten uns die Hände; sie waren leer. Doch reichten wir ihn weiter: den Reichtum der Welt.
*
Wir saßen im Garten beisammen – es war spät geworden; der Vollmond stand hinter der Kasbah, die in seine Scheibe wie in ein Siegel geschnitten war. Scharf eingezeichnet die Kuppel und das Minarett.
Zuweilen verließ einer von uns die Runde, um Luft zu schöpfen, wie ich damals nach der Lesung über Emir Musa und die Messingstadt.
Endlich schien es auch Vigo zu übermannen – nicht die Erschöpfung, denn sein Gesicht glühte; er erhob sich: »Kinder, laßt mich allein.«
6
So weit vorerst zu Namen und Beruf. Zu präzisieren bleibt meine politische Zuverlässigkeit. Sie ist nicht zu bestreiten; wie könnte ich sonst im engsten Kreis des Condors beschäftigt sein ––– in seiner Reichweite? Ich trage den Phonophor mit dem Silberstreif.
Natürlich wurde ich auf Herz und Nieren getestet, ausgelesen und -gesiebt. Zwar halte ich wenig von den Psychologen, wie von der Technik überhaupt, doch daß sie ihr Metier verstehen, muß ich zugeben. Es sind gerissene Burschen, denen keiner entgeht, der mit schrägen Gedanken oder gar Absichten kommt.
Sie beginnen gemütlich, nachdem die Ärzte die Physis und die Polizisten die Vorgeschichte des Kandidaten erkundet haben; das geht bis zu den Großvätern. Während sie beim Tee mit ihm plaudern, hören andere auf seine Stimme, beobachten seine Gesten, sein Gesicht. Man wird vertraulich, geht aus sich heraus. Unmerklich werden die Reaktionen registriert: der Herzschlag, der Blutdruck, das Erschrecken mit seiner Pause, die einem Namen oder einer Frage folgt. Zudem haben sie Psychometer, um die sie der alte Reichenbach beneidet hätte, entwickeln Bilder, auf denen gelbe oder violette Auren von der Stirn, den Haaren, den Fingerkuppen abstrahlen. Was bei den alten Philosophen die metaphysischen, das sind bei ihnen die parapsychischen Grenzgebiete ––– und daß sie diesen mit Maß und Zahl beikommen, halten sie für lobenswert. Es versteht sich, daß sie auch mit Hypnose und Drogen arbeiten. Ein Tröpfchen im Tee, von dem sie mittrinken, ein Blütenstäubchen – und wir sind nicht mehr in Eumeswil, sondern im Bergland von Mexiko.
Sollten freundliche Nachbarn, etwa aus Kappadokien oder Mauretanien, einen Agenten oder gar einen Assassinen einschleusen, so wäre er binnen drei Tagen enttarnt. Gefährlicher sind die gewiegten Emissäre des Gelben und des Blauen Chan; es ist nicht zu verhindern, daß sie sich am Hafen oder in der Stadt einnisten. Dort treiben sie so lang ihr Wesen, bis sie doch einmal eine Unvorsichtigkeit begehen. Ins Innere der Kasbah dringen sie nicht vor.
*
Mein Fall bereitete dem Gremium kein Kopfzerbrechen; es gab keine Schwierigkeit. Ich bin, das darf ich wohl sagen, nicht schräg, sondern rechtwinklig ausgerichtet – weder nach rechts noch nach links, weder nach oben noch nach unten, weder nach Westen noch nach Osten hin belastet, sondern äquilibriert. Zwar beschäftigen mich diese Gegensätze, doch nur historisch, nicht aktuell; ich bin nicht engagiert.
Bekannt ist, daß mein Vater und mein Bruder mit den Tribunen sympathisiert haben, wenngleich gemäßigt, sogar nicht ohne bescheidene Kritik. Das war in Eumeswil die Regel; es gab fast keine Ausnahme. Wozu auch? Ein Bäcker, ein Komponist, ein Professor hat schließlich andere Sorgen, als sich politisch mausig zu machen; er will vor allem sein Geschäft, seine Kunst, sein Amt versehen, ohne seine besten Jahre zu verlieren; er will einfach schlecht und recht überstehen. Außerdem ist er leicht zu ersetzen; andere lauern schon darauf.
Davon abgesehen, sind solche Typen auch für den Nachfolger brauchbarer als die »Aufrechten, die der Idee treu blieben, die Fahne hoch hielten« und überhaupt das Lob verdienen, das aus dem Militärjargon in den des Bürgerkrieges eingegangen ist. Die nehmen sich am besten in den Nachrufen aus. Als Überlebende werden sie bald wieder unangenehm.
Das wissen die Prüfer; Begeisterung ist suspekt. Daher war es für mich ein Pluspunkt, daß ich mich in Hinsicht auf den Condor sachlich, als Historiker, äußerte. Ich glaube, ich sagte unter dem Einfluß einer harten Droge: »Er ist kein Volksführer; er ist ein Tyrann.«
Sie wissen, daß bedingungslose Hingabe gefährlich ist. Ein Politiker, ein Autor, ein Schauspieler wird aus der Ferne verehrt. Endlich kommt es zur Begegnung mit dem Idol – als Person kann es der Erwartung nicht standhalten. Leicht schlägt dann die Stimmung um. Der unglaubliche Glücksfall, der Zutritt zum Schlafzimmer der Diva, ist gelungen, und die Enttäuschung kann nicht ausbleiben. Mit den Kleidern fällt auch die Göttlichkeit dahin. Der Eros wirkt am stärksten im Unverhofften, im Unerwarteten.
Sperenzien fanden sie nicht bei mir. Ich blieb normal, wie tief sie auch loteten. Zugleich rechtwinklig. Allerdings ist es selten, daß das Normale mit dem Rechtwinkligen zusammenfällt. Das Normale ist die menschliche Konstitution; rechtwinklig ist der logische Verstand. Mit ihm konnte ich zu ihrer Zufriedenheit antworten. Das Menschliche dagegen ist so allgemein und zugleich so verschlüsselt, daß sie es, wie die Atemluft, nicht wahrnehmen. So konnten sie in meine anarchische Grundstruktur nicht eindringen.
Das klingt kompliziert, ist aber einfach, denn anarchisch ist jeder; das eben ist das Normale an ihm. Allerdings wird es vom ersten Tag an durch Vater und Mutter, durch Staat und Gesellschaft beschränkt. Das sind Beschneidungen, Anzapfungen der Urkraft, denen keiner entgeht. Man muß sich damit abfinden. Doch das Anarchische bleibt auf dem Grunde als Geheimnis, meist selbst dem Träger unbewußt. Es kann als Lava aus ihm hervorbrechen, kann ihn vernichten, ihn befreien.
Hier ist zu differenzieren: die Liebe ist anarchisch, die Ehe nicht. Der Krieger ist anarchisch, der Soldat nicht. Der Totschlag ist anarchisch, der Mord nicht. Christus ist anarchisch, Paulus nicht. Da freilich das Anarchische das Normale, so ist es auch in Paulus vorhanden und bricht zuweilen mächtig aus ihm hervor. Das sind nicht Gegensätze, sondern Stufungen. Die Weltgeschichte wird durch Anarchie bewegt. In summa: der freie Mensch ist anarchisch, der Anarchist nicht.
*
Wäre ich Anarchist und nichts weiter, so hätten sie mich mühelos entlarvt. Auf Existenzen, die sich in der Schräge, »den Dolch im Gewande«, den Mächtigen zu nähern suchen, sind sie besonders geeicht. Der Anarch kann einsam leben; der Anarchist ist ein Sozialer und muß sich mit Gleichen zusammentun.
Wie überall, gibt es Anarchisten auch in Eumeswil. Sie bilden zwei Sekten: die gutmütigen und die bösartigen. Die Gutmütigen sind ungefährlich; sie träumen von Goldenen Zeitaltern, Rousseau ist ihr Heiliger. Die anderen sind auf Brutus eingeschworen; sie tagen in Kellern und Mansarden, auch in einem Hinterzimmer des »Calamaretto«. Sie hocken zusammen wie Spießbürger, die ihr Bier trinken und dabei ein unanständiges Geheimnis hegen, das sich durch ein Kichern verrät. Sie stehen in den Registern; wenn es zur Zellenbildung kommt und Chemiker sich ans Werk machen, werden sie schärfer überwacht. »Das Geschwür wird bald aufbrechen.« So der Majordomo major, vom Condor kurz »Domo« genannt; ich behalte die Abkürzung bei. Bevor es zum Attentat kommt, wird entweder verhaftet, oder der Anschlag wird gelenkt. Es gibt nichts Stärkeres gegen eine Opposition, die Fuß faßt, als ein Attentat, das ihr zugeschrieben werden kann.
Der unklare Idealismus des Anarchisten, seine Güte ohne Mitleid oder auch sein Mitleid ohne Güte, macht ihn brauchbar nach vielen Richtungen, auch für die Polizei. Er ahnt allerdings ein Geheimnis, doch vermag er es nur zu ahnen: die ungeheure Macht des Einzelnen. Sie berauscht ihn; er verschwendet sich wie eine Motte, die im Licht verbrennt. Das Absurde, das dem Attentat anhaftet, liegt nicht im Täter und seinem Selbstbewußtsein, sondern in der Tat und ihrer Verknüpfung mit der flüchtigen Situation. Der Täter hat sich zu billig verkauft. Daher verkehrt sich seine Absicht auch meist ins Gegenteil.
*
Der Anarchist ist abhängig –





























