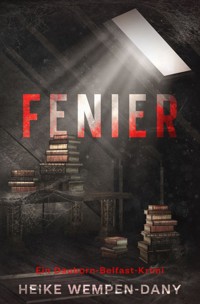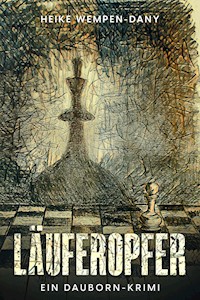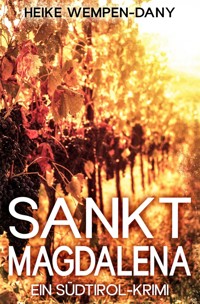
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach 10 Jahren kehrt der ehemalige Bundeswehr Profiler Friedrich Hänssler nach Südtirol zurück. Und wieder taucht er ab in die Geschichte des Landes. Kann er das Geheimnis um den rätselhaften Toten auf dem alten Mayerbach-Hof lösen? Wird es ihm gelingen, seinem italienischen Freund zu helfen? Welche Rolle spielt die sizilianische Mafia? Und was verbirgt Giulios Vater Marcello?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sankt Magdalena
Über die Autorin
Heike Wempen-Dany (*1976) wohnt mit Mann und vier Katzen in einem kleinen Dorf nahe Limburg. Als studierte Geisteswissenschaftlerin ließ sie Geschichte und Politik nie ganz los, auch wenn sie beruflich andere Pfade ein schlug. Geschichte und Geschichten habe es verdient entdeckt und erzählt zu werden. Bisher erschienen: Die beiden Kammern, Läuferopfer und Fenier, alle im Coortext-Verlag, Altheim.
Sankt
Magdalena
Ein Südtirol-Krimi
Heike Wempen-Dany
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar.
© 2025 -Verlag, Altheim
Buchcover: Germancreative
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
»Vergebung bedeutet nicht, das Unrecht zu entschuldigen, sondern sich selbst von der Last des Hasses zu befreien.«
(Quelle: unbekannt)
Eins
(Südtirol, in den Sechzigern)
Das Wasser stieg und stieg. Kalt, dreckig und unaufhaltsam. In den letzten Wochen hatten sie immer wieder für die sogenannte Einstauphase Wasser eingeleitet. Mit diesen Testläufen wollte die Baufirma die Haltbarkeit des Stauseebeckens und natürlich der Mauer testen. Zu Beginn war es nur wenig Wasser gewesen. Nichts Lebensbedrohliches. Aber immer eine unausgesprochene Drohung an die Dorfbewohner. Bald würde so weit sein. Mit jeder Einstauung schwand die Hoffnung auf Rettung. Auf Abwendung des Unvorstellbaren.
Dieses Mal würden sie wieder mehr Wasser einleiten. Wer bis jetzt nicht sein Hab und Gut in Sicherheit gebracht hatte, würde es jetzt spätestens verlieren. Die Zeit der Rücksichtnahme war vorbei.
Dort wo das Wasser ihren Körper schon umspülte, hatte sich eine Art Taubheit breit gemacht. Ein Fortbewegen war nur noch mühsam möglich. Der Befehl an die Beine sich zu bewegen, konnte von den Muskeln und Sehnen nicht mehr umgesetzt werden.
Mittlerweile hatte das Wasser ihre Hüften erreicht. Der Auftrieb machte sich bemerkbar. Die Füße schienen vom Boden abheben zu wollen. Sie versuchte dagegen anzukämpfen. Unter großen Mühen hielten die Zehen den Kontakt zum Boden. Nicht lange. Mit der nächsten Welle wurden die Füße komplett unterspült. Sie trieb nun im Wasser. In der Horizontalen. Die Beine fingen intuitiv mit Schwimmbewegungen an. Nur noch der Kopf ragte aus dem Wasser heraus.
An ein Entkommen war nicht zu denken. Die schwere Holzdecke des alten Bauernhauses bildete die Grenze und schnitt eine Flucht nach oben ab. Fenster und Türen waren geschlossen. Ein Entkommen aus der alten Küche unvorstellbar.
Das Wasser stieg immer noch. Die Luftblase nach oben zur Decke hin wurde immer kleiner. Die Luft wurde weniger. Das Atmen fiel schwer. Wasser drang in ihre Nasenflügel. Es kribbelte unangenehm. Mit dem nächsten Atemzug wanderte Wasser durch die Nase in Richtung Kopf. Es kribbelte unangenehm. Sie musste niesen. Und wachte davon auf.
Dunkelheit umgab sie. Es dauerte eine Weile, bis sie registrierte, dass statt dem eisigen Flusswasser eine kalte Bettdecke ihren Körper umhüllte. Dennoch zögerte sie tief Luft zu holen. Sie traute ihren Sinnen nicht. Mit halbgeöffnetem Mund tat sie es dann doch. Einatmen. Die Lunge mit Sauerstoff füllen. Warten. Auf das Eindringen des Wassers in die Lunge. Der verzweifelte Versuch des Heraushustens. Doch nichts passierte. Die kalte Nachtluft breitete sich in ihren Lungenflügeln aus. Erleichterung machte sich breit. Erneut versuchte sie tief einzuatmen. Auch diesmal kein Husten. Nur kalte Luft in ihrer Lunge.
Ihr Herz raste immer noch, als sie die Nachttischlampe anknipste. Mit jedem Atemzug gelang es ihr mehr, ihren Puls zu kontrollieren. Sich zu beruhigen. Sich zu befreien aus den imaginären Fluten und ihrem Todeskampf.
Mit halb geschlossenen Augen schaute sie sich in dem kleinen kargen Zimmer um. Stöhnend fiel sie in die Kissen zurück. Das schwache Licht der Nachttischlampe schaffte es nicht, dem trostlosen Anblick des Zimmers etwas Positives einzuhauchen.
Ihrem Bett gegenüber stand ein alter abgewetzter Stoffsessel, der ihr als Kleiderablage diente. Darauf lagen die Jeans und der Pullover, die sie gestern anhatte. Rechts neben dem Sessel befand sich ein Fenster. Einfachverglasung. Der Holzladen durchzog mit Astlöchern und Rissen im Holz. Diese Kombination schaffte es weder die Kälte noch das Mondlicht rauszuhalten. Fröstelnd zog sie die Bettdecke enger um ihren Körper. Der alte Bauernschrank in der linken Ecke rundete den traurigen Anblick ab. Die Türen schlossen schon lange nicht mehr richtig. Die wechselnden Temperaturen zwischen Sommerhitze und Winterkälte hatte sie so stark verzogen, dass sie ihre Form verloren hatten.
Beinahe wünschte sie sich den Alptraum wieder zurück, um der Trostlosigkeit im Hier und Jetzt zu entgehen.
Zwei
(Südtirol, in den Sechzigern)
Die geologischen Vorarbeiten waren abgeschlossen. Die Experten hatten keinerlei Bedenken. Die Gesteinsschichten waren stabil und würden notwendigen Sprengungen standhalten. Vor zwei Tagen war das finale Gutachten vorgestellt worden. Die Erleichterung war groß. Schließlich wollte die Bauleitung für diesen Stausee eine Katastrophe wie beim Bau der Vajont–Staumauer verhindern.
Vor etwa zwei Jahren war es im Vajont-Tal in den Voralpen zu einer ungeheuren Katastrophe gekommen.
Nach einem Bergsturz mit 700.000 Kubikmetern Lockergestein im November 1960 wurden neue Messungen und Simulationen durchgeführt. Keine dieser Maßnahmen stellte allerdings den Erfolg des Bauprojektes in Frage. Warum auch? Schließlich sollte die Talsperre unter anderem Venedig mit Strom versorgen. Dazu war es einfach zu wichtig. Doch das Drama sollte seinen Lauf nehmen.
Es kam zu Probefüllungen des Sees. Nichts passierte. Alles schien augenscheinlich in Ordnung.
Doch die Einheimischen waren anderer Meinung. Ihre Proteste und Warnungen wurden ignoriert.
Und dann begann auch der Berg lautstark zu protestieren – mit kleinen Erdbeben.
Als schließlich die 270 Millionen Kubikmeter Gestein des Monte Toc auf einer Länge von 2 Kilometern in das Staubecken rutschten, verdrängte die Masse das Wasser mit ungeheurer Gewalt. 25 Millionen Kubikmeter Wasser ergossen sich über die Staumauer. Die Flutwelle raste durch das Tal und erreichte das Städtchen Longarone mit den umliegenden Siedlungen.
Mehr als 2000 Menschen fanden den Tod. Noch immer waren nicht alle Opfer gefunden. Die Hoffnung schwand mit jedem Tag.
Die Untersuchungen liefen noch. Die Stimmen, die die Verantwortlichen riefen, waren mindestens genauso laut wie das Getöse, als die Steinmassen in den See fielen.
***
Antonio blickte zur wachsenden Mauer empor. Das würde ihnen hier nicht passieren. Dafür würde er schon sorgen.
»Denkst du auch an das, an das ich denke?« näherte sich Mauricio seinem Chef.
Antonio atmete tief durch. »Die Mauer sieht gut aus. Die Männer haben gute Arbeit geleistet. Und ja, natürlich denke ich an diese Katastrophe. Aber das wird sich bei uns nicht wiederholen.«
»Wie kannst du dir da so sicher sein?« wollte der Vorarbeiter unsicher wissen.
»Die Geologen haben mehrfach ihre Daten überprüft. Sie konnten nichts feststellen, was uns beunruhigen müsste.«
»Das mag sein, aber Geologen gab es dort auch. Und auch da gab es angeblich nichts zu befürchten. Was sollten sie bei uns besser machen?«
»Die Unterschiede sind gewaltig. Der Bergrutsch hatte mehrere Ursachen. Das Kriechen des Hanges, also das Bewegen des Berges wurde erst sichtbar, als der See eingestaut war. Also als sich das Wasser im Becken befand.«
»Na ja, die haben ja nicht nur eine Einstauung gemacht. Niemand hat da was gemerkt oder gesagt. Warum sollten sie das hier nicht genauso machen?«
»Nochmal, die Bedingungen hier sind ganz andere. Glaube mir. Schau, im Vajont-Tal wurde der untere Teil des Hanges, der eigentlich eine stützende Funktion hatte, geschwächt. Tonschichten unter der Geländeoberfläche sogen sich mit Wasser voll. Das erwies sich als zusätzlich destabilisierend.« fuhr Antonio in seinen Ausführungen fort.
»Es entstand eine Gleitfuge, eine Gleitschicht. Beste Voraussetzungen, damit sich der Hang in Bewegung setzen konnte.«
»Das wird ja nicht besser, wenn du das so erzählst«, versuchte Mauricio einzuwerfen. Doch Antonio schien ihn zu überhören, denn er setzte seinen Monolog unbeeindruckt fort.
»Durch verschiedene Einstau – und Absenkphasen versuchte man das Rutschen abzustoppen. Vergeblich. Im Gegenteil. Mit der letzten Absenkphase gewann das Rutschen an Geschwindigkeit und die Katastrophe nahm seinen Lauf.«
Antonio verstummte einen kurzen Moment und hielt inne. Mauricio sah seinen Chef entsetzt an. Die sachlichen Ausführungen hatten ihn nicht unbedingt beruhigt. Dessen Schweigen noch weniger. Doch so schnell und unerwartet, wie Antonio seine Rede pausierte, so schnell schien er sich wieder gefasst zu haben.
»Doch bei uns sind die Vorrausetzungen ganz andere. Der See wird eine viel größere Grundfläche haben. Der Druck des Wassers wird sich ganz anders verteilen«, beendete Antonio seinen Vortrag endgültig.
»Ich hoffe sehr, dass du recht hast. Du scheinst dich damit sehr ausführlich beschäftigt zu haben.«
»Meinst du, ich bin lebensmüde? So und jetzt wieder zurück an die Arbeit. Wir müssen den Zeitplan einhalten.«
Mauricio schlurfte wieder zu den anderen. Die Worte seines Vorgesetzten schienen ihn nicht ganz zu beruhigen. Er würde heute Abend in der kleinen Kirche eine Kerze anzünden und für alle Arbeiter beten. Dabei hoffte er, dass Gott es ihm nicht krummnehmen würde, dass sein Gotteshaus bald nasse Füße bekommen würde. Einer musste den Job ja machen und Mauricio war froh, dass er diesen hatte. Moralische Bedenken konnte er sich nicht leisten.
Antonio Scolari riss sich vom Anblick der fast fertigen Staumauer los. Das Stauseeunglück im Vajont-Tal nahm ihn mehr mit, als er erwartet hatte. Mauricio schien er mit seinem Vortrag beruhigt zu haben. Zumindest war er wortlos wieder von dannen getrottet. Auch Antonio verließ die Baustelle, um sich wieder seinen Aufgaben zu widmen. Er merkte nicht, dass er die ganze Zeit beobachtet wurde.
***
Die Sonne stand hoch Himmel. In diesem Jahr brannte sie noch gnadenloser als zuvor. Jeder Schatten war verschwunden, um Platz für den Staudamm zu schaffen.
Ständig wurde Staub aufgewirbelt, den die Arbeiter einatmeten. Einige hatten sich dünne Stofftücher vor den Mund gebunden. Der Schutz war nur von kurzer Dauer. Speichel und Staub mischten sich sehr schnell miteinander. Die breiige Masse trocknete und schmiegte sich wie ein Deckel vor den Mündern der Arbeiter. Nach und nach rissen sie sich die Stofffetzen vom Hals und versuchten zu atmen. Dabei drang erneut Staub in ihre Lungen. Ständig mussten sie husten.
Das Wasser war knapp. Welch eine Ironie. Schließlich sollte hier ein Stausee entstehen. Der Zeitplan für die Fertigstellung der Baustelle war eng gestrickt. In drei Wochen sollte die Abnahme erfolgen.
***
Die Mauer sollte den Fluss unterbrechen, so dass dann oberhalb des Gewässers ein großer Stausee entstehen würde. Über eine Länge von 1,1 Kilometern und einer Breite von 500 Metern sollte der See etwa 50 Meter tief ein. Dabei würde die Wasseroberfläche 30ha umfassen, mit einem Volumen von 1,5 Millionen Kubikmetern Wasser.
In der Staumauer sollte eine schmale Röhre verbaut werden. Das Wasser würde durch die Röhre zu einer Turbine gelangen. Durch den so erzeugten Wasserdruck gelang es dann Strom zu erzeugen, der weiter nach Norditalien geleitet werden sollte. Soweit der grobe Plan. Die Umsetzung war viel komplizierter und komplexer. Unmengen von Materialien und Arbeitern wurden für die Umsetzung benötigt. Ein riesiges Lager an Menschen.
Dieses hier bestand aus etwa 2000 Männern. Die meisten von ihnen stammten aus dem Norden Italiens. Aus einem Landstrich ohne Hoffnung auf eine Zukunft für sich und die Familie. Viele von ihnen waren das erste Mal von zu Hause getrennt. Weit weg in den Bergen Südtirols.
Die Berufe der Männer waren mannigfaltig. Neben der Bauleitung, den Geologen und Ingenieuren waren es zum größten Teil natürlich Betonarbeiter, Tunnelbauer, Sprengmeister, Lastwagenfahrer, Mechaniker, Baumaterialienlieferanten und Elektriker. Sie lebten in einfachen Holz- und Wellblechbarracken auf dem Baustellengelände, damit sie so viel wie möglich von ihrem Verdienst nach Hause schicken konnten. Schlafräume waren in der Regel eng, mit Etagenbetten für mehrere Arbeiter in einem Raum. Die Ausstattung bestand aus Betten mit Strohsäcken oder einfachen Matratzen, Haken für Kleidung und persönliche Gegenstände. Ein Provisorium. Ein Ort, um sich eine kurze Ruhepause zu gönnen. Wenn man denn von Ruhe und Pausen sprechen konnte. Die Arbeitszeiten waren lang, die Pausen kurz.
Oft gab es keine Heizung, besonders in dieser abgelegenen Bergregion, was die Wintermonate hart machte.
Um alle Arbeiter verpflegen zu können, wurde an einem zentralen Ort eine Kantine für die Mahlzeiten eingerichtet. Wie an vielen anderen Baustellen handelte es sich hier auch um ein großes Zelt mit Holztischen und Bänken.
Bernardo schaffte es, auch aus den einfachsten Lebensmitteln ein Festmahl zu zaubern. Oft kochte er einfache italienische Gerichte wie Pasta, und Eintöpfe. Ein kulinarischer Gruß aus der Heimat. Brot und lokaler Wein wurden zusätzlich serviert.
Die Bauern der Umgebung lieferten Lebensmittel – eine willkommene Einnahmequelle, aber auch ein stilles Mahnmal. Viele von ihnen hatten Verwandte in den gefährdeten Dörfern.
Und dann gab es noch die Probleme, um die sich niemand kümmerte.
***
»Ignacio, wolltest du nicht dem Vorarbeiter Bescheid geben, dass die Klos mal wieder abgepumpt werden müssen? In zwei Tagen stehen wir sonst in unserer eigenen Scheiße.«
»Silvio, ich weiß. Ich bin heute Morgen auf Zehenspitzen zwischen den Plumpsklos rumgelaufen. Ich hatte schon vor einer Woche mit ihm darüber gesprochen. Aber irgendwie scheint der gerade was anderes im Kopf zu haben.«
»Das ist ja mal wieder typisch. Wenn wir kleinen Leute was haben, hören die Chefs einfach nicht zu. Die müssen hier ja nicht aufs Klo.«
»Nee, hinter dem Ingenieursbüro soll es sogar eine Toilette mit fließend Wasser geben.«
»Auch das ist ja mal wieder typisch. Die Waschbecken und Duschen haben dort bestimmt beheizte Wasserreservoirs.«
»Bestimmt und wir haben hier nur kaltes Wasser.«
»Ich kenne einen der Lastwagenfahrer. Der kennt bestimmt den vom Güllewagen. Dann müssen wir uns eben selbst helfen.«
»Wie wir das halt immer machen.«
»Treffen wir uns heute Abend im großen Zelt neben der Kantine? Einige von uns wollen ein bisschen Karten spielen.«
»Mit oder ohne Geld?«
»Mit Geld. Wir wollen doch ein bisschen Nervenkitzel haben. Bei dem eintönigen Job hier.«
»Da muss ich leider passen. Beim letzten Mal habe ich so viel verloren, dass sich Marie beklagt hat.«
»Warum hat sie sich beklagt? Du hast ihr doch nicht etwa von unseren Spielchen erzählt?«
»Hm, nicht so wirklich«, druckste der Bauerarbeiter herum.
»Die Frauen gehen unsere Spiele doch nichts an. Das weißt du.«
»Nein, nein, verstehe mich nicht falsch. Aber als ich das letzte Mal Geld nach Hause geschickt habe, war das deutlich weniger als vorher. Das hat sie schon stutzig gemacht und dann hat sie gefragt.«
»Und du hast ihr gesagt, dass du es verzockt und versoffen hast?«
»Nein, aber dass wir diesmal nicht so viel Geld bekommen haben.«
»Gut so, wäre ja nicht das erste Mal, dass sich irgendjemand von den Chefs Geld in seine eigene Tasche steckt und wir armen Schlucker das Nachsehen haben.«
»Dachte ich mir auch«, nickte Ignacio ihm erleichtert zu. »Aber deshalb darf mir das nicht nochmal passieren. Ich muss erst einmal aussetzen.«
»Na ja, dir bleibt ja dann noch das Fußball– oder Boule-Spielen.«
»Wobei…«, überlegte Silvio. »Vielleicht lege ich mich heute Abend doch früher hin. Das war heute schon anstrengend.«
Ignacio nickte zustimmend.
***
Sie hatten heute den Stauseeboden verdichtet.
Zunächst entfernten sie lockere Sedimente und organisches Material. Anschließend wurden schwere Glatt- oder Schaffußwalzen eingesetzt, um den Boden schichtweise zu verdichten. Abschließend sorgte eine Deckschicht aus Lehm oder Ton für zusätzliche Dichtigkeit und Schutz vor Erosion.
Im zweiten Schritt hatten sie Tonnen von Schotter verteilt.
Und auch die Tage davor hatte ihnen körperlich alles abverlangt.
An der Stelle, an der die Mauer entstehen sollte, hatten sie Tonnen von Beton eingearbeitet. Mit einem komplizierten Konstrukt einer Holzverschalung wurde Schicht für Schicht die Stahlbetonmauer hochgezogen. Die. letzte Verschalung würden sie in ein paar Tagen abnehmen.
Todmüde trottete Silvio zu den Barracken. Sein karges Bett war die einzige Gesellschaft, die er heute aufsuchen würde.
***
Nur einer fuhr immer wieder nach Hause zu seiner Familie.
Der einzige Unterschied zu seinen Kollegen. Ansonsten schuftete er genauso hart wie alle anderen. Ein Tunnelarbeiter – Marcello Gallo. Still. In sich gekehrt. Wurde er angesprochen war er freundlich und hilfsbereit.
Manchmal beobachtete er all die armen Teufel, mit denen er arbeitete. Wenn die wüssten, mit wem sie da arbeiten. Wer er wirklich war. Und wer vor allen Dingen dieser Antonio Scolari war.
»Arme Teufel, genau wie wir damals. Oder vielleicht noch schlimmer? Wir hatten wenigstens ein Ziel, einen Plan vom Leben und so viele Möglichkeiten viel Geld zu machen. Aber war es wirklich die bessere Wahl?«
Er sah sein Spiegelbild in einem schmutzigen Spiegel in der Baracke an – ein letzter Blick, bevor er heute wieder zu seiner Familie fuhr. Falten auf der Stirn, Schatten in den Augen. Die Erinnerungen holten ihn ein: Die alten Gassen seiner Heimatstadt, das kleine Haus seiner Eltern, die Felder im Morgentau. Alles zurückgelassen für ein Leben in Südtirol.
»Hätte ich bleiben sollen? Hätten wir bleiben sollen?«
Marcello Gallo riss sich von seinem Spiegelbild los und machte sich auf den Weg nach Hause. Dort in seinem Wohnzimmer schaute er sich die Bilder an der Wand an. An einem bestimmten blieb sein Blick immer hängen. Das war der Augenblick, der ihm bewusst machte, was ihn von den anderen unterschied.
Und am nächsten Morgen, in aller Frühe, machte er sich erneut auf, um seine geschundenen Knochen wieder zu strapazieren.
Und seine Gedanken kreisten nicht nur um die Zukunft seiner Familie. Er versuchte vielmehr jeden Tag, ein bisschen mehr Zeit und Vergessenheit zwischen der Vergangenheit und der Zukunft herzustellen.
Drei
(Südtirol, in den Neunzigern)
Der Auftrag kam, als es bereits anfing zu dämmern. Giulio Gallo hatte sich auf einen gemütlichen Abend bei seiner Familie gefreut. Seine Frau Antonia wollte diese wundervollen Spaghetti zaubern Ein Glas Rotwein hätten sie sich bestimmt an dem Abend gönnen können. Nach dem Essen würden sie alle zusammen im Wohnzimmer sitzen, vielleicht ein kleines Kartenspiel mit den Kindern spielen, bevor es für die Mädchen Zeit war, ins Bett zu gehen.
Lange hatte Giulio keinen solchen Abend bei seiner Familie verbracht. In der letzten Zeit hatte er oft bis spät in die Nacht gearbeitet. Die Taxifahrten hatten ihm und seiner Familie ein gutes Einkommen gebracht, aber ihn auch ganz oft von seiner Familie ferngehalten.
Antonia war immer schon die Geduldige gewesen. Klaglos kümmerte sie sich um den Haushalt und die Mädchen. Ihr sanftes Lächeln kam ihm in Erinnerung, als er morgens seinen frühen Feierabend beschloss.
»Du bist da, wenn du da bist«, pflegte sie immer zu sagen. Auch dieses Mal.
»Doch, doch, heute Abend bin ich früh zu Hause«, beteuerte er sein Vorhaben.
Sie hatte ihn liebevoll auf die Stirn geküsst und hatte die Küche verlassen, um die Mädchen anzutreiben sich für die Schule fertig zu machen.
Seine letzten Fahrgäste – ein junges Pärchen aus Frankreich hatte er gerade am Bahnhof in Bozen abgeladen. Auf dem Weg nach Hause hielt er kurz bei der GärtnereiSchullian. Er wollte Antonia mit einem Blumenstrauß überraschen. Das tat er viel zu selten.
Zufrieden verließ er mit dem kleinen Strauß aus roten Rosen das Geschäft Vorsichtig legte er ihn auf den Beifahrersitz und wollte gerade den Motor starten, als die hintere Tür aufgerissen wurde.
»Gut, dass Sie hier stehen. Sie sind doch frei, richtig? Gut, ich muss ganz schnell nach…«, prasselten die Worte eines Greises an sein Ohr.
»Ich wollte gerade Feierabend machen«, versuchte Giulio den älteren Herrn am Zusteigen zu hindern.«
»Aber ihr Taxischild zeigt an, dass sie frei sind. Nun kommen Sie, junger Mann, diese eine Fahrt noch. Tun Sie einem alten Mann einen Gefallen. Danach können Sie immer noch Feierabend machen.«
Giulio beobachtete im Rückspiegel, wie der alte Mann hinter ihm Platz nahm. Er lächelte den Taxifahrer mit einem breiten Lachen an. An den Augen blieb sein Blick hängen. Sie funkelten ihn an. Wach, aber eiskalt.
Giulio hatte kein gutes Gefühl bei dem alten Mann. Er wollte schon ablehnen, als dieser ihm ein Extrabündel an Geldscheinen nach vorne reichte.
»Es soll ihr Schaden nicht sein, wenn Sie noch diese eine Fahrt übernehmen. Nun kommen Sie, geben Sie sich einen Ruck.«
Giulios Blick wanderte zu dem Geld. Das Extra könnten sie gut gebrauchen. Diese eine Fahrt würde seine Abendpläne nicht gefährden. Also wischte er seine Bedenken beiseite.
»Wo sagten Sie, soll es hingehen?«
Das Lächeln seines Fahrgastes wurde breiter.
»Sie sind ein guter Mann.«
Die Fahrt führte sie etwa 30 Kilometer aus Bozen hinaus, in eine einsame Gegend. Die Dunkelheit legte sich wie ein schwerer Schleier über die Landschaft. Bis jetzt waren sie schweigend gefahren.
Der alte Mann würde schon wissen, was er im Dunkeln bei einem alten verlassenen Hofes machen wollte.
Die Dunkelheit griff immer mehr um sich.
»Gallo ist Ihr Nachname?« unterbrach die Stimme von hinten die Stille.
»Ja, das ist richtig.«
»Verzeihen Sie mir, ich sah gerade Ihren Ausweis. Ihr Nachname ist mir aufgefallen.«
Giulio räusperte sich kurz, um zu signalisieren, dass er seinem Fahrgast zugehört hatte. Allerdings wollte er kein Gespräch zu seinem Nachnamen beginnen. Zu oft hatte er Bekanntschaft mit Menschen gemacht, denen es nicht gefiel, dass Italiener in Südtirol lebten und arbeiteten. So einem Vollidioten wollte er an dem heutigen Abend keine Bühne liefern, um ihn zu beschimpfen. Zu sehr freute er sich auf den entspannten Abend mit seinen Liebsten.
»Der ist italienisch, richtig?« ließ sich der alte Mann nicht von Giulios Wortkargheit abbringen.
»Ja.«
»Da sind bestimmt ihre Eltern damals aus Italien hierhergezogen, nicht wahr? Haben viele gemacht. Da, wo ihre Eltern herkommen, gab es bestimmt keine Arbeit.«
Giulio hielt den Atem an. Gleich würde er erzählt bekommen, wieviel Unheil die Faschisten nach Südtirol gebracht hatten.
»Wissen Sie«, setzte der Unbekannte unbeirrt seine Rede fort. »Wissen Sie, Ihr Nachname kommt mir bekannt vor.«
»Gallo ist ein wirklich geläufiger Nachname«, versuchte Giulio das Interesse des Alten einzudämmen.
»Wo kommen Ihre Eltern denn her? Nein, sagen Sie nichts. Ich würde auf Sizilien tippen.«
»Sizilien ist richtig«, musste der Taxifahrer zugeben und hoffte, dass er damit die Neugier seines Fahrgastes befriedigt hatte.
»Wusste ich es doch, dass mein Gedächtnis mich nicht trügt.«
»Ja, aber gerade in Sizilien ist der Nachname ein Allerweltsname.«
»Wissen Sie, ich kannte mal einen Marcello Gallo. Damals, als ich noch ein junger Kerl war«, setzte der Fremde unbeirrt seine Ausführungen fort.
»Ihr Vater hat Ihnen doch bestimmt von seiner Jugend auf einer Zitronenplantage erzählt.«
Stille machte sich im Taxi breit. Sollte der Fremde seinen Vater kennen? Konnte der Zufall so groß sein? Giulio hatte ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Viel hatte dieser aber nie über seine Kindheit und Jugend in Sizilien gesprochen. Und überhaupt, viele Sizilianer hatten damals auf den Plantagen gearbeitet. Das musste nicht bedeuten, dass dieser Mann tatsächlich seinen Vater kannte. Ein, zwei Schüsse ins Blaue, mehr war das nicht.
Doch bevor er sich irgendeine passende Antwort ausdenken konnte, hatten sie auch schon ihr Ziel erreicht. Vor ihnen lag ein alter verlassener Hof. Sorge machte sich bei Giulio breit.
»Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind?«
»Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie wüssten, was ich schon alles in meinem Leben erlebt habe, dann würden Sie aufgrund eines abgelegenen Hofes nur müde lächeln. Ich bin genau am richtigen Ort. Aber keine Angst, Sie müssen nicht auf mich warten, ich komme schon zurecht. Geben Sie mir einfach eine Ihrer Visitenkarten. Vielleicht treffen wir uns mal wieder.«
Giulio tat wie ihm geheißen und reichte dem mysteriösen Alten einer seiner Visitenkarten. Insgeheim hoffte er, dass er diesen so schnell nicht mehr zu Gesicht bekommen würde. Doch das mulmige Gefühl blieb.
Der Fremde bezahlte und klopfte Giulio auf die Schulter.
»Grüßen Sie ihren alten Herrn von mir. Mein Name ist Antonio Scolari. Ihr Vater wird sich an mich erinnern. Da bin ich mir sehr sicher.«
Er öffnete die Tür und ließ den verdutzen Giulio zurück. Dieser schaute dem seltsamen Fremden noch eine Weile nach und beobachte, wie dieser zielsicher auf die Ruinen der Hauptgebäude zusteuerte. Er schob das seltsame Bauchgefühl beiseite und wendete seinen Wagen.
Er würde es noch rechtzeitig zum Abendessen schaffen. Doch die letzten Worte des Alten hallten in seinem Kopf nach:
»Mein Name ist Antonio Scolari. Ihr Vater wird sich an mich erinnern.«
Was für ein seltsamer alter Mann.
Vier
(Sizilien, in den späten Vierzigern)
DerRegen ergoss sich in Strömen an diesem Samstagabend in den Straßen der Vorstadt von Palermo. Fluch und Segen zugleich.
Ein Segen, weil niemand freiwillig bei diesem Wetter das Haus verließ. Weniger Zeugen.
Ein Fluch, weil Fosco Kälte und Nässe verabscheute – besonders bei dem, was er heute für seinen Boss Don Antonio zu erledigen hatte.
Die Feinarbeiten hatte er in den letzten Tagen abgeschlossen. Die Steckverbindungen ins Semtex einzuarbeiten, ging ihm längst blind von der Hand. Wie viele Bomben er in seinem Leben gebaut hatte? Er wusste es nicht. Gezählt hatte er nie. Aber es waren viele, da war er sich sicher. Seine Bosse machten sich dieses Talent gerne zunutze – so auch heute.
Autobomben stellte er mittlerweile beinahe wie am Fließband her.
Im Grunde war eine Autobombe ein improvisierter Sprengsatz, der in oder an einem Fahrzeug platziert wurde.
Fosco bevorzugte die Platzierung in der Nähe zum Tank, um die Explosion so gewaltig wie möglich zu machen. Der Boss wollte ein Zeichen setzen. Und er bekam, was er wollte. Dieser Krieg zwischen den Clans kannte keine Gnade.
Für Fosco begann die Befriedigung schon in der Zusammenstellung der Materialien für seine Bomben. Natürlich hatte er Vorlieben, doch er blieb flexibel. Manche seiner Kollegen hinterließen absichtlich eine erkennbare Handschrift, doch er hatte kein Interesse an einer Signatur. Sobald die Bombe explodierte, war sein Job erledigt – und der nächste begann.
Die verwendeten Materialien variierten je nach Ziel und Verfügbarkeit. Die typischen Elemente einer Autobombe umfassten:
1. Sprengstoff:
An militärischen Sprengstoff wie TNT, C4, Semtex, RDX kam er nur manchmal dran. Sein Kontakt zur Armee war sehr vorsichtig. Semtex abzuzweigen, ohne dass es auffiel, war nicht einfach.
Zu den kommerziellen Sprengstoffen gehörten Dynamit oder Ammoniumnitrat-basierte Sprengstoffe. Wenn er Glück hatte, konnte er auf der einen oder anderen Baustelle zwei drei Stangen Dynamit abzweigen. Aber auch das war eher schwierig für ihn.
Seine Spezialität war der selbstgemachte Sprengstoff, bestehend aus Haushalts- oder Industriechemikalien hergestellte Substanzen wie Acetonperoxid (TATP), ANFO (Ammoniumnitrat und Diesel). Dünger war sein Element. Dünger gab es zuhauf auf den Zitronenplantagen seiner Bosse. Dünger wurde nicht bis aufs Gramm genau aufgeschrieben. Er war immer zugänglich für ihn. Lange hatte er an der richtigen Rezeptur gefeilt. Jetzt war er zufrieden. Und mit ihm die Bosse.
2. Zünder:
Hier unterschied man zwischen elektronisch, mechanisch und chemisch. Bei einer elektronischen Schaltung, die eine elektrische Ladung erzeugt, um den Sprengstoff auszulösen, wurden oft Funkgeräte oder Zeitschaltuhren verwendet.
Beim mechanischen Zünder mussten Drähte oder auch Federsysteme so gesetzt werden, dass diese durch Bewegung oder Druck aktiviert wurden.
Bei chemischen Zündern mussten spezielle Substanzen bei Kontakt miteinander eine Reaktion auslösen.
Fosco bevorzugte bei Autobomben die elektronische Zündung. Nur zu gut konnte er sich an das einzige Mal erinnern, als er einen mechanischen Zünder ausprobiert hatte. Drei Männer hatten sie verloren, die bei der Fehlzündung nachschauen wollten und die Bombe sie verzögert mit in den Tod nahm.
3. Detonator (Initialzünder):
Ein kleiner, hochreaktiver Sprengsatz, der benötigt wird, um den Hauptsprengstoff zu zünden. Sprengkapseln oder elektrische Zünder waren gängige Optionen.
4. Verstärkungsmaterialien (Sekundärschaden):
Metallsplitter: Nägel, Schrauben, Kugellager – alles, was die Splitterwirkung verstärkte.
5. Brennstoffe:
Benzin oder Diesel, um die Explosion noch verheerender zu machen.
6. Gehäuse:
Das Fahrzeug selbst diente als Hülle – unauffällig, transportabel, effektiv.