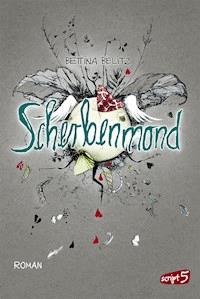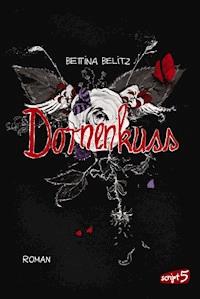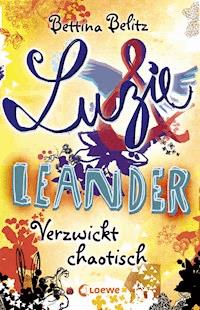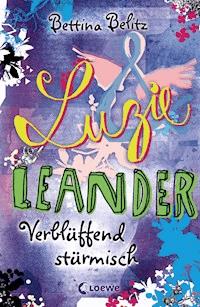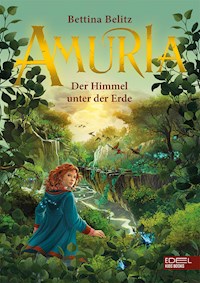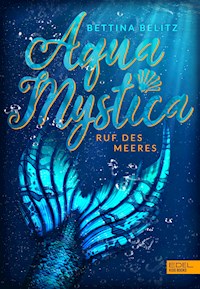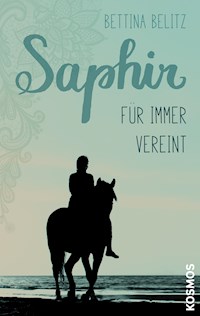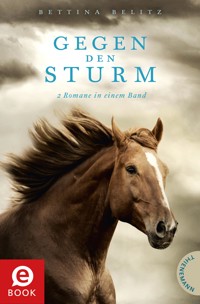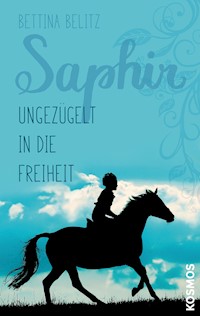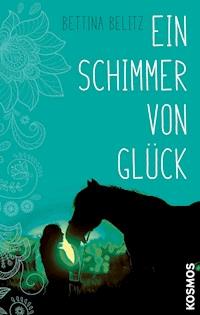8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Roxy ist ein echter Wildfang. Auf dem noblen Gestüt, wo sie Sozialstunden ableisten muss, begegnet sie dem jungen Vollblutaraber Saphir. Doch das ehemalige Rennpferd lässt sich kaum berühren. Nur Roxy hat das richtige Gespür für den sensiblen Araber. Mit viel Einfühlungsvermögen gelingt es ihr, eine besondere Beziehung zu dem scheuen Pferd aufzubauen. Doch statt Bewunderung schlägt ihr nur Missgunst entgegen und bald ist Saphirs Leben in Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bettina Belitz
Saphir Rebellische Herzen
KOSMOS
Umschlaggestaltung: Kathrin Steigerwald, Hamburg unter Verwendung von Fotomotiven von Tetiana Shamenko/fotolia und callipso/fotolia.
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele
weitere Informationen zu unseren Büchern,
Spielen, Experimentierkästen, DVDs, Autoren und
Aktivitäten findest du unter kosmos.de
© 2018, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-440-15982-8
eBook-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Zombie meets Einhorn
„Kaffee?“
Ich nicke, obwohl ich gar keine Lust auf Kaffee habe, und Steffen schiebt mir einen Becher und die Thermoskanne rüber, die er bei sich trägt wie andere Menschen ihr Handy. Wahrscheinlich ist sie ihm sogar wichtiger als sein Handy. Mit klammen Händen gieße ich mir einen Schluck ein und lege sie dann um die Tasse, um sie aufzuwärmen. Steffens prüfenden Blicken weiche ich aus. Ich mag seine Augen, so dunkel und müde, wie sie meistens sind. Überhaupt bin ich froh, mit ihm hier zu sitzen und nicht mit Diana. Aber heute fühlt es sich anders an als sonst. Er hat etwas auf dem Herzen und ich ahne, worum es geht. Schon seit Wochen warte ich auf diesen Tag.
„Geht’s dir gut, Fledermaus?“
Fledermaus. Normalerweise muss ich grinsen, wenn er mich so nennt – er tut es wegen meiner wuscheligen, kurzen schwarzen Haare und meiner blassen Haut, weil ich ihn damit an einen Vampir aus irgendeiner uralten Fernsehserie erinnere, die er als Kind gerne geschaut hat. Steffen ist einer der wenigen Menschen, die mich zum Lächeln bringen können. Doch heute fühlt sich mein Gesicht an wie eingefroren.
„Ganz okay“, murmele ich beiläufig. Ich weiß nicht genau, was „gut gehen“ eigentlich bedeutet. Keine Ahnung, ob es mir jemals wirklich gut ging – zumindest so, wie Steffen das meint. Ich lebe eben. Ich stehe morgens auf, gehe zur Schule, quäle mich mit den wenigen Hausaufgaben herum, die man uns dort zumutet, fahre zurück in die WG, spreche mit Steffen oder Diana und ziehe mich in mein Zimmer zurück, um fernzusehen oder zu schlafen. Wenn ich mal wieder nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, laufe ich den Flur auf und ab, weil ich mich in diesem Haus eingesperrt fühle. Das sind die Momente, in denen es mir definitiv nicht gut geht und in denen ich zurückwill in mein altes Leben. Es war beschissen, aber wenigstens konnte ich gehen, wann ich wollte, und an die Prügel, die ich einsteckte, wenn ich zurückkam, hatte ich mich irgendwann gewöhnt.
„Roxy, ich will nicht drum herumreden, das liegt mir nicht.“
Steffen ist anders als die anderen. Er war schon ganz unten, genau wie ich. Hat ein paar Jahre auf der Straße gelebt, bevor er sich aus eigener Kraft aus dem Dreck gezogen hat, und nun kümmert er sich um diejenigen, die das noch nicht packen. Menschen wie mich. Aber er tut es ohne Moralpredigten und die ganze emotionale Kacke, die Diana hier manchmal abzieht.
„Dann schieß los.“
„Du hast da noch was vor dir.“
Diana hätte gesagt: „Wir haben da noch was vor uns.“ Dabei bin ich es, die ausbaden muss, was ich verbockt habe, und niemand anderes.
Steffen fängt in aller Ruhe an, sich eine Zigarette zu drehen. Rauchen würde er sie in unserer WG-Küche nie, dafür geht er immer vor die Tür. Ich schau ihm gerne dabei zu, wie er den Tabak in das Papierchen bröselt und ihn schließlich einrollt. Das hat etwas Beruhigendes, selbst jetzt.
„Der Vater deines Opfers …“ Steffen verzieht den Mund. „Stopp, das muss ich umformulieren. Ich soll sie nicht Opfer nennen. Also: Der Vater des Mädchens, das du verprügelt hast, hat ja darauf bestanden, dass du eine Aufgabe bekommst, die dich fordert und fördert.“
„Ja, und ich verstehe immer noch nicht, warum.“ Vor Gericht habe ich ihn nicht angeschaut, genauso wenig wie das Mädchen. Aber an seine Stimme erinnere ich mich noch gut und auch an seine Worte. Sie waren viel zu freundlich gewesen.
„Das musst du ja nicht“, erwidert Steffen gelassen und leckt den Rand des Papierchens ab. „Du musst dich dieser Aufgabe nur stellen und nächste Woche ist es so weit. – Kennst du das Kastanien-Hof?“
Plötzlich wird mir so heiß, dass ich die Finger von der Tasse löse, als hätte ich mich an ihr verbrannt. Kastanien-Hof. Ja, das kenne ich und es passt nicht in meine Welt. Das ist, als würde in einer Walking-Death-Folge plötzlich ein schimmerndes Einhorn über die Straße laufen.
„Hm“, mache ich unbestimmt. „Schon von gehört.“
„Schon vom Hof gejagt worden“ würde es besser treffen. Damals hat mein Gesicht genauso gebrannt wie jetzt – allerdings vor Scham und nicht vor Schreck. Nie hatte ich deutlicher gespürt als in diesem Augenblick, dass man mir ansieht, woher ich komme. Selbst aus der Ferne hatten sie es gesehen – und die Hunde auf mich gehetzt.
„Dort gibt es einen kleinen Verein für pferdegestützte Therapie und …“
„Nein, auf keinen Fall, keine neue Therapie“, falle ich Steffen ins Wort und stelle die Tasse ab. „Das hast du mir versprochen!“
Was Therapien & Co angeht, habe ich in den vergangenen Monaten so einiges hinter mich gebracht: Anti-Aggressions-Training, Gruppengesprächskreis (ätzend), therapeutisches Malen (noch ätzender, ich kann einfach nicht malen) und als Krönung Progressive Muskelentspannung.
„Richtig, und es bleibt bei diesem Versprechen, solange wir regelmäßig unsere Gespräche führen.“ Steffen steckt die Zigarette in den Mundwinkel, ohne sie anzuzünden, wobei er mich an einen Cowboy erinnert, der seinen Hut irgendwo hat liegen lassen. „Du sollst dort keine Therapie machen, sondern dabei helfen, dass andere eine machen können.“
Argwöhnisch mustere ich ihn. Soll das ein schlechter Witz sein?
„Ja, Roxy. Deine Sozialstunden bestehen darin, drei Mal in der Woche nachmittags die Box des Therapiepferdes auszumisten, es zu putzen, in die Halle zu führen und anschließend zu füttern. Das ist machbar, oder?“
„Ich kenne mich mit Pferden nicht aus“, erwidere ich barsch und senke meinen Blick. Wieder wird mir heiß. Meine Worte fühlen sich an wie ein Verrat. Denn es hat mal ein Pferd in meinem Leben gegeben … früher, als ich noch ein kleines Kind war … Die Erinnerungen daran sind schwarz-weiß, wackelig und unscharf, manchmal wage ich kaum, sie zu glauben, so alt sind sie. Aber es ist da gewesen, ein kleines, schmutziges Pony mit langer verfilzter Mähne und zersplitterten Hufen, eingepfercht in einen winzigen Wagen. Ganz alleine. Jeden Tag habe ich bei ihm gesessen, schweigend, und gehofft, dass mich dort niemand finden würde. Als die Beamten mich wegholten, hat es mir laut hinterhergewiehert … Es klingt in mir nach, als wäre es erst gestern gewesen, dass dieses kleine, alte Pferd um sein Leben gerufen hat. Und noch immer killt es mich.
„Du musst dich mit Pferden nicht auskennen“, dringt Steffens tiefe Stimme durch meine düsteren Erinnerungen. „Lavendel ist ein Therapiepferd, brav und erfahren. Frau Klamm wird dir zeigen, wie du ihn halfterst und putzt. Roxy, das ist eine riesige Chance, andere Mädchen würden alles stehen und liegen lassen für eine solche Aufgabe. Das ist keine Strafe, sondern eine Belohnung, du hast mehr Glück als Verstand!“
„Wie lange?“, frage ich heiser und lege meine Hände wieder um die Tasse. Ich muss mich irgendwo festhalten. „Wie lange muss ich das tun?“
„Acht Wochen. Dann hast du deine Sozialstunden zusammen.“
Acht Wochen … Acht Wochen, die ich mit einem Pferd verbringen darf, um es dann wieder gehen lassen zu müssen, wie damals. Dieses Pony war mein einziger Freund, mein einziger Vertrauter in einer schmutzigen, dunklen Welt.
„Ich kann das nicht“, höre ich mich flüstern, wende den Kopf zur Seite und sehe durch meine Augenwinkel, wie Steffen die Zigarette aus dem Mund nimmt, beide Hände auf den Tisch legt und sich vorbeugt.
„Hast du etwa Angst vor Pferden?“
„Nein, aber … Mann, das passt nicht! Hast du dir das Kastanien-Hof denn überhaupt schon mal angesehen? Das ist ein versnobter Nobelschuppen! Leute wie mich wollen die dort doch gar nicht haben!“
„Roxy, darum geht es hier nicht.“ Steffens Ton ist strenger geworden. „Für dich sind nur Frau Klamm und das Therapiepferd interessant. Erledige deine Aufgabe und du bist frei.“
Frei? Das glaubt er doch selbst nicht. Für acht Wochen darf ich nachmittags die WG verlassen und ein Pferd putzen, um danach wieder im immer gleichen Rhythmus funktionieren zu müssen und nachts schlaflos den Flur auf und ab zu wandern. Es wird schlimmer sein als vorher. Nicht besser. Ich weiß es jetzt schon.
„Das ist eine gerichtliche Auflage, Roxy. Daran führt kein Weg vorbei. Du bist auf Anhieb mit Moses zurechtgekommen, dann wird es dir auch gelingen, mit einem Pferd umzugehen. Das weiß ich!“
Moses, sein alter, treuer Labrador-Mix, seufzt schwer unter dem Tisch und lässt sich zufrieden auf die Seite fallen, als wollte er Steffens Worte bekräftigen. „Kann ich Frau Klamm zusagen?“
Minutenlang schweigen Steffen und ich uns an, während er sich zwei weitere Zigaretten dreht, die er nicht raucht, und mein Kaffee kalt wird. Er wartet auf mein Ja. Es liegt mir auf der Zunge, schwer und bleiern. Ich muss Ja sagen, ich habe gar keine andere Wahl.
Doch es dauert, bis ich mich dazu überwinden kann. Als es endlich tonlos über meine Lippen kriecht, kann ich hören, wie eine weitere schwere Gefängnistür hinter mir ins Schloss fällt.
Steffen hat mich mit mir selbst eingesperrt.
Im falschen Film
„Du machst das gut, wirklich“, wiederholt Frau Klamm, was sie eben schon einmal gesagt hat – und erneut zucke ich nur mit den Schultern. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann mir das letzte Mal jemand gesagt hat, dass ich etwas gut mache. Vielleicht hat mir das noch nie jemand gesagt.
Je länger ich bei Frau Klamm und Lavendel in der dämmrigen Stallgasse stehe, desto heller und klarer werden meine Kindheitserinnerungen und ich schaffe es immer weniger, sie wegzudrängen. Der Geruch der Pferde, ihr Schnauben, das Geräusch ihrer Hufe auf dem Boden, das Malmen ihrer Kiefer, wenn sie Heu kauen – all das war schon einmal da gewesen, direkt vor mir. Ich darf es nie wieder so nah an mich heranlassen.
„Hier, probier du es mal.“ Frau Klamm reicht mir den Strick und ich versuche, ihn auf die gleiche Weise, wie sie es mir vor der Therapiestunde gezeigt hat, durch den Anbindering zu ziehen und zu verknoten. Lavendel atmet mir warm in meinen Nacken und bleibt geduldig stehen, bis ich es geschafft habe, den Sicherheitsknoten zu binden.
„Prima. Nun kannst du ihm den Sattel abnehmen, ihn in die Kammer hängen und ihm anschließend sein Belohnungsfutter geben.“ Sie deutet auf den Eimer, der neben der Box steht. „Das war es dann auch schon. – Kann ich dich damit alleine lassen?“
„Ja!“, sage ich etwas zu vorschnell und bemühe mich, sie freundlich anzugucken, auch wenn ich eigentlich gar nicht genau weiß, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie mein Gesicht dann aussieht. Doch sie lächelt mich zustimmend an, also kann es nicht so wild sein. Frau Klamm ist nett, aber sie erinnert mich zu sehr an Diana. Lächeln gehört für solche Leute zum Beruf. Es wird gelächelt, ganz egal, wer vor ihnen steht, denn sie haben sich auf die Fahnen geschrieben: Wir geben jedem Menschen eine Chance.
Und trotzdem kann sie es nicht erwarten, sich von mir zu verabschieden. Ich kann es kaum glauben; schon am ersten Tag lässt sie mich mit Lavendel allein.
„Dann mache ich mich wieder auf den Weg, Roxy. Am Donnerstag um die gleiche Zeit, ja?“
„Ja, okay.“ Nichts ist okay – und wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, meine Sozialstunden abzuleisten, werde ich am Donnerstag nicht wiederkommen.
Lavendel knickt den linken Hinterhuf ein und lässt mit halb geschlossenen Augen den Kopf hängen. Ich muss mich zwingen, meine Hände in den Jackentaschen zu lassen und ihm nicht über seinen mächtigen Hals zu streicheln, während er vertrauensvoll vor mir döst. Bloß keine Verbindung entstehen lassen. Gefühle sind tabu, das habe ich mir schon den ganzen Nachmittag wieder und wieder eingetrichtert. Doch meine abwehrende, kühle Haltung scheint ihn nicht zu interessieren. Er wirkt so zufrieden wie Frau Klamm eben, nur ohne das gekünstelte Lächeln.
„Du Opi“, flüstere ich und klinge dabei viel zu liebevoll. Lavendel ist schon 26 Jahre alt, und man sieht es ihm an. Die Muskulatur am Rücken ist eingefallen, seine Bewegungen sind langsam und gemächlich – genau richtig für die Kinder, die auf ihm sitzen oder liegen, wenn er in der Reithalle seine Runden zieht.
Die Box, in der er fast den ganzen Tag steht, ist eigentlich viel zu klein für ihn. Er kann sich dort nicht richtig hinlegen und die Zwischenwände sind so hoch, dass er das Pferd nebenan gar nicht sehen kann; außerdem ist der Bereich des Schulstalls, in dem er steht, dunkel und stickig.
Zwei-Klassen-Gesellschaft, denke ich und spüre, wie kalte Wut in mir hochsteigt. Auf der schönen, neu gepflasterten Seite des Hofs, mit Zugang zu den weitläufigen Koppeln und dem gut gepflegten, von Bäumen umsäumten Reitplatz, liegen die noblen Privatstallungen. Zutritt für Unbefugte verboten. Auch die große, helle Halle befindet sich dort – zumindest muss sie hell sein, denn das Dach hat mehrere Oberlichter.
In der kleinen Halle, in der die Therapiestunden stattfinden, brennt sogar tagsüber das Licht, so dunkel ist sie. Und eine Koppel bekommt Lavendel wahrscheinlich nie zu sehen. Frau Klamm sagte vorhin, wenn sie Zeit habe, gehe sie sonntags ab und zu mit ihm spazieren. Aber Zeit sei ein Dauerproblem bei ihr.
Langsam ziehe ich meine Hände aus den Jackentaschen und löse die Schnallen von Lavendels Sattelgurt. Erleichtert atmet er durch; er war viel zu eng geschnallt. Ich habe das vorhin schon gesehen, als Frau Klamm ihn festgezurrt hat, aber mit einem Knoten im Bauch meine Klappe gehalten. Es fällt mir genauso schwer, Lavendel jetzt nicht zu berühren, während ich den schweren Ledersattel von seinem Rücken ziehe und den Gurt darüber lege.
Auf beiden Armen schleppe ich ihn Richtung Sattelkammer. Der Schulunterricht ist bereits vorüber oder findet gar nicht mehr statt; außer mir scheint niemand in diesem Teil des Stalls unterwegs zu sein. Doch als ich die Tür zur Kammer öffne, spüre ich, wie mich jemand anstarrt. Ohne darauf zu reagieren, hänge ich den Sattel über seine Halterung und gehe zurück in die Stallgasse. Es sind nicht nur zwei Augen, die mich verfolgen – es sind vier und schon dringt unterdrücktes Tuscheln zu mir herüber. Ja, ihr habt mich hier noch nicht gesehen und ihr werdet es auch nicht mehr.
Erst als ich bei Lavendel stehe und den Strick löse, verstummt das Tuscheln und ich höre, wie die Mädchen sich entfernen. Wortlos führe ich Lavendel in seine frisch ausgemistete Box und hänge ihm den Eimer mit dem Kraftfutter und den zwei Möhren über, die Frau Klamm von zu Hause mitgebracht hat. Ich selbst habe ihm bisher kein einziges Leckerchen gegeben, auch wenn Frau Klamm mich mehrfach dazu aufgefordert hat, um sein Vertrauen zu gewinnen. Lavendel ist ein fremdes Pferd und so werde ich ihn auch behandeln. Fremden Pferden gibt man kein Leckerchen.
Während Lavendel sich über sein Futter hermacht, lehne ich mich an die Heuballen am Ende der Stallgasse und schaue durch das halb aufgeschobene Tor nach draußen. Die zwei Mädchen, die mich eben noch unverhohlen begutachtet haben, laufen über den Hof in Richtung Privatstallungen und reden aufgeregt miteinander, die Köpfe zusammengesteckt. Sie haben sich ausstaffiert, als ginge es zu einem Shooting für einen Reitsportkatalog. Beide tragen mit Strass besetzte Reithosen, karierte Kniestrümpfe in Pastellfarben und teuer wirkende Lederstiefeletten. Alleine für diese Stiefeletten würde ich wahrscheinlich ein Jahr lang sparen müssen.
Das rechte der beiden Mädchen hat lange, gewellte blonde Haare, die bei jedem Schritt mitwippen. Ihre Bewegungen wirken selbstsicher, als wüsste sie ganz genau, dass sie gerade mehrere hundert Euro durch die Gegend trägt. Jetzt zieht sie einen Schlüsselbund aus der Hosentasche, der glitzernd die Abendsonne einfängt. Ich hatte es mir ja gedacht: Der Privatstall ist abgeriegelt. Zutritt nur für höhere Töchter. Jetzt hält sie genau an der Tür an, aus der damals der Mann gekommen war. Ich hatte nur an der Koppel gestanden und ein Pferd angeschaut, hatte es nicht einmal berührt. Alleine, dass ich sein heiliges Terrain betreten hatte, war dem Mann Grund genug gewesen, schreiend seine Hunde auf mich zu hetzen und mich zu verjagen.
Das Klappern des Eimers schreckt mich aus meinen Erinnerungen. Lavendel ist fertig und schlägt ihn rhythmisch gegen die Boxenwand, um meine Aufmerksamkeit zu wecken.
Ich gehe zu ihm, ziehe die Riemen, an denen der Eimer befestigt ist, über seinen großen Kopf und will ihn mir gerade um die Schulter hängen, als etwas Warmes, Feuchtes über meinen nackten Unterarm fährt – Lavendels Zunge.
„Pfui“, ermahne ich ihn halbherzig, schaffe es aber nicht, meinen Arm wegzuziehen. Sorgsam beginnt er damit, ihn abzuschlecken, als wäre er eine seltene Köstlichkeit, und nicht ein einziges Mal spüre ich dabei seine Zähne. Stattdessen kitzelt seine Zunge mich und als sie die empfindliche Stelle in meiner Armbeuge erreicht, muss ich sogar lachen. Mein eigener Laut erschreckt mich so sehr, dass ich zusammenzucke und Lavendel von mir ablässt.
Es war ein anderes Lachen als das, was ich von mir kenne. Ich lache eigentlich nur noch bei Sachen, die gar nicht komisch sind. Es ist ein lebloses Lachen, das ich nur im Kopf fühlen kann.
Das hier aber kam aus meinem Bauch und ist über mein Herz direkt in meine Kehle gewandert.
Ich ducke mich unter Lavendels Hals hindurch, schiebe die Boxentür zu und hänge den Eimer an seinen Haken. Mein heutiger Sozialdienst war ein einmaliger Versuch und von Beginn an zum Scheitern verurteilt.
Ich werde nicht zurückkommen.
Andere Jugendstraftäter sammeln Müll auf, sortieren Altkleider oder arbeiten bei der Essensausgabe der Tafel. Ich kenne die Leute dort sogar, von früher.
Da wird noch ein Platz für mich frei sein.
Ich kann hier nicht bleiben.
Wüstenhauch
Noch sechseinhalb Wochen.
Sechseinhalb Wochen, in denen ich das sanfte Wiehern von Lavendel ausblenden muss, mit dem er mich begrüßt, sobald ich die Stallgasse betrete, sechseinhalb Wochen, in denen ich ihn weiterhin nur berühre, wenn es gar nicht anders geht, und sofort verschwinde, sobald ich meine Arbeit erledigt habe. Denn das ist es, worum es hier geht. Meinen Job zu machen.
Steffen hat sich gar nicht erst auf eine Diskussion eingelassen. Manchmal kann er knallhart sein. Sozialstunden seien nichts, was man sich aussuchen könne, und ich hätte schließlich etwas gutzumachen. Da ich keine Lust hatte, mit ihm zu streiten und am Ende doch wieder irgendeine Therapie aufgedonnert zu kriegen, habe ich schließlich klein beigegeben.
Die Menschen im Stall machen es mir leicht, mich nicht länger als dringend notwendig auf dem Gestüt aufzuhalten. Wo ich auch auftauche, streifen mich Blicke – lauernde, misstrauische, kritische, abfällige. Vor allem abfällige. Ich weiß nicht, ob Frau Klamm ihnen erzählt hat, wer ich bin. Frau Klamm ist, wie ich inzwischen festgestellt habe, dauerüberfordert. Sie zerreißt sich zwischen Terminen, ehrenamtlichen Aufgaben und Freizeitstress, ist immer auf dem Sprung und hat nie Zeit. Mir ist das recht, denn so muss ich mich selten länger als zwei Minuten mit ihr unterhalten. Aber unterschwellig bin ich auf der Hut und rechne jeden Moment damit, dass jemand von den Privatstallleuten auf mich zugestürmt kommt und mich vom Hof verjagen will, weil er nicht weiß, dass ich offiziell hier sein darf.
Jetzt aber sieht mich niemand. Mit verdreckten Gummiboots stehe ich in Lavendels Box und miste sie aus, während er den spastisch behinderten Max durch die Halle trägt. Das ist eine Arbeit, die ich sogar mag. Sie fühlt sich ehrlich an und es gibt dabei keine Missverständnisse; ich muss weder schreiben noch rechnen. Schmutzige Einstreu raus, frische Einstreu rein – so einfach ist das. Niemand kontrolliert mich oder schaut mir über die Schulter, und ich bin anschließend angenehm müde. In den vergangenen Nächten habe ich sogar durchgeschlafen. Kein Auf-und-ab-Wandern durch den Flur, keine Fernsehmarathons bis früh in den Morgen.
Noch eine Schubkarre, dann ist es für heute geschafft. Anschließend muss ich nur noch Lavendel absatteln und füttern und dann … Ich stocke mitten in der Bewegung und richte mich lauschend auf. Ein lautes Knallen ertönt vom Hof, dazu hektische Rufe. Ich lasse die Mistgabel sinken, meine Ohren wachsam gespitzt. Ist das Geräusch das Schlagen von Hufen gegen eine Boxenwand? Oder gegen die Tür eines Pferdeanhängers? Hatte ich nicht gerade erst einen Hänger auf den Hof fahren sehen, als ich auf die winzige, schmutzige Toilette der Schulpferdereiter gegangen bin?
Wieder ertönt das Knallen und dazu ein tiefes, heiseres Wiehern, das mir sofort einen Schauer über den Rücken jagt. Vorsichtig stelle ich die Gabel in die Ecke der Box, zwänge mich an der Schubkarre vorbei und laufe zur hinteren Stalltür, die ich wie immer halb aufgeschoben habe, damit frische Luft in die Stallgasse strömen kann. Im Schatten des Tors linse ich auf den Hof. Ein SUV mit Hänger steht vor den Privatstallungen und zwei Männer lösen gerade die hintere Verriegelung des Hängers und ziehen die Rampe aus. Immer wieder knallen die Hufe des Pferdes gegen die Wände, ein Geräusch, das mir durch Mark und Bein geht. Ein blondes Mädchen versucht, von der vorderen Tür des Hängers aus beruhigend auf das Pferd einzureden. Ich erkenne sie sofort wieder. Sie ist eins der beiden Mädchen, die am ersten Tag über mich getuschelt hatten. Auch heute sieht sie aus wie aus einem Reitmodenkatalog entsprungen. Ein junger Mann kommt dazu, schlank und hochgewachsen, und reicht ihr einen Strick.
„Das kann doch nicht gut gehen …“, stöhne ich leise. Der ganze Hänger erbebt unter den Tritten des Pferdes und sie belagern ihn von allen Seiten, wie Raubtiere, die Beute machen wollen. Hinten die zwei Männer, die nun den letzten Riegel lösen, vorne das Mädchen und der schlanke junge Mann. Ihre Bewegungen wirken angespannt. Das blonde Mädchen verschwindet durch die kleine Seitentür ins Innere des Hängers.
„Hast du ihn?“
„Ja, ich hab ihn am Strick!“ Sie klingt nervös und unsicher.
„Jetzt!“, brüllt einer der Männer und sie klappen die Tür auf. Der Zugang zur Rampe ist frei. Ein Huf saust in die Luft, dann ertönt ein spitzer Schrei und ein pechschwarzes, hochbeiniges Pferd schleift das Mädchen mit schnellen, kleinen Schritten rückwärts aus dem Hänger heraus.
Mit beiden Händen klammert sie sich an den Strick, will den Rappen nicht loslassen, doch ihr Gesicht ist verzerrt vor Angst. Schon rutscht sie bäuchlings vor den wirbelnden Hufen des Pferdes die Rampe hinab.
„Lass los, verdammt“, flüstere ich und nur einen Sekundenbruchteil später ruft der junge Mann: „Loslassen, Isabella!“ Haarscharf verfehlt der linke Vorderhuf des Pferdes ihren Kopf, bevor sie gehorcht, rückwärts krabbelt und von ihrem Helfer in Sicherheit gebracht wird. Der Hänger gerät ins Schwanken, als der Rappe ein letztes Mal buckelt und mit beiden Hinterbeinen von außen gegen die Seitenwand tritt, dann dreht er sich steigend ein Mal um sich selbst und beginnt im ungleichmäßigen Galopp über den Hof zu stürmen.
„Oh Gott, bist du schön …“, wispere ich überwältigt. Jetzt, wo er losgelassen über den Hof läuft, kommt er mir vor wie eine exotische Geistererscheinung aus einer fernen Welt, ein Sohn der Wüste, frei und stark. Doch die Menschen um ihn herum machen ihm Angst. Seine Nüstern sind so weit gebläht, dass ihr Inneres rosa aufleuchtet, und er trägt seinen Hals beinahe senkrecht. Immer wieder scheuchen sie ihn mit ihren Peitschen und Gerten zurück in die Mitte des Hofes und schreien ihn an, wenn er ihnen bei seinen Fluchtversuchen zu nahe kommt. Er weiß nicht, wohin mit sich. Hat keine Ahnung, wo er ist und was mit ihm geschehen wird … und es gibt nicht ein einziges Wesen, dem er vertrauen kann.
Wieder wiehert er, mit hoch erhobenem Kopf und blitzenden Augen, und ich höre darin das kleine, zarte Fohlen, das nach seiner Mutter ruft, einsam und verzweifelt. Für ein paar Sekunden gelingt es dem jungen Typen, nach dem herunterbaumelnden Strick zu greifen, während Isabella weinend Schutz bei einem älteren Mann sucht, doch er hat keine Chance. Er muss loslassen, um sich vor den fliegenden Hufen des Pferdes zu retten – und dieses Mal kann es den Kreis aus Peitschen und Gerten durchbrechen. Im vollen Galopp prescht es auf den Schulstalltrakt zu und an mir vorbei, bevor es am mannshohen Zaun des Gestüts anhalten muss und sich panisch zu den Menschen hinter sich herumdreht. Sogar von hier aus kann ich das Weiße in seinen Augen sehen – und als würden sich unsere Herzen suchend miteinander verbinden, dreht er seinen Kopf in meine Richtung und nimmt schnaubend Witterung auf.
Hier bin ich – und ich werde dich weder schlagen noch in die Ecke treiben. Ich bin einfach nur da. Für immer, wenn du willst.
Wieder dreht er sich suchend zu mir um, obwohl ich mich noch im Schatten der Tür verberge.
Ich weiß, dass ich das nicht darf. Dass es unerwünscht ist. Dass meine Welt sich mit der Welt der anderen nicht zu vermischen hat. Aber das Pferd steht hier, bei mir, und nicht drüben bei den anderen – und das kann kein Zufall sein.
Mit langsamen, ruhigen Schritten trete ich aus dem Dunkel des Toreingangs heraus, meinen Kopf gesenkt, und ohne das Pferd zu beachten. Wenn ich es anschaue, wird es nur glauben, ich sei einer von den anderen und wolle etwas von ihm. Der Atem des Rappen geht pumpend und ich höre, wie sein Schweif hin und her peitscht und seine Hufe nervös über die Pflastersteine scharren. Aber er flieht nicht. Noch bleibt er stehen und schaut zu mir herüber.
Ohne mich ihm zuzuwenden, halte ich in der Mitte des Hofes an, gehe in die Hocke und verharre, meine Blicke ins Nichts gerichtet, die Arme lasse ich hängen.
Die Männer haben aufgehört, zu schreien und ihre Peitschen zu schwingen. Stattdessen macht sich warnendes Gemurmel breit, durch das hell das Schluchzen von Isabella dringt. Jetzt höre ich zudem entschiedene, klackende Schritte in meine Richtung.
„Nein, lass sie, Ewald! Bleib lieber hier, sonst rennt er nur wieder weg.“ War das die Stimme des jungen Mannes? Die Schritte verstummen, doch das Gemurmel ist noch da und es klingt drohend und unfreundlich.
Ich ignoriere es; tue so, als wäre es still um mich herum, wie in der Wüste, über deren sandige Dünen nur der Wind rauscht, endloser Blick in alle Richtungen. Wieder scharren die Hufe des Rappen über den Boden– dann macht er einen zögernden Schritt auf mich zu. Zwei. Verharrt. Kommt näher … Obwohl meine Oberschenkel zu brennen beginnen, rühre ich mich nicht und versuche, tief und gleichmäßig zu atmen. Das Gemurmel wird wieder lauter, nun mischt sich auch Isabellas drängendes, schluchzendes Flüstern darunter. Der Rappe reagiert sofort und zieht sich wieder einen Meter zurück.
„Leise“, ertönt die Stimme des jungen Mannes. „Seid doch mal ruhig …“
„Aber was macht sie denn da! Wer ist das überhaupt?“
„Pscht. Nicht reden!“