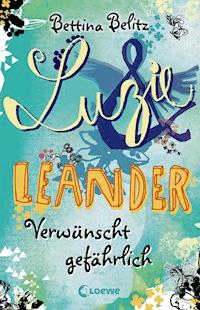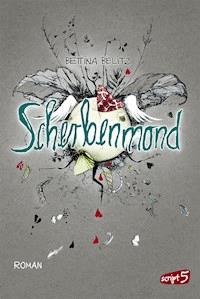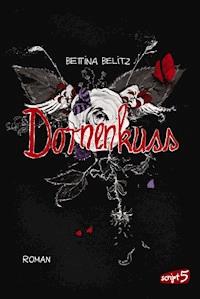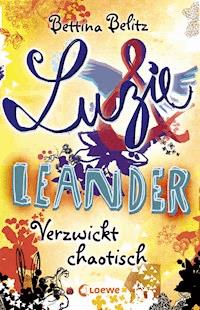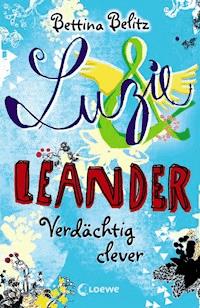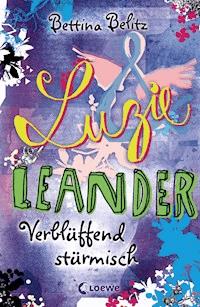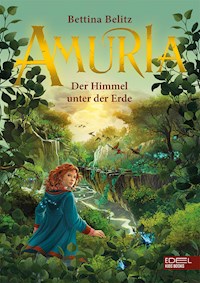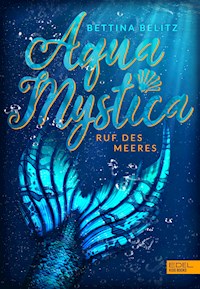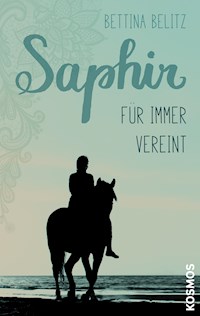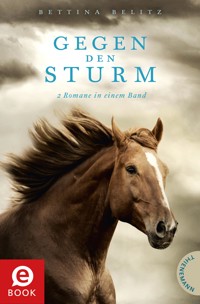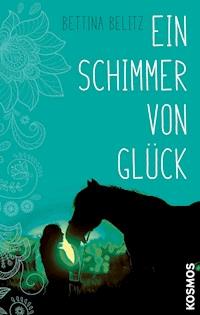
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Mira findet auf dem Bauernhof ihres verschwundenen Vaters die völlig vernachlässigte und schwerkranke Stute Bonnie. Niemand glaubt an Heilung! Doch Mira hat etwas in Bonnies Augen gesehen – Leben! Und sie will mit aller Kraft kämpfen, um sie zu retten. Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt Bettina Belitz unnachahmlich die berührende Geschichte eines Mädchens und ihren Kampf für ein besonderes Pferd.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bettina Belitz
Ein Schimmer von Glück
KOSMOS
Umschlaggestaltung: Kathrin Steigerwald, Hamburg
unter Verwendung von Fotomotiven von Tetiana Shamenko/fotolia
und callipso88/fotolia
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele
weitere Informationen zu unseren Büchern,
Spielen, Experimentierkästen, DVDs, Autoren und
Aktivitäten findest du unter kosmos.de
© 2017, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-440-15934-7
eBook-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Auf der Flucht
„Moment, warte kurz. Ich glaub, da muss ich rangehen …“
„Bitte nicht!“, bat ich Mama flehentlich, doch sie hatte ihre Tasche schon auf den Stufen vor dem Haus abgesetzt und kniete sich nieder, um ihr Handy herauszukramen. Ihr Trolley kippte langsam zur Seite. Mit dem Fuß stoppte ich ihn, bevor er die Treppe hinunterrutschen konnte.
Auch ich hatte Mamas Handy in der vergangenen halben Stunde dreimal läuten hören – bei ihr ein Meeresrauschen mit Möwenkreischen – , es aber wie sie ignoriert, denn wir waren spät dran und hinter dem Anruf konnte nur jemand aus der Redaktion stecken, der sie in letzter Sekunde zu einem neuen Auftrag verpflichten wollte. Sie hatte mir versprochen, dass wir in den Osterferien endlich zusammen verreisen würden, ganz egal, wer was von ihr wolle, und nie war mir mehr daran gelegen als jetzt, von zu Hause wegzukommen.
Ich wollte keine Minute länger in dieser Stadt verbringen, weil ich dringend vergessen musste, was gestern Abend geschehen war, und das konnte ich nur, wenn ich mir sicher sein konnte, weder Bille noch Janis über den Weg zu laufen. Ich wusste nicht, was ich tun würde, wenn es geschah. Scham und Wut wechselten sich im Sekundentakt ab, als kämpften sie darum, wer die Vorherrschaft bekommen würde, doch am schlimmsten war dieses schmerzhafte Brennen zwischen Herz und Bauch.
Endlich hatte Mama ihr Handy gefunden.
„Ja, was ist denn?“, fragte sie unwirsch und ließ sich auf die nächstbeste Stufe sinken, um sofort wieder aufzustehen. Ihr Blick wurde starr und ihre Nase verdächtig blass. „Wie bitte? Was hat er … ich verstehe nicht … was!?“ Das letzte „Was“ schrie sie beinahe, während ihre freie Hand hektisch über ihren Hinterkopf fuhr. Okay, es war also ihr Chef persönlich und irgendetwas hatte sie verbockt. Doch das musste warten. Urlaub war Urlaub. Und versprochen versprochen.
„Mama“, murmelte ich warnend und deutete auf meine Armbanduhr. Wir mussten die nächste S-Bahn kriegen, um den Flughafen rechtzeitig zu erreichen, und die fuhr in drei Minuten. Sie wusste das! Doch sie drehte sich nur mit dem Rücken zu mir und fuhr erneut über ihren Kopf.
„Das darf nicht wahr sein … Ich glaub das nicht. Dieser …“ Mamas Rücken spannte sich an, als müsse sie sich zusammenreißen, um nicht zu explodieren, und auch ich begann, nervös zu werden. „Was soll ich denn jetzt machen? – Aber das kann ich nicht, das geht nicht, ich bin auf dem Sprung zum Flughafen, zusammen mit meiner Tochter … Ja, gut, das sehe ich ja ein, aber …“ Kopfschüttelnd lauschte sie in den Hörer, den Rücken immer noch zu mir gewandt. Mein Bauch zog sich in einer unguten Vorahnung zusammen. Wurde sie etwa gefeuert? Wenn ja, konnten wir unseren Urlaub vergessen.
„Gut, ja … ja, ich habe es kapiert! Dieser Ton ist nicht nötig, ich kann nichts dafür. – Doch, bin ich, aber nur noch auf dem Papier, und … was? Davon weiß ich nichts. Oh mein Gott … Ich bringe ihn um.“ Den letzten Satz sagte sie mehr zu sich selbst als zu dem Anrufer, während sie das Handy vom Ohr nahm und sich wie in Zeitlupe zu mir umdrehte. Sie hatte vorhin schon gestresst ausgesehen, aber jetzt grub sich eine tiefe Falte zwischen ihre Augen und ihr Atem ging so rasch, dass er wie ein Keuchen klang.
„Wir können nicht fliegen, Mira“, verkündete sie tonlos. „Oh Mann, dieser Arsch!“ Aufgebracht trat sie gegen ihren Trolley, sodass er doch die Stufen herunterpolterte. Es fehlte nicht viel und sie fing an zu weinen. Auch ich fühlte mich aufgewühlt und panisch, obwohl ich noch gar nicht wusste, was geschehen war – ich wusste nur, dass es ernst war. „Du hast mir versprochen, dass wir nach Mallorca fliegen, Mama! Wir haben vier Jahre lang keinen Urlaub mehr gemacht und außerdem … Was ist eigentlich los? Haben sie dir gekündigt?“
„Man kann freien Mitarbeitern nicht kündigen“, erwiderte Mama dumpf und machte einen vorsichtigen Schritt auf mich zu. „Und es war nicht mein Boss, sondern das Veterinäramt von Strassnitz.“
„Strassnitz“, echote ich verständnislos. „Strassnitz!?“ Dieses Wort sagte mir gar nichts, was meine Verwirrung nur noch größer werden ließ. Ich kapierte überhaupt nichts mehr.
Mama zuckte mit den Schultern, als wüsste sie selbst nicht genau, wovon sie sprach. „Ja. Das ist der Ort, in dem Marius einen alten Hof gekauft hat, und jetzt, jetzt hat er das Weite gesucht. Er ist weg, Mira. Keiner weiß, wo er steckt, und er hat Tiere zurückgelassen. Das Amt ist schon informiert worden und auf dem Weg dorthin. Dieser egoistische Idiot! Das ist so typisch für ihn, so typisch …“
„Papa hat einen Bauernhof? Ehrlich?“ Sprach sie wirklich von meinem Vater? Den ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und an den ich heute Nacht komischerweise hatte denken müssen, weil ich mich nach einem Menschen gesehnt hatte, der mir in all dem Chaos Halt gab? Offensichtlich hatte er mein Chaos eher noch verstärkt. Und was hatte er bloß mit einem Bauernhof gewollt?
„Wir bleiben hier, der Urlaub muss ausfallen“, beschloss Mama, als sei sie alleine auf der Welt, doch mein fassungsloser Blick schien sie zumindest zu erinnern, dass hier auch noch ein zweiter Mensch betroffen war. „Es tut mir leid. Ich muss jemanden organisieren, der sich um die Angelegenheit kümmert, und zwar sofort. Denn die nehmen mich gerade in Sippenhaft und drohen mit Strafanzeigen. Warum passiert so etwas immer nur mir? Was für ein Mist … Wie soll ich das nur aus der Ferne hinkriegen? Wie soll ich das schaffen?“
Ich kannte Mamas Monologe samt den unzähligen Fragen darin zu gut. Sie spulte sie immer dann ab, wenn sie unter Druck stand, ohne echte Antworten von ihrem Gegenüber zu erwarten. In der Regel gab ich auch keine, sondern ließ sie reden. Irgendwann fand sie selbst eine Lösung. Eigentlich wollte sie gar nicht, dass man ihr Ratschläge gab, denn das stresste sie noch mehr. Doch heute war mir das egal und ich hatte auch keine Geduld mehr, ihr noch länger bei ihren Selbstgesprächen zuzuhören. Ich würde verreisen! Wenn nicht Mallorca, dann halt Strassnitz. Hauptsache, weg von hier und das so schnell wie möglich. „Gar nicht“, erwiderte ich deshalb forsch. „Wir fahren selbst hin.“
„Was?“
„Das ist doch das Einfachste, oder? Wir fahren hin. Wir haben schon unsere Koffer gepackt, du hast Urlaub genommen … Wir müssen unser Gepäck nur in den Kofferraum schmeißen und uns ins Auto setzen. Den Flieger kriegen wir eh nicht mehr.“
Abwehrend schüttelte Mama den Kopf. „Nein, das sehe ich nicht ein. Ich putze deinem Vater nicht wieder hinterher …“
„Aber du musst es doch sowieso machen! Und vor Ort ist es einfacher als aus der Ferne. Wir kennen dort niemanden, der das für dich tun kann.“
„Mira, das ist Mecklenburg! Das Einzige, was diese Gegend mit Mallorca gemeinsam hat, ist das ‚M‘ im Namen! Du machst dir keine Vorstellung … Das ist kein Ersatz für einen Urlaub.“
„Aber ich will verreisen und du hast mir versprochen, dass wir es tun.“ Nun zitterte auch meine Stimme, doch ich schluckte eigensinnig dagegen an. Sie sollte nicht merken, wie verzweifelt ich war, denn ich würde nicht darüber sprechen können, ohne in Tränen auszubrechen und dabei in meiner Scham zu ertrinken. „Also lass uns wegfahren, bitte. Bitte, Mama!“
„Oh, was für eine Scheiße …“, flüsterte sie und setzte sich wieder auf die Stufen vor dem Haus. „Verwahrloste Bauernhoftiere in Mecklenburg statt Strandspaziergänge auf Mallorca. Besten Dank, Marius, das hast du klasse hingekriegt.“ Erneut nahm sie ihr Handy und ging auf Google Maps, um Strassnitz einzugeben und sich die Route anzeigen zu lassen. „Fünf Stunden Fahrt, um hinter meinem infantilen Ex sauber zu machen. Mira, das wird nicht schön, das muss dir klar sein!“
„Ich finde es nicht schön, wie du von ihm redest. Er ist immerhin mein Vater.“
„Ein Vater, der nur sich selbst kennt und sonst nichts und niemanden“, entgegnete Mama hart. „Das hat er ja wieder einmal prächtig bewiesen.“
„Ich will trotzdem dorthin.“
Zweifelnd sah sie zu mir hoch. „Was ist eigentlich los mit dir seit heute früh? Du kommst mir verändert vor.“
„Nichts. Ich will einfach nur weg“, log ich mit gesenkten Lidern. In Wahrheit war meine gesamte Welt zerbrochen. An einem einzigen Abend hatte ich meine beste Freundin verloren und den Jungen, in den ich seit Monaten heimlich verliebt war, gleich mit dazu.
Jeder Ort auf der Welt war besser als dieser hier. Sogar Strassnitz.
„Na gut, von mir aus, dann fahren wir eben und schauen, was er angerichtet hat. Aber länger als eine Nacht bleibe ich dort nicht, das schwöre ich.“
„Okay“, willigte ich ein, denn eine Nacht in der Ferne war besser als gar keine. Vielleicht war es dort ja schöner, als wir glaubten, und Mama hängte noch ein paar Tage dran. Es war schon schwierig genug für mich, mich länger als ein paar Minuten vor unserem Haus aufzuhalten, denn Bille wohnte nur zwei Blocks weiter und konnte jederzeit hier auftauchen. „Dann los.“
Schweigend liefen wir zu Mamas Polo, quetschten unsere Taschen und Trolleys in den Kofferraum und setzten uns hinein – Mama auf den Fahrersitz, ich auf die Rückbank. Während wir die Stadt verließen und uns im Schneckentempo von einer Ampel zur nächsten bewegten, fing es an zu nieseln. Die Wolken sahen aus, als wollten sie sich an den Boden schmiegen, um alles zu verdecken und einzuhüllen, was Konturen hatte. Mit jedem Kilometer, den wir zurücklegten und mit dem die Landschaft um uns herum einsamer und flacher wurde, begann mein Kummer sich tiefer in mir einzunisten und gemeiner zu schmerzen. Mir war nicht, als entferne ich mich von ihm, sondern als würde er sich wie die Leere um uns herum ausdehnen und mich verschlingen wollen, sobald wir angekommen waren und ich aus dem Auto stieg. Janis, Bille, Bille, Janis …
Die Kapuze meiner Fleecejacke tief über meinen Kopf gezogen, sodass Mama meine Tränen nicht sehen konnte, döste ich ein, um wie heute Nacht zu hoffen, dass ich anschließend aufwachte und feststellte, dass alles nur ein Albtraum gewesen war.
Doch ich wusste schon jetzt, dass das nicht geschehen würde.
Im Nirgendwo
„Wach auf, Mira. Wir sind da. – Glaube ich jedenfalls …“
Verschlafen blinzelte ich, ohne zu wissen, wo wir uns befanden und was in den vergangenen Stunden geschehen war – bis es mir schlagartig wieder einfiel und das angenehm unschuldige Gefühl, das mein Schlummer mir geschenkt hatte, im Nu zerstörte. Bille … Warum hast du das nur getan? Und wieso hab ich mich nicht gewehrt, warum bin ich so still geblieben? Ich hätte etwas sagen müssen, sie anschreien, alle beide … Es war falsch, was sie gemacht haben, falsch und fies dazu! Das mussten sie wissen!
„Mira? Ist dir schlecht?“ Prüfend blickte Mama mich durch den Rückspiegel an.
„Nein. Doch. Ein bisschen“, brummelte ich und schälte mich umständlich aus meiner Jacke. „Hab wohl zu wenig gegessen.“ Genau genommen gar nichts. Seit gestern Abend war mein Magen wie zugeschnürt. „Was ist das für ein Geräusch, wer schreit da so?“
„Ziegen?“, riet Mama und drehte sich mit hochgezogenen Augenbrauen zu mir um. Für Tiere hatte sie sich nie sonderlich interessiert. Daran hatten selbst ihre Fotoaufträge im Zoo nichts ändern können. Auch ich kannte Ziegen in erster Linie aus dem Fernsehen.
„Könnte sein.“ Der Regen fiel so dicht, dass wir nicht viel von dem sehen konnten, was sich auf dem Hof abspielte, denn die Scheibenwischer waren bereits ausgeschaltet und die Dämmerung hatte sich längst über das Land gesenkt. In dem diffusen Grau vor uns gelang es mir lediglich, drei dunkle Gebäude und zwei mächtige Bäume auszumachen, zwischen denen ein paar Gestalten eilig hin und her huschten – kleine vierbeinige und größere zweibeinige.
„Ich will da nicht raus“, wisperte Mama und äugte mich noch einmal fragend durch den Rückspiegel an, weil ich ihr weder zustimmte noch sie aufmunterte. „Hast du etwa geweint?“
„Nein, bin nur müde.“ Dieser Tag mauserte sich zu einem einzigen Lügenfestival. Doch mit Mama konnte und wollte ich über mein Bille-Janis-Fiasko nicht sprechen. Sie würde mir doch nur vorwerfen, dass ich zu naiv gewesen war und Männer in erster Linie Schweine seien. Das half mir nicht weiter. Ich ärgerte mich schon genug über mich selbst. Diese Geschichte würde bei mir bleiben, für immer.
„Also, wenn ich das richtig sehe, fangen diese Männer gerade ein paar entlaufene Ziegen ein“, fasste Mama stockend zusammen. Wie zur Bestätigung schallte ein gellendes Meckern über den Hof, das gruselige Ähnlichkeit mit dem Schreien eines Babys hatte. Unbehaglich zogen wir unsere Köpfe ein.
„Die haben uns längst gesehen, Mama.“
„Ja, ich weiß.“ Seufzend griff sie nach ihrem Mantel und streifte ihn sich über, während ich den Reißverschluss meiner Fleecejacke bis zum Kinn zog und mir die Kapuze wieder überstülpte. Da Mama wie versteinert sitzen blieb, beschloss ich, den Anfang zu machen, löste den Gurt und stieß die Tür auf. Schrill meckernd galoppierte eine schwarz-weiß gemusterte Ziege an mir vorbei, der zwei kleinere nicht minder protestierend folgten.
„Halt sie auf, Mädchen!“, brüllte mir ein Mann zu, der von Kopf bis Fuß in grüner Regenkleidung steckte und gerade mit einem wehrhaften Bock rangelte, der versuchte, seine Hörner in sein rechtes Bein zu versenken. Sofort setzte ich mich in Bewegung, doch ich hatte nicht mit dem glitschigen Boden gerechnet. Schon auf den ersten Metern rutschte ich auf meinen dünnen, glatten Sohlen aus und schlug der Länge nach hin.
„Mira! Um Gottes willen, ist alles okay?“, hörte ich Mama rufen und wollte mich gerade aufrappeln, als zwei kräftige Arme unter meine Schultern griffen und mich auf meine schlammbesudelten Beine stellten. Verwirrt blickte ich auf ein Paar graue Gummistiefel, eine abgetragene Armeehose und einen dicken, verfilzten Seemannspullover, die zu einem glatzköpfigen Mann in Mamas Alter gehörten. Er musterte mich nur kurz, um sich dann sofort wieder dem entlaufenen Vieh zu widmen.
„Ich nehme Ziegen!“, rief er mit starkem Akzent und winkte beidarmig zu den anderen Gestalten rüber. „Nicht wegbringen, ich nehme Ziegen!“
„Mira, Schatz …“ Mama hatte sich durch den Regen zu mir gekämpft und spannte sofort ihren Schirm über mir auf – zu spät; ich sah bereits aus, als hätte man mich ins Wasser geworfen und anschließend im Schlamm paniert. Doch ein noch seltsameres Bild gab Mama ab. In ihrem raffiniert geschnittenen Mantel, den engen Designer-Jeans und ihren hochhackigen Pumps wirkte sie vollkommen fehl am Platz und die Blicke, die die Männer uns zuwarfen, waren alles andere als ein freundlicher Willkommensgruß.
„Sind Sie die Ehefrau?“, brüllte der Hüne in Grün zu ihr herüber, während der Armeehosen-Mann eine der Ziegen mit sicherem Griff an den Hörnern packte und sich auf die Arme hievte, um sie auf das Nachbargrundstück zu tragen. Kaum hatte er sie hinter einem Zaun abgesetzt, kam der Rest der Ziegenschar ihm entgegengetrabt.
„Ich war es“, rief Mama eisig zurück und nahm mich an der Hand, um mit klappernden Absätzen hinüber zum Hauptgebäude zu laufen, wo sich der Hüne mit seinen beiden Kollegen untergestellt hatte. Das Dach ragte so weit hervor, dass es uns einigermaßen vor dem strömenden Regen schützen konnte.
„Na, laut Gesetz sind Sie es immer noch und Sie stehen als Mitbesitzerin dieses Hofs in den Papieren, also sind Sie auch dafür verantwortlich.“
„Das bin ich nicht!“ Mit verschränkten Armen baute Mama sich vor ihm auf, während die anderen beiden Männer verstohlen einander zugrinsten und ich mich überflüssig zu fühlen begann. Mama hatte keinen Sinn mehr für mich und die Männer erst recht nicht. „Ich wusste weder von diesem Hof noch dass ich als Mitbesitzerin eingetragen bin noch dass mein Exmann verschwunden ist. Ich hatte keine Ahnung! Also, was ist hier eigentlich los? Sie haben wahrscheinlich mehr Informationen als ich.“
Das Grinsen der Männer erlosch innerhalb einer Millisekunde, denn Mamas Worte attackierten sie wie Pfeile, und auch der Hüne trat einen kleinen Schritt zurück. Sein strafender, verächtlicher Blick aber blieb.
„Mag sein, dass Sie in der Stadt keinen Sinn dafür haben, Frau Schönborn, aber hier sind beinahe Tiere verhungert, weil ihr Mann …“
„Mein Exmann“, verbesserte Mama ihn scharf.
„… und mein Vater“, murmelte ich in meine Kapuze, um Mama etwas runterzuholen, doch sie reagierte gar nicht auf mich.
„Sie sind nicht geschieden. Ihr Ehemann …“ Mama atmete schwer durch. „… ist spurlos verschwunden und hat seine Ziegen, Hühner und Pferde ohne Aufsicht zurückgelassen. Damit hat er sich strafbar gemacht, das wissen Sie, oder?“
„Die Ziegen wirken doch noch recht munter, oder?“ Mama deutete provokant auf sein zerrissenes Hosenbein.
„Weil der Nachbar ab und zu nach ihnen gesehen hat.“ Besagter Nachbar bugsierte gerade die fünfte Ziege in ein Entengehege, wo sich die Tiere begierig auf einen Ballen Heu stürzten. „Die Pferde sind heute früh von ihrem neuen Besitzer abgeholt worden. Sie standen bereits bis zu den Knien im Schlamm. Kümmern Sie sich um die Hühner? Sie sind wohlauf, aber der Stall muss dringend gereinigt werden.“
Langsam begriff ich, dass die Lage ernster war, als ich gedacht hatte, und ich konnte es kaum erwarten, endlich alleine mit Mama darüber zu sprechen. Doch die befand sich gerade in bester Kampfstimmung. „Kümmern? Stall sauber machen?“ Mama schüttelte belustigt den Kopf. „Nein, meine Herren, ich kenne mich mit Hühnern nicht aus und habe weder vor, diesen Hof zu bewirtschaften, noch eine Nacht länger als nötig zu bleiben. Vielleicht freut sich der Nachbar ja auch über eine neue Hühnerschar. Ich sehe hier nur nach dem Rechten und dann verschwinde ich wieder.“
„So einfach ist das nicht, Frau Schönborn.“ Der Hüne wagte sich wieder einen kleinen Schritt nach vorn, sodass ich unwillkürlich zur Seite auswich. „Sie müssen erst für uns herausfinden, wo ihr Mann steckt und ob er vorhat, zurückzukommen.“
„Ja, das wüsste ich auch zu gerne“, erwiderte Mama sarkastisch, und plötzlich schoss mir der Schrecken durch den ganzen Körper. Was war überhaupt mit Papa geschehen? Machte sich hier denn niemand Gedanken darüber, ob mit ihm alles in Ordnung war? „Hat er den Bunker wenigstens abbezahlt?“
„Das weiß ich nicht, das müssen Sie mit der Bank klären. Wir sind vom Veterinäramt. Schlosser“, stellte sich der Hüne steif vor und streckte Mama seine Pranke entgegen, die sie jedoch nicht ergriff. „Das sind meine Kollegen Rossbach und Schlesitz.“ Die Männer nickten knapp und ohne jedes Lächeln, wobei ich immer noch Luft für sie war. „Wir stellen sicher, dass es den Tieren gut geht. Der Rest ist Ihre Privatangelegenheit. Wir schauen in den nächsten Tagen zur Kontrolle vorbei. Ist alles in Ordnung, kommen Sie mit einer Verwarnung davon. Schönen Abend, die Damen.“
„Halt, stopp!“, rief Mama ihnen hinterher, als sie schon fast ihre Autos erreicht hatten. „Wie komme ich überhaupt ins Haus?“
Doch sie zuckten nur mit den Schultern, stiegen in ihre beiden Kombis, warfen die Motoren an und fuhren davon. Mama fluchte und zog mich zur Eingangstür, wo sie vergeblich an der Klinke rüttelte.
„Hab ich das richtig verstanden – Papa hatte eigene Pferde?“, fragte ich neugierig.
„Dein Vater hatte vor allem eines: Rosinen im Kopf.“ Mama bückte sich, um unter der verdreckten Matte vor dem Eingang nach dem Schlüssel zu suchen.
„Was meinst du denn, wo er steckt?“
„Der Schlüssel?“ Keuchend richtete Mama sich wieder auf, um den Türrahmen abzutasten.
„Nein. Papa!“, rief ich drängend. „Machst du dir gar keine Sorgen um ihn?“
„Mira.“ Stöhnend ließ Mama sich gegen die Tür sinken. „Natürlich mache ich mir Gedanken, wo er ist, auch wenn ich in den vergangenen Jahren kaum ein Wort mit ihm gewechselt habe. Aber vor allem bin ich sauer auf ihn. Ich weiß ja nicht mal, wie ich in diesen verdammten Schuppen kommen soll!“
„Ej! Frau!“, schallte es vom Nachbarhaus zu uns herüber – das einzige Gebäude außer Papas Hof weit und breit. Der Mann mit der Armeehose stand vor seiner offenen Garage und deutete fuchtelnd auf die Rückseite des Hauses. „Gucke hinten!“
„Aaaah ja“, machte Mama mit leiser Ironie und hob die Hand, um ihm zu bedeuten, dass wir verstanden hatten. „Dann gucken wir doch mal hinten.“ Mit hochgezogenen Schultern stapften wir durch den prasselnden Regen um das Haus herum, bis wir an eine Hintertür gelangten, die nicht abgeschlossen war und sich problemlos öffnen ließ.
„Halt, Mama, warte.“ Rasch griff ich nach ihrem Arm, um sie zu stoppen. Ich klang wie ein verängstigtes Vögelchen, denn in meinem Kopf jagte plötzlich eine Horrorvision die andere. „Was ist, wenn Papa da drinnen … ähm … irgendwo … liegt? Oder – hängt?“
„Hängt? Mira! Also bitte!“, entrüstete Mama sich, konnte sich aber nicht dazu entschließen, die Tür weiter aufzuschieben. „Dein Vater haut zwar gerne mal ab, aber nach Sterben war ihm nie zumute.“
„Du hast selbst gesagt, dass du in den vergangenen Jahren kaum mit ihm gesprochen hast, und ich auch nicht und vielleicht …“
„Schluss mit dem Blödsinn. Der bringt sich nicht um. Dazu lebt er viel zu gerne.“ Mamas Nase wurde trotz ihrer überzeugten Worte wieder weiß, als sie tief Luft holte, die Tür aufstieß und nach einem Lichtschalter suchte. Es vergingen zähe Sekunden, in denen sich meine Horrorvisionen zu einem ganzen Film verdichteten, bis ich endlich das Klicken eines Schalters hörte. Doch im Haus blieb es finster. „Mist. Der Strom ist abgestellt … Oder?“ Mama wagte sich ein paar Schritte in den Raum hinein und suchte nach weiteren Schaltern. Nichts tat sich. „Mira? Bist du noch da?“
„Bin ich. Versuch es doch mal mit der Taschenlampe von deinem Handy.“ Meines steckte tief in meiner Reisetasche. Ich hatte seit heute Nacht nicht mehr draufgeschaut und daran wollte ich auch jetzt nichts ändern. Bille konnte mich mal.
„Okay. Gute Idee.“ Mama holte es aus ihrem Mantel und leuchtete in den Raum hinein, während ich vor lauter Furcht vor dem, was ich sehen könnte, die Augen zusammenkniff. „Ach du Scheiße.“
„Hat er sich doch …?“
„Nein! Mira, du machst mich noch bekloppt. Komm rein, du holst dir da draußen nur eine Erkältung. Komm schon!“ Mama griff resolut nach meiner Hand, um mich ins Haus zu ziehen, und obwohl ihre Handy-Taschenlampe den Raum nur punktuell ausleuchten konnte, wusste ich sofort, was sie mit ihrem „Ach du Scheiße“ meinte.
Wir waren in einer Küche gelandet, in der pures Chaos herrschte. Noch vor Kurzem musste jemand die Spüle geputzt und den Boden gefegt haben, und auch das Geschirr stand ordentlich gestapelt in dem einzigen, altertümlichen Schrank. Doch nichts in diesem Raum passte richtig zusammen. In der Ecke lehnte ein Schaukelstuhl, dessen Sitzfläche durchgebrochen war, auf dem Tisch lagen lose Zügel, Plastikzaunpfähle und ein Halfter, kein Stuhl glich dem anderen, der Gasherd stammte aus dem vorigen Jahrhundert und auf dem Boden knüllten sich verblichene Flickenteppiche zu einem wirren Haufen zusammen. Die Wand zierte ein wildes Durcheinander an historischen landwirtschaftlichen Geräten, die eher in ein Museum als in eine Küche gepasst hätten, und in einem ausrangierten Kaninchenstall türmten sich schwere gusseiserne Pfannen und Töpfe. Der Kühlschrank war vom Strom genommen worden; seine Tür stand offen und er verströmte einen unangenehm fauligen Geruch. Am stärksten aber verunsicherte mich die bleierne Stille im Haus. Die alte Kuckucksuhr über dem Herd hatte längst zu ticken aufgehört, entweder weil sie kaputt war oder weil niemand sie mehr aufgezogen hatte. In diesem Raum war seit Tagen kein Mensch mehr gewesen.
Als Mamas Handy diese Stille plötzlich mit Meeresrauschen und Möwenkreischen durchbrach, zuckten wir beide zusammen. Während mein Herz stolperte, als habe es verlernt, regelmäßig zu schlagen, war sie geistesgegenwärtig genug, um sofort abzunehmen.
„Hallo?“ Mama klang ähnlich eingeschüchtert, wie ich mich fühlte. Dieses Haus machte mir Angst, und der Gedanke, dass Papa sich etwas angetan hatte, wich nicht aus meinem Kopf, auch wenn nur ein sehr sorgsamer Selbstmörder vorher den Kühlschrank ausschaltete.
„Oh. Ja, will ich … Was, Amerika!?“ Mamas Stimme überschlug sich vor Erstaunen. „Aber was will er denn in … Eine Greencard? Nein, oder? Der hat doch mehr Glück als Verstand … das gibt es nicht … Mira?“ Sie hielt die Hand vor den Hörer und sah mich funkelnd an. Die Angst in ihrem Gesicht hatte blankem Zorn Platz gemacht. „Dein Vater ist in die USA abgehauen. Ausgewandert! Dieser Mistkerl … Joe, bist du noch dran? Ja, erzähl …“
Schon hatte sie sich wieder zur Wand gedreht – der altvertraute Anblick; Mama mit dem Handy am Ohr und in ihrer eigenen, hektischen Welt. Erlöst atmete ich aus. Gott sei Dank, Papa lebte. Ich kannte keinen Joe, aber so wie Mama mit ihm sprach, musste er einst ein gemeinsamer Freund von ihr und Papa gewesen sein. Und offensichtlich wusste er ziemlich genau, was wir nicht wussten. Mein Vater war fort, auf einem anderen Kontinent – und das nicht nur für einen Urlaub, sondern für ein neues Leben. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich begriffen hatte, was das bedeutete, und meine Erleichterung verwandelte sich in bittere Enttäuschung.
Warum hatte er mir nicht gesagt, dass er plante, das Land zu verlassen? Ich hatte ihn zwar vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen, als er Freunde in Frankfurt besucht hatte, aber ab und zu hatten wir geschrieben oder telefoniert. Wie konnte er so etwas nur tun – auf die andere Seite des Ozeans auszuwandern, ohne seiner Tochter von diesem Schritt zu erzählen? Es wäre ihm doch ein Leichtes gewesen, Mama und mich zu erreichen, und ich war sein einziges Kind!
Weil Mama Joe mit Fragen bombardierte und ich nicht länger tatenlos und frierend neben ihr herumstehen wollte, schloss ich die Hintertür und begann, die unteren Räume des Hauses zu erkunden – ein großes Wohnzimmer mit Essecke, ein kleiner Flur und ein winziges Gästeklo. Nirgendwo funktionierten die Lichtschalter, doch nach und nach gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit, und die Straßenlaterne zwischen Hof und Nachbarhaus, deren Licht durch die vorderen Fenster fiel, half mir dabei. Das Wohnzimmer hatte einen Kamin; es stand sogar noch Feuerholz daneben. Die Farbe der Couch und der Sessel konnte ich nicht erkennen, aber sie wirkten dunkel und trutzig, genauso wie die schweren Schränke und Regale. Die Luft roch abgestanden, als habe seit Wochen niemand mehr gelüftet. Ich wollte gerade das größte der drei Fenster öffnen, als ein schmaler, dunkler Schatten dahinter auftauchte, der mich zu sich winkte und sofort wieder im Dunkel verschwand.
Misstrauisch blieb ich stehen, ohne das Fenster aus den Augen zu lassen. Für den Nachbarn mit dem Glatzkopf war die Gestalt zu klein gewesen und erst recht für die Männer vom Veterinäramt. Doch andere Menschen hatte ich vorhin nicht gesehen. Papas Hof lag am Ende eines schmalen, von Bäumen gesäumten landwirtschaftlichen Weges und abseits von Strassnitz. Wir hatten nur den Ziegen-Nachbarn. Da, schon wieder!
Für eine Sekunde zeigte sich die Gestalt, winkte mich zu sich und tauchte wieder ab. Dieser Mensch meinte mich – und ganz offensichtlich wollte er nicht, dass meine Mutter von seiner Gegenwart Wind bekam. Mit angehaltenem Atem schlich ich zum Fenster, griff nach oben und drehte den Riegel um. Langsam ließ ich das Fenster aufgleiten, trat aber gleich wieder einen Schritt zurück.
„Hallo?“, wisperte ich in das Rauschen des Regens. „Ist da jemand?“
„Komm mit! Schnell“, flüsterte es prompt zurück.
„Wer ist da?“
Endlich zeigte sich die Gestalt wieder – es war ein Junge mit schlankem, drahtigem Körper, doch sein Gesicht konnte ich nicht sehen, so schnell verbarg er sich wieder an der Hauswand. Ich hatte nur erkennen können, dass er eine Kappe trug und den Kragen seiner Regenjacke weit hochgeschlagen hatte, was mein Vorschussvertrauen in seine Absichten nicht gerade verstärkte.
„Komm einfach mit. Ohne deine Mutter“, drang seine volle, tiefe Stimme leise aus der Dunkelheit.
„Das kann ich nicht!“
„Bitte.“ Er klang nicht bettelnd, sondern entschieden und wissend, und genau diese Forschheit weckte meine Neugierde. „Muss dir was zeigen.“
„Na gut.“ Papa lebte, also konnte das, was er mir zeigen wollte, so schlimm nicht sein, und trotz seiner Wortkargheit wirkte er nicht gefährlich auf mich. „Moment.“ Rasch lief ich zurück zur Küche, wo Mama immer noch telefonierte – dieses Mal jedoch mit ihrer besten Freundin Britta, bei der sie sich regelmäßig ausheulte, wenn sie im Stress erstickte. Das konnte dauern. Unter einer Stunde kam Britta nicht weg. „Mama, ich sehe mich mal draußen um, okay?“
Sie nickte, um mir zu bedeuten, dass sie einverstanden und ich frei war, zu gehen. Ich verließ das Haus durch die Hintertür und trabte durch den nachlassenden Regen zur Fensterseite des Wohnzimmers, wo der fremde Junge mit den Händen in den Hosentaschen auf mich wartete. Ich schätzte ihn auf etwas älter als ich, und seinen Gummistiefeln und den khakifarbenen Hosen nach zu schließen, konnte er nur der Sohn des Mannes mit dem starken Akzent sein, der vorhin die Ziegen eingesammelt hatte. Aus feiner Garderobe machten die beiden sich nichts, doch mit meinen verschlammten Hosen durfte ich heute keine Ansprüche stellen.
„Hier bin ich“, verkündete ich leise.
Er nickte nur kurz und marschierte mir voraus dem größeren der beiden Schuppen entgegen, die auf der anderen Seite des Hofes errichtet worden waren. Sie wirkten schief und baufällig, als könnten sie beim nächsten stärkeren Windstoß in sich zusammenfallen.
„Wohin gehen wir?“, rief ich ihm hinterher.
Mit einem „Pscht!“ bedeutete er mir, dass Sprechen nicht erwünscht war, und umrundete den Schuppen, um auf seiner dem Feld zugewandten Seite ein paar schwere Balken von der Holztür zu nehmen und sie aufzuschieben. Er brauchte seine ganze Kraft, um sie zu bewegen, doch schließlich gab sie knarzend nach.
„Hier“, vermeldete er knapp.
„Ich kann nichts sehen!“ Vor mir breitete sich pure Dunkelheit aus und einen Moment lang bekam ich Angst, er würde mich in die Finsternis stoßen und hier einsperren. Doch dann roch ich plötzlich etwas – und vor allem spürte ich etwas und es zog mich magisch in das Innere des Schuppens. Hier drinnen wartete ein Wesen auf mich, groß und lebendig. Es atmete; schwer, langsam, geplagt. Die Wärme seines Fells legte sich sanft auf meine nassen, kalten Wangen und für eine Sekunde glaubte ich, das Glitzern seiner Augen aus der Dunkelheit aufschimmern zu sehen.
Der Junge schloss langsam das Tor hinter uns. Nur einen Sekundenbruchteil später erleuchtete der helle Schein einer Taschenlampe den Schuppen.
„Oh Gott …“ Mit einem leisen Keuchen drückte ich meine Hände gegen meine Brust. Direkt vor unseren Füßen lag ein Pferd im verdreckten Stroh, die Vorderläufe steif von sich gestreckt, der Kopf flach auf dem Boden, während seine dunklen, großen Augen wachsam zu uns aufblickten. Sein Fell war so schmutzig, dass ich seine Zeichnung nicht genau erkennen konnte; doch es musste gefleckt sein, dunkel und hell. Die schwarz-weiße Mähne des Tieres, in der sich etliche Strohhalme verfangen hatten, fiel lang und weich über seinen kräftigen Hals und sein Bauch hob sich angestrengt im Rhythmus seines Atems. Irgendetwas stimmte mit ihm nicht; ich wusste es sofort. Dieses Pferd musste höllische Schmerzen haben.
„Die haben sie nicht gefunden.“
„Die?“, hakte ich mit brüchiger Stimme nach, während ich mich vorsichtig niederkniete. Es war mir egal, dass meine Beine dabei im Mist landeten. Ich musste diesem Pferd auf Augenhöhe begegnen, auch wenn ich noch nie zuvor in meinem Leben mit Pferden zu tun gehabt hatte und nicht wusste, wie ich mit ihnen umgehen musste. Doch dieses Tier zog mich magisch an, trotz seines schmutzigen Fells und des Gestanks nach Mist und Urin, das es umgab.
„Bonnie. Is’ eine Sie“, antwortete der Junge schleppend. „War der Liebling deines Vaters.“
„Sein Liebling? Ja?“ Jetzt klang ich genauso zornig wie Mama. „Das war ich angeblich auch mal gewesen. Macht ihm wohl großen Spaß, seine Lieblinge zu vergessen und im Stich zu lassen.“ Der Junge reagierte nicht auf meine Worte, blieb aber neben mir stehen, sodass ich einfach weiterredete – ich konnte gar nicht anders. „Mein Vater ist ausgewandert. In die USA. Er ist weg, für immer, verstehst du?“
„Ja“, antwortete er schlicht. „Verstehe ich. Sind wir auch. Aus der Ukraine hierher.“
„Das ist etwas anderes“, widersprach ich brüsk. „Er hatte keine Not.“