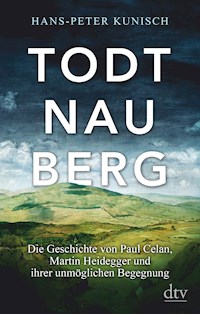19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine unbekannte Freundschaft des großen Preußenkönigs Albert von Hoditz war ein Genießer und Lebensreformer, der sein Schloss an der umkämpften Grenze zwischen Österreich und Preußen zu einem »Arkadien in Mähren« machen wollte. Seine Untertanen sollten Künstler werden. Auch Friedrich der Große wurde auf Hoditz aufmerksam. Für Friedrich bedeutete dessen freie Existenz in Rosswald, das er zweimal besuchte, die Erinnerung an ein verpasstes eigenes Leben. Legendär ist ein Freiluftschachspiel der beiden mit »lebenden Figuren«. Friedrichs Beziehung zu Hoditz, auf den er zwei Gedichte schrieb, stellt den strengen, pflichtbewussten König, den der "exzentrische Epikureer" Hoditz auch in seinen orientalischen Harem führte, in ein neues Licht und dürfte auch Kenner überraschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Freigeist und Philosoph, Kriegstreiber und Friedensgraf, Preuße und Österreicher – eine außergewöhnliche Freundschaft vor dem Hintergrund des Siebenjährigen Krieges
Albert von Hoditz war ein Genießer und Lebensreformer, der sein Schloss an der umkämpften Grenze zwischen Österreich und Preußen zu einem »Arkadien in Mähren« machen wollte. Seine Untertanen sollten Künstler werden. Auch Friedrich der Große wurde auf Hoditz aufmerksam. Für Friedrich bedeutete dessen freie Existenz in Rosswald, das er zweimal besuchte, die Erinnerung an ein verpasstes eigenes Leben, das er in Hoditz noch einmal wie in einem Spiegel sah. Immer wieder wollte er ihn nach Potsdam holen, aber Hoditz beharrte auf seiner Eigenständigkeit. Legendär ist ein Freiluftschachspiel der beiden mit »lebenden Figuren«. Friedrichs Beziehung zu Hoditz, auf den er zwei Gedichte schrieb, stellt den alten, schlauen, aber in sich vergrabenen König, den der »exzentrische Epikureer« Hoditz auch in seinen orientalischen Harem führte, in ein neues Licht und wird auch Kenner überraschen.
Hans-Peter Kunisch
Schach dem König
Friedrich der Große und Albert von Hoditz.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
1 Achtundsechzig Räume, ein Kriegstreiber und der Friedensgraf. Der preußische König trifft auf einen mährischen Epikureer
2 »Der große Pan meiner Schäferey«. Mitten im Krieg am Rand – Rosswald im Frühling und Sommer 1758
3 Inkognito – ein offensichtliches Geheimnis. Und über ein paar Schwierigkeiten mit Quellen und Legenden aus dem 18. Jahrhundert
4 Wer ist dieser Hoditz? Berichte von der mährischen Grenze – wilde Zügellosigkeit, Feste, Gärten und sokratische Abendmahle. Maria Theresia und Tiresias
5 Der Werdegang eines Zauberers. Leibniz, Osiris und Isis. Auf den Spuren von Büchern. Das »Mémorial d’un mondain«
6 »Aber a propos was ist galant und ein galanter Mensch?« Der Weg nach Liegnitz und zum Lac de l’indifférence – oder: was ist eine »Ritterakademie« und was hat Albert von Hoditz dort getan?
7 Sophie von Sachsen-Weißenfels – Messalina, Lais oder fromm? Die Liebe zu einer Prinzessin und Skandalfrau des 18. Jahrhunderts. Ein Hut und die Heirat der Punker
8 Friedrich und Hoditz als Freimaurer, der Rat des Papstes, ein exzentrischer Bischof
9 Freude, Intensität und Melancholie. Ein Leben wie Watteau
10 Ich bin in eine Verwunderung geraten. Rosswald – Theater mit Leibeigenen und Bauern
11 Parallele Bewegungen: Übersee und Europa nach dem Krieg. Graf Hoditz, Friedrich II. und der neue Kaiser Joseph II. auf dem Weg nach Neiße. Die Klimakatastrophe setzt Rosswald zu
12 »Ich werde nach Rosswald kommen, mein lieber Graf, und ich werde Sie bewundern, wie die Königin von Saba die Weisheit von Salomo bewunderte, und vor allem seinen Serail«
13 Friedrich mit Nymphen und Tritonen im Garten der Verwandlungen. Erzählungen, Legenden und Berichte aus Rosswald
14 O singulier Hoditz! Friedrich im Serail von Rosswald. Das erste Gedicht auf Albert von Hoditz
15 Schach dem König – Das Kriegsspiel als Lehre der Liebe? Eine Erzählung und Anmerkungen zu einer Mode des 18. Jahrhunderts
16 Freiheit für den armen Fritz – oder: »Sie muss coquette sein«. Zum Paradigmenwechsel in der Einschätzung des Privatlebens Friedrichs des Großen. Eine Revue der Meinungen und Quellen
17 Ich bin noch ganz bezaubert. Der Nachhall von Friedrichs Besuch in Rosswald und die erste Zeit von Hoditz in Sanssouci (1770/71)
18 »Je vous ai vu / Ich habe Sie gesehen«
19 Die Flucht. In Glogau warten Tausende auf einen Kaffenkahn. Von Breslau nach Potsdam auf Oder und Havel. Erzählungen und Überlegungen
20 Die zweite Zeit in Sanssouci – ein langer, souveräner Brief voller Sorgen
21 Danach. Die letzte Reise des Albert von Hoditz und ein Testament
Dank
Literaturverzeichnis (Auswahl)
Literatur zu Albert von Hoditz
Literatur zu Friedrich dem Großen
Literatur zum zeit-, kultur- und geistesgeschichtlichen Hintergrund
Personenregister
Für Martin Kunisch (1705–1785) aus Große bei Rosswald, von dem ich gerne gewusst hätte, was er von Albert von Hoditz und Friedrich II. gehalten hat.
»Ich werde nach Rosswald kommen, mein lieber Graf, und ich werde Sie bewundern, wie die Königin von Saba die Weisheit von Salomo bewunderte, und vor allem seinen Serail.«
(22.7.1770)
1Achtundsechzig Räume, ein Kriegstreiber und der Friedensgraf. Der preußische König trifft auf einen mährischen Epikureer
Ein Mann mit einer hellblau leuchtenden Kappe auf dem Kopf, ein dunkelgrüner Traktor, ein altes Auto. Eine Stunde lang nichts. Auf einer Ebene glühende Rapsfelder. Dazwischen lässt sich, im Schatten einer kleinen, alten Allee, auf einer schmalen Landstraße gut gehen.
Kein Mensch. Ein bisschen Wind. Dann sanfte Hügel, grüne Wiesen, dichter Wald. Eine abgehängte Gegend, rechts und links einer hundertzwanzig Jahre alten Schmalspurbahn, die alle vier Stunden lärmend den ruhigen Traum der Landschaft durchpflügt: ein Triebwagen, ein Wagen. Gemeinsam mit ein paar Bussen bestreiten sie den öffentlichen Verkehr. Die Dörfer, an deren Rand sie halten, sind beinahe aufgegeben. Ältere Leute, die nicht mehr wegwollen, und ein paar Familien bleiben.
Eine lange, schmale Straße führt zu kleinen grauen Häusern, die um einen großen, staubigen Platz gruppiert sind. Eine Kneipe gibt es, ein schmales Häuschen, auf dem Česká Pošta steht, ein Lebensmittelgeschäft, eine kleine Pension. Als ich zum ersten Mal in der Gegend bin, sind alle geschlossen.
Hier war wohl der Markt. Irgendwann muss Betrieb gewesen sein, Lachen, Düfte, Geschrei. Doch was die grauen Häuschen heute besonders bedauernswert erscheinen lässt, ist ihr Gegenüber auf der anderen Seite des Platzes, schräg nach hinten versetzt: ein Schloss, vanille- bis goldbraun, »kaisergelb« sagte man dazu. Es hat die Form eines prachtvollen, übergroßen Renaissance-Landhauses. Eine Anlage, als könne es Armut nicht geben. Dahinter ein weitläufiger Park.
Aber auch am Schloss, das immer mal wieder umgebaut wurde, wie man auf einem Informationsschild lesen kann, scheint bei genauerem Hinschauen alles zu bröckeln. Die routiniert präsentierten Öffnungszeiten gelten nicht mehr. Gründe dafür sind nirgends zu erfahren.
Slezské Rudoltice/Rosswald. An einem der abgelegensten Orte Mitteleuropas, abseits aller bekannten Straßen, irgendwo zwischen Kattowitz und Olmütz, an der tschechisch-polnischen Grenze, steht auf einmal ein kleines Versailles.
Wie kam dieser mächtige Stein hierher? Durch die Luft, mit großem Segel? Gab es für Schlösser eigene Wege? Die kleine Bahn hier fuhr damals noch lange nicht. Achtundsechzig Räume sollen es einmal gewesen sein. Nach einem Brand im Dachgeschoss, vor mehr als zweihundert Jahren, sind es heute noch siebenundvierzig. Ein EU-Schild steht neben dem Gemäuer, auch es schon verblichen.
Auf der Informationstafel heißt es, hier seien Friedrich der Große, Voltaire und Kaiser Joseph II. zu Gast gewesen. Wie? Muss man sich Kutschen mit edlen Pferden und großem Gefolge vorstellen? Damen in Reifröcken, schneidige Generäle? Hier? Was haben sie hier gesucht?
Wochen später der Blick ins Netz. Irgendwann gibt Herr Kravar, ein Archivar aus Opava, das einmal Troppau hieß, den Hinweis, dass Herr Bernert aus Kassel, der noch in Troppau geboren worden sei, viel von dem Thema verstehe. Herr Bernert ist Mitte achtzig, hellwach, ein Meister im Digitalisieren historischer Texte. Er hat einen Scanner, der Tschechisch lesen kann, und gibt mir die Adresse von Herrn Sondermann, einem Professor in Kyoto, dessen angenehm genaue Aufsätze mir schon begegnet sind. Beide interessieren sich seit Jahren für den Schlossherrn, schicken Kopien und Fotos von Dokumenten, geben Hinweise, beantworten Fragen. Es gibt einige: Wer war dieser Mann: ein mehr oder weniger universal begabter junger Graf, der eine viel ältere Fürstin ehelicht, um später zusammen mit jugendlichen Dorfschönheiten im Sommer als Schäfer zu leben? Ein »Einsiedler«, der opulente Feste für Arme und Reiche organisiert, aber Besucher, die er nicht leiden kann, mit Affenmasken vertreibt? Ein bücherverliebter Aufklärer, ein Frauenliebling, ein Alchimist? Ein Friedensgraf, der sich aus allen militärischen Konflikten der Zeit heraushält und sich trotzdem mit Friedrich dem Großen gut versteht?
Zu Albert Reichsgraf von Hoditz, der 1706 in Rosswald geboren wurde, seine letzten beiden Jahre in Potsdam verlebte und 1778 dort starb, gibt es viele, sich oft widersprechende Geschichten. Und sehr verschiedene Bilder. Das erste Porträt, das mir begegnet, ein Stahlstich eines namenlosen zeitgenössischen Künstlers, zeigt Hoditz mit einer typisch kurzen weißen Perücke aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Im einfachen Ornat eines Adeligen, dem es nicht schlecht zu gehen scheint. Aber viel wichtiger ist der neugierige Blick des genauen Zuhörers. Der Mund, über den der Hauch eines freundlich-spöttischen, schelmisch-besorgten Lächelns zieht.
Ich fahre noch mal nach Rosswald, stehe wieder vor dem verschlossenen Tor, und es wird bis zum dritten Besuch dauern, ehe mir Tomáš Zemba öffnet und vor Ort von der Geschichte des erstaunlichen Reichsgrafen erzählt. Tomáš, ein Mann um die fünfzig, der früher im Ort Polizist war und jetzt den Titel Kastellan trägt, der ihm noch immer nicht viel einbringt, führt mich durch die Säle des Schlosses und den dazugehörigen Park, als wäre er im 18. Jahrhundert dabei gewesen. Wenn man etwas genauer nachfragt, deutet er an, dass er als Kind miterlebt habe, wie das, was hier nach dem Zweiten Weltkrieg übrig blieb, bis in die 1970er Jahre hinein weiter zerstört wurde. Der Kopf sei da schon abgeschlagen gewesen. Der Kopf? Eine wunderbare Statue, er, Tomáš, sei als Kind noch über ihr herumgehüpft. Von Hoditz selbst in Auftrag gegeben, habe ein unbekannter Künstler sie für ihn geschaffen. Er zeigt mir ein altes Foto: Hoditz als Liegender, auf seinem Rasen entspannt-verzückt in die Natur versunken. Ob ich es schon gesehen habe? Eines Tages seien auch die Bruchstücke der Statue verschwunden. Er habe alles versucht, sie wiederzufinden. Vor ein paar Jahren dann habe er begonnen, sich um die Renovierung des Schlosses zu kümmern, das der Gemeinde gehöre. Jetzt habe er ab und zu Hilfe. Er wolle etwas wiedergutmachen.
Und ja: Die zweiundzwanzig Jahre ältere »Femme fatale« des Schlosses, die Prinzessin, habe als lustige Witwe eines ungebärdigen Onkels von Friedrich für den späteren Schlossherrn von Rosswald, der damals nur ein vom Vater verstoßener Sohn war, alles stehen und liegen lassen und ihn über Nacht in einem Wirtshaus geheiratet. Eine dreifache Mesalliance! Zwischen einer Fürstin und einem einfachen Adeligen, einer älteren Frau und einem jungen Mann, einer Protestantin und einem Katholiken.
Je mehr ich von der Geschichte hörte, desto mehr will ich wissen: von diesem schillernden mährischen Grafen, seinem Schloss und der Kunstrepublik, die er mit seinen Leibeigenen aufzog, von der Beziehung zu seinem Freund, dem noch heute berühmtesten und umstrittensten König, den Preußen und Deutschland hervorgebracht haben.
Über Friedrich, diesen Flötenspieler und Kriegstreiber, glauben viele Bescheid zu wissen: Das bürgerliche 19. Jahrhundert verehrt ihn als Staatsdiener, Realpolitiker und Philosophen. Die Nazis spannen ihn als Durchhaltefeldherrn, der selbst nach erbärmlichsten Niederlagen wieder hochkam, vor ihre schlingernde Kriegskutsche, und noch heute spaltet Friedrich die Menschen in Bewunderer und giftige Kritiker, gilt als intelligent und feinsinnig, zugleich als rücksichtslos, brutal und verschlagen, als vom Vater unterdrückter Pagenliebhaber und opportunistischer Menschenverächter. Oder war er doch auch ein treusorgender Landesvater mit beeindruckend weit gespannten Interessen?
Was verbindet Albert von Hoditz und Friedrich den Großen, diese zwei so unterschiedlichen Männer? Der allseits bekannte Friedrich hat Hoditz, den heute kaum einer mehr kennt, als »einzigartig« verehrt und ihm die Treue gehalten; hat ihn nie, wie die meisten seiner ehemaligen Freunde, in die Wüste geschickt oder in ein Gefängnis gesteckt; hat ihn, als der einst gefeierte Exzentriker Hoditz am Ende bankrott, verhasst und krank war, per luxuriös ausgebautem Oderkahn zu sich nach Potsdam geholt und ihn damit vor der Verfolgung der Gläubiger gerettet.
Warum? Kaum einer konnte es dem ungeduldigen, launischen Preußenkönig auf Dauer recht machen. Selbst Voltaire nicht, dessen Nähe Friedrich anfangs beinahe unterwürfig suchte. Was band den ruhmsüchtigen deutschen Geopolitiker, der ganze Landstriche ins Unglück stürzte, weil er behauptete, sie seien vor Hunderten von Jahren seinen Vorfahren versprochen worden, an einen habsburgischen Reichsgrafen, der sich schon mit fünfunddreißig Jahren aufs ererbte Schloss zurückzog, um mit Leibeigenen und Bauern Theater zu spielen, sich selbst als »Maler, Bildhauer, Chemiker, Mechaniker, Vergolder, Musiker und Dichter« für die Ausbildung seiner Leute einzusetzen, statt sie auf den Feldern zu verbrauchen?
Das erste Mal besucht der preußische Herrscher den österreichischen Grafen kurz und inkognito, mitten im Siebenjährigen Krieg; für den zweiten, mehrtägigen Besuch arrangiert Hoditz ein legendäres Fest, die beiden spielen eine Partie Schach mit Lebendfiguren und Hoditz führt Friedrich in seinen Serail. Wovon Friedrich in einer langen, den Grafen, sein Fest und seinen Harem feiernden »Epistel« erzählt.
Was konnte der feinsinnige Frauenfeind Friedrich mit den orientalisierten Dorfschönen des Grafen anfangen? Warum wurde das briefähnliche Gedicht in der maßgeblichen deutschen Werkausgabe gekürzt und der Alte Fritz zum zensierten König gemacht?
»Im 18. Jahrhundert ….« – das meint vor der Französischen Revolution. Eine auf kaum mehr vorstellbare Weise zur Schau gestellte Distanz zwischen Arm und Reich war die Regel. Die absolutistische Fürstenherrschaft wankte, aber noch hielt sie. Immerhin klingt die Zeit schon einigermaßen erschließbar. Dokumente wurden, wenn sie Fürsten von europäischem Ansehen betrafen, in der Regel aufbewahrt. Doch je mehr man erfährt, desto klarer wird, wie wenig wir wissen. Vor allem von Lebensgeschichten, die sich abseits der Heerstraßen zutrugen, in der Provinz, bei den »kleinen Leuten«. Manche der Menschen, die man da antrifft, haben gerade mal einen Satz hinterlassen oder ein Detail ihres Lebens wird von jemand anders erzählt. Von Martin Kunisch, der sechs Jahre älter wurde als der »alte Fritz«, weiß ich sonst nur, dass er Bauer war, dass er in Haus Nr. 23 geboren wurde, dass Freiherr Wolfgang von Friedenthal sein Taufpate war, und dass er am 14. November 1731 eine Rosalia Schäfer heiratete.
Und was macht man, wenn von den Briefen von Albert von Hoditz an Friedrich die meisten bei einem Brand im Haus des letzten Sekretärs von Hoditz verloren gegangen sind? Auch im Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem sind sie nicht aufzufinden. Ähnlich wie die Briefe Prinz Heinrichs an Bruder Friedrich. Von Friedrichs Briefen hingegen finden sich auch im Falle von Hoditz beinahe alle in Dahlem. Dabei scheint vor allem Hoditz am schriftlichen Austausch interessiert, während Friedrich den Grafen, den er »Philosoph« nennt – in seinen Augen der höchste Adelstitel, den er gerne auch sich selbst zusprach –, immer persönlich sehen wollte, immer wieder Besuche in Potsdam anregt. Hoditz hält sich zurück, bis es nicht mehr anders geht, und doch hört die Beziehung nicht auf. Warum?
Neben dem Spiegel der Briefe des Königs gewinnt das Vexierbild des von ihm umworbenen Grafen durch andere Dokumente an Klarheit. Es gibt Gedichte von Hoditz, einen Essay über den Adel, eine juristische Doktorarbeit, philosophische Merksprüche, Briefe an Verwandte und Förderer, schriftliche Festordnungen, zeitgenössische Berichte von Dritten, einen Katalog seiner Bibliothek, Akten, in denen die skandalöse Ehe auftaucht. Alle Spuren gehören dazu, jeder Splitter Wirklichkeit in alten Handschriften. Mal geben die Quellen, Berichte und Legenden, die sich vom 18. bis ins 20. Jahrhundert um das Leben des »mährischen Epikureers« und seines staatstragenden Freundes ranken, Anlass zu einer Erzählung, die alle verfügbaren Fakten aufnimmt. Und darüber hinaus die Möglichkeit schafft, auch eine Ahnung vom Leben der »unteren Stände« zu vermitteln. Ein andermal ist es sinnvoller, die dürre oder widerspruchsvolle Forschungslage gesondert zu präsentieren, verbrieftes Wissen und Erzählung nebeneinanderzustellen.
Gemeinsam bilden die unterschiedlichen Perspektiven den Versuch, zwei außergewöhnliche Individuen, eine überraschende Freundschaft und, über sie, eine lange vergangene Zeit für heute neu zu verstehen. Kein Bild wurde beibehalten, dem irgendein Dokument widerspräche. Ohne Quellen wären die Erzählungen nichts. Zusammen führen sie uns mehr als zweihundertfünfzig Jahre zurück, in eine oft phantastisch wirkende, wirkliche Welt.
2»Der große Pan meiner Schäferey«. Mitten im Krieg am Rand – Rosswald im Frühling und Sommer 1758
Im Park, nahe einer alten, brüchigen Mauer. Wieder einmal denkt der große, kräftige Mann, der in ihrem Schatten steht, dass sie ihm so sehr gefällt, dass er sie nicht abreißen lassen kann. Zusammen mit dem wilden Wein, der sie überwuchert, passt sie zu gut zu der bizarren Szene, die er gerade beobachtet. Hinter der mächtigen alten Linde, nur ein paar Meter entfernt, jagt eine Art Ritter eine Nymphe, die sich in einen der Arme des breiten Bachs zu retten versucht, der den Schlosspark über drei, vier Kanäle in langen Bögen durchzieht und sich zu kleinen Seen weitet. Die Nymphe trägt einen leichten, beinahe durchsichtigen Phantasieumhang mit etwas unbeholfenen Chinoiserien. Das Wasser spritzt auf. Es muss noch sehr frisch sein. Albert von Hoditz schüttelt sich. Brigitta ist eines der launischsten, ihm liebsten Dorfmädchen. Sie spielt gut. Sie redet gescheit. Sie soll, zusammen mit Max, dem leicht humpelnden Ritter, einem etwas älteren Dorfburschen, der gerade an einer Wurzel hängen geblieben ist, in einem Sommernachtstraum auftreten, den Hoditz geschrieben hat. Aber ob die Proben noch Sinn machen? Ob es alles, was er hier sieht, im Sommer noch geben wird: ihn selbst, Schloss Rosswald, das man immer öfter »Feensitz« nennt, und Gäste, die weit reisen, um sich sein Leben anzuschauen?
Der Ritter steht in seiner blechernen Rüstung schwer atmend am Ufer des Bachs, das Mädchen schwimmt lachend davon.
Aber so sehr Albert von Hoditz sich anstrengt, nicht an die Welt hinter den Mauern von Park und Schloss zu denken: Es ist ihm nicht wohl dabei. Vorgestern hat er in einem Zimmer des oberen Stockwerks aus dem Fenster geschaut. Plötzlich waren da auf den sanften Hügeln preußische Truppen, schwarz-weiße Fahnen und blaue Uniformen. Auf der Kuppe, die er von seinem Zimmer aus sehen kann, hielten kurz ein paar Reiter. Zwei Minuten nur. Dann war über eine Stunde ruhige Bewegung, Husaren, Fußvolk, Verpflegung zogen vorbei.
Hoditz, dem der weite Umhang, die Hakennase und die dunklen Locken gerade das Aussehen eines Reiterfürsten geben, hat sie mit den Augen verfolgt, ohne sich von der Stelle zu rühren. Im ganzen Schloss veränderte sich nichts. Das Leben summte in seinen gewöhnlichen, ruhigen Tönen. Helle und dunklere Stimmen, alte, quietschende Türen, zwei Katzen. Erst als einige der Preußen, etwa hundert Meter vom Schloss entfernt, sich in seine Richtung bewegten, wurde es stiller. Hatte jemand im unteren Stockwerk etwas gesehen? War eine Dienstmagd vom Dorf herübergekommen und hatte etwas erzählt? Kein Ton war zu hören. Als könnten alle, die jetzt mit ihrem Herrn zusammen still waren, ihr Schicksal gerade noch selbst bestimmen.
Dann zogen die Truppen weiter in Richtung Troppau.
Nur ganz sachte haben sie Rosswald diesmal gestreift, aber es hat gereicht. Albert von Hoditz hat wieder gemerkt: Es ist Krieg, und zwar einer, der viel Blut kostet. Noch weiß niemand, wie lange das Schlachten dauern wird, aber wir sind schon im dritten Jahr.
Im Januar hatte Preußen die Gegend um Rosswald besetzt. Nach über zehn Jahren Waffenruhe war das Schloss wieder von einer Welt umgeben, die Hoditz nur noch in kleinen Dosierungen zu sich lassen wollte, nachdem er sie eine Zeit lang sehnsüchtig gesucht hatte. Mit dem Erbe seiner Mutter war er in Italien auf Kavalierstour gewesen, sein Vater, der seine Launen nie ausgehalten hatte, hatte ihn weggeschickt. Hoditz hatte Unsinn getrieben und Geld verschwendet. Der Vater hatte ihm Rosswald verboten, doch Anfang Juli 1741 war er gestorben. Hoditz musste das Schloss übernehmen, mitten im Ersten Schlesischen Krieg.
Schon damals ist Albert klar geworden, dass die idyllischen Hügel und Wälder hier nicht die ganze Geschichte der Gegend erzählen. Ein Ort in Österreichisch-Schlesien, direkt an der preußischen Grenze, das roch nach Pulver und Blei, hörte sich an wie Kanonendonner, gespaltene Zungen.
Hoditz hat beschlossen, sich danach zu richten. Er hat durchaus Sympathien für den Aufklärer Friedrich, von dem er schon viel gehört hat, aber er ist Untertan der katholischen Kaiserin. Er muss versuchen, keine Unterschiede sehen zu lassen. Ja, Albert hat preußische wie österreichische Generäle versorgt, von Drašković bis zu Zieten, der im Zweiten Schlesischen Krieg zu ihm kam. Militärs beider Seiten haben bei ihm gegessen, getrunken, gespielt.
Der Theatermann und Reiseschriftsteller Johann Christoph Kaffka – 1754 in Regensburg geboren, 1815 in Riga gestorben – hat Hoditz’ notgedrungen geschicktes Agieren in einer politischen Zwickmühle schön auf den Begriff gebracht: Hoditz, schreibt Kaffka, glich »jenem verschlagenen Einsiedler, der der kleinen Insel Lampadouse auf dem mittelländischen Meer den Namen gegeben hat, weil er, wenn ein christliches Schiff landete, das Kreuz, und wenn ein türkisches ankam, den halben Mond auf seine kleine Kapelle steckte, und von beiden geehrt und beschenkt wurde«.
Aber ganz recht hat Kaffka nicht. Hoditz versteckte nichts. Im Park standen Madonnen für Maria Theresia und Pyramiden für Friedrich nebeneinander. Hoditz vertrat eine Utopie der friedlichen Koexistenz, die keiner der beiden Seiten recht gab.
Doch jetzt macht die große Truppenbewegung, die Hoditz vor zwei Tagen beobachtet hat, den Anschein, als sei es dem Preußenkönig, achtzehn Jahre nach seinem ersten Vorstoß gegen die junge österreichische Kaiserin, ernst mit dem Marsch auf Wien. Diese Soldaten hätten über ihn und seine Leute herfallen können, nebenbei, ohne Aufhebens.
Sie sind weitergezogen, hatten keine Zeit. Hoditz hat nur stillgehalten. Auch das ist ihm schwergefallen. Manchmal merkt er, dass es ihn wieder reizt, beim größeren Spiel mitzumachen. Er hat sich überlegt, zu den Soldaten zu reiten. Vielleicht kannte er den befehlenden General noch? Und was war mit dem obersten Kriegsherrn? Sie waren doch verwandt oder waren es wenigstens gewesen. Wenn Sophie noch lebte, wäre alles einfacher. Friedrich war ihr viel berühmterer, viel mächtigerer Neffe.
Aber ob er die Flucht seiner Tante gebilligt hatte, diese Unglücksheirat mit einem einfachen katholischen Grafen bei Nacht und Nebel in einem fränkischen Gasthof? Hoditz wusste wie alle Welt: Auch Friedrich hatte eine Flucht hinter sich. Auch der Kronprinz hatte fliehen wollen, nach London, vor der Brutalität des rabiaten Vaters, mit zwei Freunden. Friedrich habe, so hieß es, schon bei der Einigung um Sophies Witwenrente Ende der 1730er Jahre auf der Seite von Sophie und Hoditz gestanden.
Doch war das mehr als nur ein Gerücht? Auch Friedrich musste die Freiheit lieben. Aber vielleicht nur die eigene? Wahrscheinlich war es besser, jede Einmischung zu vermeiden. Hoditz, der jedes Spektakel genießt, wird dieses abgelegene Schloss und seinen Park zu einem Ort machen, über den von Berlin bis Paris gesprochen wird. Aber es gibt bessere Gelegenheiten aufzufallen, als um sich zu schlagen.
An der Ritterakademie in Liegnitz hat Hoditz Sprachen, Tanzen und Fechten gelernt, aber auch mit neunzehn Jahren als Jurist promoviert: »De jure militari« hat er die »Dissertatio polemico-iuridica« genannt. Militärrecht klingt nach starrer Ordnung, aber das Motto, das er in seinem Vorwort an den Gönner der Akademie versteckt hat, war gegen den Strich gewählt: »Wir wissen ja von den Philosophen, Prinz, dass wir ohne Wissen nicht sein könnten. Kriege braucht die Welt nicht.« Das war, in all den notorischen Höflichkeitsfloskeln der Zeit verborgen, eine unverschämte Forderung nach dem Ende der Gewalt.
Hoditz hat keine Ahnung, wem er die Schonung diesmal zu verdanken hat: unglaublichem Glück, der Eile der Truppe, dem Zufall? Oder Isidor, seinem jüngeren Bruder, der lange wie zu einem Vorbild zu ihm aufgesehen hatte und selbst ein Grenzgänger war; der als habsburgischer Offizier zum Rittmeister der Armee Friedrichs geworden war und schließlich das 6. preußische Husarenregiment geführt hatte?
Aber Isidor war das Kommando schon nach zwei Jahren wieder entzogen worden. Monatelang haben sie ihn im Brünner Spielberg-Kerker angekettet. Hat er wirklich Geld unterschlagen, die dreitausendachthundertvierzehn Taler, die nach seinem Abgang in der Regimentskasse fehlten?
Sieht er jetzt beinahe nichts mehr, weil er dort geblendet wurde? Hat Isidor es nur dem Verlust seines Augenlichts zu verdanken, dass Friedrich ihn wieder laufen ließ? Der Hitzkopf hat nichts erzählt, zu allem geschwiegen. Jetzt ist er selbst beinahe nichts mehr. Manche schreiben sein Leben schon Albert zu, weil es Isidor nicht mehr gibt. Der einst lebenslustige blinde Bruder hört der Weltgeschichte nur noch zu.
Der Siebenjährige Krieg ist der erste, der mehrere Kontinente umfasst. Frankreich und England sorgen seit 1755 dafür, dass es auch der erste Weltkrieg wird. Es geht um die Vorherrschaft in Amerika und Indien. Um Handelswege, um Gold und Silber, um Sklaven. Zuerst bringen die Briten Verstärkung nach Übersee, dann die Franzosen. Auf beiden Seiten gebiert der Kolonialismus auch Helfershelfer unter den Kolonisierten: Indianer, die noch nicht beseitigt wurden, lassen sich anstiften oder werden gezwungen mitzumachen. Aber sie bringen ihre eigenen Regeln mit. Entsetzt beobachten Weiße das Skalpieren getöteter Gegner, sprechen in vollendeter Doppelmoral von den »Massakern« der von ihnen für eigene Zwecke eingespannten »Wilden«.
Friedrich der Große mischt sich da nicht ein. Er versucht auszunützen, dass Engländer wie Franzosen in Übersee beschäftigt sind und in Europa Allianzen brauchen. In seiner eigenen Darstellung des Siebenjährigen Kriegs wird er die Gründe für den Kolonialkrieg als »Grenzfragen in Kanada« abtun. Er hat ganz andere Pläne. Der König muss sein kleines, sandiges Land erweitern, um bedeutend zu wirken. Seit er die Regierungsgeschäfte bestimmt, ist das fruchtbare Schlesien sein erstes Ziel. 1740 ist er, nach dem Tod seines Vaters und des österreichischen Kaisers Karl VI., ein erstes Mal dort eingefallen, und der Sieg im Zweiten Schlesischen Krieg hat ihn in Europa zum Vielbestaunten gemacht.
Auch diesmal will er weiter Richtung Osten. Anfang 1756 bringt die Londoner Westminster-Konvention die Engländer auf seine Seite, was das noch immer viel kleinere Preußen in die Lage versetzt, die auseinanderdriftende Großmacht Österreich-Ungarn erneut herauszufordern.
Auch in der Frage der »Kriegskunst« markiert »The Great War for the Empire«, wie ihn die Engländer nennen, eine Zeitenwende. Die Kampfpraxis der Indianer schockiert die Generäle der englischen und französischen Truppen auch, weil sie militärische Auseinandersetzungen schon länger als Strategiespiel verstehen, ohne sich um die Opfer unter den Soldaten zu kümmern. Mit seiner Schachbrettrationalität hat der Kabinettskrieg den mittelalterlichen Fanatismus der Kreuzzüge und die religiösen Schlachtereien des Dreißigjährigen Kriegs als Modell organisierter Gewalt abgelöst. Die neuen Bündnisse haben kaum etwas mit Erbfeindschaften und Ähnlichem zu tun. Sie werden oft nur nach strategischem oder gar taktischem Augenblicksnutzen gebildet. Friedensverträge werden ebenfalls nur für ein paar Jahre geschlossen. Der sportliche Respekt vor dem Gegner gilt als wichtiger Bestandteil militärischer Fairness. Nicht nur Isidor von Hoditz, auch Generäle dienen im Lauf ihres Lebens mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Die feindlichen Truppen haben den »eigenen« in der Regel nichts angetan, was »gerächt« werden müsste. Auch wenn Friedrich immer wieder davon spricht, für »Preußen« zu kämpfen oder Opfer zu bringen, meint er damit noch nicht die sich abschottende »Nation« des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der »Nationalismus«, der der »romantischen« Entdeckung des »Volkes« folgen wird und seine Gespenster bis ins 21. Jahrhundert schickt, ist noch nicht stilbildend.
Wohlgefällig wird ein Henri de Catt aus Morges am Genfer See, der gerade in Breslau als Begleiter zu Friedrich gestoßen ist und für zweiundzwanzig Jahre sein Vorleser bleiben wird, in Troppau beobachten, wie sich preußische Husaren um verwundete und gefangene österreichische Husaren bemühen, ihnen Branntwein geben, »damit sie wieder zu sich kommen«.
Das angerichtete Grauen reicht vom Hühnerdiebstahl über das Abbrennen der durch einen Feldzug betroffenen Dörfer bis hin zu Vergewaltigungen. Aber darum geht es nicht. Es liegt nicht in der Absicht der Kriegsherren dieser Zeit, ein Land zu zerstören. Auch die gegnerischen Menschen sind kein mit Wahn aufgeladenes Ziel der neuen Schusswaffen. Die blutigen Verletzungen, die sie in den Auseinandersetzungen davontragen, sind so peinliche wie verdrängte, aber in Kauf genommene »Petitessen«. Es geht um Macht, und Zuwachs an Macht bedeutet Zuwachs an Ruhm. Es geht darum, neues Land und neue Untertanen zu erobern, um auch sie für den eigenen Nutzen einzusetzen – sei es als Nahrungs- und Rohstofflieferanten oder als Material für neue Kriege. Das Konzept eines »reinen«, strategischen Kriegs bleibt eine Selbsttäuschung der Kriegsherren, die auch die eigene Bevölkerung täuschen.
Denn was die Auseinandersetzungen im engeren Sinn betrifft, hat sich ein Wandel ins Brutale vollzogen: Das technischere Verständnis von Gewalt trägt nicht zu ihrer Zivilisierung bei. Massenschlachten mit Zehntausenden Soldaten führen zu flächendeckenden Gemetzeln, die Zahl der Opfer steigt. Soldat sein bedeutet immer öfter, keine Chance zu haben. Der individuelle Beitrag ist unerheblich. Einer ist nur wichtig als winziger Teil einer Masse, die im Kampf gegen eine andere Masse verbraucht werden kann. An einem einzigen Tag, dem 18. Juni 1757, fordert die Schlacht bei Kolin, die den gelungenen preußischen Kriegsbeginn vergessen lässt, knapp vierzehntausend Tote und Verwundete, mehr als ein Drittel der zur Verfügung stehenden fünfunddreißigtausend preußischen Soldaten. Noch die siegreichen Österreicher verlieren über achttausend ihrer vierundfünfzigtausend Mann.
Wieder stehen Pferde auf der Kuppe über Rosswald. Aber mehr als einen Monat nach der vorbeiziehenden Truppe ist es ein deutlich kleinerer Tross. Ein preußischer Offizier mit nur einem Soldaten. Die Pferde sind gut. Auch wenn sie erschöpft sind, sehen sie kräftig aus, aber jetzt müssen sie ruhen. Der Offizier, der privat unterwegs zu sein scheint, neigt seinen Kopf melancholisch zur Seite. Mit dem ist wohl nicht mehr viel.
Er muss ja auch verrückt sein, denkt Max. Weiß dieser Mann nicht, dass um uns herum Krieg ist und Rosswald auf österreichischem Gebiet liegt? Es ist nicht ungefährlich hier. Das preußische Heer liegt vor Olmütz, wie Max von einem Scherenschleifer gehört hat, der von brennenden Dörfern erzählt hat, durch die er seinen Wagen geschoben habe.
Ob Max dem Offizier den Weg zum Schloss weisen soll? Vielleicht hat er Neuigkeiten zur Belagerung. Aber Max darf sich nicht einmischen. Es ist nicht seine Aufgabe. Mit dem Förster und ein paar anderen Burschen hält er den Wald des Grafen in Ordnung. Mehr darf er nicht. Auch wenn sein Ehrgeiz weiter reicht: Er kann sich nicht einmal zum Krieg melden und eine Uniform anziehen.
In seinen Ritterkostümen fürs Theater kommt sich Max manchmal wie ein Kasper vor. Dann verflucht er den Grafen. Hoditz zahlt für die theatralen Sperenzchen nur einen zusätzlichen Hungerlohn. Als Soldat für Maria Theresia gäbe es mehr! Aber gerade stellt sich auch für Max die Frage: zu welchem Heer denn? Muss Max bei Hoditz ausharren? Bleibt er für immer Österreicher?
Genau genommen ändert sich für Max nirgendwo nichts. In jeder Armee der Zeit gibt es Söldner, und sie bleiben es, bis sie auf dem Feld sterben.
Max Neubert vergisst nie, dass er der Sohn eines Leibeigenen ist. Einer zum »Roboten«, einer fürs Vieh, für die Fron. Er hat nicht viele Rechte im Reich der gottgnädigen Kaiserin. Er weiß, dass er am Ende lieber mit Brigitta Theater spielt, als auf den Feldern zu schuften und Schweine zu hüten. Wenn er doch, wie Cousins aus dem benachbarten Matzdorf, wenigstens ein Freibauernkind wäre: niemandes Herr und niemandes Knecht!
Aber Max wird vielleicht einmal mit dem Grafen unterwegs sein, wie früher der Blümel Fritz, des Grafen persönlicher Hofschranz, sein Diener, sein Koch, »und das seit drei Dezennien«, wie ihm der Blümel erklärt hat. Blümel ist ein klapperdürres, zähes Gestell, das schief auf der Bühne herumsteht und knurrt, wenn sie ihn noch rauflassen, ein alter Faxenmacher, eine komische, ja peinliche Figur. Sollte der Graf wieder losziehen in die Welt, wird sich schon zeigen, wie gut der Blümel noch mitgehen kann, mit seinen krummen Beinen. Da nützt es ihm nichts mehr, dass er sein Kriechen vor allem und jedem in seiner Schrulligkeit gut versteckt.
Er soll sich sogar im Verfassen von Versen üben, aber Max hat noch keinen gehört. Er hat nur bemerkt, dass Blümel ihn ignoriert.
Doch was macht sich Max so viel Gedanken um den armen Kerl? Jetzt ist der neue Regisseur des Grafen sein Freund. Müller ist aus Deutschland und scheint alles zu wissen. Glücklicherweise hat er Blümel schon einen »Hanswurst« genannt, dem die Stellung beim Grafen zu Kopf gestiegen sei.
Der Blümel ist immer nur ernst. Er macht keine Scherze. Er ist einer.
Max ist kein Diener. Dazu ist er zu bockig. Er muss etwas anderes finden. So viel ist sicher: wenn der Graf ihn lassen würde, wäre Max weg.
Er könnte mit dem schiefköpfigen preußischen Offizier dort weiterziehen. Er könnte ihn fragen, ob er einen zweiten »Adjutanten« braucht. Aber ist einem Militär zu vertrauen, der nicht weiß, auf welch gefährlichen Wegen er sich befindet? Noch immer bewegen sich die zwei dort drüben nicht. Was sie wohl denken?
Vielleicht kann Max mit Müller auf Reisen? Müller war bei einer Hamburger Schauspieltruppe, die wegen des Kriegs aufgelöst werden musste. Und er hat es geschafft, hierherzukommen.
Aber dann wäre Brigitta weit.
Gestern hat Max sie beinahe geküsst. Weit hinten, am Wald, direkt beim chinesischen Tempel.
Brigitta ist weggelaufen und hat wieder frech gelacht, sonst ist gar nichts geschehen, und Max ist, wie immer, der Dumme geblieben. Sicher schwärmt sie, wie alle Mädchen hier, für den Grafen.
Vor sechs Jahren, nach dem Tod seiner Frau, war Hoditz in Starre verfallen. Eine Weile lang hieß es, er sei gläubig geworden, so sehr, dass man ihn nicht einmal in der prächtigen Schlosskapelle sah, die mehrere Hundert Gläubige fasst. Hoch über den Betenden soll er aus einem kleinen Fensterloch im Gemäuer die Messe über einen Spiegel verfolgt haben. Als wäre er hässlich geworden, ja kein Mensch mehr, ließ er sich nicht mehr blicken.
Davon hat Max nichts mitbekommen, das war vor seiner Zeit.
Aber was soll er jetzt anstellen mit diesem Preußen und seinem Begleiter, der ein großes, breites, blasses Gesicht und riesige Augen hat, aber, wie sein kleiner Herr, Max noch immer nicht gesehen zu haben scheint? Soll er sich um die beiden kümmern?
Sind es Spione? Soll er sie verjagen?
Kommt der Offizier selbst auf die Idee, sich das Schloss anzusehen? Vielleicht sollte Max erzählen, dass der Graf ein gastfreundlicher Mensch ist? Sonst würde er nicht immer all diese Leute zu sich bitten, ihnen Essen offerieren für nichts. Und dann können sie auch noch Musik hören oder Theaterstücke begucken. Alles für nichts.
Aber andererseits sind Krieg und Graf unberechenbar. Wenn einer im Schloss übernachten darf, heißt das wenig. Vielleicht führt der Graf ihn in ein Zimmer, in dem mitten in der Nacht Wasser auf sein Bett spritzt. Am nächsten Morgen verneigt sich der Graf bis zum Boden und lächelt.
Wie soll Max das dem Privatoffizier dort drüben alles erzählen? Max ist nicht auf den Kopf gefallen. Er ist einer, der alles, was ihm begegnet, aufsaugt. Aber er kann ja nicht mit Theaterwörtern zu dem Mann hinübergehen. Er selbst hat nicht viele eigene Sätze.
Er kann sich fast alles merken, was gesagt wird, und wenn er den Wörtern nachsinnt, begreift er sie auch. Aber wenn er etwas sagen will, bleiben sie in seinem Kopf stecken. Sie machen den Mund nicht auf. Sein Leben ist nur kleines Gerede.
Max beneidet seinen neuen Freund, den Müller aus Halberstadt, der erst zwanzig Jahre alt ist und es noch bis zum Leiter des Wiener Hoftheaters am Kärntnerthor bringen wird. Müller kann sprechen, als ob er tänzelt oder marschiert, laut oder leise, mal schnell, mal gemächlich, wie es ihm passt. Nur vor dem Grafen muss auch er kriechen.
»Gnädigster Graf und Herr! Meine Pflicht erfordert es, daß ich Ihnen, Gnädigster Graf und Herr, durch alles, was nur von mir abhängt, meine Dankbarkeit bezeige. Denn was bin ich Ihnen nicht schuldig? Sie haben mich Ihres Schutzes und Ihrer Gnade gewürdiget.«
Das hat der Müller neulich Abend am Feuer der Schäferey hergesagt. So werde er die Aufführung einleiten. Das »Kriechen« sei »aber nicht schlimm«. Das sind »Kurialien«, wie er es genannt hat. »Das spielt keine Rolle. Man muss nur wissen, was sagen. Was ist, ist den Wörtern, die die Menschen darüber machen, einerlei.«
Ohne Krieg hätte Müller nie hergefunden. Er wäre irgendwo in einer Weltstadt herumspaziert.
Aber immerhin spricht er mit jedem, als sei er ein Mensch. Vielleicht, weil er ein Waisenkind ist. Ja, das hat er Max verraten. Nicht mal ein Bürgerlicher also. Aber Müller sagt, er habe Glück gehabt, er habe einen älteren Bruder, der Pfarrer sei und ihm viel beibringen konnte.
»Kurialien!« Fast hätte Max es noch lauter gesagt, aber es liegt ihm nicht gut im Mund. Er ist kein gezierter Lakai. Er würde das auch gar nicht wollen. Höchstens, wenn Brigitta ihn wieder hochnimmt, weil er stumm bleibt, wenn andere sprechen.
Sie ist verwöhnt, weil der Graf sie anglotzt! In den letzten Jahren hat er alle verrückt gemacht. Das Gelübde ewiger »viduitas«, Witwerschaft, hat der Müller gesagt, stehe auf Lateinisch in der Kirche. Wahrscheinlich, damit es in dieser Sprache, die kaum einer der Untertanen des Grafen lesen kann, versteckt bleibt.
Aber schon vor dem Tod der Gräfin hat der Graf herausgefunden, dass er nicht unbedingt heiraten muss. Die Just Anna nicht und die Wohler Theresia, geborene Goluschkin nicht, und eine andere auch nicht. Der Graf hat sie alle zahm hier. Manche sind eitel und alle anderen neidisch. Alle Rosswalder Dorfmädel fühlen sich wie Schauspielerinnen und Sängerinnen. Das Publikum für die Aufführungen kommt bis aus Breslau und Wien. Jeder Heuschreck auf den Wiesen hier sinniert: Will ich Tänzer oder Musiker werden? Nur weil der Graf glaubt, dass jeder ein Künstler sein kann.
Zwei Mal war er schon über dem Schloss gestanden.
Zuerst als Teil einer siegreichen Armee auf dem Vormarsch, da hatte er bloß kurz hinuntergeblickt und die Geschichten vor sich gesehen, die er von diesem Schloss gehört hatte, und seinem Pferd dann wieder zügig die Sporen gegeben.
Damals war der Privatoffizier, der sich Baron Kreutz nannte, auch noch deutlich besserer Laune. Er war noch neugierig gewesen auf die Zukunft und stolz auf die unmittelbare Vergangenheit. Nach jämmerlichen Niederlagen hatte die Winterschlacht von Leuthen endlich den ersten großen Erfolg bedeutet. Dabei war die schiefe Schlachtordnung, die vorgetäuschten Schwächen und vermeintlichen Bewegungen des Heereskörpers, nichts Besonderes. Die »Schiefe« hatte noch jeden Feldherrn der Antike, der sie nutzte, zum Sieg geführt: Epaminondas, Alexander, Hannibal, Cäsar. Aber man musste den Mut haben, sie einzusetzen! Nicht immer geradeaus!
Ja, der Sieg von Leuthen war derart deutlich gewesen, dass Baron Kreutz nichts mehr behelligen konnte. Die Aussicht auf den bevorstehenden Kampf um Olmütz, die »uneinnehmbare« Festung, die Maria Theresia ihrer erklärten Favoritin unter den Städten des Reichs gegönnt hatte, hatte ihn euphorisch gestimmt.
Beim zweiten Mal über Rosswald hatte die Geschichte schon anders ausgesehen. Die »Eroberung der weißen Stadt« mit den reich verzierten Brunnen hatte sich mühseliger angelassen als erwartet. Das eigene Lager war gut geschützt: links durch einen Höhenzug, gegenüber diente ein Dorf als Puffer; Sümpfe vorne, die Kavallerie im Rücken.
Aber die Offensive war einfach nicht vorangekommen! Dabei ging es darum, die Schlacht herbeizuführen! Diese Stadt war das Tor zum Kaiserreich! Der Verlust von Olmütz würde Maria Theresias Widerstand brechen, da war sich der Baron sicher. Nur wie? Hoffnung und Mutlosigkeit durchzogen Kreutz in wilden Schüben.
Am Ende konnten wir die Schlacht, musste er jetzt denken, nicht einmal führen und dennoch ging sie verloren! Obwohl Baron Kreutz an Paradoxien seine Freude hatte: Die Absurdität dieser Wahrheit peinigte ihn! Mehr als ein Vor und Zurück, ein Beinahe-Stillstand, der immer länger dauerte und die Moral anfraß, war aus Olmütz nicht geworden. Der österreichische Feldmarschall Daun, ein alter Langweiler und überlegter Stratege, einer der besten Militärführer, die der Baron je erlebt hat, hatte jedes offene Aufeinandertreffen vermieden, aber die preußischen Belagerer mit kleinen nächtlichen Überfällen in Aufregung versetzt und zermürbt, statt sich von ihnen zermürben zu lassen. Zuletzt war Kreutz selbst um die Stadt geritten, aber auch ihm war keine Möglichkeit aufgefallen, die ausgezeichnet versorgte Festung aus der Reserve zu locken. Deprimiert hatte er die Geduld verloren und sich auf einen »Aufklärungsausritt« gestohlen. Dieser hatte ihn wieder näher an Rosswald herangeführt.
Immer hatte er sich gefragt, wie es wohl hinter diesen Mauern aussehen mochte. Er wusste, dass Graf Hoditz dort Feste veranstaltete, die von allen, die sie erlebt hatten, bewundert wurden. Manchen galten sie als Teil des Entwurfs einer neuen Lebensform, die in diesem kleinen Reichsgrafen ihre staunenswerte Verkörperung fand. Ein glanzvolles Leben abseits der Höfe und ihrer Gesellschaft! Ein wahrhaftiger Epikureer, mitten im Krieg?
Kreutz hatte neue Aussichten nötig.
Erst als er wieder über dem Schloss gestanden hatte, hatte er erneut zu zögern begonnen. Doch nach einiger Zeit war der vierschrötige junge Mann, der ihm damals im Weg stand, auf ihn und seinen Begleiter zugekommen und hatte den Schlossherrn gerufen.
Kreutz hatte es genossen, vom Grafen mit nachlässiger Ironie durch den menschenleeren Park geführt zu werden. Doch als er plötzlich bemerkte, dass der Graf ihn erkannte, war ihm unbehaglich zumute geworden. Sollte er sich zu erkennen geben, wie zuerst beabsichtigt? Aber warum hatte er es nicht gleich getan?
Der Graf spielte die Komödie mit Eleganz und löste sie auf, ohne zudringlich zu werden. Sie unterhielten sich einen Abend lang ohne Ziel. Baron Kreutz fühlte sich von einem überlegenen Geist an die Hand genommen, was ihm selten geschah. Am nächsten Morgen hatte er wieder etwas Zuversicht gefasst und war in aller Frühe nach Olmütz zurück.
Vor ein paar Tagen aber hatte er dort bitterlich lernen müssen, dass es noch schlechter gehen kann, als dass nichts passiert. Der eigene Nachschub an Munition und Nahrung war ausgeblieben. Es war Daun und seinen Truppen gelungen, den vierzig Kilometer langen preußischen Versorgungstross aufzuhalten und zu zersplittern. Daun hatte auf seine Weise schief kämpfen lassen, einen unerwarteten Angriffspunkt gewählt.
Alle Vorräte dahin, die gesamte Kriegskasse, dreitausend wertvolle Wagenladungen und eine Million Taler verloren!
Auf einen Schlag war der Kampf der Belagerer aussichtslos. Auf einmal waren sie es, die sich umstellt fühlen mussten. Plötzlich konnte es für Preußen nur noch darum gehen, den Rückzug so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, um den Angriff der Russen auf Berlin zu verhindern. Aber der direkte Weg dorthin, der über Schlesien verlief, war jetzt durch österreichische Truppen versperrt. Preußen musste den Umweg über Böhmen einschlagen – erst recht Feindesland. Auch Kreutz machte sich mit einer Vorhut noch in der Nacht auf. Wieder einmal war er vorneweg geritten, obwohl er keineswegs unabhängig war. Er war nur in einer etwas anderen Position. Er musste nichts. Er war verantwortlich. Baron Kreutz war kein Baron, sondern Friedrich der Große selbst.
Eine tiefe Schwermut überkam ihn bei diesem Gedanken. Es nahm kein Ende mit dem Auf und Ab seines Lebens! Jedes Mal, wenn er sich auf einem Höhepunkt glaubte, trat ihm das Schicksal so schmerzhaft ans Bein, dass ihm nicht einmal mehr die heiteren Kreuzsprünge halfen, die er seinen armen Knochen noch immer gelegentlich abverlangte, obwohl er nach einem Tag zu Pferd manchmal kaum mehr gehen konnte.
Alter Mann!
Hungrig nach Ruhm und mit dem Ziel, seine Macht auszuweiten und am Ende in ganz Europa als Vorreiter der Herrschaft der universalen Vernunft zu gelten, hatte Friedrich gleich zum Auftakt seines Königtums den ersten Krieg begonnen. Damals hatte er gehofft, mit einem Blitzschlag die Landschaft heimzuholen, die ihm nach Auffassung aller preußischen Staatenlenker seit der Liegnitzer Erbverbrüderung vor zweihundert Jahren zustand. Auch das Herzogtum Jägerndorf, das direkt an Rosswald grenzte, gehörte zu diesem Gebiet! Mochten die Feinde noch so sehr über den »verjährten« Anspruch Preußens lachen.
Vor sich selbst allerdings hätte Friedrich diese Begründung für den Einfall in Schlesien auch nie vorgebracht. Es war nicht das Recht der Vergangenheit, das ihm wichtig war. Es war nicht mehr als ein schlichter Vorwand. Sein Vater, den er gehasst hatte, hatte ihm Verantwortung vor der Geschichte eingebläut, aber er war jetzt schon siebzehn Jahre tot.
Friedrich hätte leben können, wie er es immer gewollt hatte. Er hätte den Staat vom Tag seiner Krönung an alleine lassen können – lesen, dichten, Gespräche führen, Flöte spielen! Leider aber hatte der Vater Erfolg gehabt: Friedrich hatte die Wichtigkeit eines machtvoll-strengen Herrschers für das bei seinem Antritt höchstens mittelgroße Haus Preußen zu gut verstanden! Er hatte sie sich einbläuen lassen! Und selbst die Republik der Freigeister, die er – gegen seinen Vater – manchmal noch immer als höchstes Ziel seines Strebens ansah, verlangte einen stabilen Staat.
Sobald er an die Regierung gekommen war, merkte Friedrich: All diese Gegebenheiten trafen sich auf erstaunliche Weise mit seinem eigenen, gut proportionierten Ehrgeiz, der ihn, wie er wusste, seit je unerträglich machte. Aber er wusste auch: Sein Temperament verpflichtete ihn nicht unbedingt, von der Welt geliebt zu werden. Er musste nur unverwechselbar sein.
Seit dem unseligen ersten Krieg, der ihm Schlesien eingebracht hatte, aber auch die bleibende Feindschaft der jungen, doch erstaunlich widerstandsfähigen Maria Theresia, hatte sich vieles verändert. Nur eine der wesentlichen Konstanten im Staatengefüge der Zeit, das vage Gleichgewicht zwischen den katholischen Kaisern von Österreich, deren lähmende Verkrustung die junge Kaiserin beseitigen sollte, und den immer ehrgeizigeren preußischen Königen und ihren Verbündeten, hatte sich erhalten. Friedrichs erster Angriff hatte nicht die rasche Entscheidung gebracht, die er sich erhofft hatte. Er war nur zum Ausgangspunkt eines sich vertiefenden Zerwürfnisses geworden, der Auftakt zu einem Morden, wie es kein philosophe auf dem Thron, als den sich Friedrich noch immer gern sah, wollen konnte. Kolin hatte ihn in bittere Verzweiflung gestürzt. Er hatte auf einmal wieder begriffen, wie viele Mächte auf die Schwäche des gerne großen Preußen warteten. Mit Scham erinnerte er sich an den Jammer, den Wilhelmine danach von ihm lesen musste.
Liebste Schwester (…) mich treffen so viele Schläge, daß ich wie betäubt bin. Die Franzosen haben Friesland besetzt und werden die Weser überschreiten. Sie haben die Schweden aufgestachelt, mir den Krieg zu erklären. (…) Die Russen belagern Memel (…). Seit meinem letzten Brief häuft sich bei mir Unglück auf Unglück. Es ist, als wolle das Schicksal all seine Wut und all seinen Zorn auf meinen armen Staat entladen. (…) Hätte ich meiner Neigung folgen wollen, ich hätte sogleich nach der unglücklichen Schlacht, die ich verloren habe, ein Ende gemacht. (…) Was kann ich da noch ausrichten? Der Feinde sind zuviel. Gelänge es mir auch, zwei Heere zu schlagen, das dritte würde mich erdrücken.
Immer wieder hat Friedrich daran gedacht, sich davonzustehlen. »Das Leben wurde uns von der Natur als eine Wohltat gegeben; sobald es das nicht mehr ist, hört der Vertrag auf, und es steht jedermann frei, seinem Mißgeschick ein Ende zu machen. (…) Du allein fesselst mich noch an die Welt (…). Falls Du den gleichen Entschluss fasst wie ich, so werden wir zusammen unser Unglück und unser Missgeschick beenden.«
Wilhelmine hatte ihm den Geschwister-Liebestod verweigert und ihn noch einmal aus seinem Seelental geholt: »Um Gottes willen, beruhige Dich, lieber Bruder! Deine militärische Lage ist verzweifelt. Aber es besteht Aussicht auf Frieden (…) man hat mir versichert, Frankreich sei mit der Kaiserin schon halb zerfallen.«
Aber von Frieden war jetzt, mehr als ein halbes Jahr später, noch immer keine Rede, das elende Kriegsschicksal ging nach wie vor alles andere als einen geraden Weg. Hatte es nach dem Rossbacher November-Sieg gegen die Franzosen noch geheißen, der König von Preußen habe sich endgültig in die erste Reihe der Herrscher Europas gedrängt und selbst jede zweite französische Frau berge sein Bildnis in ihren Kissen, war wieder alles anders gekommen. Wieder schien sein Leben nahe am Abgrund.
Was für ein blödes Vogelgezwitscher in idyllischer Landschaft! Was für ein Spott! Friedrich hatte Olmütz verloren und ritt auf Trübau zu, nicht auf Rosswald! Der Weg dorthin war von Österreichern versperrt! Er würde es womöglich nie wiedersehen. Er hatte davon geträumt, den Grafen auf dem Rückweg von der Eroberung weiterer Ländereien besuchen zu können, vielleicht sogar als neuer Herrscher über Wien, als Kaiser aller Deutschen, der einem seiner schillerndsten neuen Untertanen huldvoll die Gunst hätte erweisen und sich über dessen unter den eigenen Schutz zu stellende Welt hätte informieren können. Er hatte gedacht, er könne auftreten wie ein großer Mann, wie Ritter Lancelot, von dem ihm Duhan, sein Erzieher, erzählt hatte. Als französischer Held in preußischer Gestalt! Wie ein Befreier der im alten österreichischen Tanz Befangenen, wie der beste aller Ritter, der die selbstvergessenen Untertanen Maria Theresias aus ihrem verlorenen Wald erlöste, wo sie ihren schiefen katholischen Weisen lauschen und sich so hemmungs- wie hoffnungslos im Kreise drehen mussten.
Das preußische Reich, zu dem Rosswald nie hatte gehören dürfen, würde, das hatte er schon früh gewusst, größer wiederauferstehen.
Friedrich I., sein eitler Großvater, hatte sich die Königskrone selbst auf den Kopf gesetzt und damit das simple Kurfürstentum hinter sich gelassen. Sein Enkel war ausgezogen, ein glücklicheres Königreich zu gestalten. Vielleicht konnte er auch Hoditz dafür gewinnen.
Vor seinem ersten Besuch hatte Friedrich General Balbi einen Brief an ihn schreiben lassen, Balbi, den Friedrich zum Kommandeur des preußischen Ingenieurskorps gemacht hatte, Balbi, aus altem Genueser Adel, war selbst schon bei Hoditz gewesen. Auch er hatte Wunderdinge von der schillernden Gelehrsamkeit des Mannes, seinen hübschen bäuerlichen Schauspielerinnen, von den brillanten Musikern seiner Kapelle erzählt, dabei aber auch immer wieder bedenklich mit dem Kopf gewackelt. Als wolle er sich nicht festlegen, was er von »diesem Experiment« halten sollte. Aber so viel hatte Friedrich gelernt: das Geschwätz der Leute zählt nichts. Gerade das von Balbi! Das wusste er jetzt! Balbi war einer der Verantwortlichen für die Niederlage von Olmütz! Trotzig hatte er an seinen verfehlten Plänen festgehalten! Viel zu sichtbar hatte er die Laufgräben angelegt!
Der Graf hatte dem König eine enthusiastische Antwort zukommen lassen, auf den 23. Mai 1758 datiert: »Nach sehnsüchtigen siebzehn Jahren hatte ich das Glück, Sie zum ersten Mal zu sehen, als Sie in Roswald vorbeikamen, aber die Aussicht auf Ruhm führte Sie zu schnell zum veni vidi vici, um meine Sehnsucht ganz zu befriedigen. Tausend große Taten, deren Ruhm bis in meine Einsamkeit drang, hatten mich bereits den Helden des Jahrhunderts in Ihnen erkennen lassen. Ich wünschte mir, den Menschenfreund zu sehen, der von seinen Untertanen so sehr gepriesen wird.«
Frech hatte Hoditz in sein überschwängliches Lob Passagen gemischt, die man als Kritik lesen konnte. Etwa, wenn er schrieb, so wie Friedrich »tatsächlich der Mars der Erde« sei, für ihn werde er »auf immer der große Pan meiner Schäferey« sein.
Als ob Rosswald die Kraft und den Willen hätte, Friedrich, den Kriegsgott, in einen Hüter des Friedens zu verwandeln! Selbstverständlich, musste sich Friedrich denken, hatte der Brief einen zweiten Sinn, vielleicht war es der hauptsächliche: Hoditz bat darum, nicht in den Krieg miteinbezogen zu werden. Er habe leider kein Geld.
Hatte der Graf die Millionen, die man ihm nachsagte, wirklich alle verprasst? Oder versuchte er, Friedrich zu täuschen? Sophie, Hoditz’ Frau, Friedrichs verrückte Tante, hatte auch nie Geld gehabt, sie hatte nur Rechnungen und Bettelbriefe nach Preußen geschickt.
Am 30. Mai hatte Friedrich dem Grafen persönlich geantwortet und edelmütig versichert: »Graf von Hoditz, Ihr Brief vom 23. dieses Monats hat mich mit großer Befriedigung erfüllt, und ich weiß Sie voll der Gefühle mir gegenüber, die Sie darin betonen. Sie können von meinem guten Willen überzeugt sein, Ihnen meine Protektion zu gewähren, soweit dies die vorhandenen Umstände zulassen.«
Ein Brief, der die Form wahrte, ein distanziertes Schreiben, in dem sich Friedrich keine Blöße gegeben hatte. Aber das war am 30. Mai auch noch einfach, war er doch damals in ausgezeichneter Position gewesen. Gerade eben hatte er de Catt noch erzählen können, er rechne mit der Kapitulation der Verteidiger von Olmütz innerhalb von wenigen Tagen, »ohne einen Schwertstreich«. Danach hatte er nicht mehr geschrieben.
Wie hätte er Hoditz jetzt entgegentreten können? Beinahe konnte er von Glück reden, dass er die Hügel um Trübau vor sich sah, nicht eine Heerschar von Gräbern. Nach seinem erbärmlichen Rückzieher fühlte sich Friedrich wieder einmal wie einer, der wissentlich eine zu hohe Position eingenommen hatte und jetzt umso schlimmer zerstört am Boden lag. Wie eine unwürdige Leiche, die zu Recht von ihren Gegnern verlacht und bespuckt wurde.
Wie eh und je spürte er, dass ihm die Menschen, die er verachtete, nicht gleichgültig waren. Dass bei ihm wie immer alles mit allem verknüpft war, nicht zuletzt die eigene Selbstachtung mit dem Ansehen, das er bei irgendwelchen Unwürdigen genoss.
Und so fühlte er eben wirklich: dass der ganze Entwurf seines Lebens, auf den er stolz war, wieder einmal gefährdet schien. Ja, es war ihm, als sei er diesmal endgültig gescheitert. Wieder dachte er über den Grund seiner Unbeständigkeit, über seine mangelnde Zuversicht nach. Warum wirkte er in einem Moment stahlhart, im nächsten wie ein zerfetztes Blatt im Wind?
Sollte er aus diesem vermaledeiten Trübau, das da nur noch ein paar Hundert Meter vor ihm lag und das de Catt ihm als mährisches Athen und Ähnliches hatte schönreden wollen, wieder hinauskommen und irgendwann noch einmal den Hang über Rosswald hinunterreiten können, wird er versuchen, alle peinlichen Niederlagen seines Lebens zu vergessen. Der Schutz, den er Hoditz anbieten kann, wird wieder etwas wert sein!
Es ist zum Verzweifeln! Warum ist er so dünn besaitet, dass solche Dinge ihm größte Mühe bereiten? Mit sechsundvierzig Jahren ist Friedrich im 18. Jahrhundert schon weit über die Mitte seines Lebens hinaus und einer der mächtigsten Männer Europas. Er weiß das. Aber noch immer sieht er sich alle paar Tage am Rand einer schreckenerregenden Schlucht. Was dieses Mal auch einen banalen Hintergrund hat, den kaum einer der Männer, die mit ihm reiten, ahnt. Friedrich kann nicht mehr verdrängen, dass der preußische Staatsschatz erschöpft ist, dass schon vor dem Auftakt dieses Feldzugs klar war, dass der Krieg neue Einnahmen bringen musste.
Friedrich will nicht mehr von Mitchell, dem Gesandten des Britischen Königsreichs, und den Unterstützungszahlungen, die Mitchell für Friedrich organisiert, abhängig sein. Mitchell ist ein gebildeter Mann, der mit Montesquieu, einem der besten französischen Aufklärungsphilosophen, befreundet ist, aber auch ein übler Geizhals! Friedrich hasst, dass Mitchell, den er schätzen muss, immer mitreitet. Es ist, als kontrollierten ihn die Engländer über diesen reisenden schottischen Inspektor. Sagen Sie uns, lieber Mitchell, ist der König unser Geld wert? Friedrich schnaubt verächtlich. Was diesen Feldzug angeht, ist ihm die Flucht nach vorne gründlich missraten. Er kann nur beten, dass den Russen kein zweiter übler »Husarenstreich« gelingt. Er muss sie von Berlin fernhalten! Erst im vergangenen Oktober haben sie ihn zum lächerlichsten Geschöpf der Erde gemacht und einen ganzen Tag lang die russische Fahne über Berlin gehisst.
Als Unterlegener wollte er bei Hoditz, der nur ein Graf ist, aber vielleicht auch ein philosophe, wie Friedrich ihn sich wünscht, nicht vorstellig werden. Womöglich war er für den Grafen jetzt nur noch der ungeliebte, angezählte Besatzer, der verschwinden musste.
Aber nur in Rosswald kann er herausfinden, wer dieser mährische Sonderling ist, ob ihm in seinem »schlesischen Versailles« eine Existenz gelingt, wie Friedrich sie selbst gerne geführt hätte.
Es hat auch bei Friedrich Ansätze zum Selbst-Leben gegeben, durchaus. Auch er hat davon geträumt, Privates und Politik zusammenzuführen. Nach dem Tod seines Vaters und dem eigenen Regierungsantritt war Friedrich mit Francesco Algarotti, den er zuvor eilig zum Grafen gemacht hatte, in gemeinsamer Kutsche auf Huldigungsreise nach Königsberg gefahren. Wie mit einer offiziellen Geliebten. Elisabeth-Christine, die Zwangsfrau, an die ihn sein Vater verkuppelt hatte, hatte er endlich in Berlin und Schönhausen abstellen können. Sollten sie doch reden! Friedrich war jetzt König!
Damals, vor achtzehn Jahren, hatte es so ausgesehen, als könne er den Aufbruch seines Staats mit seiner eigenen zweiten Geburt verbinden.
Aber all das war lange vergangen. Der Venezianer Algarotti war vor fünf Jahren endgültig nach Italien zurück. Aus gesundheitlichen Gründen! Algarotti war immer noch gleich alt wie Friedrich, aber er schien an allen Krankheiten dieser Welt zu leiden! Beinahe wie Fredersdorff!
Friedrich musste aufpassen, dass ihm nicht die Tränen kamen. Fredersdorff, sein Mann für alles und die Finanzen! Auch an ihm hatte Friedrich gehangen. Für keinen hatte er sich so eingesetzt! Für die richtige medizinische Behandlung! Er hatte Fredersdorff sogar erlaubt zu heiraten, auf dass er eine Pflegerin bei sich habe. Aber der kränkliche lange Kerl war dennoch gestorben, im Januar, keine fünfzig Jahre alt! Friedrich hatte die Nachricht im Breslauer Winterlager erreicht. Hilflos hatte er sie sich angehört. Vorher schon war seine Mutter gestorben, kurz nach der verteufelten Schlacht von Kolin.
»Ein neuer Kummer, der uns niederdrückt! Wir haben keine Mutter mehr«, hatte er am 5. Juli 1757 an Wilhelmine geschrieben, »dieser Verlust setzt meinem Schmerz die Krone auf. Ich muss handeln und habe kaum Zeit, meinen Tränen freien Lauf zu lassen.«
Als Algarotti noch gesund war, hatte er große Reden geführt, hatte Friedrich von seinem komplizierten Liebesdreieck mit Lady Montagu und Lord Hervey