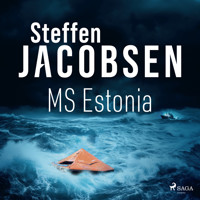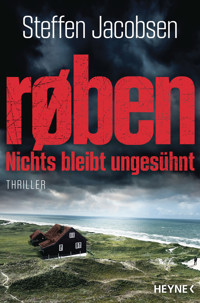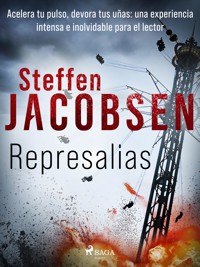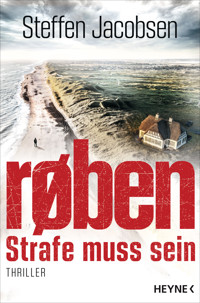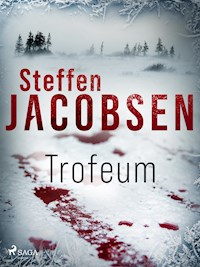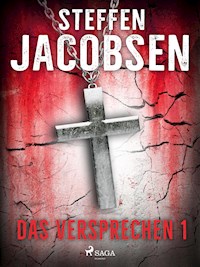19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Spion zwischen den Fronten zweier Supermächte
Los Alamos, USA, 1945: Der Elektroingenieur David Adler stößt zum Manhattan-Projekt, in dessen Rahmen an einer revolutionären neuen Waffe gearbeitet wird. Als Verwandter von Niels Bohr gewinnt er schnell das Vertrauen des großen Forschers und wird sein persönlicher Assistent. Was niemand wissen darf: David spioniert gezwungenermaßen für die Sowjetunion. Mit Grauen verfolgt er die Entwicklung der Atombombe, deren Erprobung immer näher rückt. Doch für Moral ist kaum Zeit. Seine geheimen Auftraggeber werden ungeduldig. Und David ist nicht der Einzige mit einer eigenen Agenda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DASBUCH
Los Alamos, USA, 1945: Der Elektroingenieur David Adler stößt zum Manhattan-Projekt, in dem die größten Forscher seiner Zeit an der Entwicklung der Atombombe arbeiten. David ist mit Niels Bohr verwandt, was ihm Zugang zu dieser Gruppe außergewöhnlicher Männer verschafft, zu der auch J. Robert Oppenheimer und Klaus Fuchs gehören. So wird David zu Bohrs persönlichem Assistenten, kann dessen Forschung auskundschaften und dokumentieren. Denn was niemand weiß: David ist ein Spion.
Je mehr David von der verheerenden Waffe weiß, an der getüftelt wird, desto weniger will er damit zu tun haben. Niemand sollte seiner Meinung nach so viel Zerstörungsmacht in Händen halten. Doch für Moral ist kaum Zeit. Trinity, der erste Atombombentest, rückt immer näher, Kurjakin macht Druck, und David entdeckt, dass er nicht der Einzige ist, der eine geheime Agenda verfolgt.
DERAUTOR
Steffen Jacobsen, 1956 geboren, lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in Kopenhagen. Seine Bücher wurden unter anderem in den USA, England und Italien veröffentlicht. Bei Heyne ist seine Thrillerreihe um die Kommissarin Lene Jensen und den Ermittler Michael Sander erschienen.
STEFFEN
JACOBSEN
SCHACH MIT
DEM TOD
AUS DEM DÄNISCHEN
VON MAIKE DÖRRIES
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel DABLEVJEGDØDEN bei Lindhardt og Ringhof Forlag, Kopenhagen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Steffen Jacobsen
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Werner Wahls
Herstellung: Mariam En Nazer
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel|punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com (Reddavebatcave, Ysbrand Cosijn, oOhyperblaster, Photo Oz, Wilqkuku)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-23573-4V002
www.heyne.de
Mir scheint, Bohr sollte eingesperrt oder jedenfalls zu der Einsicht gebracht werden, dass er sehr nah am Rand todeswürdiger Verbrechen ist.
Winston Churchill an Lord Cherwell, oberster wissenschaftlicher Fachmann und Berater der Regierung
Eine solche Initiative, deren Ziel es ist, den zukünftigen Wettstreit um den Besitz einer solchen Superwaffe zu verhindern, darf in keiner Weise die sofortige militärische Anwendung hemmen.
Niels Bohr in einem Memorandum an den Schatzkanzler im Kabinett Churchill und verantwortlichen Minister für das britisch-kanadische Atomwaffenprogramm Tube Alloys
FAKTEN
Abgesehen von einer Handvoll Politiker, einer Gruppe Wissenschaftler und Einheiten der amerikanischen Streitkräfte, befand sich der Rest der Menschheit in seliger Ahnungslosigkeit, als im Nuklearlabor der amerikanischen Armee in Los Alamos eine neue Ära der Ausübung militärischer Konflikte anbrach und am 16. Juli 1945 in der Wüste Jornada del Muerto, New Mexico, getestet wurde. Das Testgelände befand sich auf prähistorischem, vulkanischem Meeresgrund. Das einzige zivile Gebäude dort war die Ranch der Familie McDonald, die 1942 von der Armee enteignet und verstaatlicht wurde. Das Testgelände bekam den Codenamen Trinity. Der Name ist wie alles andere in dieser Geschichte mehrdeutig. Vielleicht bezieht er sich auf die drei Berggipfel in der näheren Umgebung, die von den ersten spanischen Besiedlern Trinität genannt wurden, vielleicht wurde der Ort aber auch nach einem Gedicht von John Donne benannt. Möglicherweise ist das alles auch nur eine nachträgliche Interpretation.
Um 05:29:45 SMT (Standard Mountain Time) hatte der Physiker Sam Allison auf null runtergezählt, und die erste Atombombe der Welt – »Gadget« genannt – explodierte mit einer Sprengkraft, die 22 000 Tonnen TNT entsprach.
Die Plutoniumbombe schlug mit einem Dröhnen auf den Amboss der Geschichte ein, das bis heute nachhallt.
Das war ein Morgen mit zwei Sonnenaufgängen.
Die atomare Ära wurde eingeläutet mit einem Zitat des wissenschaftlichen Direktors des Projekts, J. Robert Oppenheimer, aus der hinduistischen Schrift Bhagavad Gita (Sanskrit: Gesang des Erhabenen): »Jetzt bin ich der Tod geworden, Zerstörer der Welten.«
Wie es der Physiker Kenneth Bainbridge nicht ganz so pathetisch, aber deutlich präziser ausdrückte: »Jetzt sind wir alle Hurensöhne geworden.« Dieser Kommentar spiegelte die Zweifel wider, die von den Verantwortlichen für die Entwicklung der Atombombe nach der Probesprengung genährt wurden. Sie hatten, angespornt vom Patriotismus und von der Befürchtung, die Achsenmächte könnten vor ihnen Atomwaffen entwickeln, zugestimmt, ihre Arbeitskraft in Los Alamos, New Mexico, zur Verfügung zu stellen – über Jahre hinweg und in völliger Isolation.
Als im Mai 1945 die letzten deutschen Streitkräfte kapitulierten, wurde offenbar, dass die Kernphysiker des Dritten Reiches nicht einmal in die Nähe einer anwendbaren Atombombe gekommen waren. Adolf Hitlers Interesse an Atomwaffen war nicht sehr groß gewesen, denn er hatte deren Fertigstellung in absehbarer Zukunft für unerreichbar gehalten. Trotzdem wurde das amerikanische Atomwaffenprogramm, das Manhattan-Projekt, auch nach Ende des Krieges unverdrossen weitergeführt.
In einem unwirklich kurzen Zeitraum, nämlich zwischen März 1943 und Juli 1945, wurde das Manhattan-Projekt einzigartig erfolgreich in Los Alamos, New Mexico, Hanford, Washington State, und Oak Ridge, Tennessee, vorangetrieben. Für das Projekt wurden genauso hervorragende wie exzentrische Talente aus dem naturwissenschaftlichen Bereich rekrutiert. Auf anscheinend harmonische Weise trugen diese ausgeprägten Individuen in einer fieberhaften Kreativität zu revolutionären Erkenntnissen und neuen technologischen Errungenschaften bei, wie die Welt sie noch nicht gesehen hatte. Unübertrefflich. Das zumindest glaubten alle Beteiligten.
Die Wissenschaftler in Los Alamos hatten eine Massenvernichtungswaffe mit einer bis dahin nicht bekannten destruktiven Kapazität entwickelt, die sie dem amerikanischen Militär überantworteten. Am 6. August 1945 wurde eine uranbasierte Atombombe, »Little Boy«, über Hiroshima abgeworfen. Drei Tage später eine Plutoniumbombe, »Fat Man«, über Nagasaki. Die Zahl der Todesopfer belief sich auf über 100 000. Vor diesen Angriffen waren durch konventionelle Bombardierungen mit Brandbomben, ausgeführt von B-29-Superfortress-Langstreckenbombern von den Marianen im Pazifik aus, 67 japanische Städte ausgelöscht und 400 000 Zivilisten getötet worden.
In den Jahren nach Trinity setzten sich der dänische Atomphysiker und Nobelpreisträger Niels Bohr und Professor J. Robert Oppenheimer für wissenschaftliche Offenheit, Transparenz und Kooperation der Nationen ein, um unverrückbare Grenzen für die militärische und zivile Nutzung der neuen Technologie zu setzen. Dabei betonten sie immer wieder, dass ein Atomwaffenwettlauf zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion um jeden Preis verhindert werden müsste. Sie schlugen die Einrichtung einer einflussreichen, internationalen Kontrollbehörde durch die Vereinten Nationen vor, um die grenzenlose Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern.
Wie die Geschichte gezeigt hat, hatten Bohr und Oppenheimer indes einen nicht neu verhandelbaren Vertrag mit dem Schicksal unterschrieben. Von 1945 bis 1953 führte das amerikanische Militär weitere 42 atomare und thermonukleare Testsprengungen durch. 1955 umfasste das atomare Waffenarsenal der Vereinigten Staaten 2422 Sprengköpfe. Während ich das hier schreibe, verfügen zehn Nationen über Atomwaffen, von denen einige ihre Arsenale weiter aufstocken und entwickeln.
Zum Entsetzen der Alliierten wurde am 29. August 1949 in Semipalatinsk, Kasachstan, die erste sowjetische Atombombe erfolgreich gezündet. Der Bauplan für die Bombe mit dem Spitznamen »Tatjana« war eine exakte Kopie der Konstruktion von »Fat Man«.
Eine amerikanische B-29 Superfortress, die am gleichen Tag den Nordpol überflog, sammelte radioaktives Beweismaterial ein.
Diese sowjetische Probesprengung war der Auftakt zum Kalten Krieg. Churchills Eiserner Vorhang zog sich durch das alte Herz Europas.
Die sowjetischen Wissenschaftler und Ingenieure waren in viel zu kurzer Zeit zu erfolgreich, womit rückblickend klar war, dass der Vorläufer des KGB, das NKWD, und dessen militärische Schwesterorganisation GRU das Manhattan-Projekt von Anfang an infiltriert hatten. Spione leiteten die Informationen über die neuen Entdeckungen so schnell nach Moskau weiter, wie sie gemacht wurden. Einige wenige Agenten wurden enttarnt, die bekanntesten von ihnen waren der britisch-deutsche Atomphysiker Klaus Fuchs, der englische Physiker Allan Nunn May und die amerikanischen Physiker Theodore Hall und Bruno Pontecorvo. Darüber hinaus wurden mehrere ihrer Kuriere enttarnt: Harry Gold, David und Ruth Greenglass und Ethel und Julius Rosenberg.
Es gibt unzählige Theorien über die Protagonisten des Diebstahls des bisher größten Militärgeheimnisses überhaupt. NKWD und GRU hatten nicht einfach nur umfassendes Wissen über die Herstellung atomarer Waffen erworben, sie hatten sich Skizzen angeeignet, Fotos und Formeln für jedes noch so kleine Detail der extrem komplizierten Konstruktion der Plutoniumbombe.
1995 gab die NSA Tausende Dokumente frei, die in irgendeiner Form mit dem Manhattan-Projekt befasst waren und die aus überseeischen Rezidenturas nach Moskau weitergeleitet worden waren. Mit allergrößter Sorgfalt hatte das United States Army Signal Corps, die Fernmeldetruppe des US-amerikanischen Heeres (Vorläufer der NSA), die Dokumente dechiffriert, die später unter dem Namen VENONA-Papiere bekannt wurden.
Im Oktober 2014 folgte das amerikanische Energieministerium der Empfehlung seines eigenen Öffentlichkeitsausschusses und gab bis dahin streng geheime Dokumente frei, die sich mit den Anhörungen in Bezug auf die Geheimhaltung des Manhattan-Projekts beschäftigten – und der Nichteinhaltung derselben.
Die Dokumente deuteten an, dass die Enthüllung der Geheimnisse des Manhattan-Projekts das Werk eines einzigen Individuums war: Ein einzelner goldener Faden in dem Gespinst von Informanten, Spionen und Kurieren.
Unter den herausragenden Talenten, die in den Laboratorien von Los Alamos arbeiteten, gab es einen, der an der Berechtigung des Projekts zu zweifeln begann und am moralischen Format der Menschen dieser Zeit, mit den Instrumenten blinder Zerstörung umgehen zu können. Es gab einen – möglicherweise den Begabtesten von allen –, der die Verantwortung übernahm, die Geschichte zu verändern. Ein weiteres Mal.
Und er traf eine Entscheidung, die uns alle angeht.
Kernspaltung nach dem Aufeinanderprallen eines Neutrons und eines Uran-235-Atomkerns.
»The Gadget«. Probesprengung am 16. Juli 1945 auf dem Trinity-Testgelände in der Wüste Jornada del Muerto in New Mexico (Alamogordo).
PROLOG
Militärhospital Bordenko, Gospitalnya Ploshad, Moskau 16. September 1948
General Juri Pawlowitsch Kurjakin schob den Vorhang des Untersuchungsraums auf, knöpfte den oberen Hemdkragen auf, band seine Krawatte und zog die Uniformjacke an, die schwer dekoriert war mit Ordensbändern und Medaillen. Die maßgeschneiderte Jacke hing lose an seinem abgemagerten Körper. Obgleich gerade Anfang fünfzig, bewegte Kurjakin sich wie ein alter Mann. Sein sonst gesunder und sonnengebräunter Teint war in den letzten Monaten einer schlammigen Gesichtsfarbe gewichen, das blonde Haar fiel ihm büschelweise aus. Darüber hinaus litt der General an permanentem Nasenbluten.
Die Betriebsamkeit in der bekanntesten hämatologischen Klinik des Landes drang als das Hintergrundgeräusch klingelnder Telefone, klappernder Holzschuhe der vorbeieilenden Krankenschwestern, Gesprächsfetzen und knallender Türen in das abgelegene Büro des Oberarztes.
Er setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch des Klinikchefs Oberst Poljakow. Der Oberarzt war ein korpulenter, jovialer Mann mit einer schwarzen Hornbrille. Er hatte polierte, hellrosa Nägel und schlechte Zähne. Meist trug er ein Lächeln auf dem Gesicht, heute allerdings nicht.
Der General ließ seinen Blick über das nikotingelbe Skelett hinter Poljakows Schreibtisch schweifen, zur aufgesägten Granathülse, die als Aschenbecher diente, und zu einer schweren Rückenmarkskanüle in einer mit reinem Alkohol gefüllten Schale aus rostfreiem Stahl. Eine solche Kanüle hatte wenige Wochen zuvor – äußerst schmerzvoll – seinen Beckenknochen durchbohrt und in dem weichen, wehrlosen Knochenmark herumgestochert, geführt von Dr. Poljakows energischer und behandschuhter Hand. Vielleicht genau dieses Exemplar. Ein Tropfen Blut löste sich von der Nadelspitze und stieg in dem klaren Krankenhaussprit auf, und Kurjakin verzog sein Gesicht.
Der Arzt führte die Fingerspitzen über der Krankenakte zusammen.
»Und? Was sagen Sie, Doktor? Wie lautet Ihre Diagnose?«, fragte der General.
»Die Resultate sind nicht die erwarteten, unsere Lehrbücher helfen da im Moment leider nicht weiter.«
Kurjakins Blick wanderte von der Schale zu den hinter den dicken Brillengläsern verschwommenen braunen Augen.
»Aber ich bin im letzten halben Jahr, verdammt noch mal, jeden Monat mindestens einmal hier gewesen«, brauste er auf. »Mir wurden unzählige Blutproben entnommen, diese verfluchten Knochenmarksproben … Urin und Exkremente. Und Sie können mir nach wie vor keine vernünftige Antwort geben? Ich krepiere langsam, aber sicher, zum Teufel!«
Der Arzt wurde blass, gluckste aber besänftigend: »Nicht doch, nein, Genosse Kurjakin. Natürlich sterben Sie nicht. Aber es steht fest, dass Sie von einer Knochenmark-Depression befallen sind. Alle Blutzelllinien, von den Stammzellen über Blutplättchen und rote Blutkörperchen. Die Ursache der meisten Ihrer Symptome ist ganz simpel Blutmangel geschuldet. Erschöpfung … Atemnot … Impotenz …«
Mit einem Funken Zorn und Verdruss dachte der General an seine ein Vierteljahrhundert jüngere Geliebte, eine temperamentvolle und neurotische Tänzerin vom Bolschoi-Theater, die ihn erst in der vergangenen Nacht wegen seiner Leistungen im Bett verhöhnt hatte, was sie mit einem blauen Auge und einer geplatzten Lippe bezahlt hatte – und mindestens zwei Wochen Krankschreibung.
»Alle Blutzellen, sagen Sie?«
»Eine Art chronische lymphatische Leukämie … und doch nicht ganz. Atypisch.«
»Ich bin also sehr krank?«
Der Arzt befeuchtete seine Lippen mit der Zunge.
»Das sind Sie, und darum werden wir augenblicklich mit einer intensiven Therapie mit Bluttransfusionen, Vitamin- und Mineralinjektionen beginnen und …«
Der General hob abwehrend die Hände.
»Aber was zum Teufel passiert da gerade mit mir?«
»Da bin ich mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, Genosse Kurjakin.«
»Wozu sind Sie dann überhaupt nütze?«
Der Arzt lächelte hilflos. Der General war bei der GRU, dem Militärnachrichtendienst, und hatte unbeschränkte Machtbefugnisse.
Kurjakin holte tief Luft und versuchte sich zu beherrschen.
»Und wie krank bin ich tatsächlich, Doktor? Sie brauchen es nicht hübsch zu verpacken oder mich schonen. Ich bin ein erwachsener Mann.«
»Sie meinen die Prognose?«
»Was sonst?«
Der Oberarzt legte die Handflächen aneinander und bedachte den General mit einem unsicheren Lächeln. »Es ist sicher kein Leiden, an dem Sie sterben werden. Aber ein Leiden, mit dem Sie sterben werden … zu seiner Zeit, natürlich.«
»Soll das ein Trost sein?«
Der Arzt begann zu schwitzen, obgleich es im Büro einigermaßen kühl war.
Der General grüßte die Wachposten der Roten Armee und schritt langsam die breite Treppe vor dem Hospital hinunter zu der wartenden Zil-Limousine. Auf der zweitletzten Stufe stolperte er und fluchte derb, worauf sein Adjutant, Hauptmann Kirill Gromow, besorgt zu ihm hochsah. Normalerweise war in Gromows Gesicht keine Gefühlsregung zu erkennen, falls er überhaupt welche hatte. Der Hauptmann war jung, seriös und tödlich effektiv. Er schloss die Autotür hinter dem General, ging hinten um die Limousine herum und nahm auf der Rückbank Platz. Der Wagen scherte vom Bordstein aus.
Der General lehnte sich zurück. Er befeuchtete die Zeigefingerspitze, tauchte sie in ein Depot groben Salzes in der Jackentasche und leckte das Salz ab.
Hauptmann Gromow tat, als hätte er es nicht gesehen.
Kurjakin rutschte irritiert auf dem Sitz vor. Er war nur noch Haut und Knochen, und alles tat weh. Alles.
»Der Arzt. Poljakow. Ich wünsche, dass er verschwindet«, sagte er. »Er ist komplett untauglich.«
»Verschwindet?«
In Gromows Welt hatte das Wort sehr unterschiedliche Bedeutungen.
»Die Minen in Kolyma«, entschied Kurjakin. »Außerdem ist er zu fett. Es wird ihm guttun, mit Hacke und Schaufel in einem Minenschacht zu arbeiten.«
»Wie Sie meinen.«
Kurjakin marschierte zwischen langen Reihen von Sekretärinnen und Schreibtischen durch das enorm große Vorzimmer. Mehrere Plätze waren leer. Den in der Sowjetischen Kommission für Kernphysik kursierenden Gerüchten zufolge wütete gerade eine bösartige Grippe-Epidemie im Hauptquartier.
Die Schreibmaschinen verstummten, eine nach der anderen.
»Lassen Sie sich nicht von der Arbeit abhalten, meine Damen. Machen Sie weiter …«
Der General schloss die gepolsterten Türflügel und lehnte sich dagegen, keuchend wie ein gerade noch einmal dem Jäger entkommenes Tier. Draußen war wieder das Klappern der Schreibmaschinen zu hören. Anfangs noch gedämpft wie der begleitende Trommelwirbel eines dreifachen Salto mortale am hohen Trapez. Dann lauter und hitziger, je mehr Maschinen den Chor verstärkten.
Kurjakins Privatbüro lag in permanentem Dämmerlicht. Er zog nur selten die Vorhänge vor den Fenstern auf. Die Wände waren mit hohen Holzpaneelen verkleidet. Vor einem der Fenster stand ein kleiner runder Tisch mit zwei Sesseln, und auf dem Tisch war ein Schachspiel mit wenigen Spielfiguren aufgebaut. Er hatte sie seit exakt einem Monat nicht mehr angerührt. Er fuhr sich mit einem Kamm durchs Haar und betrachtete missmutig die losen Haarbüschel. Danach inspizierte er seine Zähne und das Zahnfleisch in einem Wandspiegel und seufzte. Das Zahnfleisch blutete zwar nur leicht, aber chronisch.
Kurjakin hängte seine Uniformjacke über den Stuhlrücken und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Um Punkt 9 Uhr klopfte es an der Tür, und seine Privatsekretärin, Olesya Apalkowa, trat mit der Morgenpost auf einem silbernen Tablett ein. Sie lief schnellen Schrittes über den Parkettboden und blieb neben seinem Stuhl stehen. Er hatte immer, aus ehrbarem Abstand natürlich, die allergrößte Zuneigung für Olesya Apalkowa empfunden, die er an Stelle der unausstehlichen Ballerina als Geliebte hätte nehmen sollen. Sie stellte das Tablett mit einer anmutigen Bewegung ab, und er bewunderte nicht zum ersten Mal ihre wohlproportionierten Schenkel unter dem langweiligen grünen Uniformrock.
Sie nahm die Teekanne.
»Tee?«
Der General bemerkte mehrere lange, lose und dunkelbraune Haare auf der Schulter von Apalkowas grauem Cardigan, sagte aber nichts. Gewöhnlich war seine Sekretärin die personifizierte Makellosigkeit.
»Nein danke, Olesya Apalkowa. Heute ist der 16., nicht wahr? Ist es gekommen?«
Sie nickte.
»Es liegt zuunterst. Wie war der Besuch des Generals im Hospital?«
»… Ausgezeichnet … Vortrefflich …«
Er sah sie nicht an. Wusste, dass sie ihm nicht glaubte.
Die Sekretärin nieste in ein sauberes Stofftaschentuch. Kurjakin bemerkte winzige rostrote Flecken in dem weißen Stoff.
»Was ist nur mit den Leuten los? Das halbe Sekretariat steht leer!«
Apalkowa lächelte zurückhaltend. »Das ist die Grippe. Sie wird vorbeigehen, und die Leute werden zurückkommen.«
Die Tür schloss sich hinter ihr, und Kurjakin suchte das verhasste Telegramm aus dem Poststapel. Er öffnete das rot-weiße Kuvert und legte das dünne Blatt darin zu seinen fünf Geschwistern. Seit einem halben Jahr kam immer am 16. eines Monats diese persönlich an Kurjakin adressierte Nachricht. Die Telegramme wurden aus verschiedenen europäischen Hauptstädten abgeschickt, dieses Mal kam es aus Ankara. Der General hatte Spezialtruppen angesetzt, um den Absender zu identifizieren und zu liquidieren. Bis jetzt ohne Erfolg. Aber eines Tages würde es ihm gelingen. Es war nur eine Frage der Zeit.
Bevor er das Telegramm las, tippte er den befeuchteten Zeigefinger in eine Schale mit Salz und leckte ihn ab. In den letzten Monaten hatte er ein unerklärliches und unstillbares Bedürfnis nach grobkörnigem Küchensalz entwickelt.
BISTDUMÜDEALTERFREUNDSTOP
O ja. Ja. Er war müde wie der Tod nach Stalingrad.
HATDASNASENBLUTENBEGONNEN
Der General konnte sich nicht erklären, woher sein unbekannter, aber zutiefst verhasster Gegner von den Blutungen wusste.
BISTDUBEREIT
Ganz und gar nicht. Aber er hatte keine andere Wahl. Es war eine Frage der Ehre.
Er setzte sich an den Schachtisch. Die Figuren waren aus Ebenholz, kunstvoll und mit Liebe zum Detail geschnitzt. Kurjakin wischte mit seinem Taschentuch eine gräuliche Staubschicht vom Brett und schüttelte es aus.
Auf dem Brett standen nur noch der weiße König, ein weißer Läufer, der schwarze König und zwei schwarze Bauern. Seit sechs Monaten versuchte Kurjakin diese unbegreiflich komplizierte und frustrierende Schlusspartie zu lösen, die seinerzeit vom Schachgenie Richard Réti konstruiert wurde. Der General spielte schwarz, aber der unbekannte Gegenspieler war am Zug.
Kurjakin las die nächste Zeile des Telegramms:
WEISSERLÄUFERAUF D1X
Die Hand des Generals bewegte sich langsam über das Brett, als er einen der schwarzen Bauern mit dem weißen Läufer eliminierte. Jetzt war er dran. Seine Hand schwebte unentschlossen über dem schwarzen König. Eine Fingerspitze berührte die Krone. Er zog die Hand zurück, als hätte er sich verbrannt, legte die Stirn in Falten und knetete die Unterlippe zwischen zwei Fingern.
SCHWARZERKÖNIGAUF C3, ALTERFREUND? INDEMFALLWEISSERLÄUFERAUF E1. STOP. SCHWARZERBAUERAUF D4? WEISSERKÖNIGAUF F6!!
Kurjakin lehnte sich zurück. Es war, als bewegten sich die Figuren aus eigener Kraft. Unmöglich. Er war schachmatt. Nach einem tiefen Atemzug sah er wieder auf das Telegramm.
DUWIRSTDASLICHTDERTAUSENDSONNENNIEMALSERBLICKENSTOP
Der General seufzte verbittert. Seine Finger schlossen sich um den besiegten schwarzen König. Als er die Hand wieder öffnete, blieb ein schwacher, gräulicher Abdruck in seiner Handfläche zurück. Er betrachtete den schwarzen König, als sähe er ihn zum ersten Mal. Er fühlte sich warm an der Haut an. Er schüttelte ihn vorsichtig. Dann ließ er ihn mit einem lauten Aufschrei fallen und sprang von seinem Stuhl auf. Der schwarze König rollte über den glänzenden Parkettboden.
Im Vorzimmer schreckten alle von ihren Schreibmaschinen hoch, als die Doppeltür mit einem Krachen aufflog, und es wurde schlagartig still wie in einer Bibliothek.
»Einen Geigerzähler, Herrgott noch mal! Besorgen Sie mir einen. Sofort!«
Die Sekretärinnen starrten unsicher den General an, der in der Türöffnung stand. Nicht seine Forderung war es, die sie so verstört starren ließ. Schließlich war der General der von der GRU eingesetzte Aufsichtsvorsitzende des sowjetischen Atomwaffenprogramms, und Geigerzähler und andere Messinstrumente in greifbarer Nähe waren nichts Ungewöhnliches.
Nein, es war die instinktive Anrufung einer verbotenen und belanglosen christlichen Gottheit, die ihre Verstörung und Bestürzung weckte.
Das Eismeer nördlich von Jan Mayen, 7. Februar 1945
Leichter Schnee fiel auf die Dünung und schmolz. Es waren nur wenige Wolken am Himmel, und David hatte das Gefühl, sich nur ein wenig ausstrecken zu müssen, um die Sterne vom Himmel zu pflücken. Der weißflorige Schleier der Milchstraße flirrte von Horizont zu Horizont, und der Mond war eine schmale goldene Sichel im Osten. Im letzten September hatte er vergeblich versucht, seiner fünfjährigen Tochter Sara die elementarsten Sternbilder beizubringen, aber sie hatte hartnäckig die Namensgebung der alten Astronomen abgelehnt. Der Große Bär wurde bei ihr zum Grashüpfer, der Hund zum Piepmatz und der Zwilling zu Mutter und Vater auf Schlittschuhen.
Das Stahldeck vibrierte monoton unter Davids Fußsohlen, in seinen Ohren pochte der ruhige Puls des Dieselmotors.
Er war der einzige Zivilist an Bord der Mary Jane, einem fünfzig Meter langen, aus Maine stammenden Bergungsfahrzeug. Das Schiff war drei Monate nach Pearl Harbor von der amerikanischen Flotte eingezogen und für Konvoidienste im Nordatlantik eingesetzt worden. Die Besatzung hatte eine Kurzausbildung in maritimer Kriegsführung durchlaufen und Uniformen und unterschiedliche Dienstränge bekommen. Algernon Hawke, der Kapitän der Mary Jane, wurde zum Fregattenkapitän ernannt. Die Mary Jane war mit 20- und 40-mm-Flakgeschützen ausgerüstet und besaß Heckrampen für die Wasserbomben.
In ihrer kurzen Karriere hatte die Mary Jane 17 alliierte Konvois zwischen Loch Ewe in Schottland und Murmansk in Russland eskortiert.
Der Geleitzug JW51B war am 26. Januar 1945 aus Murmansk ausgelaufen. Frachtschiffe und Tanker in der Mitte des Konvois wurden an den Flanken von Zerstörern und Torpedobooten geschützt. Der erste Reisetag war ereignisreich gewesen: Ein Tiefdruckgebiet von der Labrador-Küste war von Westen nach Osten über das Nordmeer gezogen und hatte seine geballte Wut an dem Konvoi ausgelassen. Wind von Sturmstärke, zehn Meter hohe Wellen, dichter Schneefall und Eisgestöber.
Inzwischen hatte sich das Meer wieder beruhigt und war jetzt glatt wie ein Spiegel, doch jetzt hätte der Konvoi dieses Ragnarök willkommen geheißen, da eine aufgewühlte See den Angriff von deutschen U-Booten unmöglich gemacht hätte. Obgleich die Angriffe der sogenannten Wolfsrudel so spät im Krieg eigentlich ein überstandenes Phänomen sein sollten.
David war aus seiner Koje neben dem Maschinenraum, wo er vergeblich versucht hatte einzuschlafen, geflüchtet. Jetzt schob er sich entlang der Backbordreling zum Steven vor, wo der Lauf einer Maschinenkanone auf einen Punkt zwischen Venus und Mars zielte.
Romeo, ein junger und immer gut gelaunter Kalifornier, begrüßte ihn mit einem Lächeln und einer Packung Lucky Strike. Romeos vorschriftswidrig lange Locken zeichneten sich deutlich vor der Milchstraße ab.
Sie standen schweigend nebeneinander und rauchten, bis Romeo dem Dänen den Rücken zukehrte und mit in den Nacken gelegtem Kopf zur Brücke über ihnen schaute, wo Kapitän Hawke im Schein der Funkanlage stand.
Romeo schnipste die Kippe über die Reling.
»Er empfängt Nachrichten …«, murmelte der Amerikaner nervös.
David konnte Romeos Befürchtungen nachvollziehen: Funkstille war das 11. Gebot des Geleitzugs. Einzig vom Flaggschiff des Konvois, dem schweren Kreuzer HMS Devonshire, weitergeleitete Eiltelegramme der britischen Admiralität waren erlaubt, und ein Eiltelegramm bedeutete normalerweise, dass die britischen Codebrecher in Bletchley Park Mitteilungen zwischen den U-Booten und dem deutschen Atlantik-Kommando in Norwegen dechiffriert hatten. »Soll ich ihn fragen?«, bot David an.
Romeo zuckte unentschlossen mit den Schultern. Kapitän Hawke konnte äußerst ungehalten auf Störungen reagieren und verabscheute überflüssige Fragen. Er war der reservierteste Mensch, dem David je begegnet war, eine magere Bronzesphinx, geboren in einer maritimen Gießerei irgendwo in New England.
Andererseits war David eine zivile Landratte ohne jede militärische Bedeutung: ein Passagier, schlicht und ergreifend. Er besetzte eine kleine, neutrale Zone an Bord der Mary Jane. Die Besatzungsmitglieder plauderten mit ihm über alles Mögliche, auch sehr Vertrauliches und Privates, was wahrscheinlich, wie David vermutete, an seiner Neutralität und der Tatsache lag, dass er niemandem von der Besatzung je wieder begegnen würde, nachdem er in Schottland von Bord gegangen war.
Kapitän Hawke behandelte ihn mit gleichbleibender Höflichkeit und Gastfreundschaft.
David sah Romeos weiße Zähne kurz aufblitzen.
»Okay. Fragen Sie ihn. Aber um Himmels willen vorsichtig.«
David hatte sich zu der Leiter umgedreht, die hoch auf die Brücke führte, als Romeo ihn mit einem Aufschrei an der Schulter packte und mit der anderen Hand nach Osten zeigte.
Das erste Schiff im Zug wurde von einem Torpedo getroffen. Sie sahen einen weißen, blendend grellen Lichtblitz und eine grün schimmernde Wassersäule, die zum Himmel emporstieg. Wenige Sekunde später erreichte sie das laute Grollen der Unterwasserexplosion auf einer Druckwelle heißer Luft.
»Das ist Clarence!«
Das amerikanische Tankschiff lag hoch im Wasser, nachdem es in Murmansk seine Tanks mit Tausenden Tonnen Flugbenzin entleert hatte. Die Treibstoffgase in den leeren Tanks entzündeten sich in einer Serie neuer, dumpfer Explosionen. Das Schiff stand still im Wasser, als wäre es auf einen Eisberg aufgefahren. Dann brach sein Rückgrat, und beide Steven richteten sich in einem grotesken Winkel auf.
Der Tag des Jüngsten Gerichts brach an.
Romeo lief nach achtern zu den Wasserbomben. Auf allen Schiffen des Geleitzugs heulten Sirenen. David sah, wie Kapitän Hawke sich über das Sprachrohr zum Maschinenraum beugte, um volle Kraft auf allen Maschinen zu beordern. Die Luken flogen auf, die Besatzung strömte aufs Deck und verteilte sich an die Kampfstationen. Sie trugen nur Unterwäsche, Rettungswesten und Helme, und ihre nackten Glieder leuchteten gespenstisch weiß vor dem schwarzen Meer. Zerstörer und Torpedoschnellboote fuhren Richtung Süden, dorthin, wo die Sonare ihnen die ungefähren Positionen der U-Boote angezeigt hatten. Der messerscharfe Steven drückte weiß schäumende Bugwellen hoch und an Deck. Die Suchscheinwerfer streckten ihre weißen Finger tief in die feindliche Dunkelheit.
David presste sich gegen die Reling, um nicht im Weg zu stehen. Weit über sich hörte er Kapitän Hawkes Kommandostimme und das Geräusch schwerer Schraubenschlüssel, die die Wasserbomben einstellten. Die Ketten am Ende der Rampe wurden entfernt, und die ersten rollten los und verschwanden im Kielwasser der Mary Jane.
Instinktiv und aus einer unheilschwangeren Vorahnung heraus wendete David seinen Blick nach Süden und sah unmittelbar an der Horizontlinie einen unnatürlich roten Punkt aufblitzen, wie eine aufflackernde rote Kerzenflamme … das rote Licht des Infrarot-Nachtsichtgeräts eines U-Bootes.
Hawke hatte oben auf der Brücke sein Nachtsichtgerät auf exakt den gleichen Punkt wie David gerichtet. Er setzte es ab und schaute runter zu dem Dänen.
Das Gesicht des Kapitäns war kaum zu sehen, aber in Davids Augen spiegelte sich pure Resignation darin.
»Torpedo! Hundertfünfundsechzig Grad …«
Hawkes Stimme schnitt klar durch den Tumult und die Betriebsamkeit an Deck. Alle unterbrachen ihre Unternehmungen und schauten auf. Der Kapitän lief zurück zur Kommandobrücke, und Mary Janes runder, solider Steven setzte zu einem Seitwärtsschwenk an.
David beobachtete mit angehaltenem Atem und um die Reling gekrümmten Fingern einen unheilverkündenden, quecksilberglänzenden Schimmer vielleicht vierhundert Meter entfernt auf die Backbordseite der Mary Jane zuschießen.
Mit reiner Willensanstrengung zwang er seine Hände aus der Umklammerung um die Reling und seine Füße, sich auf die Luke zum Decksaufbau zuzubewegen, wo er die steile Stiege zum Maschinendeck in Mary Janes Bauch hinunterrutschte. Während David durch den schmalen Korridor lief, begann ein nüchterner, mathematischer Bereich seines Gehirns die Geschwindigkeit des Torpedos zu berechnen und den geschätzten Zeitpunkt für die Kollision. Die Zahlen erschienen vor seinem inneren Auge wie auf einer Filmleinwand. Der deutsche T5-Zaunkönig-Torpedo hatte eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 25 Knoten und führte eine Sprengladung von 540 Pfund TNT mit sich, mehr als genug, um einem kleineren Schiff als der Mary Jane die Eingeweide aus dem Leib zu reißen. Der Torpedo war vielleicht vierhundert Meter entfernt, als er ihn entdeckt hatte, was bedeutete, dass …
Während er Stoßgebete an alle Götter murmelte, die ihm in den Sinn kamen, von Jahwe bis Poseidon, riss er die Luke zu seiner kleinen privaten Kajüte auf, fiel auf die Knie und zog den kostbaren gelben Ölhautrucksack aus dem schmalen Hohlraum unter der Koje, warf ihn über die Schulter und rannte zurück an Deck.
Plötzlich kippte der Boden in einem jähen Ausweichmanöver abrupt unter seinen Füßen zur Seite. David knallte mit dem Kopf gegen ein Schott und stürzte. Blut tropfte aus einer Wunde an der Stirn, als er sich wieder aufrappelte und zur Reling lief.
Leidenschaftslos beschäftigte sich sein Hirn weiter mit den Zahlen: 400 Meter … Der Torpedo bewegte sich circa 13 Meter pro Sekunde durchs Wasser … Er stolperte an dem Handlauf entlang, brach sich einen Fingernagel ab … Sie hatten noch … wie viel? … Acht Sekunden! Er flehte die urzeitlichen Dieselmotoren der Mary Jane, die Antriebswellen und die gigantischen Bronzeschrauben an, ihre verdammte Pflicht zu tun und sie alle zu retten.
Er starrte aufs Wasser und entdeckte das todbringende Projektil nur zwanzig Meter entfernt. Der Torpedo schoss viel zu schnell in einer Hülle aus weißen Luftblasen durch das schwarze Wasser, und ihr Schiff war viel, viel zu langsam.
In buchstäblich letzter Sekunde vor dem Aufprall sprang David auf die leeren Kartoffelkisten, die akkurat für so eine Notsituation am Seitendeck des Schiffes angebracht waren: der gefürchtetste Schaden bei einem Torpedoangriff wurde durch den unmittelbaren senkrechten Anstieg verursacht, mit dem ein Schiff mit Mary Janes Tonnage auf einen Treffer reagierte. Das Schiff würde sich in weniger als einer Sekunde einen Meter heben. Wenn man in dem Augenblick auf einem unnachgiebigen Stahldeck stand, würden die Oberschenkelknochen sich, die Beckenknochen zerschmetternd, weit in die Bauchhöhle bohren.
Der Torpedo rammte das Schiff unmittelbar hinter der Schornsteinlinie.
Wie lange er unter Wasser gewesen war, wusste David nicht, aber er fühlte sich wie zwischen eiskalte Walzen geraten. Sein Schädel schrumpfte. Dann durchbrach er hustend und spuckend die Oberfläche. Er trat Wasser und sah sich panisch um. Das Wasser stand dem todgeweihten Bergungsfahrzeug bis an die Reling. Das sonore Vibrieren im Wasser, das er nicht nur hörte, sondern vor allen Dingen fühlte, bedeutete, dass die mächtigen Schiffsmaschinen nach wie vor arbeiteten. Darüber war ein wildes, unrhythmisches, metallisches Klopfen zu hören wie von einem im Schiffsbauch Gefangenen, der verzweifelt gegen eine Luke oder ein Schott hämmerte.
Plötzlich traf ihn von der Seite eine Hitzewelle, und die Dunkelheit verschwand wie bei einem jähen Sonnenaufgang. Die Luft um ihn herum war erfüllt von den Schreien der Männer und dem beißenden, bitteren Geruch brennenden Dieselöls. Die Flammen breiteten sich mit unfassbarer Geschwindigkeit auf dem Wasser aus. David holte tief Luft und tauchte unter. Über sich sah er die Flammenzungen auf dem brennenden Ölteppich und schwamm unter Wasser weiter.
Sein rechtes Bein fühlte sich ab dem Knie abwärts wie ein schmerzhaftes, fremdes Anhängsel an. Er hatte nicht mitbekommen, wo oder wie er sich verletzt hatte.
Seine Lunge begann zu brennen. Er würde nicht mehr viel länger durchhalten. Die Kälte tat ihr Übriges, seine Bewegungen wurden unkoordiniert und kraftlos. Er schluckte mit aufeinandergepressten Lippen, gierte nach dem erlösenden, kalten Atemzug, der sein letzter sein würde.
Er schwamm zur Oberfläche und durchbrach sie kurz vor den ausgestreckten Flammenfingern.
Er blinzelte das salzige Wasser aus seinen Augen und hörte jemanden schreien. Romeo war von Flammen eingekreist. Sein Körper schob sich aus dem Wasser, als würde er von unten hochgedrückt. Das Gesicht war unversehrt, aber der Mund war ein großes schwarzes Loch, das helle, spitze Schreie ausstieß. David konnte den Blick nicht losreißen von seinem gequälten Schiffskameraden und hoffte nur, dass Romeos junge Seele den brennenden, sich windenden Körper bereits verlassen hatte.
Der Kalifornier verschwand verkohlt unter der Oberfläche. Erst jetzt nahm David die Rufe hinter sich wahr, aber seine Kraft verließ ihn, und er sank.
Starke Hände packten ihn. Er knallte mit dem Kopf gegen das Rettungsfloß, als er aus dem Wasser gezogen wurde. In gewaltsamen Krämpfen spuckte er Galle und Meerwasser, und jemand schlug ihm kräftig zwischen die Schulterblätter.
Danach breitete sich Stille zwischen dem halben Dutzend Überlebender auf dem Floß aus. David stemmte sich auf die Knie hoch und schaute zur Mary Jane, die sich majestätisch in der flachen Dünung drehte. Die Schiffsunterseite war von schorfigen weißen Seepocken überzogen wie ein alter Wal. Dann verschwand sie, und das Meer schloss sich über ihr.
Erst in diesem Moment merkte David, dass etwas … etwas sehr Wichtiges fehlte. Er sah sich nach dem Rucksack um und entdeckte fünf, sechs Meter entfernt etwas Gelbes im Wasser.
David ließ sich zurück in das verhasste, feindliche Element gleiten. Die Männer schickten Flüche hinter ihm her.
Drei Meter. Zwei Meter. Seine Gliedmaßen waren entsetzlich schwer, das rechte Bein war nur noch Schmerz.
Der Rucksack verschwand aus seinem Sichtfeld.
Maidencombe, Devon, 20. März 1945
David starrte an die von feuchten Flecken überzogene Decke. Er versuchte still zu liegen, weil die geringste Bewegung die ausgeleierten Bettfedern zum Jammern brachte. Was sich kaum vermeiden ließ, wenn man von Fieber geschüttelt wurde. Die vergilbte Blumentapete hatte jegliche Bemühungen, an den Wänden haften zu bleiben, aufgegeben, und der Gasofen war kalt wie ein Wintergrab.
Er hatte mit weit aufgerissenen Augen geträumt.
Schwaches, verwässertes Tageslicht fiel durch das einzige Fenster des Raumes. Der Morgen versprach genauso grau, wolkenverhangen und stürmisch zu werden wie die vorhergegangenen. Sie nannten es Devon-Grau: Die vom Ärmelkanal heranrollenden Nebelbänke machten die Welt eintönig und zweidimensional.
Er hörte den Wind in den Telefonleitungen vor dem Fenster und die sich verschiebenden Schieferplatten auf dem Dach. Dann drang das ferne, enervierende Geräusch eines deutschen Heinkel-Aufklärers durch die Fenster, der vermutlich auskundschaften sollte, ob sich an der englischen Südküste noch Invasionstruppen befanden, die auf die Verschiffung warteten.
Er überlegte erschöpft, ob er versuchen sollte, den Traum festzuhalten oder sich durch einen weiteren Tag in diesem gottverlassenen Exil zu kämpfen.
Und wie an jedem ewig wiederkehrenden Morgen betrachtete er den wippenden Zweig, vom dem die Frage aufflog, ob es heute passieren würde? Würden sie heute kommen? Würden sie jemals kommen? Und wollte er die Antwort überhaupt wissen?
David setzte sich auf die Bettkante und zog behutsam das rechte Hosenbein seines Pyjamas bis übers Knie, um das blauknotige und straffe Narbengewebe zu inspizieren, das sich über die Innenseite des Knies zog, wo eigentlich Haut, Bindegewebe, Muskeln, Sehnen und Gelenkkapseln hätten sein sollen. Die Kniescheibe war gleichermaßen vor und zurück wie seitwärts beweglich.
Im Laufe der Nacht hatte sich in dem Narbengewebe eine neue, empfindliche Beule gebildet. Er tastete in der Leiste nach geschwollenen Lymphdrüsen, die bedeuteten, dass die Entzündung noch nicht aus der Wunde war, und fand ein paar harte, nussgroße Knoten.
Er zog das Hosenbein wieder runter. Trotz der Kälte, die die Dachkammer in der Pension der Witwe O’Sullivan in winterlichem Klammergriff hatte, war er schweißgebadet.
Die stabilisierende Kniebandage lag neben dem Bett auf dem Boden. Der Sattler im Ort hatte sie nach den Anweisungen des Militärarztes Dr. Rhodes aus Stahl und Leder angefertigt. Mühsam zog David die verhasste Bandage über das Bein, hakte die Verschlüsse ein und stand auf.
Als er wieder zu sich kam, konnte er nicht sagen, wie lange er bewusstlos gewesen war. Er zog sich mithilfe der Ellenbogen über den Linoleumboden. Am Abend zuvor hatte er einen kleinen Stapel Schillinge neben den Gasofen gestellt. Sein letztes Geld. Mit zitternden Fingern schob er die Münzen in den Automaten und hörte das Gas durch die Rohre rauschen.
Während es allmählich wärmer wurde in der Kammer, lag David mit unter das Kinn gezogenen Knien in Embryonalhaltung da und betrachtete den gelben Ölzeugrucksack, der schlaff unter dem Bett lag – und ihn um ein Haar das Leben gekostet hätte.
Normalerweise war das Frühstück in der Pension eine stille und triste Angelegenheit. Mrs. O’Sullivan führte ein drakonisches Regiment. David wusste von ihr, dass sie die Witwe eines Keksfabrikanten war, den sie schon vor langer Zeit ins Grab geschickt hatte. Ihr fünfunddreißigjähriger Sohn wohnte in einem Schuppen hinter dem Haus und war ein verklemmter und zutiefst phlegmatischer Mensch, der sich ausschließlich für Taubenwettflüge interessierte.
Die Hausordnung der Pension hatte mehr Gebote als das 3. Buch Mose.
Die Witwe beherbergte Patienten aus dem örtlichen Militärhospital. Die Pension sollte den versehrten Veteranen eine Freistatt und ein wenig Ruhe bieten auf ihrem schwierigen Übergang vom aktiven Kriegsdienst zurück ins zivile Leben. David, der nicht nur Zivilist, sondern obendrein noch Staatsbürger eines besetzten Landes war, war in den Augen der Witwe O’Sullivan eine wahre Pestilenz.
Zähneklappernd hatte er die unappetitliche Masse aus aufgebackenem Roggenmehl und Eipulver auf der graukrümeligen Unterlage runtergewürgt und jagte zerstreut ein paar gebratene Tomaten mit seiner Gabel über den Teller. Mrs. O’Sullivan war maßlos stolz auf ihr Gewächshaus. Er trank Tee – mit einem Löffel Zucker pro Tasse – und dachte an den Pilgermarsch, der ihm im Laufe des Tages zum Militärhospital weiter unten an der Küste bevorstand. Er schob seinen Teller beiseite und wischte sich die Lippen mit der Stoffserviette ab.
Mrs. O’Sullivan, eine kräftige, stämmige Frau in einem fadenscheinigen, geblümten Baumwollkleid, betrat das Speisezimmer. Sie schaute auf seinen Teller. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns wissen ließen, ob Sie die gebratenen Tomaten wollen oder nicht, Mr. Adler. Ihnen ist sicher bekannt, dass die hier nicht auf Bäumen wachsen.«
David sah an ihr vorbei zu der dampfenden Küche, wo ein Stab verschüchterter Mädchen aus den umliegenden Dörfern mit Töpfen und Pfannen hantierte.
»Natürlich.«
»Und ich wäre Ihnen ebenfalls sehr verbunden, wenn Sie sich morgens etwas zeitiger am Frühstückstisch einfinden könnten. Die Mädchen müssen jetzt schon wieder das Mittagessen vorbereiten.«
»Ich bitte Sie, meine tief empfundene Entschuldigung anzunehmen, Mrs. O’Sullivan«, murmelte David.
Der Devon-Dialekt war normalerweise weich, freundlich und fett wie Sahne, aber aus Mrs. O’Sullivans Mund klang er wie scharfe Salzkristalle.
Mit übertriebenen Gesten räumte sie den Tisch ab – inklusive seiner halb vollen Teetasse.
David bemerkte ein Zwinkern und ein blasses Lächeln von einem jungen Hauptmann der Long Range Desert Group, der an einem Tisch hinter der Tür und außerhalb des Blickfelds von Mrs. O’Sullivan saß. Der rechte, leere Ärmel des Hauptmanns war mit einer Sicherheitsnadel an seiner Uniformjacke festgesteckt. Das Weiße seiner Augen war gelb vom Chinin.
Mrs. O’Sullivan war noch lange nicht fertig.
»Ich gehe mal nicht davon aus, dass es Neuigkeiten wegen Ihrer Abreise gibt? Wie lange sind Sie jetzt schon hier – sechs Wochen?«
»Vier«, korrigierte David sie. »Ich befürchte, dass in dieser Hinsicht keine erfreulichen Nachrichten zu erwarten sind. Bedaure. Ich wünschte, es wäre anders.«
»Worauf warten Sie eigentlich, Mr. Adler?«, fragte sie.
David betrachtete die kleinen Krümel harten Kriegslippenstifts in Mrs. O’Sullivans Mundwinkeln.
»Mmh … Das ist nicht so einfach zu beantworten.«
»Und was ist mit der Miete für diesen Monat?«
David bekam jeden Monat ein Taschengeld von dem ortsansässigen Lions Club, nicht viel, aber genug zum Leben. Dr. Rhodes hatte ihn als Bedürftigen vorgestellt. Er ließ die Serviette von der Tischkante rutschen und tat so, als würde er es nicht merken.
»Ich habe die an Gewissheit grenzende Vermutung, dass sich meine finanzielle Situation im Laufe weniger Stunden vorteilhaft verändern wird«, sagte er. »Danach sollte ich in der Lage sein, meine Unterbringung für die ausgemachte Zeit zu begleichen … bis in zehn Tagen, also.«
Das Lächeln des Hauptmanns wurde breiter. David erhob sich. Mrs. O’Sullivan bückte sich, um die Serviette aufzuheben. David warf einen Blick aus dem Fenster und blieb reglos stehen. Dreißig Meter die Straße runter parkte ein schwarzer, glänzender und offiziell aussehender Humber Imperial vor dem Laden des Schuhmachers. Er konnte nicht erkennen, ob im Wagen jemand saß. In den letzten Tagen hatte er dieses Fahrzeug an verschiedenen Stellen im Ort gesehen.
»Das Auto dort … vor Mr. Haileys Werkstatt …«
Davids Herz schlug schneller beim Anblick des Humber. Es tauchten immer mal wieder Autos im Ort auf, die niemand kannte, fremde Gesichter, die niemand zuvor gesehen hatte. Aber die verschwanden immer wieder.
Mrs. O’Sullivan stellte sich neben ihn und wischte ihre geröteten Hände an einem Wischlappen ab. Sie verströmte einen Duft von gekochtem Kohl und abgestandenem Eau de Cologne.
»Was für ein Auto?«
David zeigte auf die Straße.
»Das große schwarzglänzende dort drüben.«
»Ich habe genug um die Ohren, dafür zu sorgen, dass Sie alle satt und zufrieden sind, und habe keine Zeit, zu jeder Zeit und Unzeit aus dem Fenster zu schauen, Mr. Adler, darum …«
David fiel ihr ins Wort.
»Selbstverständlich, und das wissen wir alle sehr zu schätzen. Danke.«
Er schielte zum Hauptmann. Der junge Mann, der etwa in Davids Alter sein mochte, aber zwanzig Jahre älter aussah, schüttelte den Kopf.
Mrs. O’Sullivan war nicht zu bremsen.
»Ist es völlig ausgeschlossen, dass Sie eventuell ein paar Rationierungsmarken zugeteilt bekommen könnten? Für Fleisch. Oder Zucker? Alles wäre willkommen. Es ist unendlich schwierig, über die Runden zu kommen, wenn einige wenige Gäste nichts beitragen.«
Dieses Gespräch hatten sie schon unzählige Male geführt.
»Ich werde im Rathaus nachfragen«, sagte er. »Noch einmal einen guten Tag.«
Als er unten aus dem Haus trat, war der Humber verschwunden.
Er schaute sich um, und als er ihn nirgendwo entdecken konnte, schlug er den Mantelkragen hoch und humpelte die Straße hinunter.
Maidencombe war eine eigentlich recht hübsche, kleine Ortschaft an Devons Küste. Die meisten Häuser hatten graue Ziegeldächer, der Rest war strohgedeckt. Ohne den ewigen, grauen Nebel, der durch die Kopfsteinpflastergassen und Straßen waberte, hätte dies ein malerischer Platz sein können. Gerade schien die Sonne ausnahmsweise einmal beschlossen zu haben, die Wolkendecke zu durchdringen. Trotz des Fiebers hob David den Kopf und schwang leicht mit dem Arm. Selbst sein Atem ging leichter.
Er marschierte an The Thatched Tavern vorbei, dem beliebtesten Pub im Ort. Vor der Kneipe saß wie gewohnt ein rotwangiger, junger Veteran ohne Beine und bot Passanten Kaugummi, Bleistifte, Zigaretten und paradoxerweise Schnürbänder feil. Eine laute Gruppe Angestellter des amerikanischen Bomberkommandos in Winkley und Exeter füllte die Straßen. Die Amerikaner waren kräftiger, wohlgenährter und größer. Sie hatten schönere Zähne und sahen gesünder aus als ihre britischen Kollegen.
Das Geräusch des deutschen Fliegers kam und ging.
David verließ den Ort auf dem Küstenpfad, der sich über grasbewachsene Hänge und steile Klippen durch Watcombe bis runter nach St. Marychurch schlängelte. Nach einer halben Stunde lehnte er sich außer Puste gegen ein Schild mit der mahnenden Aufschrift: Von der Kante fernhalten!
Er wünschte, das wäre möglich.
David legte die Stirn in Falten, als sich leise Klangfetzen eines Kirchenliedes den Abhang hocharbeiteten. Spielte ihm seine überspannte Fantasie einen Streich, und bildete er sich das nur ein? Er trat an die Felskante heran.
Auf einem schmalen Steinstrand weit unter sich sah er die kleine Baptistengemeinde des Ortes bei der Taufe einiger Neubekehrter. Die Gemeindemitglieder trugen weiße Gewänder und sangen aus voller Kehle. Der Priester stand in einem einfachen, schwarzen Anzug bis zum Bauch im Wasser. Er hatte eine Hand unter den Nacken einer jungen Frau gelegt und zeichnete mit der freien Hand das Kreuzzeichen über ihrer Brust. Die Frau hielt sich die Nase zwischen zwei Fingern zu, schloss die Augen und ließ sich lächelnd mit dem ganzen Körper unter Wasser gleiten. Ihr langes dunkles Haar fächerte sich wie schwerelose Bänder auf der Oberfläche auf, und das jungfräulich weiße Gewand blähte sich nach oben.
David wischte sich den Schweiß von der Stirn und wandte sich wieder um; und da war er wieder, der schwarze Humber Imperial. Er fuhr ebenfalls in südlicher Richtung die Küstenstraße entlang.
Eine Stunde Fußmarsch später fiel der Pfad zum Meer ab, und die steilen schwarzen Dächer und hohen Schornsteine des Gutsgeländes ragten hinter den sie einrahmenden Alleen und aus dem Park und dem Wald auf: ein freundlicher und zivilisierter Flecken goldener gotischer Sandsteinarchitektur und Gartenkunst an der ansonsten nackten und schroffen Küste.
Sein Knie schmerzte wahnwitzig.
Das Gut diente seit der Evakuierung der britischen und alliierten Expeditionskorps bei Dünkirchen im Mai 1940 als Militärhospital. Die adelige Familie hatte sich großzügig nach London zurückgezogen, solange der Krieg nun einmal währte. Malerische Rasenflächen erstreckten sich bis zu einem schmalen Strandstreifen, und die Sonne hatte die meisten Bewohner ins Freie gelockt. Überall standen Liegen, Tragen, Korbstühle und Rollstühle herum. Krankenschwestern und Pflegerinnen in gestärkten Uniformen und Häubchen servierten Tee und Kuchen, lasen vor, trösteten und schrieben Briefe für die verstümmelten Soldaten, die die erstversorgenden Feldlazarette in der Normandie, der Bretagne und den Ardennen überlebt hatten.
David saß auf einer der Untersuchungsliegen in Dr. Rhodes’ Klinik, die in der Bibliothek des Herrenhauses eingerichtet worden war. Von den Seidentapeten blickten die Vorväter der Besitzer streng auf ihn herunter. Einer von ihnen, mit stechend blauen Augen, Tropenhelm und wallend rotem Backenbart, stand, auf eine lange Büchse gestützt, mit seinem knöpfstiefelbekleideten Fuß zwischen den Schulterblättern eines gefallenen, federkronengeschmückten Zulukriegers.
Davids Finger schlossen sich fest um den Rand der Pritsche, als Dr. Rhodes auf ihn zukam.
Der Arzt war ein mittelgroßer, vorwiegend heiterer und distinguierter Mann in den Sechzigern mit energischen, routinierten und zielstrebigen Gesten. Der untere Teil seines Gesichtes war von einem Mundschutz bedeckt.
Dr. Rhodes schnalzte vorwurfsvoll mit der Zunge: »David, mein Junge … das wird nun leider ein wenig schmerzhaft werden. Ich begreife wirklich nicht, wie Sie es fertigbringen, Teile Ihres Skelettes auf diese hartnäckige und ehrlich gesagt frustrierende Weise abzustoßen. Wollen Sie nicht ein für alle Mal damit aufhören?«
»Ich tue das ganz sicher nicht mit Absicht«, nuschelte David und biss sich auf die Unterlippe. Er starrte auf sein jodgelbes Knie, das unbeherrscht zitterte.
»Etwas Äther?«
»Ich krieg Kopfschmerzen von Äther.«
Dr. Rhodes legte die Pinzette weg und nahm stattdessen ein Skalpell vom Instrumententisch. Das Blatt reflektierte die Sonne und warf helle Flecken an die Wand.
David starrte wie hypnotisiert auf das Messer. Er wusste, dass der Arzt im nächsten Augenblick die Beule aufschneiden würde.
»AAARRRGHHH!«
Das Knie zuckte spastisch, am liebsten hätte er dem Chirurgen gegen den Kopf getreten.
Dr. Rhodes grub einen Stumpen toten Knochengewebes von der Größe eines äußeren Fingergliedes aus der Wunde und pfiff durch die Zähne. Dem Knochensplitter folgte ein Löffel voll Eiter. Die kornblumenblauen Augen des Arztes strahlten David an.
»Ah! Pus bonum … der reine Eiter. Wunderbar.«
Tränen pressten sich aus Davids Augenwinkeln, das Atmen fiel ihm schwer.
»Schhhhhh…! Zum Teufel …«
Routiniert spülte Dr. Rhodes die Wunde mit sterilem Salzwasser aus, verband das Knie mit Kompressen und einer elastischen Binde und befestigte das Ganze mit einer Schleife aus Leinenband.
David zog die Lederbandage mit zitternden Händen darüber.
Obgleich er wahnsinnige Schmerzen hatte, spürte er wenig später, wie das Fieber schlagartig nachließ. Es grenzte an ein Wunder.
Der Arzt reichte ihm ein braunes Pillenglas.
»Dreimal am Tag jeweils eine Tablette, bis das Glas leer ist.«
»Was ist das?«
Dr. Rhodes zog die braunen Gummihandschuhe aus und nahm den Mundschutz ab, ehe er sich eine Pfeife anzündete, sich auf dem Schreibtischstuhl vor den gotischen Fenstern der Bibliothek niederließ und die Beine übereinanderschlug.
»Ein neues Wundermittel namens Penicillin. Es heißt, dass es für alle Zukunft die Chirurgen arbeitslos machen wird.«
»Wollen wir es hoffen.«
David rutschte von der Pritsche und richtete sich auf. Sein Hosenbein rutschte hinunter.
»Läuft ansonsten alles, wie es soll?«, fragte Dr. Rhodes.
»Abgesehen vom Knie, meinen Sie?«
»Ja, abgesehen vom Knie … Dieser verfluchte Krieg wird bald vorbei sein, David. Schon bald können wir alle heimkehren zu unseren Höfen, Netzen und Äckern.«
»Gut …«
»Wie ist es in der Pension?«
»Wunderbar, danke.«
Der Arzt ließ meditativ den Blick über die sonnenbeschienenen Rasenflächen schweifen. Selbst das Meer am Ende des Parks schimmerte heute silbrig und freundlich.
»Gott sei gedankt für den Sonnenschein«, sagte er. »Ich hatte fast vergessen, wie sich das anfühlt. Man ist gleich besser aufgelegt, nicht wahr?«
David lehnte sich an einen ausgestopften Rothirsch und musterte Dr. Rhodes.
»Auf meinem Weg über den Küstenpfad hierher habe ich einen schwarzen Humber Imperial vom Gutsgelände fahren sehen, als ich um die Ecke bog. Das sah nach offiziellem Besuch aus, würde ich sagen. Gäste?«
Der Arzt erwiderte seinen Blick nicht und fischte stattdessen einen Umschlag aus der Innentasche seiner Jacke.
»Das hätte ich fast vergessen. Das ist etwas Bargeld, David. Nicht viel, aber genug für ein paar Bier im Pub und um Mrs. O’Sullivans scharfe Zunge etwas zu schleifen.«
»Tausend Dank. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar.«
David setzte sich auf den Besucherstuhl und nahm den Umschlag entgegen. Der Geruch von Jod, Äther und infiziertem Gewebe bereitete ihm Übelkeit.
»Das ist das Mindeste, was wir tun können. Wie sieht es mit Kleidung aus, David? Einige unserer Patienten fahren trotz unserer größten Bemühungen in den Himmel auf. Die freiwilligen Helferinnen reinigen und plätten die Kleider, dass sie fast wie neu sind.«
»Eine Generalsuniform wäre möglicherweise sehr nützlich.«
Dr. Rhodes lachte einen Tick zu herzlich.
»Ich befürchte, ein Artillerie-Feldwebel ist das Beste, was wir Ihnen momentan bieten können.«
»Sehr freundlich, aber ich habe ausreichend Kleidung. Aber wer waren die Gäste?«
Der Arzt zündete erneut die Pfeife an und schaute auf einen Punkt über der rechten Schulter des Dänen.
»Ich bin ein einfacher Chirurg und kein Verwalter oder Diplomat, aber ich habe eingewilligt, auf diesem Stuhl sitzen zu bleiben, bis der Krieg vorbei ist. Als Klinikchef muss ich versuchen, private Diskretion und offizielle Pflichten unter einen Hut zu bringen. Die häufig widersprüchlich sind. Ich bin mir sicher, dass Sie das verstehen.«
David nickte, und Dr. Rhodes fuhr fort: »Wir können die Behandlung Verwundeter nicht ablehnen, egal ob Freund oder Feind. Aber später … wenn sie so weit wieder auf den Beinen sind, müssen sie sich alleine weiterhelfen. Wir können den Feinden des Empires kein Asyl gewähren, die in allen nur erdenklichen Verkleidungen auftreten. Der Krieg ist längst nicht in den Augen aller vorbei.«
»Ich verstehe.«
Der Arzt lächelte. »Natürlich. Wir bekommen immer mal wieder Besuch von sowohl zivilen als auch militärischen Behördenvertretern, die über die Situation und das Befinden gewisser Individuen auf dem Laufenden gehalten werden wollen. Das ist nun mal ihre Aufgabe. Ich kann Ihnen natürlich keine konkreten Fälle nennen, aber Ihnen zumindest versichern, dass alle medizinischen Fakten hier verbleiben …«
Dr. Rhodes tippte sich mit der Pfeifenspitze gegen die Schläfe.
David erhob sich von seinem Stuhl. Sein Knie fühlte sich schon viel besser an.
»Ich habe einfach das Gefühl, am Ende einer Sackgasse mit der Nase vor einer Mauer zu stehen«, murmelte David.
Dr. Rhodes begleitete ihn zu der Eichentür mit geschnitzten Jagdmotiven.
»Sie befinden sich in einem Zustand unfreiwilliger Passivität. Im Limbo. Wie wir alle. Das ist ganz natürlich, aber mehr ein Gemütszustand als irgendetwas sonst.«
Der Arzt öffnete die Tür zu der riesigen Halle.
»Wenn ich mich nicht täusche, habe ich Oberst Stavros im Park herumschleichen sehen. Wollen Sie spielen?«
David sah ihn mit leerem Blick an.
»Spielen?«
»Schach, David. Wie Sie es immer tun.«
Der Arzt kniff die Augen zu.
»Sie stehen heute aber wirklich neben sich, mein Junge.«
David gab sich Mühe, sich zu konzentrieren.
»Alles in Ordnung, Doktor. Mir fehlt nichts. Natürlich spiele ich. Die Sonne scheint, und …«
Er fand seinen Freund, Oberst Andrea Stavros von der 5. griechischen motorisierten Division, an einem weißen, kunstfertig geschmiedeten Tisch in der Nähe des Strandes. Das Schachbrett stand parat, aber Andrea hatte die Figuren noch nicht aufgestellt. Er hob eine Hand zum Gruß, als er den jungen Dänen kommen sah.
Der Grieche war zwei Meter groß und entsprechend breit. In Jugoslawien hatte sich eine Maschinengewehrkugel durch seine Lunge gebohrt. Die Karte zweier Weltkriege hatte sich in sein braunes Gesicht eingebrannt.
David setzte sich und streckte sein Bein aus.
Andrea musterte ihn aufmerksam.
»Du siehst blass aus. Was hat der Großinquisitor mit dir angestellt?«
David verteilte die Figuren auf dem Brett.
»Er hat an mir rumgeschnippelt. Mein Körper stößt Teile ab wie ein Leprakranker.«
»Du wirkst tatsächlich etwas kürzer als bei unserem letzten Treffen«, räumte der Oberst ein. »Was mich an diese durch und durch wahre Geschichte erinnert …«
Andrea drehte im Verborgenen unter dem Tisch den Flachmann auf und füllte zwei Silberbecher. Sie prosteten sich stumm zu und tranken. Der achtzigprozentige Raki, der einem den Zahnschmelz wegätzte, bescherte David eine Hustenattacke, die ihm die Tränen in die Augen trieb.
»Noch einen?«, fragte Andrea.
»Danke.«
Das deutsche Aufklärungsflugzeug flog an der Küste entlang. Andrea schaute gereizt zum Himmel.
»Die Dreckskerle haben mich geweckt«, brummte er, leerte den Becher und schnalzte anerkennend mit der Zunge. »Man sollte eigentlich meinen, es gäbe andere und nicht so komplizierte Möglichkeiten des Selbstmords, als in einer alten Blechkiste über den Kanal zu fliegen und die Landschaft zu observieren, die im Übrigen gespickt ist mit Spitfires und Mustangs, die mindestens dreimal so schnell sind wie die Antiquität da oben.«
Er schenkte noch mal nach.
»Ansonsten ist hier nichts zu sehen außer Äckern, Schafen und hässlichen Frauen.«
»Das können die ja nicht wissen.«
Andrea war noch nicht fertig.
»Wieso zum Teufel geben die sich nicht selbst die Kugel, ehe sie aus dem Vaterland abheben, und ersparen anderen die Mühe.«
Gleich darauf lächelte er in seinen Bart.
»Was mich wieder an dieses absolut historisch belegte und interessante Ereignis erinnert.«
»Noch eine wahre Geschichte?«
»Nein, verflucht. Dieselbe Geschichte. Geduld. Sie ist nicht allzu lang.«
David lächelte. Die Geschichten des Griechen waren immer lang. Homerisch.
Andrea faltete die Hände vor sich auf der Tischplatte und sah ernst vor sich hin.
»Ich glaube, es hat sich im Mai letzten Jahres zugetragen … oder war es im Juni?«
»Ist das nicht egal?«
Der Oberst lächelte großzügig. »Schon möglich. Wie auch immer, es trug sich während eines Nachtangriffs auf eine wichtige Industrieanlage irgendwo im Rheintal zu. Ein unglücklicher Mosquito-Bomber wurde von einem Flakgeschütz getroffen, der Pilot musste hinter der feindlichen Linie notlanden, was ihm tatsächlich ruhmvoll gelang, wenn auch der Navigator noch an Ort und Stelle starb und der Pilot schwer verletzt war. Danach war das Schicksal ihm ziemlich gnädig. Die Ortsbewohner transportierten ihn zu einem herausragenden deutschen Feldlazarett mit hervorragenden deutschen Ärzten, die ihr Bestes taten, ihn am Leben zu erhalten. Bedauerlicherweise waren sie gezwungen, seinen rechten Arm zu amputieren, der grausam verbrannt und nerventot war. Der junge Pilot war am Boden zerstört und bat die Ärzte, einen Luftwaffen-Piloten zu überreden, den amputierten Arm auf ihren nächsten Bombeneinsatz über England mitzunehmen und über seiner Basis in Lincolnshire abzuwerfen. Auf diese Weise hatte er das Gefühl, dass wenigstens ein Teil von ihm sicher wieder heimkehrte.«
Andrea sah David feierlich an, um sicherzugehen, dass er seine volle Aufmerksamkeit besaß. Als David ihm bestätigte, dass er ganz Ohr sei, fuhr der Grieche fort.
»Das war, gelinde gesagt, schon ein recht eigentümlicher Wunsch, aber nach etlichen Diskussionen hin und her willigten die deutschen Ärzte ein, und noch in derselben Nacht wurde der Arm des Piloten über seiner Basis abgeworfen.«
»Wer hätte das von den Deutschen gedacht?«, sagte David.
Andrea nickte unbeirrt.
»Nicht wahr? Leider ging es dem Piloten nach der Aktion nicht besser, eher schlechter, sodass die Ärzte sich am nächsten Tag gezwungen sahen, auch sein linkes Bein zu amputieren. Natürlich war er kreuzunglücklich deswegen, und wieder bat er darum, dass die Piloten sein Bein mit ins gute alte England nahmen und es über der Basis abwarfen. Und wieder unterstützten die Ärzte …«
»Und am nächsten Tag?«
Der Grieche verdrehte theatralisch die Augen.
»Linker Arm, bei Maria, Josef und den vier Eiern des Esels. Das war absolut notwendig, um sein Leben zu retten. Und wieder brachte er seinen bizarren Wunsch an, aber diesmal ließen die Deutschen sich nicht an der Nase herumführen.« Andrea sagte mit fettestem deutschen Akzent: »Nein, nein, noch einmal machen wir das nicht! Auf keinen Fall! Wir glauben, sie wollen flüchten!«
Der Oberst legte den Kopf in den Nacken und lachte aus voller Kehle. Die Goldzähne glitzerten in der Sonne. Immer noch glucksend wischte er sich mit dem Hemdsärmel die Tränen von den Wangen, schüttelte den Kopf über seinen eigenen Witz und schaute dann finster auf das Schachbrett.
»Weiß oder Schwarz?«, fragte er.
»Du bestimmst. Weiß?«
»Dann kriegst du Schwarz. Du bist ein schlitzohriger Teufelsbraten, und ich bin deine perversen sizilianischen Eröffnungen so unendlich leid.«
Kurz darauf saßen sie konzentriert über das Brett gebeugt.
Der Grieche legte einen Zeigefinger an die Nase, während er seinen nächsten Zug überlegte.
»Die 27. Armee der Russen hat die Oder überquert und steht nur achtzehn Kilometer vor Berlin. Sie können bei westlichem Wind die Glocken der Marienkirche hören.«
Er schob seinen Springer vor.
»Ihr Sturmtrupp besteht aus zwölfjährigen Mädchen und Jungen und halb blinden Greisen.«
David betrachtete die Stellung. Das war nicht uninteressant.
»Mmm … das habe ich auch gehört.«
»Du weißt schon auch, dass der Krieg in einem Monat vorbei sein kann, oder?«
»Und dann beginnt ein neuer«, sagte David abwesend.
Als es auf der anderen Tischseite still blieb, schaute David hoch. Der Oberst sah ihn streng an.
»Was bitte schön soll das denn heißen? Ein neuer Krieg? Zwischen wem?«
David breitete die Arme aus.
»Ich rede nur so daher. Ich meine gar nichts. Vergiss es, all right?«
Andrea hatte nicht vor, ihn so leicht davonkommen zu lassen. Er musterte David skeptisch, der so tat, als ob nichts wäre. Nicht, weil er dem Griechen nicht vertraute. Das tat er. Aber er hatte seine Vergangenheit in ein Schließfach gesperrt und den Schlüssel weggeworfen. Das Einzige, was er anderen von sich erzählte, war, dass er vor ein paar Monaten im Eismeer nördlich vor Jan Mayen neu geboren worden war.
»Es ist nichts, Andrea. Du bist übrigens dran.«
»Das weiß ich auch. Danke.«
Eingeschnappt setzte Andrea einen Bauern. Seine Stellung war ziemlich hoffnungslos.
»Was ist mit dir?«, fragte David. »Was hast du nach dem Krieg vor?«
Andrea hob den Kopf mit einer verärgerten Grimasse. Dann wendete sich sein Blick nach innen. »Ich kehre wohl zurück nach Kreta. Immerhin sind dort meine Wurzeln. Ich habe einen Hof, eine Frau und ein paar Kinder an der Südküste.«
Er schaute übers Meer.
»Gott weiß, wie sie inzwischen aussehen … Krieg war über dreißig Jahre mein Beruf. Ich habe es selber so gewählt und würde es wieder tun. Zurückzukehren auf den Hof und als Oliven- und Tabakbauer anzufangen ist sicher nicht ganz leicht. Ich glaube, mir wird was fehlen, wenn ich keine Deutschen mehr umbringen kann, ganz zu schweigen von hier und da einem lächerlichen Italiener.«
»Ich bin mir sicher, dass du dich wieder einleben wirst und es dir dort gut geht«, sagte David. »Remis?«
»Ist Hitler ein Arschloch? Ja, gerne. Remis. Das ist sehr anständig von dir, David. Wieso habe ich eigentlich das Gefühl, dass du mich elf von zehn Malen mit verbundenen Augen schlagen würdest?«
»Das ist gar nicht wahr«, protestierte David. »Du bist ein hervorragender Spieler.«
Der Grieche schnaufte verächtlich.
»Es ist die Geschwindigkeit, mit der du die Figuren verschiebst. Und sobald du denkst, ich würde was merken, gehst du mit dem Tempo runter.«
David zuckte mit den Schultern.