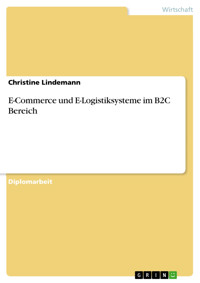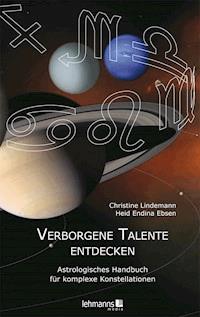Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lehmanns
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als am 20. Dezember 2018 die letzte Zeche im Ruhrgebiet stillgelegt wird, ist das nicht nur das Ende einer über 200-jährigen Industrie. Zu Ende geht auch ein Lebensgefühl. Was bleibt, ist Erinnerung. Erinnerung an den Alltag in einer der Zechensiedlungen mit ihrer Mischung aus dörflich-ländlichem Idyll in unmittelbarer Nähe zu den Standorten der urbanen Schwerindustrie. Christine Lindemann hat in ihrem Buch „Bausteine“ dieses Lebensgefühls unaufdringlich-eindringlich zu einer Erinnerung an ihre Kindheit verarbeitet und ein genaues Abbild authentischen Lebens der Sechziger- und Siebzigerjahre geschaffen: unprätentiös, stimmig und wohltuend normal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
© 2019 Lehmanns Media GmbH Helmholtzstr. 2-9 10587 Berlin
Umschlaggestaltung: Bernhard Bönisch, Berlin
Vorwort
In Bottrop wurde im Dezember 2018 das nun wirklich allerletzte Stück Steinkohle gefördert – mit allen Ehren, großem Tamtam und Polit-Spektakel. Der Steinkohlebergbau in Deutschland, im Ruhrgebiet, ist also unwiderruflich beendet. Und obwohl man im Ruhrgebiet stolz auf Strukturwandel, Industriekultur und Digitalisierung ist, sind die Mythen rund um Zeche, Bergleute, Maloche, Kohle und der damit verbundenen Dingwelt ungebrochen stark!
In den Andenkenshops der Ruhrgebietsmetropolen, aber auch in denen der einschlägigen Museen kann man so ziemlich all das kaufen, was in den 60er und 70er Jahren zu unserem normalen Lebensalltag – nämlich dem der Bergmannsfamilien – ganz unspektakulär dazugehörte: Bergmannsseife, blau-weiße Küchenhandtücher, Kohle- und Koksstückchen, Figürchen der Hl. Barbara, Grubenhemden usw. Zusätzlich stößt man auf so absurde Kitsch-Objekte wie schwarze Nudeln oder schwarzen Zucker, Bonbons in Brikettform.
An sich wäre das Ende der lebensgefährlichen, zermürbenden und dreckigen Plackerei unter Tage doch nichts, dem man nachweinen und hinterhertrauern müsste, dennoch sorgt das Ende der Steinkohlezechen flächendeckend für wehmütige Melancholie. Es gibt mit Sicherheit ein ganzes Geflecht von Deutungen für diese Phänomene, mir scheinen diese hier ganz stimmig:
Der Bergmann ist seit je her quasi der Prototyp des proletarischen Arbeiters, der durch Verausgabung seiner Muskelkraft und seiner gesamten Physis der unberechenbaren Natur, dem dunklen Erdreich sichtbar materielle Schätze abringt – das schwarze Gold nämlich. Ähnlich mythische Bedeutung hat vielleicht nur noch der Stahlwerker, der im Angesicht glühenden Feuers Tag und Nacht rabottet. Geschicklichkeit, Kraft und Zähigkeit schlagen im Verbund mit Arbeitersolidarität den Elementen ein Schnippchen! In der Zeit vereinsamter Clickworker, digitalen Nomadentums und durch die Straßen hastender Paketboten ist die Sehnsucht nach ortsgebundener, erschaffender, physisch erkennbarer (eben „ehrlicher“) Arbeit mehr als verständlich – das Verschwinden des Bergmanns mitsamt seinem Habitat, der Zechenkolonie, muss allein aus diesem Grund schon abgrundtief traurig stimmen.
Außerdem geht die Erinnerung an die Blütezeit des Steinkohlebergbaus Hand in Hand mit der Erinnerung an die Wirtschaftswunderstimmung nach dem Krieg. Es ging bekanntlich endlich bergauf und nicht immer nur bergab. Die durch den Krieg vernichtete Warenwelt entfaltete sich wieder, trieb manch wunderliche Blüten und wurde emsig beworben. Zechenhäuser wurden bezogen, Gärten und Trimm-Dich-Pfade angelegt, Kinder – nämlich wir, die Babyboomerkohorte – in die Schulen geschickt. Urlaubsfahrten wurden sogar für die Arbeiterschaft und ihre Familien möglich. Die CDU hatte in ihrem Ahlener Programm von der Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien geträumt, während die Bergbaugewerkschaft IGBE betriebliche Mitbestimmung einforderte und (teilweise) auch durchsetzte. (Die Gewinne aber aus der Schufterei im Schacht wurden privatisiert, während die Verluste durch die Unmengen staatlicher Subventionen auf die Steuerzahler umgelegt wurden.)
Mit ihrer Mischung aus dörflich-ländlichem Idyll und der unmittelbaren Nähe zu den Standorten der urbanen Schwerindustrie waren die Zechensiedlungen, die Kolonien, eine ganz eigene, spezifische und oft skurrile Welt, die unwiederbringlich versunken ist. In dieser Welt bin ich als Tochter eines Bergmanns in Hamm-Herringen aufgewachsen.
Von den verschiedenen Schichtungen und Eigenheiten des Lebens im Ruhrgebiet der 60er- und 70er Jahre will ich berichten; will erzählen, wie es (für mich) gewesen ist, ein Schachthauerkind zu sein. Sie werden allerdings keine historische Dokumentation und auch kein Tagebuch lesen. Es geht mir nicht um historischen Faktenabgleich und schon gar nicht um Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit. Denn genauso oft, wie die Erinnerung spricht und erhellt, trügt sie ja leider bekanntlich auch... Und selektiv ist sie allemal. Wichtig war mir, die Atmosphäre und die Gefühlsmelange meiner Kinder-und Jugendjahre stimmig zu skizzieren, wobei ich ausgiebig mit der damaligen Dingwelt und dem Zeitkolorit jongliert habe.
Dagegen habe ich einer Versuchung erfolgreich widerstanden, nämlich der Verwendung von Brachialhumor und Ruhrpottslang. Also kein Willze, Kannze, Musse, kein Hömma, Sachta, Tuma, Kumma, kein woanders is auch scheiße. Dennoch geht es kurzweilig und amüsant zu, das kann ich versprechen.
1 Unter Tage – aber nicht vor Ort
Wurde ich in der Schule oder anderswo nach dem Beruf meines Vaters gefragt, konnte ich sicher und wie aus der Pistole geschossen antworten: dass er erstens Bergmann, genauer gesagt Schachthauer sei, zweitens auf Heinrich Robert und drittens unter Tage aber nicht vor Ort arbeite. Wie dieses „Unter Tage“ im einzelnen beschaffen war, wusste ich nicht. Wie alle anderen Schachthauerkinder wusste ich aber genau, dass dieses „vor Ort“ unangenehm und sehr gefährlich war – da musste mein Vater Gott sei Dank nicht hin! Ich hatte lediglich verschwommene Vorstellungen von den Umständen und den Verrichtungen, die zur täglichen Arbeit meines Vaters gehörten. Die Zeche war ausschließlich seine Welt, nicht die der Familie. Sehr vertraut aber waren mir von seinen Erzählungen und von Unterhaltungen der Erwachsenen etliche, kontinuierlich wiederkehrende Bezeichnungen und Fachwörter. Genau die bildeten das Fundament, auf dem sich in meinen kindlichen Gedanken mysteriöse Bilder und märchenhafte Assoziationen von Räumen und Abläufen entwickelten.
Zentral für meine Vorstellungswelt waren auf jeden Fall die Wörter Grube und Schacht. Grube und Schacht ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um dunkle, absolut unheimliche Abgründe handeln musste, in die mein Vater täglich einzutauchen hatte. Er nannte das wiederum nicht eintauchen, sondern einfahren. Jeden Tag fuhr er ein. Monat für Monat. Jahr um Jahr. Jahrzehntelang. Dort in den Schlünden lauerten unberechenbare Gefahren. Manch einer kam nicht wieder ans Tageslicht. Das wurde erzählt, das stand in der Zeitung, das lernten wir in der Schule. In den allertiefsten Abgrund, den Stollen, wo der Mensch nur noch kriechen und liegen kann, wo es so eng und heiß ist, dass man furchtbar schwitzt und Angst hat, nicht mehr raus zu können und wo schon oft Männer verschüttet worden waren – dort brauchte mein Vater zum Glück nicht hinab! Er hatte sich schon als junger Mann entschieden, niemals direkt vor Ort zu arbeiten. (Es heißt übrigens das Ort, nicht etwa der Ort – dies nur für Zechenfremde!) In meiner Imagination befand er sich ein paar Etagen höher (sechste Sohle, davon war häufig die Rede), wo er, das wusste ich genau, mit anderen Kollegen Spurlatten verlegte und Einstriche anbrachte. Mittlerweile weiß ich, dass diese Spurlatten den Förderkorb sichern und leiten und: dass sie senkrecht verlegt werden.
In meinem kleinkindlichen Vorstellungsszenario aber sah das etwa so aus: Mein Vater und seine tapfere Truppe schleppen in einer Art dunklen Höhle enorm lange, schmale und doch stabile Latten herbei, die sie waagerecht über düstere Abgründe legen – quasi unter Lebensgefahr. Auf diesen schwankenden „Spurlatten“ – so mein Bild – balancieren dann die Bergleute mit Helm und Grubenlampe über den Schacht, schwer beladen mit einem Korb voller Kohle. Den sie von irgendwoher aus dem Abgrund bekommen hatten und mit dem großen Förderkorb, der so etwas wie ein unterirdischer Fahrstuhl sein mochte, nach oben bringen würden...
Es gab Korb und Deckel, auch das wusste ich. Den Korb stellte ich mir wie einen Käfig vor, in dem einem Menschen nichts passieren konnte, wenn er durch die düsteren Schächte sauste, ungemütlich natürlich, aber sicher; den Deckel visualisierte ich aber wie eine sehr große rostige, runde Eisenplatte mit scharfen Kanten, von der man an allen Seiten herunterfallen konnte. Nur die allerbesten Schachthauer würden wohl auf diesem Deckel fahren können. Mein Vater gehörte selbstverständlich dazu.
Oft, wenn mein Vater später als üblich von der Zeche kam oder wenn er überraschend eine Doppelschicht machen musste, hieß es: „es gab wieder mal Murks.“ Diesen Murks hatten er und seine Leute zu beseitigen.
Mein Bild für Murks: In der Dunkelwelt liegen um einen Abgrund herum Haufen von kaputten Maschinen, Werkzeugteilen, Latten und Schutt unentwirrbar ineinander verkeilt, teilweise sind diese Schrottberge wohl schon in den Schacht hinuntergefallen. Kabelenden und kaputte rostige Metallstangen ragen aus aufgebrochenen Wänden hervor. Es kracht, knirscht und dröhnt bedrohlich von allen Seiten. Mein Vater – der Schichtführer – und seine Kumpane ordnen dieses unsägliche Chaos, diesen Murks im Schweiße ihres Angesichts durch Aufräumen, Abtransportieren, Reparieren... Dazu benutzen sie ihr Gezähe, Schachthauers Spezialwerkzeug nämlich, und natürlich die Grubenlampen, um in der Dunkelwelt überhaupt etwas sehen zu können.
© Thorsten Bachner. Grubenlampen Bergwerk Ost
Wenn der Murks abgearbeitet war, konnte mein Vater dem Steiger