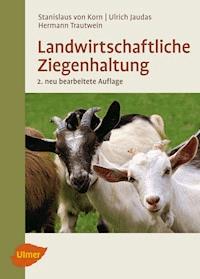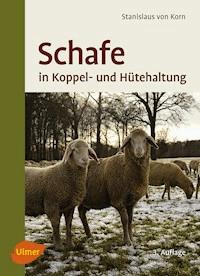
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erläutert die Grundlagen der Schafzucht und Haltung, Erkenntnisse aus der Wissenschaft und Erfahrungen aus der Praxis – schwerpunktmäßig im Hinblick auf die Koppelschafhaltung. Aspekte zur Ausgestaltung einer optimalen Schafhaltung sowie betriebliche und überbetriebliche Zuchtmaßnahmen. Auch die Vermarktung von Lammfleisch und Schafskäse wird besprochen. Das Buch eignet sich für Profischafhalter genauso wie für Hobbyschafhalter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Stanislaus von Korn
Schafe
in Koppel- und Hütehaltung
Unter Mitarbeit von
Dr. Daniela Bürstel
Dr. Ulrich Jaudas
Dr. Gerhard Stehle
3., vollständig neu bearbeitete Auflage
142 Fotos und Zeichnungen
54 Tabellen
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Vorwort
1 Bedeutung der Schafhaltung
1.1 Bedeutung weltweit
1.2 Entwicklungen in der deutschen Schafhaltung
2 Betriebsformen
2.1 Hütehaltung
2.1.1 Standortungebundene Schafherden (Wanderschafhaltung)
2.1.2 Standortgebundene Schafherden
2.2 Koppelschafhaltung
2.3 Ganzjährige Stallhaltung
2.4 Aufzucht- und Mastverfahren
3 Die Biologie des Schafes
3.1 Der Bewegungsapparat
3.1.1 Anatomische Grundlagen
3.1.2 Entwicklung und Wachstum der Körpergewebe
3.2 Der Verdauungsapparat
3.2.1 Die Verdauungsorgane
3.2.2 Der Verdauungsvorgang
3.3 Der Sexualapparat
3.3.1 Die männlichen Geschlechtsorgane und ihre Funktionen
3.3.2 Die weiblichen Geschlechtsorgane, ihre Funktion und die Embryonalentwicklung
3.4 Die Milchdrüse
3.5 Die Haut und Wollfaser
4 Rassen
4.1 Die Rassenentstehung
4.2 Merinos
4.3 Fleischschafe
4.4 Milchschafe
4.5 Landschafe
4.6 Weitere ausländische Rassen
5 Zucht
5.1 Allgemeine Grundlagen
5.1.1 Vererbung
5.1.2 Zuchtmethoden
5.2 Die überbetriebliche Organisation der deutschen Schafzucht
5.2.1 Einrichtungen und Organisationen der Schafzucht
5.2.2 Das Tierzuchtgesetz
5.2.3 Herdbuch- und Gebrauchsherden
5.2.4 Körung, Absatzveranstaltungen und Schauen
5.2.5 Leistungsprüfungen
5.2.6 Bestimmung und Erfassung äußerer Merkmale
5.2.7 Feststellung des Zuchtwertes
5.2.8 Zucht auf Scrapie-Resistenz
6 Management auf dem Schafbetrieb
6.1 Dokumentation
6.2 Kennzeichnung der Schafe
6.3 Herdenmanagementprogramme
6.4 Selektion von Zuchttieren
6.4.1 Auswahl der Zuchtböcke
6.4.2 Auswahl weiblicher Schafe
6.5 Klauenpflege
6.6 Schwänze kupieren
6.7 Kastrieren
6.8 Fortpflanzung und Lämmeraufzucht
6.8.1 Deckperiode
6.8.2 Trächtigkeit
6.8.3 Geburt
6.8.4 Versorgung der neugeborenen Lämmer
6.8.5 Mutterlose Aufzucht
7 Fütterung und Ernährung
7.1 Futtermittel
7.1.1 Zusammensetzung und Bewertung der Futtermittel
7.1.2 Mineralstoffe und Vitamine
7.1.3 Beschreibung der Futtermittel
7.2 Praktische Fütterung
7.2.1 Futteransprüche
7.2.2 Fütterung der Mutterschafe
7.2.3 Fütterung der Lämmer während der Aufzucht
7.2.4 Fütterung der Mastlämmer
7.2.5 Fütterung der Jung- und Zuchtböcke
7.2.6 Fütterung weiblicher junger Zuchtschafe
7.3 Futterplanung und Futterkosten
8 Grünlandwirtschaft
8.1 Allgemeine Aspekte
8.1.1 Grünlandpflanzen
8.1.2 Aufwuchsverhalten
8.2 Weidewirtschaft in der Schafhaltung
8.2.1 Weideführung
8.2.2 Weidesysteme
8.2.3 Das Verhalten der Schafe auf der Weide, Auswirkungen und Konsequenzen
8.2.4 Düngung der Schafweiden
8.2.5 Weidepflege
8.2.6 Neuansaat und Nachsaat von Schafweiden
8.3 Technische Einrichtungen auf der Weide
8.3.1 Zaunanlagen
8.3.2 Tränken und Zufütterung
8.3.3 Weideunterstände
8.4 Futterkonservierung
8.4.1 Heuwerbung
8.4.2 Silagebereitung
9 Stallbau und technische Einrichtungen
9.1 Planungsaspekte für den Neu- und Umbau von Stallanlagen
9.1.1 Baurechtliche Bestimmungen
9.1.2 Größe der Stallanlagen
9.1.3 Stallklima, Luftraum, Lichtverhältnisse
9.1.4 Arbeitswirtschaftliche Zweckmäßigkeit und Kosten
9.2 Die Stallbauweise
9.3 Aufstallungsformen
9.4 Inneneinrichtung
9.5 Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen
9.6 Behandlungsanlagen
10 Leistungseigenschaften und Produkte
10.1 Fortpflanzungsleistung
10.1.1 Kriterien der Fruchtbarkeit
10.1.2 Einflüsse und Möglichkeiten der Leistungssteigerung
10.2 Die Gewichtsentwicklung der Lämmer
10.2.1 Leistungskriterien
10.2.2 Einflüsse und Möglichkeiten der Leistungssteigerung
10.3 Schlachtleistung
10.3.1 Bewertung des Schlachtlammes
10.3.2 Klassifizierung der Schlachtkörper
10.3.3 Qualitätskriterien
10.3.4 Beeinflussung der Schlachtleistung
10.3.5 Vom Schlachten bis zur Verwertung
10.4 Wolle
10.4.1 Die Bedeutung der Wolle
10.4.2 Die Schur
10.4.3 Leistungs- und Qualitätskriterien
10.4.4 Beurteilung der Wolle
10.4.5 Wollpflege
10.4.6Wollfehler
10.5 Felle
10.6 Schafmilch
10.7 Schafmist, Schafkot
11 Markt und Vermarktung
11.1 Der Lammfleisch- und Wollmarkt
11.2 Vermarktung von Fleisch und Wolle
12 Landschaftspflege
12.1 Bedeutung der Landschaftspflege
12.2 Die Pflegeleistung von Schafen
12.3 Die wirtschaftliche Situation der Schafhaltung in der Landschaftspflege
13 Erkrankungen des Schafes
13.1 Verhalten des kranken Schafes
13.2 Bestimmungen und Empfehlungen
13.3 Parasiten
13.3.1 Außenparasiten
13.3.2 Innenparasiten
13.4 Bakterielle Infektionskrankheiten
13.5 Viruskrankheiten
13.6 Krankheiten durch andere Erreger
13.7 Verdauungs- und Stoffwechselstörungen
13.8 Mineral- und wirkstoffbedingte Erkrankungen
13.9 Vergiftungen durch Futtermittel
14 Die Wirtschaftlichkeit der Schafhaltung
14.1 Berechnung der Wirtschaftlichkeit
14.2 Einflüsse auf die Rentabilität der Schafhaltung
14.2.1 Einnahmen
14.2.2 Kosten
14.2.3 Arbeitszeit- und Flächenverwertung
14.3Optimierungsansätze
14.4 Die Schafhaltung im wirtschaftlichen Vergleich
15 Gesetzliche Rahmenbedingungen
15.1 Tierschutzrechtliche Vorschriften
15.1.1 Verordnungen zum Schutz von Tieren beim Transport
15.1.2 Tierschutz-Schlachtverordnung
15.2 Viehverkehrsverordnung
15.3 Lebensmittelrecht bei der Vermarktung
15.4 Allgemeine Hygienevorschriften
Service
Auszug aus den DLG-Futterwerttabellen für Wiederkäuer
Wichtige Adressen: Schafzuchtverbände, Schafgesundheitsdienste, Untersuchungsämter
Literaturverzeichnis
Bildquellen
Die Autoren
Vorwort
Über die Jahrhunderte hinweg hat es die Schafhaltung immer verstanden eine der wirtschaftlichen Gesamtsituation angemessene Funktion zu übernehmen. So war das Schaf im Laufe der Geschichte Saatbettbereiter und Dunglieferant, Wollproduzent, Erzeuger von Fleisch und Milch und in jüngerer Zeit auch Landschaftspfleger.
Damit hat die Schafhaltung auch heute noch eine hohe volkswirtschaftliche wie auch landwirtschaftliche Bedeutung, die sich vor allem in folgenden Funktionen zeigt: Erzeugung von hochwertigem Lammfleisch, Nutzung von freiwerdenden Flächen bzw. Restflächen, die im Rahmen des anhaltenden Strukturwandels anfallen, Erhalt und Pflege von Biotopen und ganzer Kulturlandschaften sowie der flexible Einsatz in unterschiedlichen Betriebsformen, die vom Vollerwerbs- bis zum Hobby-Betrieb reichen.
Die Schafzucht und -haltung wird heute von verschiedenen Personengruppen mit unterschiedlichen Zielen betrieben. Von Berufsschäfern, die stets auf eine hinreichende Wirtschaftlichkeit hinarbeiten müssen, um bestehen zu können; in zunehmendem Maße aber auch von Nebenerwerbslandwirten und Hobbyhaltern, die meist weniger ökonomischen Zwängen ausgesetzt sind und das Schäferhandwerk nur selten erlernt haben.
Um die Schafhaltung wirtschaftlich rentabel betreiben zu können und im großen wie im kleinen Stil auch Freude daran zu haben, bedarf es jedoch fundierter Fachkenntnisse auf den verschiedensten Gebieten. Das vorliegende Fachbuch hat das Ziel möglichst eingängig alle für den Praxisbetrieb relevanten Kenntnisse zu vermitteln; vor allem aus den Bereichen Zucht, Haltung, Fütterung bis hin zur Grünlandwirtschaft, Landschaftspflege, den Marktverhältnissen und der Betriebswirtschaft. Dabei sollen mit der 3. Auflage dieses Buches nicht nur allgemeines Grundwissen, sondern auch aktuelle und weiterführende Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis dargestellt werden. Sowohl dem Berufsschäfer als auch dem weniger erwerbsorientierten Schafhalter werden damit Informationen und Empfehlungen für eine erfolgreiche Schafhaltung geboten. Aufgrund der strengen Gliederung nach Fachthemen kann das Fachbuch auch als Nachschlagewerk genutzt werden.
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle all denjenigen, die ihr Spezialwissen zu einzelnen Kapiteln mit beigetragen haben. Frau Dr. Daniela Bürstel vom Schafherdengesundheitsdienst Baden-Württemberg hat mit ihren Erfahrungen aus der Schafbestandsbetreuung das Kapitel ‘Erkrankungen des Schafes’ völlig neu überarbeitet und auch Maßnahmen und Empfehlungen in der Herdeführung im Kapitel ‘Management auf dem Schafbetrieb’ mit eingebracht. Großer Dank gilt auch Dr. Ulrich Jaudas, langjähriger Lehrer an der Landesberufsschule für Tierwirte Stuttgart-Hohenheim (Schäferschule), der das Kapitel ‘Fütterung’ neu gestaltet und mit seinem fundierten Wissen bereichert hat. Mein aufrichtiger Dank gilt letztlich auch Herrn Dr. Gerhard Stehle vom Veterinäramt Esslingen, der die ‘Gesetzlichen Rahmenbedingungen’ für die Schafhaltung mit den aktuellen Vorschriften zum Tierschutz, zur Viehverkehrsordnung und zum Lebensmittelrecht bei der Vermarktung verständlich aufbereitet hat.
Dieses Fachbuch richtet sich an alle, die sich für Schafhaltung interessieren und sich für diese Tierart einsetzen: praktische Schafhalter und Berater, die Landwirtschaftsverwaltung, hier insbesondere die Tierzuchtverwaltung, den Naturschutz sowie Schulen und Hochschulen. Auf das alle mit der Schafhaltung befassten Personen auch mit Hilfe dieser Auflage einen Beitrag für eine erfolgreiche Schafhaltung leisten.
Nürtingen, Februar 2016
Stanislaus v. Korn
1 Bedeutung der Schafhaltung
Das Schaf wurde schon früh, etwa 8000 Jahre v.Chr., als eine der ersten Tierarten vom Menschen in den Hausstand übernommen (domestiziert). Die praktisch handhabbare Größe, die leicht zu erfüllenden Ansprüche an Futter und Haltungsumwelt, aber auch die vielseitigen Produkte wie Fleisch, Milch, Wolle, Felle, Dung, Sehnen, Därme etc., haben diesem kleinen Wiederkäuer schon bald einen hohen Stellenwert in der Nutzung von natürlichem Grünland eingeräumt. Dabei handelt es sich nach wie vor vorrangig um ertragsarme Flächen, für die häufig kaum Bewirtschaftungsalternativen bestehen.
1.1 Bedeutung weltweit
Als zahlenmäßig zweithäufigste Nutztierart stellt das Schaf in der Welt noch heute vielerorts seine hohe Bedeutung unter Beweis. Insbesondere in trocken-warmen und gemäßigten Breiten wie in Neuseeland, Australien, Vorder- und Mittelasien, im Mittelmeerraum, im südlichen und östlichen Afrika sowie auf den Britischen Inseln sind deutliche Verbreitungsschwerpunkte zu finden. Das außerordentliche Anpassungsvermögen und die große Rassenvielfalt erlauben dieser Tierart die Besiedlung fast aller geografischen Zonen des Erdballs.
So ist gerade beim Schaf in eindrucksvoller Art und Weise zu beobachten, wie sich durch die Anpassung an die natürlichen Standortverhältnisse die unterschiedlichsten Erscheinungsformen herausgebildet haben:
–Zwergschafe (Haartyp) unter den feuchtheißen Klimaten Westafrikas mit ausreichendem Futteraufwuchs,
–langbeinige Haarschafe im trockenen Sahel zur Überwindung großer Strecken bei der Futtersuche (das weniger dichte Haarkleid der Haarschafe erlaubt unter heißen Klimaverhältnissen eine bessere Wärmeabgabe),
–grobwollige Fettscheiß- und Fettschwanzschafe im vorderasiatischen Raum zur Kompensation langer Futterengpässe über die gespeicherten Fettanlagerungen,
–Fleischschafe mit z.T. feiner Wolle an gemäßigten Standorten (Europa und Ozeanien) zur Ausnutzung guter Futterverhältnisse.
Aber auch aufgrund der variablen Haltungsmöglichkeiten des Schafes, die vom Hütebetrieb über die Koppelhaltung – allein oder im Verbund mit anderen Nutztierarten – bis hin zur Einzel- und ganzjährigen Stallhaltung reichen, wird die Nutzung verschiedenster Standorte über das Schaf möglich.
1.2 Entwicklungen in der deutschen Schafhaltung
Infolge geänderter (agrar-) politischer Rahmenbedingungen war die deutsche Schafhaltung während der vergangenen 100 Jahre durch gravierende Veränderungen gekennzeichnet.
Bestände
Mit der Blütezeit der Merinozuchten erreichte die Schafhaltung in Deutschland um 1860 einen Höchstbestand von etwa 28 Mio. Schafen. Seitdem reduzierte sich die Schafzahl in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts – abgesehen von kurzen Aufschwüngen in Spannungszeiten (Kriege, Wirtschaftskrise) – kontinuierlich. Schon um die Jahrhundertwende ließ die Intensivierung der Landwirtschaft der deutschen Schafhaltung immer weniger Raum. Darüber hinaus stellte die Einfuhr ausländischer Qualitätswollen eine ernste Konkurrenz für die deutsche Wolle dar. Weltweit trug aber auch das Aufkommen der Baumwolle und später das der modernen Kunstfasern zu einem Wertverlust der Wolle bei, welche einst das maßgebliche Verkaufsprodukt in der Schafhaltung war. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts hatte 1 kg feine Wolle den Wert von etwa 9 kg Fleisch, heute erhält der Schafhalter für Lammfleisch drei- bis viermal so viel wie für die Wolle.
In der Nachkriegszeit nahm die Entwicklung der Schafbestände in Westdeutschland und der ehemaligen DDR einen unterschiedlichen Verlauf (Abb. 1). In Westdeutschland gingen die Schafzahlen zurück, da sich aufgrund der weiter fallenden Wollpreise die Einkommenslage der Schafhaltung erheblich verschlechtert hatte. Mitte der 60er-Jahre wurde ein Tiefstand von nur noch 700 000 Schafen erreicht. Mit der Neuausrichtung der Schafhaltung auf das Produktionsziel Lammfleischerzeugung erholte sich der westdeutsche Schafbestand wieder allmählich, sodass 1990 ein Bestand von 1,7 Mio. Schafen gezählt wurde. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die 1980 eingeführte EG-Marktordnung für Schaffleisch und die damit verbundene Mutterschafprämie sowie die zunehmende Verbreitung der Koppelschafhaltung, die der Schafhaltung auch im Nebenerwerb beste Möglichkeiten bot.
Abb. 1. Entwicklung der Schafbestände in Deutschland (Statistisches Bundesamt 1960–2014).
Die ehemalige DDR schirmte sich, wie auch andere osteuropäische Länder, gegen äußere Markteinflüsse vom Westen ab und konnte so den Wert der Wolle erhalten. Bis zu 100 Mark/kg Wolle wurden hier zeitweise gezahlt. Bei schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf Wollerzeugung wurden in der DDR zuletzt (1989) etwa 2,6 Mio. Schafe gehalten. Durch die Öffnung der Grenze im Jahr 1990 brach der Fleisch- und Wollmarkt durch ein überhöhtes Angebot aus Ostdeutschland zusammen, sodass die Erzeugerpreise für Fleisch- und Wolle um mehr als die Hälfte fielen. In den neuen Bundesländern kam es bald zu drastischen Bestandsdezimierungen, die vor allem zur Merzung der zahlreichen Hammelherden führten. 1990 wurden in den ostdeutschen Bundesländern nur noch etwa 1,4 Mio. Schafe gehalten. In den 90er-Jahren fand mit westdeutscher Unterstützung eine beachtliche Anpassung an das Produktionsziel Lammfleischerzeugung statt.
Insgesamt werden heute (2014) in Deutschland 1,6 Mio. Schafe von 10 100 Betrieben gehalten (Statistisches Bundesamt 2014). Dabei sind gemäß Viehzählung jedoch nur die Betriebe mit mehr als 20 Schafen bzw. 2 ha landwirtschaftliche Nutzfläche berücksichtigt. Bayern und Baden-Württemberg sind die Länder mit den meisten Schafen und Betrieben (Abb. 2).
Der seit 1991 anhaltende Rückgang der Schafbestände ist letztlich auch Ausdruck einer vergleichsweise geringen Wettbewerbsfähigkeit sowie einer begrenzten Attraktivität (Hütehaltung) für den Schäfernachwuchs. Einen wesentlichen Einfluss auf die Bestandsrückgänge hatte auch die Agrarreform im Jahr 2005, die eine Umstellung der Mutterschafprämie auf eine flächenbezogene Prämie vorsah.
Preise
Mit der Verschiebung der Preisverhältnisse für Wolle und Fleisch (Westdeutschland ab den 1960er-Jahren, Ostdeutschland ab 1990) hat sich die heutige Zucht und Produktion – abgesehen von der Milchschafhaltung – fast ausschließlich auf die Erzeugung von Lammfleisch ausgerichtet, sodass die Marktleistungen der Schafherden heute zu über 90 % aus dem Verkauf von Schlachtlämmern erbracht wird. Bedingt durch das verminderte Angebot von Schaflämmern legten die Preise für Schlachtlämmer seit etwa 2004 deutlich zu.
Betriebsformen
Seit Anfang/Mitte der 60er-Jahre ist die westdeutsche Schafhaltung auch durch drastische Veränderungen in den Betriebsformen geprägt.
So fanden ein starker Ausbau der Koppelhaltung und ein Rückgang der Hütehaltung statt. In der damaligen DDR setzte sich die Koppelschafhaltung hingegen weniger durch; hier wurde wesentlich an der traditionellen Hüteschafhaltung festgehalten.
Abb. 2. Anzahl Schafbetriebe und Schafe nach Bundesländern 1994 und 2013 (Statistisches Bundesamt 1995 und 2014).
Abb. 3. Schafbestände in ausgewählten Ländern der Europäischen Union in 1000 Stück im Jahr 2013 (FAOstat 2014).
Abb. 4. Schafhaltung in Neuseeland – unter günstigen klimatischen Verhältnissen werden Schafe in Großherden gekoppelt.
Funktionen
Besondere Erwähnung verdient heute die Aufgabe der Schafhaltung in der Landschafts- und Biotoppflege. Gerade in jüngster Zeit haben agrar- und umweltpolitische Forderungen diesen Funktionswert wieder in den Vordergrund gerückt, der mit erheblichem volkswirtschaftlichem Nutzen verbunden ist.
Wenn auch das Schaf weniger verbreitet ist als Rind und Schwein, so weist diese Tierart gerade heute doch wesentliche zukunftsträchtige Werte auf.
Nennenswert sind vor allem folgende Gesichtspunkte, da die Schafhaltung
–über die Erzeugung von Qualitätsfleisch den bestehenden Verbraucherwünschen bestens gerecht wird,
–im Rahmen der anhaltenden Extensivierungs- und Flächenstilllegungstendenzen als Nutzungsalternative oder Landschaftspfleger Bedeutung findet ohne Überschüsse zu produzieren,
–zur Nutzung von Grenzertragsstandorten und zum Erhalt strukturschwacher Regionen beiträgt (Schafhaltung als Einkommensquelle),
–als kapital- und arbeitsextensives Produktionsverfahren auch in den Nebenerwerbs- und Hobbybetrieb gut einpasst.
Gegenüber anderen Ländern der Europäischen Union verfügt Deutschland nur über einen vergleichsweise geringen Bestand an Schafen. Die größten Schafbestände sind heute in Großbritannien, Spanien, Griechenland, und Rumänien zu finden. Dementsprechend ist auch der Markt durch die Exporte solcher Länder, insbesondere durch Großbritannien, beeinflusst (Abb. 3).
2 Betriebsformen
In den zurückliegenden 100 Jahren haben sich recht unterschiedliche Betriebsformen in der Schafhaltung herausgebildet, die stets als Anpassung an den Standort und die betrieblichen Voraussetzungen zu verstehen ist. Die Betriebsformen lassen sich in Hütehaltung (Wanderschafhaltung), standortgebundene Schafhaltung, Koppelschafhaltung (inkl. Einzelschafhaltung) und ganzjähriger Stallhaltung untergliedern.
Knapp die Hälfte der Schafe werden heute als Koppelschafe in Herden bis ca. 200 Schafen vorwiegend im Nebenerwerb gehalten. Die wesentlich größeren Hüteherden gehören ausschließlich Vollerwerbsbetrieben an, deren Herden durch Familienarbeitskräfte oder von einem entlohnten Schäfer betreut werden. Über die Hälfte aller Schafe werden in Deutschland gehütet.
Während sich in Westdeutschland neben der traditionellen Hütehaltung seit den 60er-Jahren zunehmend auch die Koppelhaltung von Schafen durchsetzte, wurden in der damaligen DDR die Schafe fast ausnahmslos gehütet. Die zumeist großen Herden waren vorrangig Betrieben der Tier- und Pflanzenproduktion wie Landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften (LPG,) Volkseigenen Gütern (VEG) und anderen kooperativen Einrichtungen angegliedert. Da die Hütehaltung täglich eine Arbeitskraft für die Beaufsichtigung des Weideganges bindet, ist sie angesichts der gestiegenen Lohnkosten für viele Schafhalter im Vollerwerb heute zu kostenintensiv und wird ganz oder teilweise durch die Koppelhaltung ersetzt (Strittmatter 2005).
2.1 Hütehaltung
Die Hütehaltung verlangt neben den allgemeinen Kenntnissen der Schafhaltung besondere Fähigkeiten in der Hütetechnik. Zum einen muss mit maßgeblicher Unterstützung der Hütehunde eine kontrollierte Führung der Herde gewährleistet sein, um auf Straßen und Wegen Schaf und Verkehr nicht zu gefährden und den unerwünschten Verbiss angrenzender Kulturpflanzen zu verhindern. Zum anderen muss die Hütetechnik aber auch den Fütterungsansprüchen der Schafe Rechnung tragen, um Leistungsvermögen und Gesundheit der Herde zu erhalten. Dabei ist die Herde so zu lenken, dass sich die Schafe zweimal täglich (vormittags und nachmittags) satt fressen können und dazwischen um die Mittagszeit eine Ruhepause erhalten. Da mit den ständigen Wanderungen ein häufiger Weidewechsel verbunden ist, dürfen die Schafe nur allmählich auf die neue Futtergrundlage umgestellt werden, um Verdauungsstörungen zu vermeiden. Diese Vorsicht ist besonders beim Wechsel auf Kleeweiden zu beachten (Blähgefahr).
Die Hüteformation der Herde richtet sich nach den Futterverhältnissen und dem Ausmaß der zu beweidenden Flächen. Auf großen ertragsarmen und auch trittempfindlichen Flächen zieht die Herde weit auseinander (weites Gehüt), wobei die Schafe in Ruhe die nährstoffreichsten Futterstoffe suchen können. Dagegen muss die Herde auf kleinen oder lang gestreckten Flächen eng zusammenbleiben (enges Gehüt) und darf nicht auf benachbarte Bereiche ausweichen.
Die meisten Hüteherden werden während der Weidezeit oder der Wanderbewegung nachts und ggf. auch während der Mittagstunden in Pferchen zusammengefasst. Gerade die nächtlichen Pferchplätze sollen trocken sein und jedem Schafe eine Fläche von 1–2 m2 bieten. Letztlich hängt der Flächenbedarf vor allem von der Pferchdauer, der Beschaffenheit der Pferchfläche (Bodenart, Bewuchs) und der Witterung ab.
Ein Pferch auf einer abgeernteten Ackerfläche hat den Vorteil, dass aufgrund der Bodenstrukturen vergleichsweise trockenere Bedingungen bestehen, die eine Infektionsgefahr für die Klauen mindern. Die Pferchruhe sollte angesichts einer Erregerpersistenz für Moderhinke bei mindestens 14 Tagen liegen (MLR 2012). Während früher die Pferche oft aus Holzhürden hergerichtet wurden, werden heute die Pferche mit leichten und schnell aufzubauenden Elektroknotenzäunen installiert. Ratsam ist die Einrichtung von Pferchen in geschützten und schattigen Bereichen. Ein täglicher Wechsel der Pferchfläche wäre ideal, auf Grünland sogar dringend empfehlenswert.
Grundsätzlich sollte ein Pferch stets in andere Nutzungsformen mit eingebunden sein (Heumahd, Getreideanbau, Ackerfutter), um der Fläche wieder Nährstoffe zu entziehen, die durch den Pferch eingebracht wurden. Andernfalls würde es bei einem mittleren Stickstoffeintrag von 20–33 g/Mutterschaf und Pferchnacht zu einer Nährstoffüberversorgung kommen, was mit den Vorgaben der Düngeverordnung oder dem Bestreben zur Aushagerung von ökologisch wertvollen Flächen nicht vereinbar wäre (siehe auch Kap. 12 Landschaftspflege). Die o. g. Eintragsmengen über den Schafpferch sollten also auf die zulässigen Nährstoffeinträge laut gültiger Düngeverordnung abgestimmt und mit den Landwirten kommuniziert werden, die ihre Flächen für die Schafpferche zur Verfügung stellen.
Die Schafe müssen sich durch Marsch- und Pferchfähigkeit sowie durch Anspruchslosigkeit und Wetterhärte auszeichnen. Weiteste Verbreitung in der Hütehaltung haben die Rassen Merinolandschaf und das Schwarzköpfige Fleischschaf gefunden.
Zum Erwerb eines hinreichenden Einkommens muss ein Berufsschäfer heute mindestens 600 Mutterschafe halten. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht fallen in der Hütehaltung zwar nur vergleichsweise geringe Futterkosten an (hohe Anteile absoluten Schaffutters, keine/geringe Pachtkosten, kurze Stallperioden), jedoch bieten sich angesichts des hohen Arbeitszeitbedarfs (ganztägiges Hüten) und der oft ertragsarmen Weidegründe häufig nur begrenzte Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
Zur Minderung des hohen Arbeitseinsatzes und der damit verbundenen hohen sozialen Belastungen, die durch den ständigen Betreuungsaufwand in der Hütehaltung gegeben sind, können die Herden auch vorübergehend eingekoppelt werden. Dabei kann die Einkoppelungsdauer nur einige Tage (z.B. Wochenende, Feiertage) andauern, sich aber auch über Wochen und sogar Monate (Urlaub, Erkrankung) hinziehen.
Aufgrund der hohen Mobilität, der flexiblen Herdenführung und der vergleichsweise großen Herden hat die Hütehaltung von Schafen für die Landschaftspflege eine besondere Bedeutung (siehe auch Kap. 12 Landschaftspflege).
Dabei sind zwei Formen der Hütehaltung zu unterscheiden: die standortungebundene Schafhaltung mit ihren saisonalen Wanderungen zwischen der Sommer- und Winterweide und die standortgebundene Schafhaltung mit dem alltäglichen Schaftrieb zwischen den naheliegenden Weideflächen, vorwiegend Sommerweiden.
2.1.1 Standortungebundene Schafherden (Wanderschafhaltung)
In der Wanderschafhaltung wechselt die Herde mit dem Futterangebot im jahreszeitlichen Wechsel zwischen Sommer- und Winterweide. So entspricht diese, auch in Deutschland noch praktizierte, traditionelle Form der Schafhaltung heute noch einer nomadischen Herdenhaltung (Transhumanz), wie sie in den trockenen Gebieten Afrikas und Vorderasiens betrieben wird.
Abb. 5. Die Hüteschafhaltung – hier am Rand der Schwäbischen Alb – beweidet und pflegt meist ertragsarme Grünlandstandorte.
Im Bundesgebiet ist diese standortungebundene Schafhaltung vor allem südlich der Main-Linie verbreitet. Im Verlauf des Jahres lassen sich die oft über mehrere hundert Kilometer langen Wanderwege anhand der verschiedenen Weidestandorte nachzeichnen.
Auf den sog. Vorsommerweiden nutzen die Herden von Mitte April bis Mitte Juni ertragsarmes Grünland sowie Ödland, das keiner anderen Nutzung zugeführt werden kann. Typische Vorsommerwieden sind im Fränkischen und Schwäbischen Jura zu finden. Die Sommerweiden liegen auf Grenzertragsstandorten der Mittelgebirge, wie z.B. der Schwäbischen Alb, dem Spessart, der Rhön und im Bayerischen Wald. Mit der Beweidung von Wacholderheiden, Magerrasen oder Landschaftsschutzgebieten nehmen die Wanderherden auf den Vorsommer- und Sommerweiden in erheblichem Maße Funktionen in der Landschaftspflege wahr. Die Herbstweiden sind vor allem in den Ackerbaugebieten gelegen, wo die Herden von Mitte August bis 11. November (Martini) abgeerntete Getreide- und Hackfruchtschläge nachweiden. Anschließend werden in den klimatisch begünstigten Flusstälern und Seengebieten (z.B. Rhein- und Maintal, Bodensee) die Winterweiden aufgesucht, wo die Herden bis in den April hinein den spärlichen Aufwuchs auf meist gepachtetem Grünland nutzen. Meist umfassen die Winterweidegründe ganze Gemarkungen, die von den Gemeinden an die Schäferei verpachtet werden. Eigentümer, die keine Beweidung ihrer Flächen wünschen, können dies mittels eines aufgestellten Strohwischs oder großen Astes deutlich machen. Die Regelung der Gemeindeweide ist auch heute noch in den meisten Regionen durch die ursprünglichen Weidegesetze gegeben. Diese räumen den Gemeinden das Recht ein, weidefähige Privatgrundstücke zu einer Gemeindeweide zusammenzufassen und an Schäfer zu verpachten. Auf diese Weise soll die Ausnutzung der Futtergrundlage, die im normalen Landbau übrig bleibt, zur Förderung der Schäferei ermöglicht werden. Liegt hingegen eine Nutzung durch die Flächeneigentümer selbst vor (Feldbestellung, Weide), so sind diese nicht zur Duldung der Gemeindeweide verpflichtet. Herbst- und Winterweiden sind für die Wanderschäferei eine wesentliche Voraussetzung, da sie meist nicht genügend Flächen für die Winterfutterbereitung besitzen, um eine längere Stallhaltung zu betreiben. Dabei bietet die Winterweide auch wirtschaftliche Vorteile durch die Einsparung von Futter- und Stallplatzkosten in Höhe von 67–110€ pro Mutterschaf und Jahr (MLR 2012).
Insbesondere bedingt durch die Wanderbewegungen der standortungebundenen Schafhaltung müssen hier zahlreiche Vorschriften und Gesetze beachtet werden: Viehverkehrsverordnung und Straßenverkehrsordnung bezüglich des Verbringens und Treibens von Schafen, das Naturschutzgesetz sowie die Wald-, Weide- und Landwirtschaftsgesetze der Länder bezüglich Weiderechte und Ordnungswidrigkeiten. Das Treiben von Tieren über Kreisgrenzen hinweg ist genehmigungspflichtig und beim Veterinäramt zu beantragen. Ferner sind Duldungs- bzw. Pachtverträge mit den jeweiligen Landeignern/Gemeinden zu schließen.
Aufgrund der besonderen Haltungsverhältnisse (z.B. keine Stallnutzung) hat die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V. ‚Hinweise für die Wanderschafhaltung in der kalten Jahreszeit‘ ausgegeben, die Empfehlungen zum Schurtermin (15.5.–30.6.), zum Pferch (Windschutz, trockene Flächen) und zur Nährstoff- und Wasserversorgung der Schafe geben (TVT 2006).
Für den Wanderschäfer treten immer wieder Fragen und Probleme bzgl. der Treibwege, ausreichender Herbst-, Winter- und Sommerweiden, möglicher Pferchflächen und Straßenquerungen auf. Insofern sind die Triebwegeverhältnisse im alltäglichen Schäfereibetrieb eine elementare Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf des Arbeitsalltags (OPPERMANN et al. 2004).
Der saisonale Schaftrieb des Wanderschäfers zwischen Sommer- und Winterweide folgt traditionell zwar oftmals denselben Routen, aber in aller Regel nicht über genau festgelegte Wege. Vor allem tierhygienische Gründe sprechen dagegen, da eine Nutzung derselben Flächen von mehreren Schafherden in kurzen zeitlichen Abständen die Infektionsgefahr übertragbarer Klauenkrankheiten (z.B. Moderhinke) deutlich erhöhen würde (MLR 2012). Wichtig erscheint es, tangierte Gemeinden für die Belange der Wanderschafe zu sensibilisieren, um durch grundlegende Voraussetzungen (u. a. Auskunftsmöglichkeiten, Kommunikation) den Schaftrieb zwischen Winter- und Sommerweide zu erleichtern und diese Aspekte bei raumplanerischen Veränderungen (Neubaugebiete, Straßenbau, etc.) zu berücksichtigen. Wenn Straßennetze, Weideverhältnisse oder das Betriebsmanagement keine Fußwanderungen mehr zulassen, müssen die Herden durch teuren LKW- oder Bahntransport zu den nächsten Weideflächen verbracht werden.
Seit den 1970er-Jahren ist die Wanderschafhaltung stark zurückgegangen. Dieser noch anhaltende Rückgang hat im Wesentlichen folgende Gründe:
–Der zunehmende Ausbau der Verkehrswege sowie der Besiedelungsdruck haben die Weideflächen z.T. stark durchschnitten und erschweren die Wanderbewegungen; zudem bestehen heute in einigen Regionen nur noch unzureichende Triebwegenetze.
–Durch die Intensivierung der Flächenbewirtschaftung stehen dem Wanderschäfer immer weniger Weideflächen, insbesondere als Herbstweide, zur Verfügung. So sind kaum noch Stoppeläcker mit Auswuchsgetreide und häufig nur wenig hütetaugliche Zwischenbegrünungen der Äcker (z.B. Ölrettich, Phacelia, Senf) vorhanden.
–Der zunehmende Anbau von Mais für Biogasanlangen schränkt die Möglichkeiten der Weidenutzung im Herbst und Winter vielerorts deutlich ein. Gleichermaßen wirkt sich das erhöhte Ausbringen von Gülle und Gärresten nachteilig auf die Beweidungsmöglichkeiten aus.
–Das Berufsleben eines Wanderschäfers ist heute nach wie vor durch lange Abwesenheiten von der Familie und vom heimatlichen Umfeld sowie durch wenig Freizeit geprägt. Da solche Arbeitsbedingungen in der heutigen Zeit nicht mehr mit den sozialen Ansprüchen der jüngeren Generation vereinbar sind, sorgt sich die Wanderschäferei um den Nachwuchs.
Da durch das ‚Sesshaftwerden‘ einige Probleme der Wanderschafhaltung kompensiert werden können, wurden in einigen Bundesländern in der Vergangenheit Förderprogramme (z.B. Stallbau, etc.) aufgelegt, die den Wanderschäfer durch eine Hütehaltung vor Ort dabei unterstützten, seine Existenz zu sichern.
2.1.2 Standortgebundene Schafherden
Die im norddeutschen Raum früher noch praktizierte Gutsschäferei gibt es heute kaum noch, da die hohen Lohnkosten die Wirtschaftlichkeit der Lämmerproduktion unter den heutigen Verhältnissen infrage stellen. Auf dem Gutsbetrieb nutzt das Schaf vor allem absolutes Schaffutter (Wegränder, Böschungen, abgeerntete Getreide- und Hackfruchtfelder usw.) vorwiegend auf gutseigenen Flächen, die sonst ungenutzt blieben.
Die Bezirksschäferei hat sich inzwischen in zahlreichen Regionen behauptet. Der eigenständige Bezirksschäfer besitzt meist nur wenig Land, sodass er Weidemöglichkeiten in seiner weiteren Umgebung (bis etwa 40 km) nutzt. Abgesehen von gelegentlichen Pachtflächen wird so größtenteils absolutes Schaffutter verwertet. Häufig bestehen Absprachen mit den Landwirten, die den wertvollen Schafmist bzw. -dung als Gegenleistung für die Beweidung ihrer Flächen erhalten (siehe oben Pferchen). Im Gegensatz zur Wanderschafhaltung nutzen die standortgebundenen Schafherden für den alltäglichen Schaftrieb zwischen den einzelnen Weideflächen meist festgelegte Triebwege.
In der Gemeinde- und Genossenschaftsschäferei werden die Schafe verschiedener Eigentümer zusammengefasst und von einem Schäfer auf den Gemeindeflächen gehütet. Diese kooperative Form ist heute jedoch nahezu bedeutungslos geworden.
Die auf den Küsten- und Binnendeichen Norddeutschlands betriebene Deichschäferei hat während der vergangenen 30 Jahre stark zugenommen. Durch den bodenfestigenden Tritt und den tiefen Verbiss der Schafe gewinnen die Deiche an Stabilität. Auf den Deichen und Deichvorländern, die sich häufig in Staatsbesitz befinden und von Landwirten und Schafhaltern gepachtet sind, werden die Schafe meist nicht gehütet, sondern nur locker beaufsichtigt, da einfache Abtrennungen vorhanden sind.
In der ehemaligen DDR entsprach die Hütehaltung als weitestgehend standortgebundene Form etwa einer Guts- oder Bezirksschäferei.
2.2 Koppelschafhaltung
Die Koppelschafhaltung zeichnet sich im Wesentlichen durch die Haltung der Schafe auf fest oder flexibel eingezäuntem Grünland bzw. Futterflächen aus. Die Anzahl der in der Bundesrepublik gehaltenen Koppelschafe hat sich seit 1970 etwa versechsfacht (!), sodass heute etwa über 50 % der Schafe gekoppelt werden.
Dieser Bedeutungszuwachs ist auf verschiedene Vorzüge der Koppelhaltung zurückzuführen:
–Hervorragende Eignung für den Nebenerwerbsbetrieb und große Beliebtheit bei Hobbyschafhaltern, da kapital- und arbeitsextensiv.
–Gute Nutzungsalternative für frei werdende Flächen (Betriebsaufgabe, Kontingentierung) und ausgezeichnete Nutzungsmöglichkeit von kleinen Parzellen.
–Kein ständiger Betreuungsaufwand, sodass Lohnkosten entfallen und die Arbeitsproduktivität gegenüber der Hütehaltung höher ist.
–Flexible Einpassung in die betrieblichen Verhältnisse über die Wahl von Bestandsgröße und Haltungsintensität.
–Gute Möglichkeiten zur Produktionsintensivierung (Fütterung und Weidewirtschaft, Management).
Für eine erfolgreiche Koppelschafhaltung sind gute Fachkenntnisse zur Gründlandwirtschaft sowie zur Bekämpfung der hohen Verwurmungsgefahr erforderlich.
Aufgrund der flexiblen Verfahrensweisen in der Koppelschafhaltung haben sich vielfältige Formen entwickelt, die sich in folgenden Kriterien unterscheiden:
Im Erwerbstyp:
–kleinere bis mittlere Herdengrößen vorwiegend im Nebenerwerb,
–größere Herden im Haupterwerbsbetrieb.
Im Weidemanagement:
–Weideführung evtl. in Kombination mit Hütehaltung,
–Beweidung nur mit Schafen oder im Verbund mit anderen Tierarten wie Rind, Pferde, Ziege (gleichzeitig oder aufeinanderfolgend),
–Einbeziehung von Ackerfutterflächen.
In der Alterskategorie:
–gemeinsame Haltung von Mutterschafen mit Lämmern,
–ausschließliche Koppelung von Lämmern.
Während die Koppelschafherden nahezu standortunabhängig sind, weist die Hüteschafhaltung eine stärkere Bindung an die natürlichen Standortverhältnisse auf.
Abb. 6. Die Koppelschafhaltung nutzt vorwiegend intensive Standorte. Die Schafe verteilen sich im lockeren Herdenverbund auf der Weide.
2.3 Ganzjährige Stallhaltung
Die ganzjährige Stallhaltung hat in Deutschland bisher nur eine sehr geringe Verbreitung gefunden. Durch die Ausschaltung der direkten und indirekten Umwelteinflüsse, die gezielte Kontrolle und Fütterung, ermöglicht diese Haltungsform eine hohe Intensivierung der Lammfleischproduktion und damit auch hohe Arbeits- und Flächenproduktivitäten. Die ganzjährige Stallhaltung hätte dort Bedeutung, wo Futterflächen und Stallraum in ausreichendem Maß zu Verfügung stehen und diese vergleichweise kapital- und arbeitsintensive Form mit großen Beständen lohnenswert machen.
2.4 Aufzucht- und Mastverfahren
In Anpassung an die jeweiligen Betriebsverhältnisse haben sich in der Schafzucht unterschiedliche Aufzucht- und Mastverfahren entwickelt, die wie folgt zusammengefasst werden:
Aufzuchtverfahren
Die Natürliche Aufzucht der Lämmer an der Mutter bis zu einem Alter von drei bis fünf Monaten ist in der Hüte- und Koppelschafhaltung das verbreitetste und bewährteste Verfahren – insbesondere dann, wenn die Mutterschafe einmal pro Jahr ablammen. Die ständige Möglichkeit der Lämmer, an der Mutter zu saugen, spart Futterkosten und Arbeitszeit und führt darüber hinaus zu guten Zunahmen. Bei guter Weide und langer Aufzucht können die Lämmer Schlachtreife erreichen. Allerdings sollten die Bocklämmer mit Eintreten der Geschlechtsreife von der übrigen Herde getrennt oder kastriert werden.
Unter Frühentwöhnung versteht man das Absetzen der Lämmer im Alter von sechs bis sieben Wochen. Bei dieser Methode können Rassen mit asaisonaler Brunst sehr bald wieder zugelassen werden, sodass sich die Zwischenlammzeit verkürzt und der jährliche Lämmerertrag erhöht werden kann (3 Ablammungen in 2 Jahren).
Die Mutterlose Aufzucht der gesamten Nachzucht (Absetzen der Lämmer nach der Biestmilchaufnahme bis zum zweiten Lebenstag) wird bisher kaum praktiziert, da der Kostenaufwand für die Milchtränke bis zur fünften bis sechsten Woche (Milchaustauscher) und der hohe Arbeitszeitbedarf dieses Verfahren meist unrentabel machen. Der Einsatz von Milchtränkeautomaten würde hier zwar die Arbeitszeit erheblich reduzieren, jedoch eine hohe Festkostenbelastung verursachen. Hingegen ist die mutterlose Aufzucht einzelner Lämmer immer dann ratsam, wenn das Muttertier verendet oder erkrankt ist oder es keine bzw. für Mehrlinge zu wenig Milch abgibt (Problemlämmer). Auf diese Weise gelingt es, die Lämmerverluste zu verringern.
Mastverfahren
Die sogenannte Sauglämmermast entspricht der natürlichen Aufzucht von Lämmern an der Mutter bis zur Schlachtreife. Das Verkaufsprodukt muss nach 4–5 Monaten ein Zielgewicht von 40–45 kg erlangt haben. Auf guter Weide bietet gerade das nährstoffreiche Gras den im Spätwinter geborenen Lämmern eine ausreichende Futtergrundlage, um hohe Tageszunahmen zu erreichen. Bei geringerer Weidequalität ist den Lämmern jedoch eine zusätzliche Kraftfuttergabe anzubieten, um deren Wachstumsvermögen ausschöpfen zu können.
Die nach der natürlichen Aufzucht noch nicht schlachtreifen Lämmer werden im Rahmen der Weidemast oder Wirtschaftsmast ausgemästet. Die Weidemast wird meist von Betrieben mit Koppelschafhaltung durchgeführt, wo die abgesetzten Lämmer auf guter Weide mit oder ohne Kraftfutter nach sechs bis sieben Monaten Gewichte von 50 kg und mehr erreichen. Da in diesem Alter die Geschlechtsreife bereits eingetreten ist, weiden männliche und weibliche Lämmer getrennt.
Vor allem für grünlandarme Betriebe mit ausreichendem Ackerfutter ist die Wirtschaftsmast der Lämmer günstig. Dabei werden die mit drei bis fünf Monaten abgesetzten Lämmer (30 bis 38 kg) im Stall mit einwandfreiem wirtschaftseigenem Grundfutter und einer Kraftfutterergänzung auf Gewichte von 45–50 kg gebracht. Oft sind es Lämmer aus der standortgebundenen Hütehaltung, die im Rahmen der Wirtschaftsmast bis zur Schlachtreife gefüttert werden. Allerdings müssen solche schweren Lämmer aus der Weide- und Wirtschaftsmast angesichts des Markttrends zu leichten Schlachtlämmern oft Preisabschläge hinnehmen und sind überhaupt schwieriger abzusetzen.
Die Kraftfutter- oder Intensivmast schließt sich an die verkürzte Säugezeit (Frühentwöhnung) oder die mutterlose Aufzucht der Lämmer an. Nach Muttermilch bzw. Milchtränke werden die Lämmer ausschließlich mit Kraftfutter und Heu gefüttert und erreichen bei Zunahmen von über 350 g/Tag recht früh die Schlachtreife.
In der heute nicht mehr praktizierten Hammelmast sind die Lämmer aufgrund der verhaltenen Fütterung erst nach etwa einem Jahr schlachtreif.
Fütterungstechnische Gesichtspunkte zu den verschiedenen Aufzucht- und Mastverfahren sind dem Kapitel 7 „Fütterung und Ernährung“ zu entnehmen.
3 Die Biologie des Schafes
Kenntnisse über Körperbau, -entwicklung und -funktionen sind für jeden, der sich mit Schafen befasst, von besonderer Bedeutung, um Leistungsentwicklungen, Krankheitsauswirkungen sowie Fütterungs- und Haltungsansprüche auch aus biologischer Sicht beurteilen zu können.
3.1 Der Bewegungsapparat
3.1.1 Anatomische Grundlagen
Der Bewegungsapparat dient zur Aufrechterhaltung des Körpers und zur Fortbewegung des Tieres. Er besteht aus dem Skelett und der Körpermuskulatur.
Das Skelett des Schafes setzt sich aus 215 Knochen zusammen und wird in Kopf, Hals, Rumpf, Gliedmaßen und Schwanz unterteilt (Abb. 7). Besondere Erwähnung verdienen in diesem Zusammenhang die Klauen des Schafes, die für die Fortbewegung und das Wohlbefinden von essenzieller Bedeutung sind. Die Gesunderhaltung der Klauen durch regelmäßige Klauenpflege und die Behandlung von Klauenerkrankungen setzen genaue Kenntnisse vom Aufbau der Klaue voraus (Abb. 8).
Die Körpermuskulatur, auch Skelettmuskulatur genannt, stellt das Fleisch des Schafes dar. Durch den Aufbau der Muskelfasern wird sie auch als quergestreifte Muskulatur bezeichnet und erscheint durch den hohen Anteil an eingelagertem Myoglobin rot. Die Skelettmuskulatur kann willentlich gesteuert werden. Im Gegensatz dazu arbeitet die Eingeweide- und Herzmuskulatur, auch glatte Muskulatur genannt, unwillentlich.
Die einzelnen Muskeln des Skelettes setzen sich aus zahlreichen Muskelfasern zusammen, die sich wiederum zu ganzen Muskelbündeln vereinigen. Zwischen den Muskelfasern befinden sich Blutgefäße und Nerven. Bei gut ernährten Tieren lagert sich hier (intramuskulär) auch Fett ab. Die von Bindegewebshüllen umschlossenen Muskelfasern verjüngen sich an den Enden zu Sehnen, die am Knochen befestigt sind.
Beim Fettgewebe unterscheidet man abhängig vom Ablagerungsort im Körper zwischen Unterhautfettgewebe, Bauch- und Beckenhöhlenfett (Talg), intermuskulärem (zwischen den Muskeln) und intramuskulärem Fett (innerhalb der Muskeln, verantwortlich für die Marmorierung des Fleisches).
3.1.2 Entwicklung und Wachstum der Körpergewebe
Während der ersten drei Trächtigkeitsmonate zeigen die Föten nur ein verhaltenes Wachstum. Anschließend beschleunigt sich deren Entwicklung aber erheblich, sodass sie ihr Gewicht in den letzten vier bis fünf Wochen mehr als verdoppeln.
Abb. 7. Das Skelett des Schafes.
Nachdem sich das neugeborene Lamm auf die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes eingestellt hat, setzt wieder ein intensives Wachstum ein, sodass das Lamm schon nach 16 bis 20 Tagen sein Geburtsgewicht verdoppelt hat. Mit Erreichen der Geschlechtsreife (etwa 3. bis 5. Lebensmonat) verringern sich jedoch die Tageszunahmen wieder allmählich. Dabei wachsen die einzelnen Körpergewebe, Muskeln (Fleisch im engeren Sinn), Fett und Knochen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, sodass sich die Anteile der Körpergewebe mit zunehmendem Alter verschieben.
Abb. 8. Der Aufbau einer Schafsklaue.
1 Mittelfußknochen
2 Fesselbein
3 Strecksehne
4 Kronbein
5 Klauenbein
6 Afterklauen
7 Beugesehne
8 Lederhaut
9 Strahlbein
10 Oberhaut
11 Klauenhorn
Wie Abb. 9 zeigt, ist das Muskelwachstum während der Jugendphase am stärksten ausgeprägt. Auch die einzelnen Muskelgruppen wachsen nicht gleichmäßig, sondern je nach erforderlicher Muskelfunktion im gerade erreichten Wachstumsabschnitt überdurchschnittlich schnell. Hier ist von folgender altersabhängiger Reihenfolge in der Entwicklung auszugehen:
–Kopf- und Halsbereich: Milchaufnahme;
–Hintere Rücken- und Keulenpartie: Bewegungsaktivität;
–Bauch, Brust, Verdauungstrakt: Raufutteraufnahme;
–Rückenmuskulatur: höheres Gewicht des Rumpfes;
–Schulter, Hals, Nacken; besonders bei Böcken nach Geschlechtsreife.
Der Anteil des Fettgewebes am lebenden oder ausgeschlachteten Tier nimmt mit zunehmendem Alter zu. Diese Entwicklung geht im Wesentlichen zu Lasten des Muskelanteils. Die Reihenfolge der altersabhängigen Fettablagerungen ist wie folgt:
–Eingeweidefett
–intermuskuläres Fett
–Auflagefett
–intramuskuläres Fett
Mit fortschreitendem Alter verändert sich auch die Fettqualität. Eine anteilige Verringerung der ungesättigten Fettsäuren führt zu einer talgigen Konsistenz des Fettes und zu einem arttypischen Geschmack.
Die Knochen wachsen im Vergleich zu den beiden vorgenannten Gewebearten gleichmäßiger, sodass sich deren Anteil am Gesamttier nur wenig verändert.
Die grobgewebliche Zusammensetzung eines Lammschlachtkörpers bis zu einem Alter von max. sechs Monaten zeigt folgende Anteile:
Fleisch
51–71 % (∅ 61 %)
Fett
9–29 % (∅ 19 %)
Knochen
15–18 % (∅ 17 %)
Abb. 9. Entwicklung von Körpermasse und Körpergewebeanteilen. Schematisierter Verlauf bei Fleischschaflämmern mit guter Nährstoffversorgung.
3.2 Der Verdauungsapparat
3.2.1 Die Verdauungsorgane
Zu den Verdauungsorganen gehören die Maulhöhle, die Speiseröhre, der mehrhöhlige Magen sowie der Darmkanal. Besondere Erwähnung verdient das Pflanzenfressergebiss der Schafe (NICKEL et al. 2004). Das ausgewachsene Schaf verfügt insgesamt über 32 Zähne, davon 24 Backenzähne im Ober- und Unterkiefer und 8 Schneidezähne im Unterkiefer, die nach folgender Zahnformel angeordnet sind (siehe Tab. 1).
Der Oberkiefer ist anstelle der Schneidezähne mit einer Gaumenplatte ausgestattet. Dabei dienen die Schneidezähne hauptsächlich zur Futteraufnahme (Rupfen), die Backenzähne werden durch den Vorgang des Wiederkauens zum Zermahlen des Pflanzenbreies verwendet.
Der Wechsel vom Milchgebiss zum bleibenden Zahngebiss vollzieht sich bis zum Alter von 4 Jahren zu unterschiedlichen Zeiten und kann daher zur Altersbestimmung herangezogen werden. Anhand der gewechselten Schaufeln (Schneidezähne) kann der Schäfer das ungefähre Alter des Schafes.
Der mehrhöhlige Magen des Schafes weist drei Vormägen (Haube, Pansen, Blättermagen), sowie den Labmagen auf (NICKEL et al. 2004). Beim Sauglamm sind die Vormägen zunächst kaum entwickelt. Die aufgenommene Milch wird über den sogenannten Schlundrinnenreflex an den Vormagenabteilungen vorbei, direkt in den Labmagen geleitet, der die enzymatische Verdauung übernimmt.
Tab. 1:
Zahnformel
Backenzähne
Schneide- und Eckzähne
Backenzähne
Oberkiefer
3
3
0
0
0
0
3
3
Unterkiefer
3
3
1
3
3
1
3
3
Abb. 10. Der altersabhängige Schneidezahnwechsel beim Schaf.
1 Zangen
2 innere Mittelzähne
3 äußere Mittelzähne
4 Eckzähne
Dunkel gekennzeichnet sind die bleibenden Zähne
Abb. 11. Wechsel der ersten Schaufel (I1) mit ca. 12 Monaten.
Erst mit zunehmender Raufutteraufnahme entwickeln sich die Vormägen, und die Besiedlung mit den speziellen Pansenbakterien findet statt. Der zweigeteilte Pansen hat beim Schaf ein Fassungsvermögen von 15–20 Litern und dient den Tieren auch als Wasserspeicher (SPENGLER et. al. 2014). Er lässt sich aufgrund seiner linksseitig angeordneten Lage in der Bauchhöhle in der linken Hungergrube von außen ertasten. Der Darmkanal setzt sich aus Dünn- und Dickdarm zusammen, deren Länge der fünfundzwanzigfachen Körperlänge entspricht. Zu den Verdauungsorganen zählen auch Bauchspeicheldrüse, Leber und Gallenblase.
3.2.2 Der Verdauungsvorgang
Die Verdauung beginnt mit der Zerkleinerung des Futters im Maul (mechanische Verdauung). Dabei wird das aufgenommene Futter zunächst abgeschluckt und im Pansen aufgefangen. In den Ruhephasen nach Beendigung der Futteraufnahme beginnt das Wiederkauen. Ein Vorgang, bei dem der Futterbrei portionsweise über die Haube wieder in die Maulhöhle befördert und dort intensiv zermahlen wird. Bei raufutterreicher Fütterung wird das aufgenommene Futter etwa 8 Stunden täglich wiedergekaut. Gleichzeitig gelangt mit dem Speichel Bikarbonat als Puffersubstanz in den Pansen, der zur Aufrechterhaltung des Pansenmilieus dient. Wiederkauen ist ein wichtiger Parameter zur Beurteilung der Gesundheit der Tiere (V. ENGELHARDT und BREVES 2000). In der Hütehaltung ist darauf zu achten, dass den Schafen genügend Zeit zum Wiederkauen zur Verfügung steht, um Gesundheitsstörungen vorzubeugen.
In den Vormägen wird das zerkleinerte und eingespeichelte Futter mithilfe von zahlreichen Mikroorganismen aufgeschlossen (mikrobielle Verdauung). Vor allem der Rohfaser(Zellulose)abbau findet hier statt. Die dafür benötigten Mikroorganismen leben in einer engen Beziehung zu ihrem Wirt und sind auf die Verwertung des strukturreichen Futters spezialisiert. Diese Bakteriengemeinschaft verändert sich bei jedem Futterwechsel, z.B. Kraftfutter in der Mastperiode. Daher sollten Futterumstellungen nie abrupt erfolgen, sondern in kleinen Schritten vollzogen werden. Dies vermindert die Gefahr von fütterungsbedingten Verdauungsstörungen. Die Pansenschleimhaut resorbiert bereits einige Abbauprodukte (z.B. Fettsäuren, Ammoniak). Die große Masse der Pansenbakterien (5–10 % des Panseninhalts) dient neben dem Zelluloseabbau auch dem Aufbau von Vitaminen. Gleichzeitig sind die Mikroorganismen Eiweißquelle (Bakterieneiweiß) für das Schaf, da stets ein Teil der Kleinlebewesen im Labmagen und Darm mitverdaut wird.
Abb. 12. Die Verdauungsorgane beim Schaf. Der große Pansen füllt vor allem die linke Körperhöhle aus, während die weiteren Mägen sowie der Darmkanal mehr rechtsseitig gelegen sind.
Im Labmagen werden dem Nahrungsbrei Magensaft und im Dünndarm die Sekrete der Bauchspeicheldrüse, des Darmes und der Galle zugesetzt (enzymatische Verdauung). In diesen Abschnitten geschehen vor allem der Abbau und die Resorption von Kohlenhydraten, Eiweißkörpern und Fetten. Im Dickdarm werden nur noch wenige Stoffe durch die Darmwand aufgenommen. Hier wird der Nahrungsbrei durch Wasserentzug eingedickt und über den Enddarm ausgeschieden. Je nach Art der Futtermittel kann die Futterpassage von der Aufnahme bis zum Ausscheiden zwölf Stunden bis mehrere Tage dauern.
3.3 Der Sexualapparat
3.3.1Die männlichen Geschlechtsorgane und ihre Funktionen
In den paarig angelegten Hoden werden mit Erreichen der Geschlechtsreife Spermien und männliche Geschlechtshormone gebildet. Die Nebenhoden dienen der Ausreifung und Speicherung der Spermien, bis diese beim Deckakt über Samenleiter und Harnröhre zusammen mit den Sekreten der Geschlechtsanhangdrüsen in die Scheide des weiblichen Tieres gelangen. Die gesamte Ejakulatmenge beträgt beim Schafbock nur 1 bis 3 ml, verfügt aber mit etwa 3 bis 4 Millionen Spermien/mm3 über eine hohe Spermiendichte.
Der aus Schwellkörpern und Harnröhre bestehende Penis liegt im Ruhezustand zurückgezogen in einer Schleife und ist vollständig von der Vorhaut umgeben. Bei der geschlechtlichen Erregung streckt sich die Penisschleife durch die Blutanfüllung der Schwellkörper. Die Penisspitze wird von einem fadenförmigen Fortsatz der Harnröhre überragt.
Abb. 13. Die Geschlechtsorgane beim männlichen Schaf.
3.3.2 Die weiblichen Geschlechtsorgane, ihre Funktion und die Embryonalentwicklung
Von den weiblichen Geschlechtsorganen sind Eierstöcke, Eileiter und Gebärmutterhörner paarig angelegt. Letztere münden in den Gebärmutterkörper. Mit Einsetzen der Geschlechtsreife werden beim weiblichen Schaf in den rundlichen, 1,5 cm großen Eierstöcken (Ovarien) die ersten Follikel gebildet, aus denen nach der Follikelreifung die weiblichen Eier ovuliert werden. Das trichterförmige Ende des Eileiters fängt die ausgestoßenen Eier auf und die Eier wandern durch den Eileiter zu den Gebärmutterhörnern. Da auch die Spermien bereits etwa 30 Minuten nach der Paarung durch Eigenbewegung bis in die Eileiter vorgedrungen sind, findet bereits hier die Befruchtung statt.
Schon etwa 30 Stunden später beginnt die Embryonalentwicklung durch erste Zellteilungen. In der Gebärmutter angelangt, nistet sich das befruchtete Ei nach etwa 14 Tagen in die drüsenreiche Gebärmutterschleimhaut ein, die mit sog. Karunkeln (napfartigen Zapfen) versehen ist. Erst jetzt ist die feste Verbindung des Eies bzw. des Embryos zum mütterlichen Blutkreislauf hergestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt können aber bis zu 40 % der befruchteten Eier verloren gehen. Im Laufe der weiteren Entwicklung bilden sich zwei Embryonalhüllen:
–die mit Fruchtwasser gefüllte Amnionhülle (Schafhaut) umgibt den Embryo; darin schwimmend ist dieser vor traumatischen Einwirkungen geschützt,
–die Allantoishülle (Harnsack), die um das Amnion herumragt, Harnabsonderungen aufnimmt und einen Versorgungsstrang aus Blutgefäßen und Nabelstrang ausbildet.
Die Brunst setzt nach Abschluss der Follikelreife ein. Brunstanzeichen sind Unruhe, gegenseitiges Bespringen, Paarungsbereitschaft, leichte Schwellung der Schamlippen und Schleimabsonderung. Die Brunst hält durchschnittlich 30 bis 36 Stunden an, wobei die Ovulation etwa 25 Stunden nach Brunstbeginn stattfindet. Wenn keine Befruchtung stattgefunden hat, wiederholt sich dieser Sexualzyklus alle 18 bis 21 Tage. Nur bei einigen Rassen, z.B. den Merinos, tritt die Brunst ganzjährig auf (asaisonales Brunstverhalten). Bei der Mehrzahl der Schafrassen setzt die Sexualaktivität vorwiegend im Herbst bei abnehmender Tageslänge ein (saisonale Brunst), sodass die Lämmer im Frühling geboren werden, wenn gute Futterverhältnisse bestehen.
Abb. 14. Die Geschlechtsorgane beim weiblichen Schaf.
3.4 Die Milchdrüse
Das beim Schaf paarig angelegte Euter (die Euterhälften sind voneinander getrennt) gliedert sich in den Milch bildenden Drüsenteil, das Milch führende Kanalsystem, die Milch sammelnde Zisterne und die Zitze. Das Drüsengewebe ist Ort der Milchbildung. Es ist stark durchblutet, da die zur Milchsynthese erforderlichen Nährstoffe dem Euter über das Blut zugeführt werden.
Mit Abschluss der ersten Trächtigkeit ist das Euter voll ausgereift und die erste Milchsekretion setzt unmittelbar nach dem ersten Ablammen ein. Die Reizung der Milchdrüse durch Saugen und Stoßen des Lammes bedingt die Ausschüttung des Hormons Oxytocin, das die Milch in die Kanäle und Zisternen einschießen lässt. Eine ähnliche Stimulation wird durch das Anrüsten beim Melken erreicht. Das Mutterschaf bildet kurz vor der Geburt die Kolostralmilch, die reich an Abwehrstoffen und Vitaminen ist. Nach wenigen Tagen verändert sich die Zusammensetzung dieser Milch. Der Gehalt an Abwehrstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen nimmt ab. Es handelt sich jetzt um „reife“ Milch.
Abb. 15. Der Aufbau der Milchdrüse beim Schaf.
3.5 Die Haut und Wollfaser
Die Haut baut sich aus der Ober-, Leder- und Unterhaut auf (Abb. 16). Die Oberhaut besteht aus einer dünnen, aber dichten Hornschicht, die Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse bietet. In der darunterliegenden Lederhaut sind die verschiedenen Hautdrüsen (Talg- und Schweißdrüsen), Blutgefäße sowie die Haarfollikel angesiedelt. Aus der Lederhaut wird nach dem Gerben das Leder hergestellt. Den Übergang zum Körper bildet das lockere Bindegewebe der Unterhaut, das die Verschiebbarkeit der Haut auf dem Körper ermöglicht. Die Hautdicke liegt beim Schaf im Durchschnitt bei etwa 2 bis 3 mm. Körperregion, Rasse, Alter, Geschlecht und Konditionszustand beeinflussen die Hautstärke aber erheblich.
Abb. 16. Querschnitt durch die bewollte Haut des Schafes.
Die Haut des Schafes ist mit drei verschiedenen Haartypen bewachsen:
–Stichelhaare an Körperstellen, wo die Haut direkt dem Knochen aufliegt (z.B. Kopf, Beine),
–Grannenhaare, die zwischen den feineren Wollhaaren wachsen und dem Vlies eine dichte witterungsbeständige Struktur verleihen,
–feine, gekräuselte Wollhaare, die als Unter- oder Deckwolle gewachsen sind.
Verantwortlich für die Bildung der Wollfasern sind die Haarfollikel, die als Primär- und Sekundärfollikel auftreten. Während erstere grobe, markhaltige Oberhaare ausbilden, wachsen aus den Sekundärfollikeln, die gruppenweise um ein Primärfollikel herumgelagert sind, die feineren Wollfasern.
Histologisch ist die Wollfaser aus der Schuppendecke, dem Faserstamm und dem Markkanal aufgebaut. Die Schuppendecke setzt sich aus vielen zusammengesteckten Hornschuppen zusammen, die das Haar umhüllen. Der Faserstamm weist zwei verschiedene Zellarten auf, die sog. Para- und Orthocortex. Da sich diese an verschiedenen Stellen des Wollhaares konzentrieren und in ihrer Stabilität und Wachstumsgeschwindigkeit unterscheiden, kommt es zur Kräuselung der Wollfaser. Ein in der Mitte verlaufender Markkanal ist nur in dickeren Wollfasern angelegt. Chemisch setzen sich die Wollhaare aus Eiweißkörpern zusammen.
Aus den gruppenweise zusammenliegenden Haarfollikeln wachsen die Wollhaare zu sogenannten Strähnchen zusammen, die im Verbund mit anderen Strähnchen erst Stäpelchen und dann Stapel ausbilden. Das Wollvlies wird im Wesentlichen durch Bindehaare zusammengehalten.
Um die Haarfollikel sind Talgdrüsen angeordnet, die für die Einfettung des Wollhaares sorgen. Damit ist die Faser wasserabweisend und vor Austrocknung geschützt. Die Sekrete der Talg- und Schweißdrüsen bilden zusammen den Wollschweiß, der die Farbe des Vlieses mitbestimmt. Die Wollqualität ist in Kapitel 10.4 „Wolle“ eingehend beschrieben.
Das Wollwachstum eines gesunden Schafes liegt bei etwa 10 cm Stapellänge pro Jahr. Die Wolle hat für das Tier sowohl eine mechanische, als auch eine isolierende Wirkung. Ab einer gewissen Stapellänge, die unter unseren klimatischen Bedingungen meist nach 10–12 Monaten erreicht ist, beginnt sie zu verfilzen und zu verschmutzen. Dann verliert sie ihre schützende, isolierende Wirkung, die Nässe wird gespeichert und es kann zur Auskühlung und damit verbundenen Atemwegserkrankungen und auch Hautentzündungen kommen. Anstelle der hitzeisolierenden Funktion tritt das Risiko des Hitzestaus. Durch die Schwere der Wolllast sind die Tiere in ihrer Bewegung eingeschränkt. Die Gefahr eines Hautparasitenbefalls steigt. Daher müssen Schafe der Wollrassen mindestens einmal im Jahr komplett geschoren werden (GANTER, M. et. al. 2012).
4 Rassen
Der Begriff „Rasse“ – häufig auch Population genannt – beschreibt eine Gruppe von domestizierten Tieren, die sich in wesentlichen Form- und Leistungsmerkmalen ähnlich sind und eine gemeinsame Zuchtgeschichte haben (Sambraus 2001).
Die Zuchtarbeit baut fast ausschließlich auf der Rasseeinheit auf. Für eine effektive Schafhaltung müssen bei der Wahl der Rasse Leistungsvermögen, Fütterungs- und Haltungsansprüche den Standort- und Betriebsverhältnissen angepasst werden.
4.1 Die Rassenentstehung
Der Mufflon ist die Wildform aller Hausschafe. Wenn auch in Europa heute als z.T. jagdbares Wild verbreitet, so stammt die Urform des Mufflon doch aus dem vorderasiatischen Raum.
Abgesehen von den feinen Unterhaaren trug bzw. trägt der Mufflon noch keine Wolle, sondern grobe grannenartige Haare. Die Fähigkeit zur Bildung feiner Oberwolle konnte somit erst durch Mutation (sprunghafte Veränderung im Erbgut) und züchterische Bearbeitung dieser Veranlagung durch den Menschen entstehen.
Die Entwicklung einzelner Rassen ist im Wesentlichen an die natürlichen Standortverhältnisse gebunden, die auch heute noch Zuchtauswahl und Haltungsform mitbestimmen. Dabei sind besonders Nährstoffaufwuchs und Witterungsverhältnisse für die Ausbildung typischer Rassekennzeichen wie Gewicht, Größe und Vliescharakter entscheidend. In Anpassung an die verschiedenen Standorttypen in Deutschland (Küstenbereiche, trockene Geest- und Heidegebiete, Moorregionen, intensive Ackerbaustandorte, ertragsarme Mittelgebirgslagen, Alpengebirgszüge) hat sich eine große Rassenvielfalt herausgebildet, die von kleinen, genügsamen Heideschafen bis hin zu gut doppelt so schweren, anspruchsvollen Fleischrassen reicht. Mit mehr als vierzig Rassen liegt die Zahl der von den Zuchtverbänden betreuten Rassen in Deutschland etwa viermal höher als die des berühmten Schaflandes Neuseeland, das mit etwa 30 Mio. Schafen über einen fast 20fach höheren Schafbestand verfügt.
In der ehemaligen DDR hatten Betriebsstruktur und strenge Leistungszucht die Rassenvielfalt stark dezimiert. Etwa 90 % des Gesamtbestandes gehörten nur zwei Rassen an (Merinofleisch- und Merinolangwollschaf).
Das breite Spektrum der in Deutschland gehaltenen Rassen wird in die Kategorien Merinoschafe, Fleischschafe, Milchschafe, Landschafe und ausländische Rassen eingeteilt. Die Bestandszahlen und Anteile der zehn wichtigsten Rassen in der Bundesrepublik sind in Abb. 17 dargestellt.
Abb. 17. Anteile der wichtigsten Schafrassen am Gesamtschafbestand in Deutschland (VDL 2010)
4.2 Merinos
Angesichts steigender Wollpreise im 18. und 19. Jahrhundert wurden Merinos schon bald zahlreich in andere Länder eingeführt, wo wiederum eine züchterische Anpassung an die jeweiligen Produktionsverhältnisse stattfand. Mit abnehmender Wertschätzung der Wolle wurde jedoch auch die Fleischleistung vieler Merinorassen verbessert, sodass diese Rassen bis heute ihre Konkurrenzfähigkeit erhalten konnten. Der Erhalt ausgezeichneter Wolleigenschaften sowie gute Wachstums- und Schlachtleistungen haben den deutschen Merinorassen heute im Ausland großes Interesse verschafft.
Das Merinolandschaf
Zuchtgeschichte und Verbreitung. Das Deutsche Merinolandschaf ist im Wesentlichen auf Kreuzungen der im 19. Jahrhundert eingeführten Merinos mit südwestdeutschen Landschafen (Zaupelschaf, Niederrheinisches Marschschaf) zurückzuführen. Im Laufe der Entwicklungsgeschichte haben aber auch englische Fleischrassen und das Merinofleischschaf diese Rasse beeinflusst. Heute noch als ‘Württemberger’ bekannt, ist das Merinolandschaf besonders im süddeutschen Raum (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen) verbreitet, wo es zumeist im Rahmen der Wanderschafhaltung sowohl ertragsarme Mittelgebirgslagen als auch Ackerbaustandorte nutzt. Seit Mitte der 90er-Jahre wurden auch in den östlichen Bundesländern nennenswerte Merinolandschafbestände aufgebaut. Mit einem Anteil von 30 % am Gesamtschafbestand (etwa 80 % in Süddeutschland) stellen die Merinolandschafe die stärkste Rasse in Deutschland dar.
Zuchtziel. Ein mittelgroßes bis rahmiges Schaf mit langem, breitem Rücken, guter Rippenwölbung und Flankentiefe sowie guter Bemuskelung der Außen- und Innenkeule. Der Kopf trägt den typischen Wollschopf. Weiße Merinowolle mit ausgeglichener Feinheit von 26 bis 28 μm.
Eigenschaften und Leistungen. Die Rasse ist durch Widerstands-, Pferch- und Marschfähigkeit geprägt und besonders für die Hütehaltung geeignet. Das Merinolandschaf hat sich aber auch in anderen Haltungsformen bewährt.
Durch gute Fruchtbarkeits- und Aufzuchtleistung sowie asaisonale Brunst ist eine hohe kontinuierliche Lämmerproduktion gewährleistet. Auch Wachstum und Wollertrag sind hoch einzustufen.
Das Merinolangwollschaf
Zuchtgeschichte und Verbreitung. Anfang der 70er-Jahre setzte man sich in der ehemaligen DDR das Ziel, ein Schaf mit halbfeiner Wolle (Sortiment BC-CD) zu züchten, um damit den Anforderungen der wollverarbeitenden Industrie zu entsprechen. Mitte der 80er-Jahre war aus der Kombinationszüchtung von Merinolandschaf mit Nordkaukasischem Fleischwollschaf, Lincoln (englische Langwollrasse) und Corriedale (in Neuseeland aus Merinos und englischen Langwollrassen gezüchtet) die junge Rasse Merinolangwollschaf hervorgegangen. Im Vergleich zum Merinoland- und Merinofleischschaf weist das Merinolangwollschaf einen höheren Reinwollertrag, eine größere Stapellänge und eine etwas gröbere Wolle auf. In der ehemaligen DDR war es vor allem in den südwestlichen Mittelgebirgslagen in den Bezirken Erfurt, Gera, Suhl und Chemnitz anzutreffen. Etwa 40 % des Schafbestandes der ehemaligen DDR gehörten 1988 der Rasse Merinolangwollschaf an. Bis heute ist die Rasse in Westdeutschland kaum verbreitet. In den östlichen Bundesländern kann sich die Rasse nur noch in seiner Zuchtheimat Thüringen behaupten. Bei anhaltend rückläufiger Bedeutung zählten 2005 aber noch 2,5 % aller Schafe zu der Rasse Merinolangwollschaf.
Zuchtziel. Ein mittelgroßes, rahmiges Schaf mit langem Rücken im Zweinutzungstyp „Wolle-Fleisch“ stehend. Hohe Wollerträge und guter Wollbesatz von Bauch und Flanken bei einer Feinheit von 28 bis 32 μm.
Eigenschaften und Leistungen. Durch gute Widerstands- und Marschfähigkeit vor allem für die Hütehaltung geeignet. Bessere Eignung für niederschlagsreichere Gebiete als das auch in der ehemaligen DDR verbreitete Merinofleischschaf. Weitgehend asaisonale Brunst, gute Fruchtbarkeit und Fleischleistung.
Das Merinofleischschaf
Zuchtgeschichte und Verbreitung. Das Merinofleischschaf wurde aus dem Merinokammwollschaf und einem in Frankreich gezogenen Merinoschlag (Mérinos précoce) gezüchtet. Letztere trugen bereits hohe Anteile englischer Fleischrassen in sich.