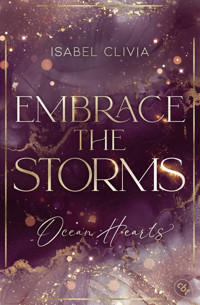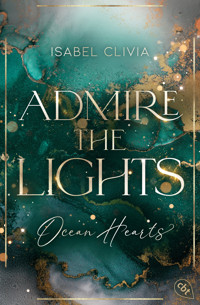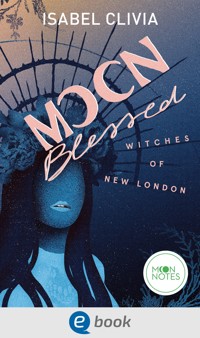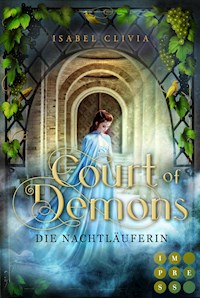Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wenn die letzte Hoffnung in den Schatten liegt ... Alienors Leben ist von Dunkelheit geprägt. Nachdem verbotene Experimente ihr gefährliche Schattenkräfte beschert und sie in eine unberechenbare Waffe verwandelt haben, fristet sie ihr Dasein in einem Verlies. Bis ausgerechnet der Mann, der sie dorthin gebracht hat, sie um Hilfe bittet. Ihre Magie soll der Schlüssel zur Zerstörung eines uralten Fluchs sein. Mit dem Zauberweber Thierry zusammenzuarbeiten ist das Letzte, was sie will. Allerdings ist da dieses verräterische Herzklopfen, das alles so verdammt kompliziert macht. Im Kampf gegen einen schier übermächtigen Feind muss Alienor sich entscheiden, wer sie sein will: das Ungeheuer, für das die Leute sie halten, oder die Hoffnung eines ganzen Landes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schattensiegel
ISABEL CLIVIA
Copyright © 2022 by
Lektorat: Alexandra Fuchs
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Giessel Design
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-405-5
Alle Rechte vorbehalten
Content Notes
On-page: Gewalt, Blut, Tod
Erwähnt: Kidnapping, Alkoholismus
Playlist
Agnes Obel – The Curse
London Grammar – Devil Inside
Hozier – In The Woods Somewhere
MILCK – Monster
Robin Loxley & Oliver Jackson – Be What You Want
Halestorm – I’m Not an Angel
Ruelle – Rival
Tommee Profitt & Sam Tinnesz – Heart Of The Darkness
Theory of a Deadman – Hurricane
Des Rocs – Used to the Darkness
Soap&Skin – Me and the Devil
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Danksagung
Drachenpost
Prolog
DER KÖNIGLICHE ZAUBERWEBER
Thierry Poitiers verliert das letzte bisschen Mut, noch bevor er einen Fuß ins Gefängnis von Pontilliard setzt. Genau in dem Moment, als etwas Weißes auf seiner Schulter landet und seine bordeauxfarbene Robe beschmutzt. Er schnaubt verächtlich.
Ein schlechtes Omen.
So ziemlich jeder andere Bewohner von Saintoux würde dieses Missgeschick als einen Glücksschiss bezeichnen. Die Exkremente eines Vogels abzubekommen gilt als Geschenk des Himmels. Wenn man jedoch vorhat, eine gefürchtete Mörderin aus ihrer Zelle zu befreien, ist Glück so ziemlich das Letzte, wofür diese Sauerei steht. Es kann nur der Vorbote einer Katastrophe sein.
Über ihm ertönt das schadenfrohe Gurren des gefiederten Übeltäters. Thierry legt seinen Kopf in den Nacken. Auf dem Vorsprung des alten Gemäuers hockt eine Taube und plustert sich auf, als wollte sie sagen: Dein Tag ist nicht erst seit eben beschissen.
»Nur ein Feuerball, dann würdest du nicht mehr lachen«, murmelt er.
Er nimmt einen tiefen Atemzug, bevor er den Blick schließlich abwendet. Seine Zeit ist zu kostbar, um sie mit diesem geflügelten Glücksbringer zu verschwenden.
Thierry strafft die Schultern, als könnte er die Demütigung mit einer stolzen Haltung ungeschehen machen, und marschiert zum Gefängniseingang. Der Wind zerrt an seinem dunklen Haar und bläst ihm salzige Meeresluft ins Gesicht. Er kneift die Augen zusammen.
Insel der Wehklagen, so nennen sie diesen Ort. Ein Stück Land mitten im Ozean, direkt vor der Küste der Hafenstadt Pontilliard. Besonders gefährliche Verbrecher werden in diesem Gefängnis weggesperrt, von denen keiner je entkommen wird – es sei denn, man befreit sie. Und ausgerechnet der schlimmsten Insassin muss Thierry jetzt zur Flucht verhelfen.
Die Wachen vor dem Eingang salutieren, als er vor ihnen stehen bleibt.
»Guten Morgen, Monsieur«, grüßt einer der beiden Männer.
Ihre Blicke verweilen länger als nötig auf Thierrys Schulter, doch sie wagen es nicht, ihn darauf anzusprechen. Er nickt und lässt sich nicht anmerken, wie sehr das Ärgernis auf seiner neuen Robe ihn stört.
»Öffnet das Tor«, weist er sie an.
Keiner der beiden stellt seinen Befehl infrage. Vielleicht würden sie es tun, wenn sie wüssten, warum er hier ist.
Nachdem sie die Metalltür beiseitegeschoben haben, verschwindet Thierry ins Innere des Gefängnisses. Bis auf die Fackeln an den dicken Steinwänden, deren Flammen unruhig vor sich hin zucken, entdeckt er keine weitere Lichtquelle. Kälte und Tristesse heißen ihn willkommen. Dieser Ort ist wie geschaffen für große Fehler.
Das werde ich bitter bereuen.
Im Gefängnis herrscht eisiges Schweigen, als hätte man ein Grabtuch darüber ausgebreitet. Keine Schreie, keine Flüche. Nicht einmal ein ersticktes Wimmern dringt aus den Zellen. Vermutlich bleibt nur diese unheimliche und zugleich resignierte Stille, wenn alle Gebete und Verwünschungen bereits gesprochen sind.
Thierry klopft an die Tür, die zum Büro des Aufsehers führt, und tritt ein, ohne eine Antwort abzuwarten.
Armand Duponts Arbeitszimmer ist von allen Räumen in diesem traurigen Loch der schönste, was jedoch nicht bedeutet, dass es sich um ein besonders prächtiges Zimmer handelt. Ein alter Teppich bedeckt den Boden, dessen grässliches Karomuster leider immer noch nicht aus der Mode gekommen ist. Auch die mit Samt überzogenen Stühle vor dem massiven Schreibtisch wirken fehl am Platz, so als hätte man versucht, Flair in einen Aborterker zu bringen. Ein bisschen feiner Stoff und ein paar halbwegs bequeme Möbel machen aus einem modrig riechenden Zimmer mit kahlen Wänden eben keine Wohlfühloase.
Thierrys Blick fällt auf die Kerzen, die den Raum spärlich beleuchten. Es bräuchte nur eine ungeschickte Bewegung, damit der Papierstapel neben ihnen in Flammen aufgeht.
Er hebt die Hand, als wollte er damit Schneeflocken auffangen, und erschafft eine Lichtkugel. Dann lässt er sie in der Luft neben sich schweben, damit sie den Raum erhellt.
»Monsieur Poitiers!«
Dupont erhebt sich von seinem Stuhl. Wäre er größer, würde er mit dieser ausgeprägten Kieferpartie und der Adlernase Respekt ausstrahlen. Stattdessen lässt ihn seine Blässe kränklich erscheinen. Die ist wohl unvermeidbar, wenn man seine Zeit an einem Ort wie diesem verbringt. Er fährt sich über seinen Bart. Den trägt er sicher nur derart lang, weil ihm die Haare auf dem Kopf fehlen.
»Bitte setzt Euch!«, sagt Dupont und deutet auf die Stühle vor dem Tisch. »Möchtet Ihr ein Glas Wein? Ich habe …«
»Nein, vielen Dank.«
»Seid Ihr sicher? Dieser Tropfen ist wirklich …«
»Ich bin in Eile.«
Der Aufseher verstummt und presst die Lippen aufeinander, bis sie an Farbe verlieren. Das Glas Wein hätte ihm sicher gutgetan, denn während sein Blick durch den Raum wandert, als halte er Ausschau nach einem Fluchtweg, zeichnen sich deutliche Schweißperlen auf seiner Stirn ab. Niemand mag Überraschungsbesuche. Vor allem nicht, wenn der Zauberweber der Königin sie abstattet. Aus irgendeinem Grund denken die Leute bei seinen Besuchen immer, er wolle sie für irgendetwas bestrafen.
»Was kann ich für Euch tun?«, fragt Dupont endlich, wobei sich seine Worte eher anhören wie: Was habe ich verbrochen?
»Ich bin gekommen, um eine Gefangene abzuholen.«
»Ihr wollt jemanden mitnehmen?«
»Das will ich in der Tat«, antwortet Thierry, obwohl es ihm widerstrebt, das auszusprechen.
»Wurde ein Urteil aufgehoben? Darüber hat mich keiner informiert.«
»Nein.«
Eine skeptische Falte erscheint zwischen den Brauen des Aufsehers. »Aus welchem Grund wollt Ihr sie dann mitnehmen?«
»Ich bin auf Geheiß der Königin hier. Sie benötigt die Hilfe einer Gefangenen.«
»Die Königin?«, wiederholt Dupont ehrfürchtig. »Was könnte sie von einer dieser Verbrecherinnen wollen? Sie hat doch Euch.«
Das hat sie, denkt Thierry verdrossen. Und ich kann nichts für sie tun. Nichts, außer diesen wahnwitzigen Plan vorzuschlagen, der alles noch viel schlimmer machen könnte.
»Die Befreiung dieser Person ist nicht verhandelbar«, erwidert er, weil er seine Zweifel unmöglich gestehen kann.
»Von wem sprechen wir?« Dupont trommelt mit seinen Fingern auf dem Schreibtisch, als ob er den Namen auf Thierrys Lippen bereits erahnt.
»Alienor Mercier.«
Seine kleinen Augen weiten sich. Für einen Moment sieht er schockiert aus, doch im nächsten starrt er Thierry an, als zweifle er an seinem Verstand. Nur wenige Menschen wagen es, einen der mächtigsten Zauberweber, die das Land je gesehen hat, auf diese Art anzusehen.
»A-Aber Monsieur …«, stammelt er. »Das könnt Ihr nicht ernst meinen! Nicht sie.«
»Waren meine Worte unverständlich? Ich hatte nie den Eindruck, dass ich undeutlich spreche.«
Der Aufseher schüttelt heftig den Kopf. »Ihr habt sie selbst hergebracht. Ihr wisst, was sie ist. Wieso wollt Ihr ausgerechnet sie befreien? Sie hätte längst hingerichtet werden müssen!«
Ja, das hätte sie. Viele fordern ihre Exekution. Vor allem Thierrys eigene Leute gieren nach ihrem Leben, aber keiner von ihnen wird es bekommen, dafür hat er gesorgt.
Er zieht ein gerolltes Pergament aus seiner Robe und reicht es Dupont. »Ich habe hier die Anordnung Ihrer Majestät. Dieses Schriftstück erlaubt mir, Mademoiselle Mercier aus ihrer Zelle zu befreien.«
Dupont reißt ihm das Papier aus den Händen, bricht das Wachssiegel und rollt den königlichen Befehl aus. Mit schmalen Augen überfliegt er die Zeilen, bevor er abrupt innehält und seine Finger fester um das Pergament schließt.
»Sie hat den Verstand verloren«, murmelt er.
Allein die Aussprache solcher Worte könnte jemandem einen Aufenthalt an einem Ort wie diesem bescheren. Heute tut Thierry allerdings so, als hätte er sie überhört. Es gibt wichtigere Angelegenheiten.
Dupont schüttelt den Kopf. »Das kann der Rat der Zauberweber unmöglich gutheißen. Nicht nach allem, was sie getan hat.«
Tatsächlich hat der Rat keinen blassen Schimmer von dieser Sache. Hätten sie davon erfahren, säße Thierry jetzt ebenfalls in einer Zelle. Oder zumindest irgendwo, von wo aus er seinen heiklen Plan nicht in die Tat umsetzen könnte.
»Die Anweisung ist klar und deutlich. Ihr haltet das Siegel und die Unterzeichnung in Euren Händen.«
Dupont lässt seinen Arm sinken. »Aber … warum?«
»Wir brauchen sie, um den Schattenfluch zu bekämpfen.«
»Den Schattenfluch? Wie stellt Ihr Euch das vor? Sie ist eine von denen!«
»Genau deshalb brauchen wir sie.«
Sein Gegenüber will weitere Fragen stellen, doch Thierry bringt ihn mit erhobener Hand zum Schweigen. »Genug der Worte. Führt mich auf der Stelle zu ihr.«
Der Aufseher schluckt, setzt sich in Bewegung und kramt aus einer der Schreibtischschubladen einen Bund mit unzähligen Schlüsseln hervor. Dann läuft er um den Tisch und bleibt vor Thierry stehen.
»Ich hoffe, Ihr wisst, was Ihr tut, Monsieur Poitiers.«
»Würdet Ihr versuchen mich aufzuhalten, wenn ich es nicht täte?«
»Ich …« Dupont stockt und richtet seinen Blick zu Boden.
»Dachte ich mir. Deshalb sparen wir uns solche Fragen lieber.«
Mit hochrotem Kopf verlässt Dupont den Raum. Thierry folgt ihm auf den dunklen Korridor, begleitet von seiner magischen Kugel, die diesen tristen Ort in hellblaues Licht taucht. Im Vergleich zu den finsteren, viel zu schmalen Gängen des Gefängnisses war es im Büro des Aufsehers sogar halbwegs gemütlich.
Nie enden wollende Stufen führen zur untersten Ebene des Gebäudes. Die Kälte kriecht unter Thierrys Robe und verursacht eine Gänsehaut. Dupont pfeift ein Lied vor sich hin, zweifelsohne, um sich zu beruhigen. Schließlich bleibt er vor einer schweren Eisentür stehen und sieht Thierry mit ernster Miene an.
»Seid Ihr sicher, dass Ihr …«
»Ja.«
»Und die Königin will nicht …«
»Sie will nicht darüber diskutieren. Ich übrigens auch nicht. Öffnet die Tür.«
Er unterbricht Dupont heute ständig, aber das scheint den Mann nicht zu stören. Noch einmal schluckt der Aufseher hörbar, als stecke ihm etwas im Hals. Mit zittrigen Fingern sucht er nach dem passenden Schlüssel und dreht ihn im Schloss. Schließlich schiebt er quälend langsam den Türriegel beiseite.
»Bitte sehr«, sagt Dupont, was in etwa so klingt wie: Euch ist nicht mehr zu helfen.
»Danke.«
Thierry verschwindet ins Innere des Raumes. Sekunden später fällt die Tür ins Schloss und wird von außen verriegelt.
»Eine Sicherheitsmaßnahme!«, ruft Dupont. »Falls Ihr in Stücke gerissen werdet!«
Das wird nicht passieren. Aber Thierry ist nicht hier, um den Aufseher von seinem Plan zu überzeugen, sondern jene Frau, die alle für ein Ungeheuer halten.
Er sieht sich um. Abgesehen von seiner magischen Kugel geht das einzige Licht im Raum von einer magischen Zelle aus. Einer Art Mauer, die türkisfarben leuchtet. Sie ohne den entsprechenden Zauber zu überwinden ist unmöglich.
Er macht einige Schritte nach vorn, bis er direkt vor der Zelle steht. Das Innere ihres Gefängnisses ist spärlich eingerichtet. Ein Teppich bedeckt den schmutzigen Boden, genauso hässlich wie der in Duponts Arbeitszimmer. An der Wand stehen einige Regale, randgefüllt mit dicken Büchern in Ledereinbänden.
Alienor sitzt auf dem Bett und starrt ihn mit einem durchdringenden Blick an. Ihre fliederfarbenen Augen leuchten schwach in der Finsternis. Das lange dunkelbraune Haar, einst glänzend und weich, wirkt nun stumpf und glanzlos. Auch die früher einmal sonnengebräunte Haut hat sich in der Zeit hier unten in fahle Blässe verwandelt. Dennoch besitzt sie eine beunruhigende Schönheit, der man sich kaum entziehen kann.
Thierry beißt sich auf die Unterlippe.
Reiß dich zusammen, ermahnt er sich. Sie ist jetzt eine andere.
Als sie aufsteht und mit anmutigen Schritten auf ihn zukommt, erinnert er sich an ihre Fähigkeiten als Tänzerin, die er so oft bewundert hat. Sie bewegt sich genau wie damals, schwebt beinahe lautlos über den Boden.
»Alienor.«
»Sieh mal einer an«, antwortet sie mit melodischer Stimme. »Das ist aber eine Überraschung.«
Kapitel1
DIE QUELLE DER FINSTERNIS
Ich beobachte ihn, ohne mit der Wimper zu zucken. Kalte Wut breitet sich von meiner Magengrube bis in meine Fingerspitzen aus. Die dunkle Macht in mir windet sich wie eine Schlange, die ihre giftigen Zähne in den Mann vor mir graben will. Am liebsten würde ich mir ein Buch aus dem Regal schnappen und es ihm an den Kopf schleudern, aber es würde nur gegen die beschissene Zauberwand prallen.
»Ich hoffe, du hast eine Flasche Wein mitgebracht«, sage ich stattdessen. »Nüchtern wäre ein Gespräch mit dir nämlich schwer zu ertragen.«
Mehr als ein Jahr hat er mich in diesem Loch verrotten lassen, und jetzt taucht er auf, als wäre nichts gewesen. Zu meinem Leidwesen sieht er noch genauso blendend aus wie bei unserer letzten Begegnung, die so verhängnisvoll für mich geendet hat. Wäre nicht wenigstens ein feuerroter Ausschlag drin gewesen? Er müsste nicht einmal sichtbar sein, es würde mir schon reichen, wenn er ganz schrecklich juckt.
Sein unnatürlich schönes Gesicht weckt schmerzhafte Erinnerungen. In seinem dunklen Haar, das ihm bis in den Nacken reicht, schimmern silberfarbene Strähnen, direkt über den Ohren. Sie passen zu seinen hellgrauen Augen und verleihen ihm eine Weisheit, die er nicht zufällig zur Schau stellt. Zauberweber altern nicht wie gewöhnliche Menschen. Die Magie in ihrem Blut konserviert ihren Körper, sodass sie deutlich jünger aussehen, als sie sind. Doch das reicht ihnen nicht, deshalb verändern sie auch nach Belieben ihr Aussehen und machen sich schöner. In Sachen Eitelkeit kann ihnen eben keiner das Wasser reichen. Genauso wenig wie in Sachen Macht. Für die normalen Leute sind sie Götter. Kein Wunder, dass sie sich da selbst für welche halten.
»Ich bin nicht hier, um auf alte Zeiten anzustoßen«, sagt er.
»Wirklich? Wie schade.«
»Ja, das bedauere ich zutiefst.«
Sieh an, den Zynismus haben wir beide nicht verloren. Er hat allerdings keinen Grund, so zynisch zu sein, schließlich sitze ich in diesem Loch, während er sein göttliches Leben genießt.
»Wen hat es diesmal erwischt?«, frage ich ungeduldig. »Muss eine ziemlich wichtige Person sein, wenn der königliche Zauberweber persönlich bei mir auftaucht.«
Er ist nicht mehr hergekommen, seit er mich in dieses magische Gefängnis gesteckt hat. Seine Leute dagegen haben mich häufig besucht, immer mit einer Person im Schlepptau, von der sie geglaubt haben, sie sei schattenverseucht. Sie kommen mit diesen Leuten her, weil ich spüre, ob jemand die schwarze Magie des Fluchs in sich trägt. Allein beim Gedanken an das eisige Prickeln unter der Haut, das ich in der Gegenwart solcher Personen verspüre, läuft es mir kalt den Rücken hinunter.
»Deshalb bin ich nicht hier«, antwortet Thierry.
»Was ist es dann? Möchtest du vielleicht ein paar Beleidigungen loswerden? Nur zu, ich höre. Weglaufen geht ja schlecht.«
»Nein, keine Beleidigungen.«
Ich lege meinen Kopf schief. »Also schön, du hast mein Interesse geweckt. Was könnte der berühmte Monsieur Poitiers ausgerechnet von mir wollen?«
Er verschränkt die Arme vor der Brust, seine typische Reaktion, wenn er mit sich hadert. Auf seiner eleganten Robe prangt ein weißer Fleck, bei dem es sich zweifellos um Vogelkot handelt. Obwohl es kein juckender Ausschlag ist, muss ich grinsen.
»Ich brauche deine Hilfe, um den Schattenfluch zu besiegen.«
»Was?«
»Du hast mich schon verstanden.«
»Ich habe dich gehört, nicht verstanden«, korrigiere ich.
Thierry selbst war es, der mir das meiste über den Schattenfluch erzählt hat. Der legendäre Gauthier – ein Zauberweber, was sonst? – hat ihn vor fast einhundert Jahren erschaffen. Warum weiß niemand, doch seitdem sucht er das Land alle zehn Jahre heim und lockt das Böse aus den finsteren Ecken des Landes hervor. Die Verfluchten, die in dunklen Wäldern oder Höhlen leben und normalerweise nur bei Nacht herauskommen. Aber wenn der Schattenfluch aktiv um sich greift, ändert sich das. Die Zahl der Menschen, die durch die finstere Magie zu Verfluchten werden, wächst stark an. Das Böse liegt in der Luft, setzt sich zuerst im Körper von empfänglichen Personen fest und bringt das Schlechte in ihnen zum Vorschein. Wie Schatten, die von ihnen Besitz ergreifen. Wut, Trauer, Schmerz – solche Emotionen ziehen die dunkle Magie geradezu magnetisch an. Diese Gefühle nähren sie, bis sie sich nicht mehr gegen die Finsternis des Fluchs wehren können und zu Verfluchten werden. Wenn sie zu solchen Wesen werden, durchstreifen sie das Land, um sich auf alles zu stürzen, was sie in die Finger bekommen. Sie sind wie wilde Tiere, die jeden attackieren, der sich ihrem Territorium nähert. Für solche Leute gibt es kein Zurück mehr. Genauso wenig wie für mich.
»Bisher seid ihr gut ohne meine Hilfe zurechtgekommen, also habe ich keinen blassen Schimmer, warum du plötzlich denkst, ich könnte etwas ausrichten.«
»Wir konnten den Schattenfluch nie besiegen«, antwortet Thierry. »Nur zurückdrängen. Mit einem Zauber, der ein Opfer verlangt. Das Leben eines Mitglieds der Königsfamilie gegen die Freiheit unseres Landes. Aus irgendeinem Grund ist Gauthiers Fluch an königliches Blut gebunden.«
Das Blut der Königsfamilie …
Endlich verstehe ich, wie die Zauberweber den Fluch jedes Mal brechen konnten. Im Austausch für zehn Jahre Ruhe haben sie ein Leben geopfert. Nicht nur irgendeins, sondern ein königliches. Kein Wunder, dass sie zuletzt alles dafür getan haben, damit sie ein solches Opfer nicht mehr bringen müssen. Um einen einzigen Monarchen zu retten, würden sie Tausende wie mich leiden lassen.
»Wo ist das Problem?«, frage ich. »Habt ihr plötzlich ein Gewissen bekommen?«
»Das Problem ist, dass die amtierende Königin die letzte ihrer Linie ist. Stirbt sie, können wir dem Fluch beim nächsten Mal nichts entgegensetzen.«
Ich zucke mit den Achseln. »Dann solltet ihr euch in den kommenden zehn Jahren wohl mehr Mühe geben.«
Was draußen geschieht, lässt mich nicht kalt, aber seitdem Thierry mich gebannt hat, sind meine Gefühle gedämpft. Nur die starken Emotionen dringen an die Oberfläche und wecken die dunkle Magie in meinem Blut. Ganz besonders in seiner Gegenwart brodelt sie wie kochendes Wasser. Kein Wunder, immerhin habe ich ihm das trostlose Dasein in meinem magischen Gefängnis zu verdanken. Er hat mich hierhergebracht. Ein Zauberweber, so wie diejenigen, die mich entführt und zu dem gemacht haben, was ich heute bin.
»Wir haben bereits einen vielversprechenden Lösungsansatz gefunden«, sagt Thierry und wirft mir einen bedeutungsvollen Blick zu. »Du bist vermutlich die Einzige, die den Spuk dauerhaft beenden kann.«
»Ach, ist das so? Warum?«
»Weil du Gauthiers Macht in dir trägst.«
»Es gibt andere, das weißt du genauso gut wie ich.«
»Du bist die Einzige bei Verstand.«
»Und die Einzige, die man kontrollieren kann«, füge ich bitter hinzu, obwohl ich das nur vermute.
Meine Kräfte zu bändigen hat Thierry etwas gekostet. Um die Magie in mir zu unterdrücken, musste er mich mit einem mächtigen Bannzauber belegen. Davon zeugt ein schwarzes Mal auf meinem Handrücken. Es gleicht einer Rosenblüte, deren Blätter bis zu meinen Fingern reichen. Ein hübsches Andenken an ein ausgesprochen hässliches Erlebnis.
»Du magst die Macht in mir gebannt haben, aber ich spüre sie trotzdem in jeder Faser meines Körpers«, sage ich. »Ich habe bemerkt, dass es draußen schlimmer geworden ist. Der Fluch breitet sich aus, nicht wahr?«
Deshalb taucht Thierry hier auf. Weil ihm die Zeit davonläuft. Welch eine Ironie, dass ausgerechnet ich der letzte Fels bin, an den er sich klammert, um nicht ins tosende Meer zu stürzen. Wäre das alles nicht so furchtbar schmerzhaft, würde ich darüber lachen.
»Er ist vor Kurzem ausgebrochen«, antwortet er. »Und er wird täglich stärker.«
Ich werfe ihm ein schiefes Lächeln zu. »Lass mich raten: Du willst, dass ich die Heldin spiele, und hoffst, dass ich mich dabei nicht in den Bösewicht verwandele, für den du mich hältst? Von was zeugt das wohl mehr? Mut? Verzweiflung? Vielleicht auch beides, die Entscheidung fällt mir wirklich schwer.«
Seinem gequälten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, behagt ihm das Ganze kein bisschen. »Hätte ich eine Wahl, wäre ich nicht hier.«
Diese Worte versetzen mir einen unerwarteten Stich. Wie naiv, so zu empfinden. Nach allem, was er getan hat, sollte seine Antwort mir nicht mehr wehtun.
»Sag mir, wieso ich die Einzige sein soll, die den Fluch brechen kann«, verlange ich.
Er presst die Lippen aufeinander. Seine abwehrende Haltung verrät, wie ungern er sich in meiner Nähe aufhält. Etwas an mir stößt ihn ab, so wie es alle abstößt. Dieser verdammte Heuchler. Seine Leute haben mich zu dem gemacht, was ich bin, und jetzt fürchten sie sich vor ihrem eigenen Werk. Wie allmächtige Künstler, die Angst vor ihrem lebendig gewordenen Gemälde haben.
»Immer wenn der Fluch ausbricht, gibt es einen Ort, an dem er seinen Ursprung findet. Die Quelle der Finsternis.«
»Ich weiß.«
An einem solchen Ort stirbt das Leben aus, und seine Bewohner fliehen vor der schwarzen Magie. Selbst nachdem der Fluch gebrochen wurde, bleibt ein unheimlicher Rest seiner Macht zurück. Eine dunkle Narbe, die niemals verblasst. Genau wie der Fluch, der nie wirklich gebrochen wurde.
»Es ist der Ort, an dem Gauthier wiedergeboren wird«, erklärt Thierry. »Bevor das geschieht, erwählt er eine Person, die zu einer Art Wächter für die Quelle wird. Soviel wir wissen, kann Gauthier nicht vernichtet werden, solange dieser Wächter lebt. Allerdings kann keiner von uns zum Herz der Quelle vordringen, um herauszufinden, ob das stimmt. Die dunklen Mächte dort sind zu stark. Sie verseuchen jeden, der dem Wächter entgegenzutreten versucht, egal ob Zauberweber oder Krieger. Wir glauben jedoch, es könnte jemandem gelingen, der bereits von der schwarzen Magie verdorben ist.«
»Ihr glaubt?«, hake ich nach. »Das klingt wenig überzeugend.«
»Es hat noch niemand versucht. Weil du die Einzige bist, die das kann.«
Ich lache kalt. »Wie sehr dir das widerstreben muss.«
Er hält meinem Blick stand, ohne zu blinzeln. »Ja, ich kann mir durchaus schönere Dinge vorstellen, als dich zu befreien und ins Ungewisse spazieren zu lassen.«
»Weil du dein Leben an meines gebunden hast?«, frage ich provokant.
Der dämliche Ausdruck, der jetzt in seinem Gesicht erscheint, verschafft mir Genugtuung. Als er mich hierhergebracht hat, dachte er wohl, ich sei bewusstlos. Aber das war ich nicht. Ich erinnere mich bestens an die entsetzte Stimme einer anderen Zauberweberin, die ihm währenddessen immer wieder dieselben Fragen gestellt hat.
Warum hast du sie nicht getötet? Oder es jemand anderen tun lassen? Warum ausgerechnet du?
Mit jedem Wort ist ihre Tonlage höher geworden. Thierrys Antwort habe ich bis heute nicht vergessen, auch wenn ich sie noch immer nicht verstehe.
Manche Bürden muss man selbst tragen.
»Woher weißt du davon?«, will er wissen.
»Man hat mir etwas geschenkt, was gemeinhin als Ohren bekannt ist. Faszinierende Dinger. Damit kann man hören, was andere Leute sagen.«
Sein Kiefer zuckt, doch mehr Kontrollverlust gestattet er sich wohl nicht. »Das hättest du nie erfahren sollen.«
»Dann hättest du diese Sache nicht in meiner Anwesenheit besprechen dürfen.«
»Du warst bewusstlos.«
»Handlungsunfähig.«
Nur wegen dieser Verbindung hatte man mich nicht hingerichtet, denn mein Tod hätte gleichzeitig den des königlichen Zauberwebers bedeutet. Selbst in diesem Drecksloch duldet man mich bloß seinetwegen. Bis heute ist es mir ein Rätsel, was er davon hat. Will er mich auf ewig für etwas bestrafen, was ich nicht getan habe?
Thierry seufzt. »Nichts davon spielt mehr eine Rolle. Egal wie gern ich dich hier unten eingesperrt wüsste, es geht nicht länger um meine Befindlichkeiten. Ich brauche deine Hilfe.«
Was für ein nobles Opfer er doch bringt. Vielleicht genügt es ihm nicht länger, einer der wenigen Zauberweber zu sein, die außerhalb einer festen Gemeinschaft leben, frei von deren verstaubten Regeln. Vielleicht will er ein Held sein. Privilegierten reicht selten das, was sie bereits ihr Eigen nennen. Sie wollen immer mehr.
»Das ist schön und gut«, sage ich. »Nur warum sollte ich mich darauf einlassen? Deine Königin bedeutet mir nichts. Aus welchem Grund sollte ich mein gemütliches Leben in diesem Kerker riskieren? Um den Menschen zu helfen, die mich am liebsten tot sähen? Das erscheint mir kaum lohnenswert.«
Mit seinen Fingern krallt er sich in seine Oberarme, als müsste er sich Mühe geben, die Beherrschung zu wahren. Was hat er denn erwartet? Dass ich mich bereitwillig in den möglichen Tod stürze?
»Ich kann dir die Freiheit schenken.«
Mir entfährt ein bitteres Lachen. Ein anderer Zauberweber hatte mir vor einiger Zeit dasselbe zugesichert, sein Versprechen jedoch nie gehalten. Das größte Talent dieser Leute besteht nicht in ihrer Magie, sondern in der Fähigkeit, sich perfide Täuschungen auszudenken. Lügenweber wäre ein treffenderer Name für sie.
»Freiheit?«, wiederhole ich zynisch. »Zu deinen Konditionen vielleicht. Ich kann nie frei sein, das weißt du. Und was ist Freiheit schon wert, wenn man sie wie ein Tier an einer magischen Leine verbringt?«
Zur Bekräftigung meiner Worte hebe ich die Hand und zeige ihm das Bannzeichen darauf. Thierry starrt es einige Sekunden an, dann wendet er sich ab und richtet seinen Blick zu Boden, als wäre ihm der Beweis seiner Taten peinlich. Seltsam, wo er doch so schrecklich stolz ist.
»Ich kann dir noch etwas anderes geben.«
»So? Da bin ich aber gespannt.«
»Informationen.«
Ich stöhne. »Was soll ich denn hier unten mit Informationen anfangen? Sie an die Ratten verfüttern?«
Tatsächlich hocken die kleinen Nager meist vor der magischen Wand meiner Zelle, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sogar sie sich vor mir fürchten.
»Ich habe Informationen über deine Schwester Sophie.«
Ein Frösteln erfasst meinen Körper, kälter als alles, was ich bisher gespürt habe.
Das war einer zu viel, Thierry.
Ich drücke die Fingernägel in meine Handflächen. »Hat dir niemand beigebracht, dass es eine schlechte Idee ist, denjenigen zu verärgern, dessen Hilfe man benötigt?«
»Das sage ich nicht, um dich wütend zu machen.«
»Lügner.«
Allein den Namen aus seinem Mund zu hören, bricht mir das Herz. Ich habe so oft an meine Schwester gedacht. Doch nichts, was Thierry sagen könnte, ändert etwas an der Tatsache, dass sie tot ist.
Kapitel2
WAHRHEIT
Vor sechs Jahren ist Sophie nach Beaucourt gegangen, um dort am Theater zu tanzen. Ich war damals neunzehn, habe ihr nachgeeifert und dasselbe Ziel verfolgt. Aber sie war mir immer zehn Schritte voraus. Du hast keine Disziplin, hat sie mich getadelt, wenn ich mich darüber beschwert habe, nie so gut zu sein wie sie. Du verbringst deine Zeit lieber damit, den Jungs schöne Augen zu machen, statt zu üben.
Damit hatte sie recht. Aus irgendeinem Grund habe ich erwartet, ein Naturtalent zu sein, dabei ist Ballett mit einer Menge Arbeit verbunden. Erst als Sophie unser Dorf verlassen hat, habe ich härter trainiert. Und dann ist sie gestorben. Ein unglücklicher Sturz bei einer Aufführung. Nach diesem Schock habe ich Tag und Nacht geübt. Ich wollte sie stolz machen, wollte den Traum vom Tanzen für sie weiterleben. Doch die Zauberweber hatten andere Pläne mit mir.
»Schämst du dich eigentlich für gar nichts?«, frage ich zornig. »Du und deinesgleichen könnt nichts als Lügen erzählen! Habt ihr mir nicht schon genug angetan?«
Es waren Zauberweber, die vor drei Jahren meine Kutsche auf dem Weg zur Hauptstadt angehalten haben. Sie haben alle Insassen aus dem Wagen gescheucht und durch eine magische Passage gezerrt, um uns danach in einem alten Kloster einzusperren.
Ausgerechnet der Zauberweber, der mich später in ein weiteres Gefängnis gesperrt hat, wagt es jetzt, Sophies Namen in den Mund zu nehmen.
»Deine Schwester lebt«, beteuert Thierry.
»Das ist unmöglich.«
»Ich sage die Wahrheit, Alienor.«
Ich will mir die Hände auf meine Ohren pressen, damit ich seine Stimme nicht mehr hören muss. Wenn er meinen Namen ausspricht, klingt sie so weich und einfühlsam, als gäbe es da nicht all den Hass zwischen uns, sondern etwas anderes, was nicht sein darf. Etwas, was wir lange verloren haben und das ich immer noch vermisse, ganz egal, wie sehr ich mich dafür schäme.
»Man hat uns einen Brief geschickt, in dem stand, sie sei tot«, erwidere ich. »Seitdem haben wir nie wieder etwas von ihr gehört.«
Thierry sieht mich mitleidig an. »Vor einer Weile habe ich in der Hauptstadt von einer Tänzerin gehört, die schwer gestürzt sein soll – Sophie Mercier. Ich war nicht sicher, ob sie deine Schwester ist, also habe ich es überprüfen lassen.« Er macht eine Pause. »Laut meinen Informationen ist sie wirklich gestürzt, aber seit diesem Vorfall kann sie nicht mehr professionell tanzen. Auch wenn ich die genauen Hintergründe nicht kenne, weiß ich eines mit Sicherheit: Sie lebt.«
Mir wird schlecht. Wie kann das sein? Diese furchtbare Neuigkeit stand schwarz auf weiß in dem Brief, unterzeichnet von der Leiterin des Ballettensembles, bei dem Sophie angestellt war. So etwas denkt sich doch niemand aus. Selbst wenn, hätte meine Schwester es früher oder später richtiggestellt.
»Warum ist sie nicht zu uns zurückgekommen? Wieso hat sie sich nie gemeldet?«, murmele ich mit brüchiger Stimme. »Wir sind doch eine Familie.«
»Ihre Motive kenne ich nicht«, gesteht Thierry.
Ich hasse es, wie einfühlsam er dabei klingt. Und ich wette, er hasst es ebenso.
So gut es geht, versuche ich das Brennen in meinen Augen zu unterdrücken. Ausgerechnet vor ihm zu weinen ist das Letzte, was ich will.
All die Jahre habe ich geglaubt, Sophie sei tot. Warum hat meine Schwester mich in diesem Glauben gelassen, wenn das angeblich gar nicht stimmt? Ist ihr denn nicht klar gewesen, was das mit Vater und mir gemacht hat? Was hat sie sich dabei gedacht?
»Wo ist sie?«, will ich wissen. »Ich muss zu ihr.«
»Sobald du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast.«
»Das ist Erpressung.«
»Du wolltest einen Anreiz. Den habe ich dir gegeben.«
Ich balle die Fäuste und spüre, wie die finstere Magie in mir erwacht. Obwohl das Siegel sie unterdrückt und gefangen hält, so wie dieser Käfig mich einsperrt, ist sie noch immer greifbar. Ein winziger Teil von ihr verstummt niemals.
»Und was, wenn ich es nicht kann? Wenn ich beim Versuch draufgehe, den Fluch zu brechen?? Dann war alles bedeutungslos.«
Empörung huscht über Thierrys feine Gesichtszüge. »Einen Fluch zu brechen, der seit einem Jahrhundert das Land heimsucht, ist wohl kaum bedeutungslos.«
»Für mich schon. Weil ich dann tot bin und meine Schwester ohne Unterstützung dasteht.«
Sollte es dazu kommen, würde ich auch nie die Wahrheit herausfinden. Momentan weiß ich nicht, was ich noch glauben soll. Das Tanzen war Sophies großer Traum, ihr Leben und ihr Lebensunterhalt. Sie wollte immer die beste Tänzerin von ganz Beaucourt sein, wollte schillernde Kostüme tragen, in illustren Kreisen verkehren und überall hohes Ansehen genießen. Hatte sie nach ihrem mutmaßlichen Unfall eine Alternative? Was, wenn sie Unterstützung braucht?
Thierry streicht sich eine Haarsträhne hinter sein Ohr. »Die Königin wird für das Wohl deiner Schwester sorgen.«
»Die Königin?« Den Zweifel in meiner Stimme kann ich nicht verbergen. »Gibt es vielleicht noch eine dreistere Lüge, die du mir auftischen kannst, damit ich dir helfe?«
»Vielleicht überzeugt dich ja das hier.« Thierry hebt seine Hand und lässt sie in rotem Licht erstrahlen. »Deine Schwester lebt. Man hat mir gesagt, wo sie ist und wie sie aussieht. Sie hat braunes Haar, ihre Augen sind himmelblau, genau wie …« Er räuspert sich. Wie deine, wollte er wohl sagen. »Falls dir etwas zustößt, wird Königin Victoire dafür sorgen, dass es Sophie an nichts fehlt.«
Das rote Licht um seine Hand färbt sich grün. Ein Wahrheitszauber. Die habe ich schon viele Male bei den anderen Zauberwebern gesehen. Nur eine einzige Lüge würde dafür sorgen, dass das Licht rot bleibt. Es stimmt also. Trotzdem reicht mir das nicht, denn mein Vertrauen in seine Worte hat Thierry mit seinem Verrat eigenhändig zerstört.
»Ich will das Wort der Königin«, verlange ich.
»Bitte?«
»Sie soll mir persönlich versprechen, dass sie sich um Sophie kümmern wird.«
Meine Forderung entrüstet ihn sichtlich, aber seine Not ist nicht von der Hand zu weisen. Könnte er die Angelegenheit ohne meine Hilfe lösen, wäre er wohl kaum hier.
»Einverstanden«, antwortet er widerwillig.
Trotz meines kleinen Sieges verspüre ich keine Euphorie. Allein der Gedanke daran, mit Thierry zusammenzuarbeiten, versetzt mein von schwarzer Magie getränktes Blut in Wallung. Diese Allianz wird alte Wunden aufreißen, die noch nicht verheilt sind. Doch der Anreiz, Sophie zu finden, ist stärker als mein Zorn und der verletzte Stolz. Ich muss sie finden. Vater wird es besser gehen, sobald er sie wiedersieht, davon bin ich fest überzeugt. Was mit mir passiert, spielt dann keine Rolle mehr. Für mich gibt es kein Zurück. Für meine Familie dagegen schon.
»Die Sache gefällt mir genauso wenig wie dir«, sagt Thierry und lässt die Hand sinken, woraufhin das grüne Licht verschwindet. »Immerhin hast du eine Zauberweber-Gemeinschaft vollständig ausgelöscht.«
»Behauptest du. An diesen Tag habe ich keinerlei Erinnerung, das habe ich dir gesagt.«
Er kommt einen Schritt näher. »Warum sollte es nur den leisesten Zweifel daran geben? Alle waren tot und du auf der Flucht. Ich habe …«
»Was hättest du an meiner Stelle getan? Gewartet, bis jemand kommt und dich verurteilt? Niemand hätte mir geglaubt!«
Dieser verhängnisvolle Tag ist ein dunkler Fleck in meiner Erinnerung. Als ich zu mir gekommen bin, waren sämtliche Personen im Kloster schon tot. Ich bin panisch geflüchtet, aus Angst, dafür hingerichtet zu werden, obwohl ich nicht einmal wusste, was passiert war. Mehr als ein Jahr habe ich mich an einsamen Orten abseits der Städte versteckt und mich durchgeschlagen, während die Zauberweber Jagd auf mich gemacht haben. Ich bin ihnen stets entkommen. Bis man Thierry Poitiers geschickt hat. Die eine Person, vor der ich nicht weggelaufen bin.
»Flucht überzeugt niemanden von deiner Unschuld«, wirft er mir vor.
Natürlich glaubt er mir nicht, schließlich ist er ein Zauberweber. Doch obwohl ich das weiß, tut es weh zu sehen, wie sehr er von meiner Schuld überzeugt ist.
»Nehmen wir mal an, ich hätte deine Leute tatsächlich getötet. Würde dich das wundern? Ihr habt mich gegen meinen Willen zu dem gemacht, was ich bin! Man hat mich einfach in dieses Kloster geschleppt!«
Thierry schüttelt den Kopf. »In den Gemeinschaften haben meine Kollegen ausschließlich mit Freiwilligen gearbeitet. Das war unumstößlich. Jeder musste sich daran halten.«
»Wenn du glaubst, jede Gemeinschaft hätte das beherzigt, denkst du wahrscheinlich auch, wir Versuchspersonen haben uns dort an den Händen gehalten und haben jeden Abend fröhlich um ein Lagerfeuer getanzt!«
Wieder reagiert er mit einem Kopfschütteln. Wie ich ihn dafür hasse. Doch egal wie vehement er alles leugnet, es ändert nichts an der Wahrheit. Er sollte wissen, dass ich mich nie freiwillig zu so etwas bereit erklärt hätte.
»Wir sollten das später diskutieren«, meint er, ganz der Pragmatiker, den ich kenne. »Jetzt müssen wir schleunigst etwas gegen den Fluch unternehmen. Dafür zahle ich jeden Preis.«
»Warum?«, frage ich ehrlich interessiert. »Ich mache das für meine Schwester. Was ist dein Grund? Deine Zauberweberehre? Königstreue?«
»Ich habe jemandem ein Versprechen gegeben, das ich zu halten gedenke.«
Mir entfährt ein eisiges Lachen. »Tu nicht so, als ob du unter deiner feinen Robe nur einen Funken Anstand versteckst.«
»Du wärest überrascht«, erwidert er.
Ich schürze die Lippen. »Ihr Zauberweber seid ein Haufen Größenwahnsinniger, die alles und jeden für ihre Zwecke opfern würden.«
»Und was ist mit dir?«
Bei dieser Frage zucke ich zusammen. Ja, was ist mit mir? Was bin ich in dieser Welt? Das Ungeheuer, das die Menschen in mir sehen, obwohl niemand mich wirklich kennt? Vielleicht wäre es leichter, das zu sein.
Mehr als ein Schulterzucken bringe ich nicht zustande. »Ich bin, was auch immer du in mir siehst, schätze ich. Dich interessiert ohnehin nur deine Wahrheit. Glaub an sie, wenn es dich glücklich macht.«
Er sieht mich an wie einen Feind, der früher einmal ein Freund gewesen ist. Wir waren so viel mehr als das, und ich weiß nicht, wer uns das genommen hat. Die anderen Zauberweber? Ich? Oder er ganz allein?
»Solltest du versuchen, mich in einem unachtsamen Moment loszuwerden, lass dir gesagt sein, dass du keinen Erfolg haben wirst«, sagt er düster.
»Das traust du mir zu?«
»Dir traue ich alles zu.«
»Und warum glaubst du dann, du könntest mich aufhalten, wenn ich es auf dein Leben abgesehen hätte?«
»Weil mein Bannzauber in beide Richtungen funktioniert. So wie ich sterbe, wenn du es tust, würdest auch du sterben, wenn ich es tue.«
Meine Miene gefriert.
Dieser Mistkerl. Ich hätte damit rechnen müssen, dass einer wie er Vorkehrungen trifft, um sein Leben zu retten. Sogar die selbst ernannten Götter fürchten den Tod.
»Du hast sie doch nicht mehr alle!«, schimpfe ich. »Wie kann es sein, dass ich im Gefängnis sitze, während Leute wie du unbehelligt rumlaufen dürfen?«
»Du hast Menschenleben auf dem Gewissen!«
»Das kannst du nicht beweisen! Aber ich weiß, was deine Leute getan haben! Trotzdem stehst du hier und denkst, ihr wäret irgendwie besser. Wenn ich es verdiene, in dieser Zelle zu sitzen, gebührt deinen Zauberweberfreunden die nebenan!«
Er öffnet den Mund, um zu protestieren, doch letztendlich kommt ihm nur ein Seufzer über die Lippen. »Darüber zu diskutieren ist müßig. Ich brauche dich, um den Fluch zu brechen, und nichts anderes zählt.«
Ich brauche dich.
Diese Worte hätten mir vor einiger Zeit die Welt bedeutet, aber in diesem Moment klingen sie hohl und kalt.
Thierry hebt beide Arme, woraufhin seine Robe bis zu den Ellenbogen herunterrutscht. Er schließt die Augen, ballt die Hände zu Fäusten und konzentriert sich. Wenig später zerspringt die transparente Wand, schwebt in glitzernden Flocken durch die Luft und rieselt schließlich wie Schnee zu Boden.
»Gehen wir«, fordert er mich auf. »Wir haben eine Audienz bei der Königin.«
»Du bringst mich ins Schloss?«
Er nickt. »Das war deine Bedingung, oder? Du wolltest das Wort der Königin, also sollst du es auch bekommen.«
»Hast du keine Angst, dass ich auf sie losgehe?«
»Daran könnte ich dich jederzeit hindern.«
Zweifellos. Thierry verfügt über mächtige Magie, während meine Kräfte seiner Kontrolle obliegen. Aber wer sagt eigentlich, dass ich gegen ihn kämpfen muss? Weglaufen wäre auch eine Möglichkeit.
»Denkst du, ich würde mich ein zweites Mal von dir fangen lassen?«, frage ich.
Er sieht mich ernst an. »Mir wirst du niemals entkommen.«
Die schwarze Magie in mir wirft sich gegen ihr unsichtbares Gefängnis, aus dem es kein Entrinnen gibt, solange er nicht die Tür aufsperrt. Thierry hat recht. Er würde mich immer finden. Ich habe meine einzige Chance auf Freiheit verwirkt, denn was auch immer uns jetzt verbindet, lässt sich nicht mehr zerstören. Das macht mir mehr Angst, als ich zugeben will.
Kapitel3
FLUCHWEBER
Ich verlasse meine einstige Gefängniszelle. Es tut gut, mich frei bewegen zu können, doch dieses Geschenk genieße ich mit Vorsicht. Alles hat seinen Preis, wenn man mit Zauberwebern verhandelt.
»Du hast übrigens Vogelkot auf deiner Schulter«, sage ich und deute auf den weißen Fleck. »Gefällt mir. Der verleiht dir Demut.«
Thierry rollt mit den Augen. »Wenn du fertig mit Starren bist, können wir los. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also sollten wir die Audienz schnell hinter uns bringen.«
Ich runzle die Stirn. »Soviel ich weiß, ist die Hauptstadt einige Tagesritte entfernt. Und die Tatsache, dass wir uns auf einer Insel befinden, macht das Ganze nicht besser.«
Eine Falte erscheint zwischen seinen Brauen. »Woher weißt du, wo du bist?«
»Ich belausche die armen Kerle, die mir das Essen bringen. Meistens beschweren sie sich darüber, dass ausgerechnet sie auf dieser Insel festsitzen und einem Ungeheuer wie mir Nahrung geben müssen.«
Zweimal am Tag, immer zur selben Zeit, ist Thierrys Zauberkäfig zusammengeschrumpft, sodass die Wärter das Essen ungefährdet auf dem Tisch abstellen konnten. Wenig später hat er sich erneut ausgedehnt. Ziemlich perfide, auf so eine Idee zu kommen.
»Wir nutzen eine Passage«, verkündet Thierry.
»Auf keinen Fall.«
Allein bei dem Wort dreht sich mir der Magen um. Ich werde nie wieder durch eine Passage gehen, schon gar nicht freiwillig. An die Ereignisse vor drei Jahren, als die Zauberweber mich durch ihre Passage gezerrt haben, erinnere ich mich lebhaft. Bei dem Gedanken daran wird mir schwindelig.
»Dir bleibt nichts anderes übrig«, erwidert Thierry. »Du hast Zeit, dich mit dem Gedanken anzufreunden, bis wir an der frischen Luft sind. Ich kann erst außerhalb dieser Mauern eine Passage öffnen.«
Wie kommt er darauf, dass ein Spaziergang etwas an meiner Einstellung zu der Sache ändern könnte? Lieber schwimme ich ans Festland, bevor ich eine Passage betrete.
»Ich hasse dich«, knurre ich.
»Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, glaub mir.«
»Dir glaube ich überhaupt nichts mehr.«
Er stöhnt entnervt und kramt in den Taschen seiner Robe. Der Schein seiner Lichtkugel fällt auf den Gegenstand, den er hervorzieht – ein himmelblaues Seidentuch.
Ich mustere es skeptisch. »Hat unser kleines Wiedersehen dich etwa zu Tränen gerührt? Hätte dich nicht für sentimental gehalten.«
»Bestimmt nicht.«
Bevor ich etwas erwidern kann, wirkt er seine Magie, und das Tuch verwandelt sich in einen Umhang mit Kapuze. Die Farbe ist gleich geblieben, doch zusätzlich befindet sich ein Seidenband am Stoff, mit dem man den Umhang vorn zuknoten kann. So ein hübsches Kleidungsstück habe ich lange nicht mehr gesehen.
Die dunkle Macht in mir faucht bei diesem Anblick geradezu. Vielleicht, weil sie meinen Schmerz und meine unstillbare Sehnsucht spürt. Solche Tricks würde ich auch gern beherrschen. Ich würde gern schöne Dinge erschaffen, doch meine eigenen Fähigkeiten beschränken sich auf Zerstörung.
»Den solltest du überziehen«, meint Thierry.
»Nach all der Zeit machst du dir plötzlich Sorgen, dass ich erfriere?«
»Nein.«
Kälte spüre ich nicht mehr so intensiv wie früher. Während der langen Tage in dieser Zelle habe ich sie nicht einmal wahrgenommen. Keine Ahnung, ob er das weiß. Mehr als ein Jahr bin ich bereits hier unten. Jeden Morgen nach der Mahlzeit habe ich eine Seite aus einem der Bücher herausgerissen, um die Tage zu zählen.
»Ich will kein Aufsehen erregen«, erklärt Thierry.
»So abstoßend bin ich auch wieder nicht, dass du mich verstecken müsstest.«
»Nein, bist du nicht.«
»Ah, das gibst du also zu?«
»Nimm ihn schon«, brummt er.
Ich rümpfe die Nase. »Wenn du Angst hast, die Wärter könnten bei meinem Anblick tot umfallen, hättest du mich vielleicht nicht befreien sollen.«
Obwohl es mir Spaß macht, ihn zu nerven, nehme ich schließlich den Umhang. Für einen Moment berühren sich unsere Finger, seine warm, meine kalt. Sofort zieht er seine Hand zurück, als hätte er bloßes Eis angefasst.
»Du bist nicht immer so zurückgezuckt«, murmele ich und schlüpfe in den Umhang. Der glatte Stoff schmiegt sich seidig weich an meine Haut.
»Die Dinge haben sich geändert.«
»Nur weil die Umstände sich verändert haben, sind wir keine neuen Menschen geworden.«
Thierry kehrt mir wortlos den Rücken zu und marschiert zur Tür. Klar, ein Zauberweber hört sich natürlich nur die Dinge an, die er auch hören will.
»Macht die Tür auf, Dupont!«
»Brenn einfach ein Loch hinein«, schlage ich vor und ziehe mir die Kapuze über. »Leute wie du holen sich doch sonst immer alles, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen.«
Er lächelt finster. »Du hast wohl nicht vor, das hier so angenehm wie möglich für uns zu machen.«
»Das hier ist alles, aber nicht angenehm. Tun wir also nicht so, als könnte es das sein.«
Ich werde niemals vergessen, was er getan hat. Seine Jagd auf mich oder den hinterhältigen Trick, mit dem er mich dazu gebracht hat, ihm zu vertrauen. Ich dachte, er würde mich verstehen. Mich vermissen, mich lieben. Doch dann hat er mich an sich gebunden und in dieses Gefängnis gesteckt. Dafür ist das, was ich ihm bislang an den Kopf geworfen habe, viel zu zahm.
Allein der Gedanke an seinen Verrat reicht, um meine Schattenkräfte an die Oberfläche zu locken. Ein zarter Hauch von schwarzem Nebel kriecht über meine Hände.
»Was machst du da?«, fragt Thierry irritiert.
»Angst vor der Dunkelheit, Poitiers?«
Ich schenke ihm ein böses Lächeln. Ein letzter Rest meiner Macht lässt sich nicht einmal durch sein Siegel zurückhalten, aber zu mehr als diesem Kunststück bin ich leider nicht fähig.
Er presst die Lippen aufeinander. »Nicht im Geringsten.«
So ein elender Lügner. Ich sehe genau, wenn er flunkert. Dann kann er meinen Blick nicht festhalten und tut so, als hätte ich seinen Stolz verletzt.
»Jeder fürchtet sich vor der Dunkelheit. Willst du wissen warum? Weil sie die Menschen an das erinnert, was in ihren eigenen Herzen lauert.«
Jemand entriegelt die Tür. Ein kleiner kahlköpfiger Mann mit Bart, den ich noch nie zuvor gesehen habe, späht in den Raum. Als er mich entdeckt, weiten sich seine Augen.
»Tu unserem Befreier einen Gefallen und beeil dich«, fordere ich Thierry auf. »Ich glaube, er wird erst wieder atmen, wenn ich außer Sichtweite bin.«
»Damit hast du vermutlich recht.« Er setzt sich in Bewegung. »Bis zum nächsten Mal, Dupont.«
Eine Antwort erhält er nicht, doch der Mann sieht aus, als würde er daran zweifeln, dass es ein nächstes Mal gibt.
Ich folge Thierry durch den finsteren Korridor, begleitet von seinem Lichtzauber, der uns den Weg erhellt. Das Gefängnis ist ein stiller, trostloser Ort ohne Hoffnung. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu verlassen, zusammen mit den Wärtern, die mich behandeln wie ein wildes Tier.
»Also«, sage ich nach einer Weile. »Du kannst ein Taschentuch in einen Umhang verwandeln, schaffst es aber nicht, einen einzigen Zauberweber loszuwerden?«
Ich genieße es, meine Stimme zu nutzen, auch wenn sie etwas rau klingt. Während meiner Gefangenschaft habe ich manchmal laut gelesen, um sie nicht einrosten zu lassen.
»Fluchweber«, korrigiert Thierry.
»Ach ja.«
Zauberweber, die sich der schwarzen Magie zuwenden, nennen seine Leute Fluchweber, weil sie in der Lage sind, mit ihren Taten einen Fluch zu erschaffen. Meistens werden sie allerdings aufgehalten, bevor sie vollkommen den Verstand verlieren.
»Gauthier ist kein gewöhnlicher Fluchweber«, erklärt Thierry, während wir die Treppenstufen erklimmen. »Kein anderer ist so tief in verbotenen Zaubern versunken. Er besitzt eine unvorstellbare Macht.«
Aus dem Grund scheint er auch unsterblich zu sein. Zauberweber leben außerordentlich lange, aber in der Regel kann man sie trotzdem töten. Gauthier dagegen taucht kurz nach seinem Tod wie aus dem Nichts wieder auf. Nur wenn der Fluch zurückgedrängt wird, verschwindet auch er. Bis der Fluch zurückkehrt.
»Er nutzt also mächtige schwarze Magie. Warum tut ihr nicht dasselbe? In diesem Fall dürfte der Zweck wohl die Mittel rechtfertigen. Bei euren Experimenten hattet ihr schließlich auch keine Probleme damit.«
»Das war keine schwarze Magie«, fährt Thierry mich an. »Ein Zauber, der mit Blut gewirkt wird, ist unberechenbar. Wir könnten damit einen weiteren Fluch erschaffen, genauso schrecklich wie dieser. Beim letzten Mal, als jemand zu tief in die schwarzen Künste eingedrungen ist, wurde der Blutfluch geboren.«
Ich gehe schweigend neben ihm her. Der Blutfluch ist eine weitere Abscheulichkeit, die von Zauberwebern in die Welt gebracht wurde. Er hat die Existenz von Vampiren zu verantworten. Ich kann von Glück reden, noch keinem begegnet zu sein.
Auf unserem Weg durch das Gefängnis hadere ich damit, ob ich die Luft anhalten oder tief einatmen soll, weil der Umhang nach Thierry riecht. Sein ganz eigener, unverkennbarer Duft, der mich an Abende vor einem knisternden Kaminfeuer und Minztee in den Händen erinnert. An Gespräche unter klarem Sternenhimmel und Nächte voller Geborgenheit. An nichts davon sollte ich denken. Ich sollte den Umhang ablegen und in eine schmutzige Ecke werfen, damit er zusammen mit der Vergangenheit in Vergessenheit gerät. Doch ich tue es nicht, weil ich offenbar schwächer bin, als ich dachte.
Wir gelangen zum Ausgang, einem massiven Metalltor, das Thierry mit einer Handbewegung öffnet.
Verdammter Angeber.
Als das Tageslicht in den Eingangsbereich fällt, kneife ich die Lider zusammen und halte mir stöhnend den Arm vor die Augen, um sie abzuschirmen. Es dauert eine Weile, bis ich mich ansatzweise an die Helligkeit gewöhne. Wenn ich das schon hier drin kaum verkrafte, wie muss es dann erst draußen sein?
Nach einiger Zeit öffne ich vorsichtig die Augen und folge Thierry hinaus. Der salzige Geruch des Meeres strömt mir in die Nase und erinnert mich an das eine Mal, als Vater mit uns zur Küste gereist ist. Ein sanfter Windhauch kitzelt meine Haut und die rauschenden Wellen schlagen gegen die Brandung. Ich atme tief ein, genieße das Gefühl, endlich an der frischen Luft zu sein.
So fühlt sich Freiheit an.
Ich weiß, dass das hier nicht von Dauer sein wird, aber die Illusion ist zu schön, um sich nicht für einen Moment in ihr zu verlieren. Mit schmerzenden, halb zusammengekniffenen Augen folge ich Thierry über die Steinbrücke vor uns und sehe kurz über die Schulter. Wenn ich nicht wüsste, dass die kleine Insel ein Gefängnis beherbergt, fände ich sie idyllisch. Das alte Gemäuer fasziniert mich, wirkt wie eine Schlossruine im Ozean. Ob dieser Ort schon immer für solche Zwecke genutzt wurde?
Als ich den Blick wieder nach vorn richte, blitzt ein grelles Licht einige Meter vor uns auf. Es weitet sich aus, wird zu einem leuchtenden Tor. Eine magische Passage, aus deren Schein eine Person tritt. Der Mann in pechschwarzer Robe kommt auf uns zu. Trotz seiner beachtlichen Größe bewegt er sich elegant, setzt leichtfüßig einen Schritt vor den nächsten. Sein dunkles lockiges Haar hat er streng über den Kopf gekämmt. Die ausgeprägten Wangenknochen und die schmalen Lippen verleihen seiner Erscheinung etwas Kantiges.
Ich wende mich von dem Fremden ab und werfe Thierry einen fragenden Blick zu. Der Mann ist ein Zauberweber, daran besteht kein Zweifel. Allein schon deswegen müssen die beiden sich kennen, so viele von ihnen gibt es schließlich auch nicht. Thierrys Gesichtsausdruck verfinstert sich jedoch zunehmend. Seine Reaktion lässt nur einen Schluss zu: Diesen Mann will er jetzt und hier nicht sehen.
Kapitel4
GÖTTER AUS FLEISCH UND BLUT
Ob das Gauthier ist? So früh hatte ich nicht mit einem Aufeinandertreffen gerechnet, aber anders kann ich mir Thierrys schlechte Laune nicht erklären.
Ich versuche meine Anspannung mit einem zynischen Lächeln zu überspielen. »Irgendwie hatte ich mir den legendären Fluchweber anders vorgestellt. Eher wie jemanden, der einem okkulten Gott Menschenopfer darbringt. Du weißt schon, mit blutverschmierten Händen und dergleichen.«
»Das ist nicht Gauthier.«
»Sondern?«
»Er ist … ein Kollege«, erklärt Thierry zögerlich.
»Wohl kein besonders geschätzter.«
Der Mann vor uns schnaubt. »Das liegt daran, dass unser königlicher Zauberweber sich immer noch für das schämen sollte, was er mir angetan hat.«
Thierry verzieht keine Miene. »Diese Sache liegt Jahrzehnte zurück, Davide.«
»Trotzdem habe ich sie nicht vergessen.«
Seine Stimme trieft vor Gift, Hass und etwas anderem, das unter der feindseligen Oberfläche lauert.
Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Falls er dich nicht durchs Land gejagt, mit einem hinterhältigen Trick gefangen genommen und in eine magische Gefängniszelle gesperrt hat, kannst du dich schön hinten anstellen.«
Davide grinst, als sein Blick auf mich fällt, und entblößt dabei seine schiefen Zähne. Obwohl er sich danach wieder Thierry zuwendet, bleibt seine Belustigung unverkennbar. »Weiß der Rat, was du hier treibst?«
Thierry versteift sich neben mir. »Meine Anweisungen kommen von der Königin. Ich schulde nur ihr Rechenschaft.«
Das entlockt Davide ein verächtliches Schnauben. »Nicht in eintausend Jahren würde unsere verehrte Regentin auf die Idee kommen, das Schattenmädchen zu befreien. Du hast ihr das eingeflüstert, oder?«
»Was willst du, Davide?«, fragt Thierry wütend. »Ist es immer noch meine Position bei Hofe? Willst du mir deshalb den Rat auf den Hals hetzen?«
Davide lächelt süffisant. »Der Rat könnte mich kaum weniger interessieren. Genauso wenig, wie mich deine Position schert. Ich verabscheue dich für das, was du getan hast. Auch jetzt. Aber mir sind andere Dinge wichtiger geworden. Inzwischen habe ich eine Position, bei der man mich für meine Arbeit schätzt.«
Er zieht ein Messer aus dem Gürtel unter seiner Robe und schneidet sich in die Handfläche. Blut quillt aus der Wunde. Kurz darauf entsteht ein rotes Leuchten an derselben Stelle, breitet sich aus und schießt direkt auf uns zu. Doch statt gegen uns zu prallen, fliegt der Zauber an uns vorbei.
»Was zum …?«, entfährt es Thierry.
Ich stöhne auf. »Schwarze Magie. Warum überrascht mich das nicht?«
»Greift sie an!«, ruft Davide.
Thierry und ich fahren erschrocken herum. Die beiden Wachen am Gefängniseingang verlassen ihre Position. Sie kommen auf uns zu, legen ihre Musketen an und richten sie auf uns.
Verdammter Mist.
Thierry streckt den Arm aus und wirft beide Männer mit einem magischen Stoß zurück, bevor sie schießen können. Sie stürzen zu Boden, wobei sie ihre Waffen verlieren. Doch sobald sie sich gesammelt haben, greifen sie erneut danach. Ein ohrenbetäubender Knall gellt durch die Luft. Die Kugel donnert gegen eine unsichtbare Wand und fällt zu Boden. Ein magischer Schutzwall. Glück gehabt.
Mit einer weiteren Handbewegung reißt Thierry dem ersten Mann die Waffe aus den Händen und lässt sie von der Steinbrücke fliegen. Nachdem er den anderen Angreifer ein weiteres Mal von seinen Füßen gerissen hat, deutet er auf den Unbewaffneten, woraufhin dieser in seiner Bewegung innehält, unfähig, sich zu rühren.
Götter aus Fleisch und Blut, schießt es mir durch den Kopf.
Aber ein Gott an meiner Seite ist auch nötig, um das hier zu überstehen, denn die Männer sind nicht länger sie selbst. Sie stehen unter dem Einfluss von schwarzer Magie.
Thierry wirbelt zornig herum. »Was hast du getan, Davide?«
Ein böswilliges Lachen ertönt. »Was ich schon längst hätte tun sollen. Mein volles Potenzial ausschöpfen. Gauthier hatte recht, ihr Zirkelweber seid viel zu ängstlich, um eure Gabe so zu entfalten, wie sie es verdient.«
»Gauthier?«
»Überrascht es dich, seinen Namen aus meinem Mund zu hören? Oder sehe ich da Angst in deinen Augen?«
Ich drehe mich wieder um. Thierrys Miene zeigt eine Menge Emotionen, und Angst gehört sicher nicht dazu. Stattdessen erkenne ich vor allem Zorn.
»Du hast dich mit Gauthier verbündet? Hast du den Verstand verloren?«
Davide schüttelt den Kopf. »Ich schlage mich lediglich auf die Gewinnerseite. Von deiner Königin und dem Rat wird nichts mehr übrig sein, wenn Gauthier sich um sie gekümmert hat. Und das wird er, denn du bist zweifellos hier, weil du dich gegen einen weiteren Opferzauber entschieden hast. Ein tragischer Fehler, mein lieber Kollege. Denn welchen Plan du auch immer in deinem klugen Köpfchen ersonnen hast, er wird scheitern. Dafür sorge ich höchstpersönlich.«
Davide lässt seine Hand in gleißendem Licht erstrahlen, doch dieses Mal ist es silbern statt rot.
»Ahh!«
Thierry umfasst sein linkes Handgelenk. Was auch immer Davide ihm angetan hat, sorgt dafür, dass er sich vor Schmerzen krümmt. Er geht ächzend in die Knie und starrt auf seinen Handrücken, wo auf einmal ein schwarzes Mal prangt, das meinem eigenen ähnelt. Statt einer Rose stellt es allerdings einen Dolch dar.
»Was ist passiert?«, frage ich hektisch.
Er hebt den Kopf. In seinem Blick liegt Verzweiflung, und zum ersten Mal werde ich richtig nervös. »Er hat meine Magie versiegelt.«
»Was?!«
Mit der Faust schlägt er auf den Boden, als könnte er das Siegel damit zerstören. »Anders als bei dir, aber …« Er keucht. »Meine Kräfte sind stark beeinträchtigt. Ich kann nicht …«
Ein Schuss zerfetzt die Luft. Ich zucke zusammen. Die Kugel schlägt nur Zentimeter neben Thierry auf dem Boden ein.
»Das reicht«, befiehlt Davide. »Wartet auf mein Zeichen.«
Bevor ich mich nach den Wachen umdrehen kann, hebt mich etwas von den Füßen. Ich schwebe nach oben und der Boden entfernt sich immer weiter von mir. Ein Meter, zwei Meter, vielleicht drei. Eine drückende Übelkeit überkommt mich. Magie beherrscht meinen Körper. Ich hasse es so sehr. Diese Machtlosigkeit. Das Gefühl, einem Zauberweber ausgeliefert zu sein.
»Und jetzt zu dir«, ruft Davide. Er hat seine Hand in meine Richtung ausgestreckt und lässt mich mithilfe seiner Magie schweben. »Gauthier will deinen Tod. Also soll er ihn auch bekommen.«
Niemals.
»Du musst das Siegel lösen!«, schreie ich, in der Hoffnung, Thierry versteht mich.
Ich weiß, dass er meinen Bann temporär aufheben kann. Und er muss, sonst sind wir am Ende.
»Nein!«
Thierry richtet sich auf und wirft Davide mit einem magischen Stoß um. Sofort stürze ich ab, doch bevor ich mir alle Knochen brechen kann, hält mich etwas wenige Zentimeter über dem Boden fest. Sanft lande ich auf dem staubigen Grund. Thierry kommt zu mir, packt mich am Oberarm und öffnet eine flackernde Passage.
»Rein da«, ruft er.
»Was?! Bestimmt nicht!«
»Wir werden sterben, wenn du es nicht tust!«
»Ich werde mit ihm fertig. Du musst nur den verdammten Bann lösen!«
Es ist nicht meine Schuld, dass wir in diesem Schlamassel gelandet sind. Davide hat offensichtlich ein Problem mit Thierry, weshalb er sich mit dem schlimmsten Fluchweber überhaupt verbündet hat.
»Er wird dich mit schwarzer Magie angreifen, und das können wir nicht riskieren!«
»Aber wir …«
Mehr bringe ich nicht heraus, denn ich sehe, wie Davide auf die Füße kommt und bereits das Messer in der Hand hält.
»Jetzt komm!«, schreit Thierry.
Bevor ich noch einmal protestieren kann, zieht er mich mit aller Macht durch seine Passage. Ein wütender Schrei ertönt hinter uns, aber nachdem sich der magische Durchgang geschlossen hat, verschluckt ein pfeifender Wind Davides Stimme.
Ein Sturm wirbelt mich durch die Luft, und wir befinden uns inmitten eines grellen silbernen Lichts. Etwas zerrt heftig an meinem Körper, wie eintausend Hände, die versuchen mich auseinanderzureißen. Ich schreie, doch meine Stimme wird fortgetragen, bevor sie in meinen Ohren widerhallen kann. Thierry schließt seine Finger fest um meinen Oberarm. Sein Atem ist direkt an meinem Ohr. Mein Herz rast und auf meiner Brust liegt ein furchtbarer Druck.
Nicht an damals denken. Bloß nicht an damals denken.
Das hier fühlt sich anders an als vor drei Jahren. Schlimmer. Die Magie erdrückt mich. Ich kann nicht mehr atmen, kann mich nicht bewegen, nicht einmal schreien. Meine Sinne sind benebelt, darum kneife ich die Augen zusammen, will das Ende nicht sehen, wenn es mich holt.
Lass mich nicht los, denke ich noch.
Dann lässt das Pfeifen nach und der Druck verschwindet. Ich stürze auf einen weichen Untergrund.
Obwohl ich sanft gelandet bin, tut mir alles weh. Ächzend öffne ich die Augen. Ich liege auf einem hässlichen Teppich mit Karomuster, das so ziemlich jede Farbe beinhaltet, die es gibt.
Wo bin ich?