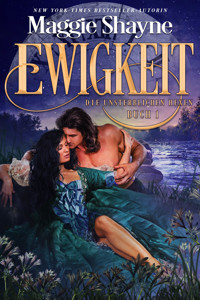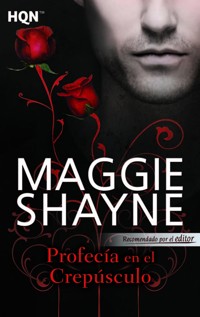4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: 2 Herzen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Intensiv, mystisch und lyrisch“, schwärmt das Library Journal und nennt die New York Times Bestsellerautorin Maggie Shayne „eine der wichtigsten Autorinnen von romantischer Fantasy“. Nidaba, die Hohepriesterin, die er anbetete, war angeblich vor mehr als viertausend Jahren in einem Feuer umgekommen. Aber als der einstige König von Sumer, Eannatum, der jetzt ein ruhiges Leben als moderner Nathan King führt, ihr Foto in einer Zeitung sieht, muss er es genau wissen. Er findet die einst mächtige Hohepriesterin von Inanna in einer geschlossenen Nervenheilanstalt, katatonisch und allein. Doch als er sie befreit und in seinen friedlichen Zufluchtsort bringt, um sie wieder gesund zu pflegen, weiß er nicht, dass die Dunkelheit, die sie vor langer Zeit auseinandergerissen hat, sie beobachtet und dass er sein neues Leben und alle, die er liebt, in schreckliche Gefahr bringt. Wenn du EWIGKEIT und UNENDLICHKEIT, Buch 1 und 2 dieser Reihe, gelesen und geliebt hast, musst du auch die dritte Geschichte haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
SCHICKSAL
EIN PARANORMALER, ROMANTISCHER LIEBESROMAN
DIE UNSTERBLICHEN HEXEN
BUCH DREI
MAGGIE SHAYNE
Übersetzt vonARNELA KADIRIC
IMPRESSUM
Schicksal: Ein paranormaler, romantischer Liebesroman
Autor : Maggie Shayne
Verlag : 2 Herzen Verlag (ein Teil von Zweihänder Publishing)
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel “Destiny”
Autor : Maggie Shayne
Verlag : 2 Herzen Verlag (ein Teil von Zweihänder Publishing)
Hedwig-Poschütz Str. 28
10557, Berlin
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachng.
NEWSLETTER
Abonnieren Sie den Newsletter, um über neue Veröffentlichungen von Liebesromanen des 2 Herzen Verlag informiert zu werden:
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/g3v1l4
Dieses Buch wäre ohne die Hilfe einiger besonderer Menschen nicht möglich gewesen: Meine Freunde. Sie haben mir nicht bei der Recherche, dem Plotten oder der Charakterentwicklung geholfen. Sie haben etwas viel Wichtigeres getan. Sie haben sich für mich eingesetzt, als ich in Schwierigkeiten war. Sie waren für mich da, wenn ich sie brauchte. Mit Freundlichkeit und Weisheit haben sie mir die Hand gereicht, als ich am Ertrinken war und mich ans Ufer gezogen.
Das sollte mich nicht überraschen. Das tun sie immer. Also auf euch, ihr Lieben: RomEx Rules!
Besonderen Dank an Justine Davis, Anne Stuart und Gayle Callen.
Die Erforschung der Zivilisation, die als Sumer bekannt ist, ist seit zwei Jahrzehnten ein Hobby von mir. Ich wusste, dass ich eines Tages den richtigen Zeitpunkt finden würde, um es in einem Buch zu verarbeiten, und das habe ich jetzt getan. Die Kultur, die Bräuche und die Religion der damaligen Zeit werden hier genau wiedergegeben, bis hin zur Art und Weise, wie man einen angesehenen Freund begrüßt, der Kleidung, den Namen und sogar der Beschreibung des Kopfschmucks der Königin.
Aber wie es in der Belletristik nun mal so ist, muss sich der Autor manchmal ein paar Freiheiten herausnehmen, und die möchte ich klar benennen. Zunächst einmal waren zwei der Figuren, die du in diesem Roman kennenlernst, König Eannatum und Königin Puabi, echte sumerische Herrscher. Sie war die Königin eines Stadtstaates namens Ur, und er war der König von Lagasch und später von ganz Sumer. Sie herrschten beide etwa zur gleichen Zeit - 2500 v. Chr. - und Eannatum wurde tatsächlich zugeschrieben, dass er Sumer vereinigte und die Bedrohung durch das nahe gelegene Land Umma beendete. Es gibt jedoch keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass sich Eannatum und Puabi jemals getroffen haben, geschweige denn, dass sie die hier dargestellte Beziehung hatten. Es ist auch nicht sicher, dass nur Männer in der Kunst des geschriebenen Wortes unterrichtet wurden, obwohl ich glaube, dass dies zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten in Sumer der Fall war. Wir wissen von mindestens einer Hochpriesterin, die dies beherrschte. Ihre Geschichten haben bis heute überlebt.
Außerdem habe ich mir die Freiheit genommen, zu sagen, dass eine Priesterin des Tempels unverheiratet und keusch bleiben musste, bis sie auserwählt wurde, den heiligen Hochzeitsritus mit dem König durchzuführen. Ich kann nicht wissen, ob das der Fall war. Es gibt keine Quelle, die das Gegenteil behauptet, und es gibt Hinweise darauf, dass die Sumerer Sex als normal, gesund und sogar als heilig ansahen, so dass sie ihren heiligen Frauen vielleicht nicht verboten haben, es auszuüben, ob sie nun verheiratet waren oder nicht. Der heilige Hochzeitsritus selbst war jedoch sehr real und in Sumer gängige Praxis.
Die Beobachtungen, die ich in diesem Buch über die sich verändernde Rolle der Frauen in dieser entscheidenden Zeit der Geschichte gemacht habe, sind absolut wahr. Dies ist in den Worten einer damaligen Hochpriesterin namens En-Heduanna festgehalten, deren Übersetzung in dem Buch INANNA, LADY OF LARGEST HEART von Betty De Shong Meador zu finden ist. Meiner Meinung nach kämpfen die Frauen immer noch darum, den Status und die Macht wiederzuerlangen, die wir vor 2500 v. Chr. hatten.
Ich habe ein paar sumerische Redewendungen in dieses Buch gestreut. Dabei handelt es sich bestenfalls um Vermutungen, da sich die Aussprache und die Bedeutung mit jedem neu erscheinenden Forschungsbuch ändern. Die alten Keilschrifttafeln zu übersetzen ist eine Sache - herauszufinden, wie die Sprache klang, ist viel schwieriger. Selbst der Name "Nidaba" wird in einigen Quellen als "Nisaba" wiedergegeben. Nichts ist also sicher. Ich habe jedoch die besten Quellen verwendet, die mir zum Zeitpunkt des Schreibens zur Verfügung standen, um die Sätze so genau wie möglich wiederzugeben.
Abgesehen davon möchte ich hinzufügen, dass alle Fehler, die man bei der Recherche findet, offensichtlich von bösen Kobolden eingebaut wurden, die meine Glaubwürdigkeit ruinieren wollen. ;)
Maggie Shayne
PROLOG
Als sie ihre Augen öffnete, lag ein Tuch über ihrem Gesicht.
Sie atmete ihren nächsten Atemzug ein, ihren ersten Atemzug, den Atem des Lebens selbst und er drang mit einer Kraft in ihre Lungen ein, die einen gewöhnlichen Fernseher zum Platzen bringen würde. Die Kraft durchzuckte sie, wölbte ihren Rücken und elektrisierte jede Zelle für einen kurzen Moment. Dann wurde sie wieder schlaff und stieß die Luft mit einem langsamen, erschütternden Seufzer aus. Langsam kehrte das Bewusstsein zurück.
Sie befand sich in einem Fahrzeug, das sich wild bewegte und wie eine Hyäne heulte. Ein Krankenwagen, stellte sie dumpf fest. Immer noch verwirrt versuchte sie, sich zu erinnern, was diesem letzten Tod und der Wiederbelebung vorausgegangen war, aber sie fand nur vage Erinnerungen: einen Kampf auf einem Dach, eine Waffe, das Gefühl, nach unten zu stürzen und den erschütternden Aufprall am Boden. Sie hob eine Hand, um das Laken von ihrem Gesicht wegzuschieben. Aber ihre Hand bewegte sich nur Zentimeter und nicht mehr. Sie war festgeschnallt.
Festgeschnallt!
Der emotionale Damm, den sie so sorgfältig aufgebaut hatte, brach auf und ließ eiskalte Panik in ihre Adern fließen. Der Puls schlug in ihren Schläfen und wiederholte sich in verstärkter Form in ihrer Brust. Erinnerungen, die sie vor langer Zeit begraben hatte, krochen aus ihren Gräbern, tief in ihrem Kopf und ein paar knorrige Finger tauchten auf, um an ihrer hart erkämpften Vernunft zu kratzen, bis sie Blut spritzten.
Sie war schon einmal an ein solches Gerät geschnallt worden. Den Göttern sei Dank gab es keine Details. Dafür hatte sie sich die Kontrolle zu hart erkämpft. Nur Empfindungen, Gefühle und Emotionen. Schmerz. Wut. Verzweiflung. Schmerz. Wut. Und ein Peiniger, der ihr Leid ausgekostet hatte.
,,Lass mich frei.“
Die Stimme, die sie hörte, war ihre eigene. Sie war tief und leise und klang befehlend, obwohl sie vor der Kraft der Emotionen zitterte, die sie zu verbergen versuchte.
,,Was zum Teufel ...“, sagte jemand. Und ihr Verstand hörte es: Jung. Männlich. Verwirrt. Verängstigt.
,,Lass mich frei“, sagte sie erneut, diesmal lauter und fester.
Das Laken wurde von ihrem Gesicht weggezogen und die großen braunen Augen eines jungen Mannes blickten auf sie herab. ,,Mein Gott, sie lebt!“, rief er, offenbar dem Fahrer des schreienden Fahrzeugs zu. Er trug eine Uniform und ein Abzeichen, wie es ein Polizist tragen könnte. Von außen blitzten Lichter auf, aber das Fahrzeug wurde nicht langsamer. ,,Um Himmels willen, sie ist ...“
,,Lösen Sie die Gurte!“ befahl sie und zerrte an den Fesseln, die sie am Boden hielten.
,,Ganz ruhig“, sagte er, legte ihr die Hände auf die Schultern und senkte seine Stimme zu einem beruhigenden Ton. ,,Immer mit der Ruhe. Die Gurte sind nur dazu da, dass du nicht herunterfällst. Du musst still liegen. Du hast schon ...“
Sie zerrte fester und eine der Fesseln riss entzwei, schnellte wie eine Peitsche nach hinten und schlug dem jungen Mann ins Gesicht, als dieser wegsprang. Er presste eine Hand an seine Wange und seine Augen weiteten sich. Sie konnte seine Angst schmecken, aber das war ihr egal. Sie griff nach dem Riemen an ihrem anderen Arm und riss ihn ebenfalls los. Dann fand der junge Sanitäter seinen Mut und beugte sich wieder über sie, packte ihre Schultern und drückte ihren Körper nach unten.
,,Beruhige dich!“, befahl er. ,,Du tust dir noch weh!“
Sie stieß ihn mit so viel Kraft von sich, dass er von den Füßen flog und mit dem Rücken gegen die Utensilien auf einer Seite des Fahrzeugs prallte. Jetzt schrie er. Der Krankenwagen kam ins Schleudern, als sie an dem einen verbliebenen Gurt an ihrer Taille riss, ihn leicht zerriss und auf die Beine kam. Sie konnte in dem Fahrzeug nicht aufrecht stehen. Gebeugt stürzte sie sich auf den hinteren Teil des Krankenwagens und wollte nur noch entkommen. Freiheit.
Ihr ganzes Leben lang, so schien es, hatte sie für ihre Freiheit kämpfen müssen. Sie schätzte sie über alles, so wie sie sich vorstellte, dass es nur wenige andere jemals getan hatten.
Der zweite Mann kletterte von vorne herein und stürmte auf sie zu, als sie gerade nach den Türen griff. Die Flucht war so nah! Er packte sie an den Schultern. Wie ein Wirbelsturm stürzte sie sich auf ihn und schleuderte ihn weg. Gegenstände krachten, zerbrachen und verschütteten. Beide Männer fluchten und griffen nach ihr.
Sie stürzte sich wieder auf die Türen, aber der Jüngere war jetzt direkt hinter ihr und hatte sich wieder erholt. Bevor sie ihn wegschleudern konnte, stach er mit einem Gegenstand nach ihr und der Stich der Nadelspitze durchbohrte ihr Fleisch. Sie spürte, wie sich ihre Augen weiteten, als sie auf die Nadel in ihrem Arm hinunterblickte.
Drogen, flüsterte ihre Erinnerung.
Experimente.
Der lebende Tod, versunken in tiefster Schwärze, ohne Hoffnung auf ein Entkommen.
Sie würde nicht an diesen Ort zurückkehren! Das darf sie nicht! Und doch spürte sie, wie er sich an sie heranschlich. Er griff nach ihr. Er wollte sie zurück in seine kalte Umarmung ziehen. ,,Nein ...“, flüsterte sie.
Sie wirbelte auf den jungen Mann zu, aber der Schwindel ließ sie taumeln. Der Mann fing sie in seinen Armen auf. ,,Ganz ruhig.“
,,Ihr Götter, was habt ihr mit mir gemacht?“ Sie presste eine Hand an ihren Kopf, als ob sie den Schwindel, die Schwäche, irgendwie wegdrücken könnte. ,,Die Drogen ... du darfst mir keine ... Drogen geben ...“ Ihre Knie beugten sich gegen ihren Willen. Ihre Beine wurden zu Wasser.
,,Es ist nur ein Beruhigungsmittel“, sagte er, der jetzt ihr Gewicht trug und sie vorsichtig in den Arm nahm. Er war verletzt und blutete an mehreren Stellen. Der andere hinter ihm hielt seinen Arm seltsam fest. Vage erkannte sie, dass er gebrochen war. Er hätte nicht versuchen sollen, sie aufzuhalten. Er hätte sie einfach gehen lassen sollen.
,,Du wirst wieder gesund, das verspreche ich dir“, sagte derjenige, der sie festhielt. ,,Jetzt komm schon.“ Er legte sie auf die Bahre und sie versuchte, seine Hände von sich zu stoßen, sich zu wehren, aber sie hatte keine Kraft. Die Dunkelheit schloss sich um die Ränder ihrer Sicht. Ihr Körper wurde langsam taub. ,,Leg dich jetzt hin“, sagte er. ,,Entspann dich.“
,,Ich ... kann nicht ...“
Sie bewegte ihren Mund, aber es kamen keine weiteren Worte heraus. Die beiden Männer beugten sich über sie und schüttelten ihre Köpfe. Einer strich mit seinen Händen über ihre Beine und Arme. ,,Ich verstehe das nicht“, sagte er. ,,Sie war so verbogen und gebrochen wie ...“
,,Tot, verdammt“, sagte der andere, der sich immer noch den Arm an die Brust presste. ,,Sie war tot. Wir taten nur so als ob, aber wir wussten beide, dass wir sie verloren hatten.“
,,Es war ein Fehler. Wir haben es vermasselt ...“
,,Sie war tot, Jerry. Du weißt es und ich weiß es.“
,,Das ist nicht möglich.“
Ihre Sicht verschwamm, als sie sah, wie der Mann den Kopf schüttelte. Er sagte: ,,Verdammt, ich glaube, sie hat mir den verdammten Arm gebrochen.“
,,Kannst du einhändig fahren?“
,,Ja. Ja, ich schaffe das. Kommst du mit ihr klar?“
,,Jetzt schon.“
Sie hörte, wie sich der Fahrer entfernte, während der andere Mann neben ihr blieb und sie auf Verletzungen untersuchte. Sie spürte, wie sich das Fahrzeug wieder in Bewegung setzte, hörte, wie die Sirene erneut zu heulen begann, aber dann verblasste auch sie im Nichts. Sie spürte, wie auch sie selbst entglitt und sie kämpfte darum, sich an ihre Seele zu klammern.
,,Ich kann nicht loslassen“, flüsterte sie, denn sie spürte, dass sie sonst vielleicht nie wieder aus der Dunkelheit herausfinden würde.
Sie brauchte etwas ... etwas, woran sie sich festhalten konnte. Etwas, das sie festhielt.
Es kam langsam zu ihr, wie eine sanfte, liebevolle Hand, die sich um ihre eigene schloss. Ihre Erinnerungen. Nicht die schrecklichen Erinnerungen, die sie so tief vergraben hatte, sondern die besseren. Die echten ... an das Leben davor.
,,Ja“, sagte sie, obwohl sie nie wusste, ob sie das Wort gesprochen oder nur gedacht hatte. Viertausendfünfhundert Jahre und mehr waren gekommen und gegangen ... aber obwohl die Zeitalter dazwischen wie Morgennebel verblassten, war ihr die Zeit davor so klar, als würde sie sie immer noch leben. Es war ihre Zeit. Damals hatte sie nicht gewusst, was sie wirklich war. Sie war ein Kind, unschuldig, jung, mit so viel vor sich ...
Mehr, als sie jemals hätte ahnen können.
2501 V. CHR.
Stadtstaat Lagash, Königreich Sumer
Ihr kleines Kaunake-Kleidchen war weiß und aus feinem Leinen, genau wie die Kleider, die die erwachsenen Priesterinnen trugen. Es reichte bis zur Mitte der Wade. Ihre Füße waren im Moment noch nackt. Sie trug das Fransentuch, das für heilige Anlässe reserviert war und in ihren kleinen Händen hielt sie eine große Tonschüssel mit üppigen, reifen Früchten. Die Priesterin neben ihr war genauso gekleidet, trug aber zusätzlich ein goldenes Band um den Kopf, um ihrem Stand gerecht zu werden. Ihre Arme waren nackt, abgesehen von den schimmernden Gold- und Silberbändern, die sich wie Vipern um ihre kupferfarbene Haut legten. Ihr Haar war dunkel wie die Nacht, lang und schimmernd. Das kleine Mädchen fand, dass die Priesterin Lia die schönste Frau auf der ganzen Welt war.
Nüchtern betraten die beiden die Cella, den Raum ganz oben im Turm der Zikkurat. Das kleine Mädchen versuchte, sich darauf zu konzentrieren, ernst und angemessen feierlich zu sein, während sie den schummrigen Raum durchquerten, der von steinernen Statuen gesäumt war, die alle mit ihren Lapislazuli-Augen im flackernden Fackellicht blinzelten. Aber der ganze nicht enden wollende Ritus kam ihr so albern vor, dass sie sich ein Lächeln verkneifen musste und schließlich trotz aller Bemühungen ein Kichern zustande kam.
Die Priesterin blickte auf sie herab und runzelte die dunklen Brauen. ,,Sei still, Nidaba! Dies ist der heiligste Raum des Tempels, der Sitz der Götter selbst. Zeige etwas Respekt.“
Nidaba biss sich auf die Lippe und hörte auf zu kichern. Stattdessen sprach sie. ,,Die Heimat der Götter ist im Himmel, nicht wahr, Lia?“
,,Das weißt du doch.“
,,Wie können sie dann auch hier leben?“
,,Die Götter sind überall, Kind. Jetzt komm, wir müssen sie besuchen.“
Nidaba seufzte, gehorchte aber. Die beiden gingen Seite an Seite weiter, ihre Füße flüsterten durch die getrockneten Binsen, die den Boden säumten und die Cella mit ihrem grünen Duft erfüllten. Sie gingen an all den kleineren Steinfiguren vorbei, die Anbeter darstellten, denn die Alten durften nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Im vorderen Teil des Raumes standen Statuen, die das Wesen mehrerer Gottheiten beherbergen sollten. Enlil, der Herr der Luft, Enki, der Herr der frischen Gewässer, und die Abzu, Nidaba, die Göttin der Heiligen Schrift, nach der das kleine Mädchen benannt worden war. Und in der Mitte stand, größer und schöner als alle anderen, die Himmelskönigin Inanna.
Mit einer tiefen Verbeugung hielt die Priesterin Lia ihre Schale mit Früchten vor die Große Göttin und sang: „Inanna me en, Inanna me en. Inanna duna agruna ka me en.“ Sie stellte die Schale mit den Früchten zu den Füßen der Statue.
,,Sie wird es nicht essen, weißt du“, sagte Nidaba und sah die Statue an. ,,Sie isst es nie.“
,,Die Opfergabe ist nur symbolisch“, sagte Lia, die sich sichtlich bemühte, die Ungeduld aus ihrem Tonfall herauszuhalten. ,,Du wirst es verstehen, wenn du älter bist.“
Nidaba schniefte. ,,Der Hochpriester wird davon essen, was er will und wir werden seine Reste bekommen."
„Das ist genug, Kind. Geh jetzt. Bring dein Opfer.“
Seufzend ging Nidaba zur Statue ihres Namensvetters, hielt ihre Schale mit den duftenden Früchten hoch und hörte ihren Magen knurren, als sie die heiligen Worte sang. Dann stellte sie die Schale zu Füßen der Göttin ab, leckte sich über die Lippen, nahm eine Pflaume und biss herzhaft hinein, bevor Lia sie aufhalten konnte.
,,Nidaba, du darfst nicht ...“ Lia presste ihre Hände auf ihren Mund, während Nidaba kaute und schluckte und dabei lächelte. Die Priesterin schaute mit großen Augen in alle Ecken des Raumes, als fürchtete sie, Zeugen einer solchen Blasphemie zu sein.
Nidaba zuckte nur mit den Schultern und nahm einen weiteren Bissen, dann wischte sie sich mit einer Hand den köstlichen Saft vom Kinn. ,,Warum darf ich das nicht? In mir steckt mehr von der Göttin als in dieser Statue. Und ich bin nach ihr benannt, nicht wahr? Eines Tages werde ich die heilige Schrift lernen. Und dann werde ich tausend Tafeln mit den Gründen füllen, warum es verschwenderisch und dumm ist, köstliche Früchte an Steinstatuen zu verfüttern.“ Sie verschränkte die Arme vor der Brust und nickte einmal zur Betonung. Ihr langes, dunkles Haar fiel ihr in die Augen und untergrub ihre kraftvolle Aussage, dachte sie, aber sie schob nur die Unterlippe vor und blies das Haar beiseite.
Die Priesterin Lia schien sich ein Lächeln zu verkneifen, aber es war ein trauriges. Sie kniete sich hin und fasste das kleine Mädchen an den Schultern. ,,Du weißt doch, dass nur Jungen die Edubba-Schule besuchen und die heilige Schrift lernen dürfen.“
,,Das ist nicht fair und das weißt du auch“, sagte Nidaba und hob ihr Kinn an. ,,Die Göttin hat diese Regel nie aufgestellt! Ich wette, irgendein ... irgendein Junge war es!“
Lia senkte ihren Kopf ein wenig und gab zu, dass sie Recht hatte, aber nicht laut. Niemals laut. ,,Das ist der Lauf der Dinge", sagte sie. "Das war nicht immer so ... aber ... nun ja, so ist es heute und es gibt nichts zu tun. Es tut mir leid, Nidaba.“
,,Es war die Göttin Nidaba, die uns die Schrift gegeben hat“, sagte das Mädchen langsam. ,,Und sie ist kein Junge.“
,,Nein, ist sie nicht.“
,,Und Nidaba war es auch, die mich dir geschenkt und mir ihren Namen gegeben hat“, fuhr das Kind fort.
Die Priesterin nickte. ,,Das ist es, was manche glauben. Du wurdest in einem Korb vor der Tür des Tempels gefunden, nur mit deinem Anhänger und der Name der Göttin war in sein Gesicht eingraviert.“
Nidaba erinnerte sich an die Geschichte, die sie am meisten liebte und milderte ihre Haltung und ihren Tonfall. ,,Und du warst diejenige, der mich dort gefunden hat“, sagte sie.
,,Ja. In dieser Nacht gab es einen schrecklichen Sturm. Ich habe dich gefunden, wie du vor Wut geheult hast, dein kleines Gesicht war ganz rot vor Wut. Ich brachte dich ins Haus und alle Priesterinnen versammelten sich, um dich zu sehen. Wir wickelten dich in trockene Kleidung, fütterten dich mit warmer Ziegenmilch, die mit Honig gesüßt war und sangen dir vor, bis sich dein Zorn zu legen schien. Und so wie das geschah, ließ auch der Sturm nach. Mit deinem ersten Lächeln verzogen sich die Wolken und der Vollmond strahlte auf die Stadt Lagash herab. Und deshalb glauben manche, dass du die Tochter der Göttin selbst bist.“
Nidaba nickte langsam und lächelte. Doch dann erinnerte sie sich an den Anfang des Gesprächs und ihr Lächeln wurde zu einem Stirnrunzeln. ,,Wer würde es dann wagen, mir zu verbieten, die Edubba-Schule zu besuchen?“, fragte sie.
Lia seufzte. ,,Es ist, wie es ist, Nidaba. Wir können es nur akzeptieren und zufrieden sein.“
,,Ich werde nicht zufrieden sein. Ich will hingehen! Ich will lernen! Ich will nach Edubba gehen!“ Nidaba ballte ihre Hände zu Fäusten, stampfte mit dem Fuß auf und knirschte mit den Zähnen, als eine Flut von Wut durch sie hindurchschwappte. Ihr Gesicht erhitzte sich und ihr Herz pochte.
Der Boden unter ihren nackten Füßen begann zu zittern, während sie tobte und wütete. Das Zittern verstärkte sich, der ganze Raum, der hoch oben auf dem Zikkurat-Turm thronte, bebte und zitterte heftig. Die steinernen Bilder selbst schaukelten hin und her und einige der kleineren stürzten auf ihre gefrorenen Gesichter.
Lia fiel vor Angst schreiend auf die Knie und warf sich vor dem Bild der Göttin Nidaba nieder, als die Erschütterungen nachließen. ,,Verzeih mir!", rief sie. ,,Das Kind wird die heilige Schrift lernen! Ich schwöre, ich werde dafür sorgen!"
Das Rumpeln hörte auf. Es herrschte nur noch Stille, während das kleine Mädchen auf die gebeugte Gestalt ihrer geliebten Priesterin starrte und ihren Ausbruch bereute. Leise ging Nidaba zu Lia, die immer noch zitternd kniete und deren Gesicht von Tränen benetzt war. Das Kind berührte die Schulter der Priesterin. ,,Hab keine Angst“, sagte sie leise.
,,Ich habe die Göttin erzürnt!“
,,Aber ... das hast du nicht“, flüsterte Nidaba. Sie stellte sich vor Lia, nahm die Wangen der Priesterin in ihre kleinen Handflächen und sah ihr direkt in die dunklen Augen. ,,Die Göttin hat nicht so viel gemacht, Lia. Das war ich.“
Lia setzte sich langsam auf und sah das Kind mit Augen an, die so groß waren wie der Himmel über ganz Sumer. „Du ... du warst das?“
Nidaba knabberte an ihrer Lippe. „Manchmal ... wenn ich sehr wütend werde, dann ... passieren Dinge.“ Sie seufzte und legte den Kopf schief. „Ich werde versuchen, es nicht wieder zu tun.“
KAPITEL1
Von allen Männern, die er je gewesen war, gefiel ihm Nathan Ian King am besten.
Er saß auf der Veranda und schlürfte starken nepalesischen Tee, als die Sonne aufging. Orange mit einem rosafarbenen Schimmer, leckte ihre obere Kurve am Himmel über dem Atlantik. Von dieser Veranda auf der Rückseite seines Hauses aus konnte er das Meer von oben betrachten. Es war die Aussicht, die ihn dazu gebracht hatte, diesen Ort zu wählen ... die ihn dazu gebracht hatte, zu bleiben. All das Wasser ...
Es erschien ihm immer noch unbegreiflich.
Nathan King war ein Sammler und Händler von Antiquitäten. Er war ein Experte auf seinem Gebiet, obwohl nur wenige erraten würden, wie er zu seinem Wissen gekommen war. Noch weniger würden glauben, dass er die meisten Stücke in seiner persönlichen Sammlung erworben hatte, lange bevor sie als alt galten.
Nathan war entspannt und zufrieden mit seinem Leben. Warum sollte er auch nicht? Er hatte seine Galerie in einem "historischen" - dieser Begriff brachte ihn zum Schmunzeln - zweistöckigen Backsteingebäude in den engen, gepflasterten Straßen des alten Boston eingerichtet. Dann hatte er dieses Anwesen gekauft, eine Autostunde von der Stadt entfernt. Das Haus war weitläufig und aus rotem Backstein im viktorianischen Stil gebaut: flaches Dach, hohe, schmale Fenster, endlose Räume, die sich an lange Flure reihen und das alles auf fünfzig Hektar saftiger Wiesen und einsamer Wälder vor der Kulisse des mächtigen Meeres.
Er hatte Nathan King und sein Königreich vor etwa zehn Jahren erschaffen. Damals war er es leid, vorsichtig zu sein, in der Anonymität zu leben, für sich zu bleiben und so oft umzuziehen. So kam es, dass Nathan in kürzester Zeit bei Hunderten von Menschen bekannt und beliebt wurde. Nathan, der jedes Jahr für Obdachlosenheime und Stipendienfonds spendete. Nathan war sogar dafür bekannt, dass er auf Wunsch der Lehrerinnen und Lehrer vor Schülerinnen und Schülern über verschiedene historische Epochen sprach.
Nathan Ian King war ein vorbildlicher Bürger. Er hat noch nie eine rote Ampel überfahren. Sein Leben war so normal, dass es fast langweilig war.
Fast.
Diese Persona war zu gut, um von Dauer zu sein. Er wusste bereits, dass seine Zeit als Nathan King irgendwann zu Ende sein würde. In zehn Jahren war er nicht einen Tag gealtert. In zehn weiteren Jahren würden sich die Leute darüber wundern. Und obwohl er jeglichen Kontakt zu anderen seiner Art abgebrochen hatte, würden sie ihm auf die Schliche kommen, sobald die Geschichten über einen Mann, der nicht altert, auftauchen würden.
Andererseits, dachte er und hob die Porzellantasse an seine lächelnden Lippen, gab es immer noch Make-up. Eine drastische Maßnahme, vielleicht, aber möglich. Er würde es wirklich hassen, sein mondänes Leben als Nathan King aufzugeben. Es war friedlich, beschaulich ... und keine einzige unsterbliche Hexe, ob dunkel oder hell, hatte ihn in der ganzen Zeit aufgespürt. Das letzte Jahrzehnt hatte einige seiner ältesten Wunden geheilt, dachte er. Wie ein überarbeiteter Arbeiter nach einem langen Urlaub fühlte er sich erneuert. Fast ... wie neu geboren. Was an sich schon ein Wunder war.
„Ich habe die Morgenzeitung für dich, Nathan.“
Nathan legte den Kopf schief, ohne den Blick von dem spektakulären Sonnenaufgang über dem Meer abzuwenden. So viel Wasser. Die Fülle eines so kostbaren Elements erstaunte ihn auch nach so langer Zeit noch. Man könnte den Mann aus der Wüste holen, überlegte er ...
„Komm, George. Schau dir das mit mir an. Es ist unglaublich.“
„Ach, das sagst du jeden Morgen“, sagte George sichtlich unbeeindruckt, aber mit einem Hauch von Humor in seiner kindlichen Stimme. Er schloss die Terrassentür hinter sich und stapfte auf die Veranda, um sich an den runden Glastisch zu setzen. Er warf die Zeitung vor Nathan hin, aber der warf nicht einmal einen Blick darauf. Noch nicht.
Die Sonne stieg noch höher und ihr neonoranger Schein breitete sich jetzt über die Wasseroberfläche aus, die sich in einer Million glühender Wellen spiegelte. Und noch höher, sie strahlte Wärme auf Nathans Gesicht und verteilte Licht und Wärme auf seinen Körper. „Es ist herrlich“, flüsterte Nathan.
Ein tiefes, dröhnendes Lachen entrang sich George. „Das sagst du auch jeden Morgen.“
„Das tue ich, nicht wahr?“ Nathan riss seinen Blick endlich von George los und sah ihn an. Seine rechte Hand war wie immer ... interessant gekleidet. Heute trug er einen schicken braunen Anzug aus dem Big and Tall Shop über einem rosa T-Shirt, das er wohl auf einem Flohmarkt erstanden hatte. Nathan schaute an sich herunter und sah die allgegenwärtigen Air Jordans an Georges Füßen in Größe 12. Er schaffte es, nicht zu lächeln. Er wollte die Gefühle des großen Mannes um nichts in der Welt verletzen.
„Erzähl mir doch mal, was heute für dich auf dem Plan steht, George“, begann Nathan.
Doch bevor George antworten konnte, klopfte es an der Terrassentür. Nathan blickte auf und sah Sheila, deren pummelige Arme mit einem überladenen Tablett belastet waren, auf der anderen Seite der Tür stehen. Nathan sprang auf und riss die Tür auf.
„Das wurde aber auch Zeit!“ Sheila schnaufte und reichte ihm das Tablett. „Eine Dame könnte an Altersschwäche sterben, bis ihr beiden Herren dazu kommt, ihr eine Tür zu öffnen.“
Nathan lächelte sie an. Er wusste ganz genau, dass ihr Name nicht Sheila war. Nicht wirklich. Sie kellnerte früher in einem Diner, in dem er gerne Tee trank. Bis man sie dabei erwischte, wie sie Essensreste klaute, um die Tauben draußen zu füttern und sie feuerte. Eigentlich nur eine Ausrede. Sie war in die Jahre gekommen und vielleicht hatte auch jemand herausgefunden, dass sie ihnen nicht ihren richtigen Namen genannt hatte und dass ihre Green Card eine Fälschung war.
Wenn man sie fragte, wer sie war und woher sie kam, war ihre Antwort immer die gleiche. „Nur eine Sheila aus Down Under. Geboren im Busch und aufgewachsen mit den Joeys.“
Sie ließ sich auf einen Stuhl am Tisch sinken und fächelte sich mit einer Hand das Gesicht zu, um einen dramatischen Effekt zu erzielen. „Ich schwöre, ihr zwei werdet mich eines Tages zu Tode arbeiten lassen.“
Das war ein Scherz. Es war ein Running Gag, wie sehr die beiden Männer des Hauses versuchten, sie davon abzuhalten, es zu übertreiben. Wenn Nathan daran dachte, wie sie gelebt hatte, als er sie kennengelernt hatte - in welchem Zustand sie sich befunden hatte ... aber das war jetzt vorbei. Sie war Teil seiner eigenen, seltsamen kleinen Familie. Auf dem Flachdach von Nathans Haus hielt sie ihre eigenen Tauben.
„Das Frühstück riecht fantastisch“, sagte er zu ihr, während er das beladene Tablett zum Tisch trug und ihr wettergegerbtes Gesicht musterte, wie er es jeden Morgen tat. Sie würde nie ein Wort sagen, wenn es ihr schlecht ginge. Sie konnte es natürlich nicht wissen, aber Nathan würde es trotzdem merken. Seine Gabe war Einfühlungsvermögen. Er neigte dazu, den Schmerz - ob körperlich oder anderweitig - anderer aufzuspüren und oft zu verinnerlichen. Er musste lernen, sich abzuschirmen, ihn größtenteils zu verdrängen oder im Elend zu leben. Aber er ließ oft seine Deckung fallen, um die Gefühle derer zu erleben, die ihm am nächsten standen. Das war wahrscheinlich der Grund, warum er, wenn er überhaupt liebte, so sehr liebte.
Heute ging es Sheila gut. Ihre Wangen waren rosig, mollig und sommersprossig, ihre Augen strahlend blau. Ihr karottenfarbenes Haar, das gerade begann, sich mit silbernen Strähnen zu schmücken, hatte sie zu einem Pferdeschwanz im Stil der 1950er Jahre hochgesteckt.
„Mein Frühstück riecht immer fantastisch!“, sagte sie mit einem Zwinkern. Sie griff nach seiner Zeitung und schob sie aus dem Weg, als Nathan das Tablett in der Mitte des Tisches abstellte. Dann sagte sie: „Meine Güte, ist das eine traurige Schönheit.“ Sie drehte ihm die Zeitung zu und Nathan blickte mit gespieltem Interesse nach unten, während er sich selbst auf seinen Platz setzte.
Dann blieb er stehen und starrte auf das kleine Foto in der Seitenleiste auf der Titelseite. Die Bildunterschrift lautete: ,,Kennen Sie diese Frau? (Geschichte auf Seite 10)“
Nathans Kehle wurde trocken. Seine Augen schienen zu brennen und seine Sicht verschwamm. Noch während er starrte und versuchte, sich einen Reim auf etwas zu machen, von dem er wusste, dass es unmöglich war, nahmen George und Sheila ihre Teller vom Tablett, entfernten die glänzenden Edelstahldeckel und griffen zu.
„Heute werden wir die neuen Zwiebeln im Vorgarten pflanzen, nicht wahr, Georgie?“ sagte Sheila. „Es wird kalt, bevor wir es merken. Dann haben wir bald keine Zeit mehr für die Gartenarbeit im Herbst.“
„Ich mag es, Dinge zu pflanzen“, sagte George mit einem Lächeln.
„Kannst du uns heute Abend auf dem Heimweg vom Laden noch etwas Mulch mitbringen, Nathan?“ fragte Sheila.
Nathan antwortete nicht. Er hob die Zeitung hoch und starrte auf das Foto, unfähig, den Blick abzuwenden und die Geschichte zu lesen, die zu dem eindringlich vertrauten Gesicht auf dem Foto gehörte.
„Nathan?“ fragte Sheila.
Schließlich riss er seinen Blick von dem Foto los und drehte sich zu Sheila um. „Ich ... Tut mir leid, ich ...“
„Nun sag schon! Ist es die unbekannte Schönheit, die dich so verblüfft hat?“ Sie benutzte ihren mütterlichen Tonfall. Von Zeit zu Zeit neigte sie dazu, das zu tun. Allerdings häufiger bei George als bei Nathan.
Sie lehnte sich näher heran und schaute ihm über die Schulter und Nathan roch den allgegenwärtigen Duft von Ben-Gay auf ihren Schultern. „Sie ist ein Hingucker, das ist sie. All die langen, dunklen Haare. Kennst du sie also?“
„Ich ... Nein, ich glaube nicht.“
„Das sieht man deinem Gesicht nicht an, Schatz. Du bist kreidebleich geworden.“
Er schüttelte verneinend den Kopf, denn das war natürlich nicht möglich. „Sie ähnelt jemandem, den ich mal kannte.“
Jetzt war es an George, neugierig zu werden. Er stand auf und humpelte um den Tisch herum, um sich ebenfalls vorzubeugen und sie anzustarren. „Ich weiß, wer sie ist“, verkündete er, als ob es für alle offensichtlich sein sollte.
Seine Worte ließen sowohl Nathan als auch Sheila zu ihm aufblicken.
George lächelte. „Sie ist die Dame auf dem Bild“, sagte er und blickte mit einem Nicken zu den Flügeltüren. „Die im vorderen Wohnzimmer, über dem Kamin.“
Nathan schloss seine Augen. Keiner von ihnen konnte wissen, dass er das Bild selbst gemalt hatte. Keiner von ihnen würde es je erfahren, wenn es nach ihm ginge. Seine Geheimnisse waren seine eigenen. Und sie zu kennen ... konnte gefährlich sein. Tödlich.
„Weißt du, George, du hast Recht. Sie sieht der Frau auf dem Gemälde wirklich sehr ähnlich! Ist das nicht seltsam?“ fragte Sheila und richtete ihre Augen auf Nathan. „Dreh die Seiten um, Nathan, Liebes. Lass uns nicht im Ungewissen.“
Er löste seine gefühllosen Finger und schaffte es, die Seiten umzublättern. Er fand den Artikel unter der Überschrift
WUNDER IN MANHATTAN.
Sheila zog ihre Bifokalbrille aus der Schürzentasche, setzte sie sich auf die Nase und las mit ihrem australischen Akzent laut vor. „Eine unbekannte Frau überlebte letzte Woche einen offensichtlichen Selbstmordversuch in Manhattan.“ Sie schnalzte mit der Zunge. „Oh je, so ein Blödsinn! Zeugen behaupten, die Frau sei am Mittwochabend von den Dachgärten des Hotels Tremayne gesprungen und vierhundert Meter tief auf die Straße gestürzt. Die Rettungssanitäter am Tatort waren verblüfft. Die Frau, die anscheinend dem Tod nahe war, kam auf dem Weg ins Krankenhaus wieder zu sich. Sie wurde desorientiert und sogar gewalttätig und brach einem Sanitäter in ihrer Panik den Arm.“
Sheila legte den Kopf schief und runzelte die Stirn. „Sie sieht aber nicht stark genug aus, um einen Zweig zu brechen, oder?“
Nathan nahm Sheila behutsam die Zeitung aus der Hand, sie ließ ihn gewähren und sah ihn mit besorgten Augen an.
Nathan las schweigend weiter. Die Frau war betäubt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Trotz des eigentlich tödlichen Sturzes, so stand es in dem Artikel, war sie unverletzt, aber katatonisch und wurde in eine psychiatrische Klinik in New Jersey gebracht.
„Unter ihren persönlichen Gegenständen wurde kein Ausweis gefunden“, las Sheila vor und der Klang ihrer Stimme erschreckte Nathan, weil sie so nah war. Sie war mit ihrer Geduld am Ende und las nun über seine Schulter. „Die Polizei bittet um Hilfe bei der Feststellung ihrer Identität und der Suche nach ihrer Familie. Sie ist etwa 1,70 m groß, von schlanker Statur, hat schwarze Haare und Augen und einen olivfarbenen Teint, was auf eine Herkunft aus dem Nahen Osten hindeuten könnte. Die einzigen anderen möglichen Erkennungsmerkmale sind laut Polizei ein gepierctes linkes Nasenloch, in dem sie einen Rubinstein trug ...“
„Ein Rubinstein“, wiederholte Nathan.
„-und ein ungewöhnliches Muttermal“, las Sheila weiter. „Seltsam, es wird nicht gesagt, was das Muttermal sein könnte.“
Nathan schluckte den Sandsteinklumpen hinunter, der ihm im Hals stecken geblieben zu sein schien. „Das werden sie verschweigen. Ein echter Verwandter würde es wissen. So können sie Verrückte herausfiltern.“
„Das macht Sinn“, sagte sie. „Davon gibt es weiß Gott genug auf dieser Welt.“
Nathan starrte auf den Zettel und hoffte, dass er ihm mehr sagen würde, aber in der letzten Zeile stand nur die Nummer, die er anrufen sollte, falls jemand etwas über die Identität der Frau erfahren würde.
Er klappte das Papier zu und starrte wieder auf das unscharfe Schwarz-Weiß-Foto auf der Titelseite, das so sehr nach einer Frau aussah, die schon seit über viertausend Jahren tot war.
Sie konnte unmöglich dieselbe Person sein.
Und er konnte nicht eher ruhen, bis er das mit Sicherheit wusste.
Er schüttelte den Kopf und schloss die Augen. Ihr Götter, es war so lange her. Er redete sich ein, dass es eine Illusion war, ein Trick einer fehlerhaften Erinnerung. Aber er wusste es besser. Er konnte sie niemals vergessen ... konnte niemals die Frau vergessen, die sie gewesen war, die er geliebt hatte.
Oder das Mädchen, das er zuerst gekannt hatte …
* * *
Der junge Prinz legte den königlichen Mantel mit dem feuerroten Stoff und den golddurchwirkten Säumen ab, sobald er das Palasttor hinter sich gelassen hatte. Drinnen war es kühl, aber draußen unter der glühenden Sonne war es viel zu heiß, um solch schwere Kleidung zu tragen. Außerdem zeichnete ihn der Mantel aus. Wenn er in die Edubba-Schule ging, um seine täglichen Lektionen in der Kunst des Schreibers zu lernen - wie sein Vater es verlangte - wollte er lieber wie die anderen Jungen aussehen.
Nicht, dass es viel gebracht hätte. Sie alle wussten, wer er war. Und sie mieden ihn, als wäre er ein Ausgestoßener. Kein zwölfjähriger Junge würde sich mit dem Sohn seines Königs anfreunden wollen.
Und jetzt, so dachte Eannatum mürrisch, hatte sein Vater beschlossen, dass er noch mehr Unterricht brauchte, um ihn darauf vorzubereiten, eines Tages über Lagasch in Sumer zu herrschen. Ausgerechnet Lektionen in Religion.
Und er hatte keine andere Wahl als zu gehorchen.
Er ging die heißen Wege von der Edubba durch das Zentrum der Stadt. Auf beiden Seiten der ausgetretenen Pfade von Lagash wuchsen üppige Gräser. Palmen und Hashur-Bäume beschatteten seinen Weg und wuchsen zwischen und um die frontenbedeckten Dächer und sonnengebleichten Lehmziegelbuden der Händler und Handwerker. Er kam an zahllosen Menschen vorbei, viele mit Bündeln auf dem Rücken, Bauern, die zum Handel gekommen waren und Handwerker aller Art, manche mit so vielen Ernten oder Waren, dass sie mit Eseln oder Ochsen kamen, die beladene Karren hinter sich herzogen. Andere stellten Skulpturen und Schmuck, Töpfergefäße und neue Tontafeln aus, die sie in nasse Blätter eingewickelt hatten, um sie feucht zu halten. Und noch mehr Händler boten Obst, Gemüse und Getreide, teure Stoffe und vieles mehr an. Im Reich seines Vaters gab es alles, was man sich wünschen konnte. Die Stadt war eine blühende Stadt, die wie ein Juwel am Ufer des Euphrat glänzte. Eine üppige Oase inmitten der wilden Wüste. Das veranlasste den jungen Eannatum, sein Kinn ein wenig höher zu heben und seine Wirbelsäule aufzurichten, während er weiterging.
Der Weg schlängelte sich weiter und dann ragte vor ihm die mächtige Zikkurat auf. Ein riesiges Bauwerk, ein von Menschenhand geschaffener Berg, der von der Sonne weiß gebleicht wurde und bis in den Himmel reichte. Es wurde mit einer massiven quadratischen Basis gebaut. Jede weitere Ebene war ein kleineres Quadrat, bis hin zur heiligen Cella ganz oben. Sie glich auf allen Seiten einer riesigen Treppe, die in den Himmel selbst zu führen schien.
Das war sein Ziel und er stieg die Stufen mit einigem Zögern hinauf. Die Wege der Tempelpriester und -priesterinnen zu erlernen - die Wege der Magie, der Weissagung und der Heilung - war eine beängstigende Aussicht. Er vermutete, dass es viel schwieriger war, als in der Schule die Symbole der Schriftsprache auf den feuchten Tontafeln zu lernen. Aber mehr noch als den Unterricht selbst fürchtete Eannatum, dass er seinen Vater enttäuschen könnte. Und das wollte er auf keinen Fall tun. Er fühlte sich oft von der Last der Erwartungen seines Vaters belastet. Er mochte es nicht, von den anderen Jungen in seinem Alter unterschieden zu werden. Es gefiel ihm nicht, über ihnen zu stehen und er wünschte sich oft, er könnte sich verkleiden und weglaufen, um das Leben eines normalen Jungen zu führen.
Doch so sehr er auch davon träumte, er kannte seine Pflicht. Und er nahm die Ehre ernst. Er würde tun, was er tun sollte ... was er tun musste.
Er öffnete die Tür am oberen Ende der Treppe und trat aus der prallen Sonne in die kühlen, schummrigen Gänge der unteren Ebenen des Turms. Die Tür ächzte, als sie sich langsam hinter ihm schloss.
Eannatum schluckte schwer und schaute sich um.
Dann erschien in der Ferne das Flackern einer Fackel und eine weibliche Stimme sagte: „Hier entlang, mein Prinz.“
Mit einem Nicken folgte er dem tanzenden Fackelschein und erblickte die Fackelträgerin nur flüchtig. Ein kurzer Blick auf ihr weißes Gewand und die goldenen Armbänder an ihren Armen war alles, was er erhaschen konnte. Er wurde in einen kleinen Raum geführt, in dem gebrannte Steintafeln die Regale an den Wänden säumten. In der Mitte stand ein Holztisch mit drei Stühlen und einem Gestell mit unbeleuchteten Kerzen in der Mitte.
„Setz dich, zünde die Kerzen an und warte“, sagte die Frau. Dann verankerte sie die Fackel, die sie bei sich trug, in einem Spalt in der Wand und verschwand wie ein Schatten.
Eannatum seufzte und fragte sich, was aus ihm werden würde, wenn er sich in die Tiefen dieses gewaltigen Gebäudes verirren würde. Natürlich war er schon einmal drinnen gewesen. Während der Zeremonien und an den Hohen Heiligen Tagen. Aber dann war er in Begleitung seines Vaters und eines Dutzend Diener. Die Hallen waren voller Menschen und Gesänge und mit Kerzen und Fackeln beleuchtet.
Jetzt war es anders. Dunkel. Einsam. So düster und hohl, dass jeder Schritt, jeder Atemzug, tausendfach widerhallte. Es spukte, dachte er. Seine Schritte in den Gängen waren immer wieder von den Wänden abgeprallt und es hatte sich angehört, als wäre er von Geistern der Unterwelt umgeben.
Er ging mit dem Kerzenständer zu der Fackel in der Wand, hob die Dochte zu den tanzenden Flammen und zündete sie einzeln an. Dann trug er das weiche Kerzenlicht zum Tisch und stellte es wieder in die Mitte. Warten war noch nie seine Lieblingsbeschäftigung gewesen. Als Sohn des Königs musste er es nur selten ertragen. Aber heute musste er es. Um sich die Zeit zu vertreiben, nahm er die feuchte Tontafel aus dem Sack, den er bei sich trug und holte auch das Griffelrohr heraus. Er konnte genauso gut an seinem Unterricht arbeiten, anstatt hier zu sitzen und Zeit zu verschwenden.
Er war immer noch über die Tafel gebeugt und drückte mit dem Schilfrohr Symbole in den Ton, als die Priesterin den Raum betrat. An ihrer Seite war ein Mädchen, das mindestens zwei Jahre jünger war als Eannatum.
Die Priesterin war wunderschön, wie jede Priesterin, die Eannatum je gesehen hatte, egal ob sie jung oder alt, dick oder dünn war. Von Frauen, die der Göttin dienten, ging eine gewisse Ausstrahlung aus. Ein Leuchten, das von innen zu kommen schien und sie für jedes Auge, das sie betrachtete, schön machte. Wie sie tatsächlich aussahen, schien für Eannatum nur wenig mit dieser Schönheit zu tun zu haben.
Aber das Mädchen ... das Mädchen war anders. Umwerfend. Ihre Augen waren groß und rund, dicht gesäumt von extravagant langen, geschwungenen Wimpern und schimmerten schwarz im Kerzenlicht mit einer Intensität, die ihm den Atem raubte. Ihre Brauen waren dick und dunkel, ihre Lippen üppig und rot. Und da war noch etwas anderes an ihr ... etwas Unsichtbares und doch so real. Es war etwas, das über das innere Licht hinausging, das alle Priesterinnen besaßen. Er wusste nicht, was es war, aber er war sich sicher, dass es real war. Sie sorgte dafür, dass sich sein Magen zusammenzog und seine Haut heiß wurde und kribbelte. Die Gefühle verwirrten ihn.
Die Priesterin verbeugte sich leicht. „Willkommen, mein Prinz“, sagte sie. Dann stupste sie das kleine Mädchen neben sich an.
Das Mädchen sah erschrocken aus. „Prinz?“, fragte sie. „Bist du Prinz Eannatum?“
„Ja“, sagte er und lächelte leicht, als ihre Augen noch größer wurden.
Wieder stupste die Priesterin das Mädchen an, und dieses Mal verbeugte sich das Mädchen, aber nur halb. Sie wandte ihren Blick nicht von Eannatum ab. Als sie sich wieder aufrichtete, sah sie die Priesterin mit einer Frage in den Augen an. „Lia, was macht der Prinz hier?“
Die Priesterin lächelte das Mädchen an. Für Eannatum war es offensichtlich, dass die Frau das Kind sehr liebte. Er wünschte sich wieder einmal, dass seine eigene Mutter über den Tag seiner Geburt hinaus gelebt hätte, damit er eine solche Liebe kennenlernen könnte. Aber das Bedauern war eine Verschwendung seiner Gedanken.
Um sich abzulenken, beantwortete er die Frage des Mädchens selbst. „Mein Vater ist der Meinung, dass ich, wenn ich eines Tages regieren soll, mehr Bildung brauche als nur die der Edubba. Er möchte, dass ich alle Geschichten der Götter und der Schöpfung lerne. Alle Riten und Weissagungen, die die Priester und Priesterinnen beherrschen. Und alle Geheimnisse der Magie.“
„Ja“, sagte die Priesterin. „All die gleichen Dinge, die du hier bei uns lernst, Nidaba“, sagte sie zu dem Mädchen. „Der König ist sehr weise“, flüsterte das Mädchen.
Ihr Name war der einer Göttin und Eannatum erinnerte sich, dass er von ihr gehört hatte, aber in diesem Moment war er zu sehr damit beschäftigt, sie zu beobachten, um sich daran zu erinnern. Er hatte alle seine Griffel in ein Tongefäß auf dem Tisch gelegt und die Augen des Mädchens huschten immer wieder zu ihnen. Er sah unverkennbar den Eifer und die Sehnsucht aus ihren braunen Tiefen schimmern.
„Das ist mein Schützling“, sagte Lia zu ihm. „Ihr Name ist Nidaba.“
Er nickte und bemerkte zum ersten Mal den Onyx-Anhänger, den das Mädchen um den Hals trug. So glänzend und schwarz wie ihre Augen. Und da fiel ihm ein, was er schon einmal von ihr gehört hatte.
„Du bist diejenige, von der man sagt, sie sei von einer Göttin geboren“, sagte er.
„Das sagen manche, ja.“ Sie trat unaufgefordert vor und setzte sich an den Tisch, wobei ihre Augen immer noch alle paar Sekunden über das Griffelrohr und die Tontafel fuhren, auf der er seine Aufgabe erledigt hatte.
„Ich hatte gehofft, du würdest Nidaba erlauben, an deinem Unterricht teilzunehmen, mein Prinz“, sagte die Priesterin Lia. „Sie ist wirklich die begabteste Schülerin, die wir je hier im Tempel hatten. Sie wird eines Tages eine mächtige Priesterin sein.“
Bei diesem Lob lächelte das Mädchen und neigte leicht den Kopf, strahlte aber trotzdem vor Stolz.
„Ich dachte, ihr zwei könntet Freunde werden“, fuhr Lia fort. „Mit einem Freund an der Seite lernt es sich immer leichter.“
Eannatum schaute das Mädchen misstrauisch an. „Hast du keine Angst, mein Freund zu sein?“, fragte er.
Ihr Kinn hob sich. „Ich habe vor nichts Angst. Warum sollte ich auch?“
Eine so temperamentvolle Antwort überraschte ihn. Er versuchte, nicht zu lächeln, weil er dachte, es würde sie kränken. Aber er fand sie wirklich amüsant. So klein, so hübsch ... und doch offensichtlich nicht im Geringsten eingeschüchtert, in der Gegenwart ihres zukünftigen Königs zu sein. „Keine Angst vor irgendetwas?“, wiederholte er und hob die Brauen.
„Nein.“
„Das glaube ich dir nicht. Was ist mit einem Löwen? Vor einem Löwen würdest du dich doch sicher fürchten.“
„Was könnte ein Löwe mir schon antun?“, fragte sie und neigte den Kopf zur Seite.
„Dich töten und fressen, natürlich!“
Nidaba sah sehr nachdenklich aus. „Dann würde ich vielleicht endlich meine Mutter und meinen Vater kennenlernen.“
Eannatum schwieg einen Moment lang. Er konnte die Traurigkeit in ihren Augen sehen und sie in ihrer Stimme hören. Seine eigene Stimme war leiser, als er sagte: „Sie sind tot, deine Eltern?“
Nidaba zuckte mit den Schultern. „Sie müssen tot sein. Warum hätten sie mich sonst nicht behalten, um mich aufzuziehen?“ Sie blickte auf den Tisch hinunter. „Es sei denn, sie wollten mich einfach nicht haben.“
„Nein“, sagte Eannatum schnell. „Das kann es nicht gewesen sein.“ Und er meinte es ernst, obwohl er sie kaum kannte.
„Warum denn nicht?“
Er lächelte sie an und sah, dass in ihren niedergeschlagenen Augen eine leichte Feuchtigkeit glitzerte. „Du bist weise, sagt deine Priesterin. Es ist klar, dass du auch mutig bist. Und du bist das hübscheste Mädchen in ganz Lagash. Nur ein Narr würde so ein Kind weggeben.“
Der Kopf des Mädchens hob sich schnell und sie presste ihre Hände auf ihre Wangen. Sie wurden noch rosiger und sie lächelte. Eannatum sah, wie die Feuchtigkeit in ihren Augen verschwand und war sehr zufrieden mit sich selbst.
„Wie kommst du darauf, dass ich Angst davor habe, dein Freund zu sein, Prinz Eannatum?“, fragte sie nach einer Weile.
„Wenn wir Freunde sein wollen, musst du mich Natum nennen. Das gefällt mir viel besser.“
„Na gut, dann eben Natum. Die anderen Jungs an der Edubba Schule sind doch sicher auch deine Freunde. Stimmt's?“
„Meine Freunde?“, fragte er und hob die Brauen. „Sie haben Angst, sich zu nah an mich heranzuwagen, weil sie einen Fehler machen und mich beleidigen könnten, was den Zorn meines Vaters auf sich ziehen würde.“
Nidaba lächelte ihn an. „Wahrscheinlich haben sie eher Angst, dass du deinem Vater von dem Unfug erzählst, den sie machen.“ Dann beugte sie sich näher über den Tisch. „Aber ich weiß, wie das ist, Natum. Die Mädchen machen einen großen Bogen um mich, wenn ich auf der Straße an ihnen vorbeigehe.“
„Und warum ist das wohl so?“, fragte er, fasziniert von ihr, auch wenn er sich nicht ganz sicher war, warum.
Sie zuckte mit den Schultern. „Ich glaube, sie fürchten, dass ich wirklich ein Teil der Gottheit bin und sie mit meinem göttlichen Blick verbrennen kann.“ Während sie das sagte, verengte sie ihre Augen zu Schlitzen und demonstrierte damit, was sie für einen furchteinflößenden Blick hielt. Das ließ ihn nur noch breiter lächeln.
„Und kannst du das?“
Ihr Lächeln war schnell und strahlend und so umwerfend, dass er nach dem nächsten Atemzug ringen musste. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich wieder in ihren Stuhl zurück. „Ich habe es noch nie versucht. Aber ich verspreche, es nicht an dir zu versuchen, solange du versprichst, deinem Vater nicht von meinem Unfug zu berichten.“
„Dann ist es abgemacht.“
Er griff über den Tisch und nahm Nidabas Hand in seine und das Gefühl, das ihn durchfuhr, war so stark wie nie zuvor. Ein kribbelndes, rüttelndes Gefühl, das keinen Sinn ergab. Ihre Augen weiteten sich und sprangen zu seinen und sie zog ihre Hand schnell zurück und starrte auf ihre Handfläche. Sie hatte es also auch gespürt. Das ist sehr merkwürdig. Es musste ein Zeichen sein. Ein Omen.
„Du wirst meine erste richtige Freundin sein“, sagte er und spürte bereits, dass es wahr war. Und er streckte erneut die Hand aus, um sie zu ergreifen.
Vorsichtig ließ sie ihre Hand in seine gleiten und wieder war da dieses Kribbeln, aber nur kurz. Es verging im Nu und er schloss seine Hand um ihre, um sie zu wiegen und das Gefühl zu genießen. „Und du wirst mir gehören“, erwiderte sie und ihre Hand wurde warm unter seiner, als sich ihre Finger verschränkten und ihre Augen zu schließen schienen.
Lia räusperte sich. Eannatum ließ Nidabas Hand schnell los und beide sahen zu der Priesterin auf. „Nidaba kann dir in deinem Unterricht eine große Hilfe sein“, sagte sie zu Eannatum. „Sie ist schon jetzt viel begabter im Wahrsagen und bei bestimmten Heilungsriten als viele der Priesterinnen im Tempel.“
„Sie meint, besser als alle“, flüsterte Nidaba hinter ihrer Hand und ihre Augen funkelten vor Vergnügen.
Lia warf ihr einen abwehrenden Blick zu. Aber die Bemerkung ließ Natum das Mädchen nur noch mehr mögen. „Ich werde für die Hilfe dankbar sein“, sagte er. „Meine Arbeit in der Edubba nimmt den größten Teil meiner Zeit in Anspruch und für diese zusätzlichen Studien nehme ich jede Hilfe an, die mir angeboten wird. Aber ... ich würde mich gerne auf irgendeine Weise für deine Freundlichkeit revanchieren, Nidaba. Gibt es irgendetwas, das du dafür haben möchtest?“
Nidabas Blick fiel wieder auf die Tontafel, die mit keilförmigen Figuren bedeckt war. Dann sah sie zu Lia auf. Die Priesterin nickte einmal. Nidaba leckte sich die Lippen und sagte mit Blick auf Eannatum: „Ja, es gibt etwas. Etwas, das ich mir mehr wünsche als alles andere in ganz Sumer.“ Sie streckte die Hand aus und nahm vorsichtig den Schilfrohrgriffel aus dem Töpferbecher. Sie starrte ihn an und flüsterte: „Ich möchte die Schrift lernen.“
Aus irgendeinem Grund erschien ihm diese Erklärung vollkommen logisch. Es überraschte ihn nicht im Geringsten. Obwohl es das eigentlich hätte tun sollen, da es Mädchen nicht mehr erlaubt war, die Schrift zu lernen. Es war ihm schon immer ein seltsames Gesetz vorgekommen, aber das war schon sein ganzes Leben lang so gewesen. Sein Vater sagte, dass es nicht immer so gewesen sei. „Dann werde ich es dir beibringen“, sagte er.
Ihre Augen weiteten sich, als sie von dem Stift zu seinem Gesicht sah. „Das wirst du? Ehrlich, das wirst du wirklich?“
Lächelnd bückte er sich, griff in seinen Rucksack auf dem Boden und zog eine neue Tafel heraus, die noch in feuchte Blätter eingewickelt war. Er packte sie aus, legte sie auf den Tisch, nahm ein frisches Schilfrohr aus dem Becher und schrieb sorgfältig die Symbole, die für Nidabas Namen standen, in den Ton.
Fasziniert kam das Mädchen um den Tisch herum zu ihm und beugte sich über ihn, um zu sehen, was er getan hatte. „Das ... das ist mein Name“, flüsterte sie. „Genau wie auf meinem Anhänger.“
„Ja.“ Er schob die Tafel zur Seite, so dass sie vor ihr lag. „Jetzt machst du die Symbole. Genauso wie ich es getan habe.“
Sie starrte ihn an, blinzelte und sah zweifelnd aus, aber er nickte ihr zu. Sie beugte sich über die Tafel, umklammerte unbeholfen den Griffel und begann. Eannatum beobachtete sie, wobei er ab und zu ihre Hand mit seiner eigenen bedeckte, um ihr zu helfen, das Griffelrohr zu führen. Das Ergebnis war unbeholfen, schlampig, aber lesbar.
Und ihre Augen leuchteten heller als zwei Sterne am sumerischen Nachthimmel. „Ich habe es geschafft“, flüsterte sie ehrfürchtig.
Es erstaunte ihn, dass eine so kleine Sache ihr so viel bedeuten konnte. Und es erstaunte ihn noch mehr, dass er sich so fühlte, als er das Licht in ihren Augen sah und wusste, dass er derjenige war, der es dorthin gebracht hatte.
„Ich danke dir, Natum“, flüsterte sie. „Du hast mir ein Geschenk gemacht, das wertvoller ist als alles andere. Und ich werde es nicht vergessen. Nicht einmal, wenn ich ewig lebe.“
„Sei nicht albern“, sagte Eannatum und grinste. „Keiner lebt ewig.“
* * *
Als Nathan, der einst Natum genannt wurde, die Zeitung zusammenfaltete und sorgfältig beiseite legte, blickte er zu seinen beiden liebsten Freunden auf. Er hatte lange Zeit das Leben eines Sterblichen gelebt. Er hatte überhaupt keinen Kontakt zu anderen wie ihm. Er liebte sein Leben. Und er wusste - verdammt, er wusste ganz genau, dass er alles, was er aufgebaut hatte, aufs Spiel setzen würde, wenn er tat, wozu er sich gezwungen fühlte.
Und doch hatte er keine andere Wahl.
„Ich kann es dir nicht erklären ... aber ich muss dorthin gehen.“
„Wohin gehen, Nathan?“ fragte Sheila.
Er räusperte sich. „Nach New Jersey. Zu ... zu diesem Krankenhaus. Ich muss sie sehen.“ Er senkte den Kopf, richtete seinen Blick wieder auf das unscharfe Foto und murmelte: „Ich muss sicher sein.“
KAPITEL2
Ungekämmtes, ungewaschenes und verfilztes rabenschwarzes Haar quoll ihr über die Schultern und die Vorderseite ihres Krankenhauskittels. Sie saß auf dem Boden in der dunkelsten Ecke ihres abgeschlossenen Zimmers. Die Knie an die Brust gezogen, den Blick auf nichts gerichtet und völlig ausdruckslos. Onyxfarbene Augen. Dunkle, dichte Wimpern. Sie blinzelte nicht, schien Nathan gar nicht zu bemerken, der sie durch das winzige Quadrat aus doppeltem Sicherheitsglas in der Tür anstarrte.
„Und?“ fragte Dr. June Sterling. „Kennen Sie sie?“
In Nathans Brust bildete sich ein fester Knoten. Das konnte nicht sein ... das konnte nicht Nidaba sein. „Kann ich reingehen?“, brachte er hervor, obwohl seine Stimme heiser und kaum hörbar war.
„Es ist ihre Entscheidung.“ Die kleine, schlanke Frau mit den kastanienbraunen Haaren und der goldumrandeten Brille zog einen klappernden Schlüsselbund aus ihrer Tasche und schloss die Tür auf. „Gehen Sie nur nicht zu nah ran.“
„Ich glaube nicht, dass sie mir wehtun könnte, selbst wenn sie wollte“, sagte er und starrte auf die von verfilzten Haarsträhnen verdeckten Augen mit schweren Lidern. „Es sieht so aus, als ob sie so betäubt ist, dass sie nicht einmal mehr klar denken kann.“
„Milde Beruhigungsmittel machen Menschen nicht katatonisch, Mr. Smith.“ Die Ärztin schob die schwere Tür auf und trat zurück, um ihn durchzulassen.
„Die meisten Menschen nicht, nein.“ Er betrat den Raum und sagte nichts mehr. Was sollte er auch sagen? Dass bestimmte Medikamente bei Unsterblichen übertriebene Wirkungen haben können? Nein, das konnte er natürlich nicht. Nicht ohne in der Gummizelle neben diesem Raum zu landen. Also sagte er gar nichts.
Er stand einen Moment lang da und starrte die Frau an, hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung, dass sie Nidaba war und der Hoffnung, dass sie es nicht war. Denn er hatte Nidaba gekannt. Sie war stolz, stur und unabhängig. Sie würde die Art und Weise, wie er sein Leben lebte, hassen, dachte er vage. Sie war das Gegenteil des langweiligen Mannes, den er geschaffen hatte. Frei. Sie war schamlos stolz darauf, zu sein, wer und was sie war und weigerte sich, ihr wahres Ich vor irgendjemandem zu verbergen. Diejenigen, die damit ein Problem hatten, sollen verdammt sein.
Nein, die Nidaba, die er kannte, würde Nathan Ian King nicht besonders mögen. Nicht so, wie sie König Eannatum gemocht hatte.
Und sie wäre lieber tot, als zu dieser ... dieser ... Hülle einer Frau reduziert zu werden. Wenn sie sich ihrer Umgebung bewusst gewesen wäre, hätte allein die Enge ausgereicht, um sie in den Wahnsinn zu treiben. Sie war immer ein freier Geist gewesen. Die freieste, die er je gekannt hatte.
Diese Frau konnte nicht die wilde Priesterin sein, die er gekannt hatte. Sie konnte nicht seine Nidaba sein.
Mit schmerzhaft zugeschnürter Kehle sprach Nathan, ohne sich umzudrehen und richtete seinen Blick auf das erbärmliche Stück Mensch, das sich vor ihm auf dem Boden zusammengerollt hatte. „Lassen Sie mich mit ihr allein, ja?“
„Ich glaube nicht, dass ...“
„Gehen Sie einfach raus und machen Sie die Tür zu. Ich übernehme die volle Verantwortung.“
„Mr. Smith, das ist nicht ...“
„Um Himmels willen, tun Sie es!“ Wenn er einen kleinen Teil seiner Macht in den Befehl legte, konnte er nicht anders. Es mag manipulativ sein, aber verdammt noch mal, er brauchte Privatsphäre. Er musste sie sehen. Sie berühren.
Um zu wissen ...
Dr. Sterling sagte nichts mehr. Sie ging zurück und ihre Schritte hallten nach, als sie ging. Die Tür ächzte, als sie sich wieder schloss. Gut. Nathan spannte sich an, holte tief Luft und sagte sich, dass diese Frau nicht Nidaba war. Sie konnte nicht Nidaba sein. Er durchquerte den Raum, wo sie auf dem Boden saß und bewegte sich langsam, um sie nicht zu erschrecken. „Hallo“, flüsterte er mit leiser Stimme und erfüllte sie mit Ruhe und Gelassenheit. Wer auch immer sie war, das Letzte, was er wollte, war, sie zu erschrecken. „Ich bin gekommen, um dich zu besuchen. Ist das in Ordnung?“