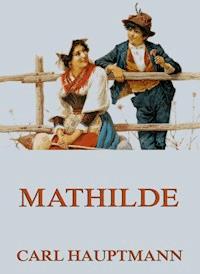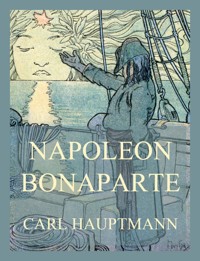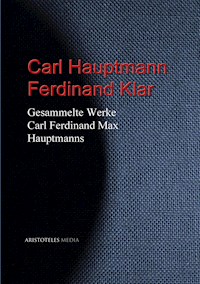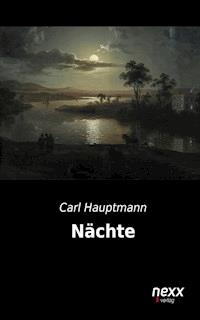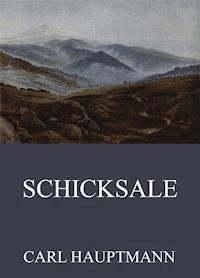
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Schicksale" sammelte Hauptmann seine folgenden Kurzgeschichten: Magdalena mit der Balsambüchse Ein Bruder der Steine Der Tanzmeister Grandhomme Weil der Bräutigam nicht kommen will Der Freund des Kardinals Herzoginnen Zwei echte Adepten der schönen Glasmacherkunst Der Höllenfahrer Durchlaucht Fürstin Odinska Der Bäcker Einhorn Fürst Gribow und seine Kinder Odela mit den Katzen Baron Bercken Der Evangelist Johannes Der Südenvogel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schicksale
Carl Hauptmann
Inhalt:
Carl Hauptmann – Biografie und Bibliografie
Magdalena mit der Balsambüchse
Ein Bruder der Steine
Der Tanzmeister Grandhomme
Weil der Bräutigam nicht kommen will
Der Freund des Kardinals
Herzoginnen
Zwei echte Adepten der schönen Glasmacherkunst
Der Höllenfahrer
Durchlaucht Fürstin Odinska
Der Bäcker Einhorn
Fürst Gribow und seine Kinder
Odela mit den Katzen
Baron Bercken
Der Evangelist Johannes
Der Südenvogel
Carl Hauptmann – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 11. Mai 1858 in Obersalzbrunn, Niederschlesien, verstorben am 4. Februar 1921 in Schreiberhau, Niederschlesien. Bruder von Gerhard Hauptmann. Nach dem Abschluss der Realschule 1880 studierte H. Naturwissenschaft und Philosophie an der Universität Jena und promoviert 1883 zum Dr. phil. Heirat mit Martha Thienemann ein Jahr später und Fortsetzung seines Studiums in Zürich. Erst 1889 kehrt H. nach Deutschland (Berlin) zurück und bezieht zwei Jahre später mit Bruder Gerhard ein Haus in Schreiberhau im Riesengebirge. 1908 Scheidung von Martha und erneute Hochzeit mit Maria Rohne.
Wichtige Werke:
1893 Metaphysik in der modernen Physiologie
1894 Marianne (Drama)
1896 Waldleute (Drama)
1897 Sonnenwanderer (Sammlung von Erzählungen)
1899 Ephraims Breite (Drama, erneut 1920 unter dem Titel Ephraims Tochter)
1902 Die Bergschmiede
1902 Mathilde. Zeichnungen aus dem Leben einer armen Frau (Roman)
1903 Des Königs Harfe (Bühnenspiel)
1905 Austreibung (Drama)
1907 Einhart, der Lächler (Roman, 2 Bände)
1909 Panspiele (vier Dramen)
1911 Napoleon Bonaparte (Drama)
1912 Nächte (Novellen)
1912 Ismael Friedmann (Roman)
1913 Schicksale (Erzählungen)
1913 Die lange Jule (Drama)
1913 Die armseligen Besenbinder (Drama)
1914 Krieg. Ein Tedeum (Drama)
1916 Tobias Buntschuh (Lustspiel)
1916-18 Die goldnen Straßen (Dramen-Trilogie)
1919 Rübezahlbuch
1919 Der abtrünnige Zar (Drama)
1920 Drei Frauen (Erzählungen)
1927 Tantaliden (Roman)
Schicksale, C. Hauptmann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849627263
www.jazzybee-verlag.de
Magdalena mit der Balsambüchse
Das Bauernhaus leuchtete schneeweiß. Und die Holzbalken im weißen Grunde waren hellgrün gestrichen, so daß sie sich noch heiter abhoben, wenn die alten Linden über dem Hausgiebel im Sommerlicht rauschten.
So war es auch in der Zeit, als die alte Mutter Luba im Bauernhause im Sterben lag.
Die alte Mutter Luba war zwar jetzt eine völlig verarmte Dorffrau. Denn ihr Sohn und dessen ganze Familie, an sich auch nur kümmerliche Leute, waren vor Jahren bei einer Typhusepidemie alle unerwartet hingestorben. Bis auf einen Enkel, der damals eben erst geboren war.
Aber die Mutter Luba war allezeit ein drolliger, sanfter Engel gewesen. Und die Bäuerin hatte es bei ihrem Manne durchgesetzt, daß die alte Marcella, wie man im Dorfe die Mutter Luba auch nannte, mit diesem Enkel in dem hellerlichten Bauernhause doch ihren Wohnwinkel gefunden.
Und wie die alte Luba im Sterben lag, war es in ihrem winzigen Stübel trotz der Armut sehr feierlich. Nicht bloß, weil bei ihr immer alles blitzeblank gescheuert war.
Die kleine, schmale Holzbank vor dem Ofenrohr sah wirklich aus wie aus frischem Holze. Und der rohe, schmale Tisch, der für Großmutter und Enkel gerade genug Raum bot, lag nicht wie in der großen Bauernstube voll Brotkrümel und Kartoffelschalen. Die Sonne überspielte einen mit roten Rosen bemalten Teller und vergoldete die gewaschene Tischplatte. Aber vor allem hing von der geweißten Decke ein ganz besonderes Ding herab. Mit bunten Wachslichtchen und bunten Papierblumen über und über besteckt. Eine Art Kronleuchter. Und die hereinfallenden Sonnenstrahlen konnten auch noch den Fuß einer kleinen, bemalten Holzstatue, die liebliche Vision einer heiligen Frau, bescheinen, die auf einem Postament in einer weißen Mauernische stand, so daß das kleine Öllämpchen, das immerwährend vor der Statue brannte, in den Sonnenstrahlen noch extra wie ein roter Stein glimmte und schimmerte.
Der Kronleuchter und das Heiligenbild. Heitere, feierliche Dinge. Mit denen es auch eine besondere Bewandtnis hatte.
Die alte Luba war nämlich immer im Leben voll phantasiereicher Einfälle gewesen. So hatte sie zum Beispiel, und das war, wie sie noch in ihrem Väterdorfe in Böhmen lebte, immer behauptet, daß man nie etwas Geistliches wegwerfen dürfe, worunter sie unter anderem auch die Gegenstände verstanden hatte, die mit dem Pfarrherrn selber irgendwie in leibliche Berührung gekommen waren.
Das war der Grund, weswegen der Kronleuchter überhaupt entstanden war.
Ein alter Regenschirm des Dorfpfarrers hatte ihr dazu den Anlaß gegeben. Sie hatte das vernutzte, kahle Rohrgestell derart reizend mit bunten Papierrosetten und Wachskerzchen besteckt und ausgeschmückt, daß es noch jetzt, freilich schon arg verblichen und zunderig, wie aus Blütenzweigen gewunden von der Decke hing.
Und das war auch der Grund, weswegen jetzt das buntbemalte Holzbild der heiligen Frau hinter dem ewigen Lämpchen in dem Stübchen der sterbenden, alten Luba leuchtete. Denn die kleine Figur war die ehrende Revanche gewesen, die der Pfarrherr im Heimatsdorfe in Böhmen der Frau Luba für die Ehrung seines Regenschirmes geboten hatte.
Die Statue stellte keine Madonna mit dem Jesusknaben dar. Es war die heilige Magdalena mit der Balsambüchse.
*
Auch der kleine Andreas, der jetzt dreijährige Enkel der alten Marcella, hatte schon oft auf der Großmutter knochigen Armen gesessen, pausbackig und lebensgierig, und hatte seine roten Ärmchen nach der leuchtenden Magdalena ausgestreckt, wenn die Alte mit ihren mageren zitterigen Fingern an dem Bilde der holdseligen Frau mit der Balsambüchse sich behutsam abstäubend zu schaffen machte. Und wenn die alte Marcella kindlich laut und gefaßt ihre treuherzigen Gebetsworte an die selige Frau im maigrünen, vergoldeten Faltenkleide und mit den gehäuften Rosen im Schoß richtete, hatte der straffe Junge erstaunt nicht nur auf der Großmutter welke Lippen und auf ihren großen Kehlkopfknochen am Halse gesehen, der sich dabei immer sehr aufdringlich unter der welken Runzelhaut auf und ab schob. Denn die alte Marcella war jetzt achtundsiebzig Jahre alt. Ihr Gesicht war ein Knochengerüst, daraus nur die hellen Augen noch wie heitere Wasserflecken lachten.
Die Statue der Heiligen war der alten Marcella das höchste Glück. Erst recht, wo sie jetzt im Sterben lag.
Auch wenn die verrunzelten Lider lange geschlossen gelegen, konnten sich die hellen Augen plötzlich erstaunt auftun wie aus dem Tode. Und die alte Luba konnte lange an die Decke starren, daran ein rauchbrauner Balken quer lief, von dem der geistliche Kronleuchter herabhing. Und sie konnte dann mit stillem Blicke lächelnd die Frau mit den Rosen im Schoße und der Balsambüchse langsam ertasten, die vom heiligen Lämpchen beglüht in der Mauernische stand. Und sie konnte die Heilige ewig anlächeln, als wenn aus deren buntem Gefäße wirklich Balsamtropfen in sie fielen.
Und weil sie im Fieber war, und ihre inneren Bilder nur wonnevoll leicht entschwebten, gar nicht mehr aus Erde schienen, konnte sie dann auch nach dem kleinen Andreas greifen, der in ihren Fieberarmen fest schlief. Und konnte auch ihn wie verklärt ewig anlächeln. Weil das Bild dieses frischen, kräftigen, geröteten, dreijährigen Schläfers mit dem Bilde der Heiligen völlig verschwamm, und es ihr so deuchte, als wenn alles Leben im warmen Glanze heiliger Geister geborgen wäre.
Ja freilich ist alles Leben im Schoße Gottes geborgen. Auch alle Sünder, die aufwuchsen, haben je und je in Gottes Schoße gelegen. Auch alle, die je Schicksale trugen, lagen der heiligen Jungfrau an den Brüsten.
*
Andreas Luba war ein Dorfjunge und nichts weiter.
Das seltsame Bild des reinlichen, engen Heiligenstübchens war verschwunden wie eine Juniwiese im Gebirge verschwindet, wenn Nebel ziehen, wer weiß woher, und allmählich nichts bleibt, wie grau-in-graue Lüfte.
Ein arbeitsamer Bauer fragt nicht nach reinlichen Heiligenstübchen. Er fragt, ob der Dünger gefahren ist oder der Acker umgeworfen. Und treibt die große Magd und den plumpen Knecht halb wohl noch im Spaße mit einem Schwunge der großen Peitsche zur Arbeit an. Da kann man erst recht für den Hütejungen keine Heiligenvisionen erwarten. Aber Andreas Luba hatte doch auf seine Weise Heiligenvisionen.
Wie die alte Marcella gestorben war, war die Papierkrone zu wurmstichig gewesen. Die war zerfallen. Aber die bunte, hölzerne, heilige Frau hatte die Alte den Bauersleuten noch sehnsüchtig anvertraut. Hatte ihnen, der Worte kaum noch mächtig, ausdrücklich und eifrig aufgegeben, sie ihrem einzigen Enkel in Schutz und Liebe auszuhändigen, sobald er einmal aus der Schule ginge. Und wie Andreas ins Tal zu einem Gärtner in die Lehre kam, hatte er die Statue, gut in ein Tuch eingewickelt, im Arme mit sich getragen und hütete sie in seiner Bodenkammer.
Andreas Luba war nämlich in seinen Ideen schon ein richtiger, kleiner Gauner.
Nicht etwa, daß er Böses schon getan hätte. Nur war er immer heimlich voller Ideen, um sich und sein Leben auch einen goldenen Schein zu weben.
Schon als Hütejunge.
Schon als Hütejunge träumte er, wenn er auf der Herbstwiese von einem Bein auf das andere trat, daß er schon irgendwie mitten in Nimbus und Reichtum säße. Zum Beispiel, daß er ein behaglicher, feiner Herr wäre, wie er einen immer im Dorfe bestaunt hatte. Der aus der Stadt ins Gebirge gekommen war, stets in einem ganz vornehmen Schoßrock ging, einen Spazierstock mit blauem Steinknopf tändelnd in der Hand schwenkte, und der am Arme eine wunderliebliche Junge, die der heiligen Magdalena nicht ganz unähnlich deuchte, mit sich führte.
Und wie Andreas bei seinem Gärtner unten im Tal in der Lehre war, gaukelte manches junge Frauenbild mehr an ihm vorüber, von dem er auch bei sich heimlich erwog, daß es mit Rosen im Schoße und in maigrüner Seide völlig der Heiligen gleichen, an seinem Arme leuchtend einherschreiten und ihn mit seiner Liebe köstlich besonnen könnte.
Aber wie er einmal nach der jungen Gärtnerstochter gegriffen, da hatte der Lehrherr ihm gleich den richtigen Zahlaus gegeben. Deshalb blieb alles in ihm im Verborgenen sitzen. Und er begann nur verschlossener noch in seine Träume sich einzubohren.
Die anderen Gärtnerjungen und Gärtnergehilfen mochten ihn eigentlich nicht. Er konnte mir nichts dir nichts in ein tolles Lachen ausbrechen, auch wenn ringsum keine Seele zu sehen war. Er konnte gelegentlich auch einen ganz sinnlosen Streit beginnen. Und wenn es zu einer Schlägerei kam, war er derart jäh und verbissen, daß er nichts mehr hörte und sah, gar keine Grenze kannte, und die Gewalttätigkeit kein Ende fand. Aber er konnte den anderen auch lustig zulachen, obwohl niemand wußte, aus welchem pfiffigen Register seine Schadenfreude hervorsprang.
Das kam, weil er in seinem Kopfe Ideen hatte wie Bienen im Korbe, und er immer an heimlichen Dingen sann und Projekte machte. In der Freizeit saß er und malte Blätter und Hefte voll, die er vor jedermann verborgen hielt.
Er malte allerhand.
In seinen Heftchen standen Entwürfe von Hausgärten und fürstlichen Parks. Er zeichnete Häusergrundrisse, Schloßgrundrisse, seltsame Pavillons mit Springbrunnen davor, Freitreppen mit Geländern, auf denen Heiligenfiguren standen. Er malte auch ganz kleine Würfelhäuschen. Wie Igel geformt. Kleine Verließe. Richtige Erdfestungen, darin einsame Leute wandelten, von denen er sich auch ausdachte, daß sie die Menschen haßten. Auf einem Blatte war ein ganz kleines Dorfhäuschen aufgezeichnet. Alle Fenster nur wie Gucklöcher klein, und alle mit Gittern verkleidet. Vier Zimmerräume lagen innen um einen Lichthof. Darinnen mitten ein kleiner Wasserspiegel lag. Und Magdalena mit der Balsambüchse, aber durchaus nicht auf einem Postamente, nur ganz wie eine irdische Frau am Wasser stand. Und er hatte auch sich selber hineingemalt. Einen Mann im seinen Schoßrock neben die schlanke Heiligenfigur im fließenden Kleide. Und hatte um das kleine Festungshäuschen in kurzer Entfernung eine hohe Mauer angebracht, die das Häuschen noch überragte und Zinnen und Schießscharten trug.
Denn immer gingen Andreas Lubas Phantasien auch auf Kampf und Verteidigung hinaus. Er träumte hundertmal von blutigem Streite und genoß ein wahres Vergnügen daran, sich auszudenken, daß er das Festungshäuschen mit seiner Heiligen drinnen auf Leben und Tod schützen müßte.
Auf einem Blatte stand ein richtiges Grabbollwerk. Ein Kreuzgang mit schönen Säulen zu beiden Seiten. Und in der Mitte auf dem gewaltigen Steine, der auf einem Postamente ragte, standen die Worte:
»Hier ruht« »der Ritter Andreas Luba« »und seine Ehefrau« »Magdalena mit der Balsambüchse.«
Andreas Luba hatte eben immer Spiel und Träume im Hirn. Auch die alte Marcella, seine Großmutter, war ihr Leben lang ein phantasievoller Mensch gewesen.
Und Andreas kam damit seinem Lehrherrn sehr zupasse, der eine sehr ansehnliche Gärtnerei im Tale besaß. Denn der Lehrherr hatte nur Muster, nach denen er Vorschläge zu machen verstand. Aber Andreas warf ein neues Blatt voll schöner Anlagen nur so aus dem Handgelenke hin.
Aber seine Ideen waren doch auch Vampyre. Sie sogen alles Blut an. Oder auch sie waren Irrlichter. Sie zogen ihn am Ende ganz in den Sumpf.
*
Schon wie er ausgelernt hatte, wollte er wegen seiner Ideen sofort ein Herr sein. Er war es auch eine Zeitlang.
Als er von der Gestellung heimkam und frei geworden war, hatte er an einem Kornraine eine von den jungen, dürftigen Mägden aus einem Großbauergute gefunden, die auch nur gerade daran gedacht hatte, wo sie einen Mannesmund fände, um sich anzusaugen. Und geschmückt und lustig, wie Andreas auf dem Heimwege von der Gestellung aussah, hatte er ihr, behaglich mit ihr am Kornfelde sitzend, erzählt, daß er frei geworden wäre, daß er natürlich jetzt ein Weib nehmen würde, und daß sie zwar bisher Elfriede geheißen, aber in der Zukunft als sein Weib Magdalena heißen müßte.
Alles im Spaße noch. Und doch sehr im Ernste auch wieder. Wie das bei Andreas so zuging.
Und er war die nächsten Tage in den Feierstunden wieder zu ihr gekommen, hatte ihr seine Zeichnungen gezeigt und hatte gesagt, daß er jetzt eine kleine Festung bauen und mit ihr darin wohnen wollte.
Einstweilen so pfiffig in Korn und Klee. Da standen die Aussichten noch immer nur als Schemen und schwebten lustig mitten im Getreideduft, wenn die kräftigen Hände sich verschlangen.
Aber dann, wie mehr Aufträge kamen, und weil Elfriede, die jetzt Magdalena hieß, in alles längst lustig eingewilligt hatte, kaufte er wirklich eine ganz entlegene Hütte am Walde oben in seinem Heimatdorfe. Begann sie zu ummauern, wie er es sich schon hundertmal ausgedacht, und hatte bald Magdalena zu sich genommen.
Es war eine ganz kleine Hütte, die nur eine Stube und einen kleinen Stall mit einer Ziege umfaßte. Und in der anfangs nur die buntbemalte, hölzerne Heiligenfigur und das brennende Öllämpchen davor, aus einer Nische einen feierlichen Schein gab.
Aber es dauerte nicht lange, da brachte Andreas allerlei Kleinkram, der zum Schmücken der alten Holzwände taugte, nachdem er sich in seinen Feierstunden abgemüht hatte, daß auch der kleine Garten bis zur Mauer wie ein Blumenparadies aussah. Und mit der Zeit trug er wer weiß was in seine Festung. Denn er begann sich jetzt für seine Magdalena richtig zu verzehren. Mit der Zeit brachte er sogar Goldsachen. Und er brachte endlich auch ein helles Seidenkleid, damit Magdalena in leuchtendem Prunke mitten in den Blumen stand. Wie dürftig und ärmlich und nur wie des kleinen Gärtners Wirtin gekleidet sie auch sonst immer zu Tale laufen und auf der Dorfstraße hinschreiten mochte.
Fast könnte man denken, daß Andreas Luba gleich von Anfang an wahnsinnig war.
Niemand hätte es begreifen können, wenn er auch nur einmal hätte in den kleinen Prunkgarten und das einzige Festungsstübel hineinblicken können.
Obwohl er viele gute Aufträge im Dorfe und auch auswärts hatte, so hätten doch seine Einkünfte nicht annähernd hingereicht, Hauswände und Weib mit kleinen Schätzen zu schmücken. Und Andreas schmückte schon mit richtigen Schätzen. Nur daß jetzt um so weniger einer hätte wagen dürfen, hinter seine Festungsmauer zu dringen.
Andreas Luba hatte nämlich längst angefangen, auf eine sehr sinnvoll berechnete Weise zu stehlen. Zuerst bestahl er den Zimmermeister, der mit ihm eine Arbeit gemeinsam ausführte, und der übrigens sein guter Freund war. Und bestahl gelegentlich auch seine anderen Mitarbeiter, ohne daß je ein Verdacht auf ihn fallen konnte. Allmählich stahl er auch bei seinen vornehmen Arbeitgebern, die ihn wegen seines freien Verkehrstones und seiner üppigen Ideen sehr zuvorkommend und ein bißchen wie ein Genie empfingen. Denn Andreas machte schon Parks, die in der Kleinstadtzeitung gerühmt standen. Er hatte Einfälle, die auch verwöhnte Leute entzückten. Und innen, fern der Welt, in seiner kleinen, entlegenen Festung wurde es dabei immer mehr wie im Himmel.
Und Magdalena war durchaus nicht heilig. Sie war sehr lustig. Sie sah jetzt neben der buntbemalten, kleinen Heiligen sehr lieblich aus. In seinen Armen hatte sie Wangen, die wie Äpfel im Herbstlaub glühten. Und ihre Augen konnten bei seiner Abendheimkehr wie die leibhaftige Neugier funkeln. Und lachen wie Vogelaugen.
Andreas hatte sie ganz zu seiner heiligen Frau herausstaffiert und hätte nie mehr wissen können, daß sie nur einer verwahrlosten Dorffrau Tochter war.
Ihr Bild in Seidengewändern und mit Golde und blinkenden Steinen verfolgte Andreas noch in seine Träume. Und auf diesen Träumen beruhte sein Leben.
*
Das war so ein ganzes, kurzes, 'seliges Jahr hingegangen. Da waren die Leute im Dorfe doch endlich stutzig geworden.
Eines Tages, es war wieder im Juni, war ein kräftiger Bauer an die Tür der Mauer gekommen und hatte hineingewollt. Zuerst war es dem Zimmermeister und dann einem Stadtherrn aufgefallen, daß Geld und Kostbarkeiten verschwunden waren, jedesmal, wenn Luba am Orte gewesen.
Und auch zwei Mitarbeiter des Andreas Luba hatten ernsten Verdacht geschöpft und hatten sich schon eine längere Zeit heimlich vorgenommen, das Tun Lubas zu beobachten.
Der Bauer kam sozusagen schon zu einer näheren Rekognoszierung. Es war Sonnabends. Und weil auch auf das heftigste Klopfen niemand geöffnet hatte, war der Bauer nur Sonntags ein zweites Mal wiedergekommen.
Da wußte Andreas, der jetzt ein richtiger Gauner war, ein Mann aus der Welt, wo die Träume ohne Grenzen aufschießen wie Sumpfblasen, schon genug.
Andreas war erst zweiundzwanzig Jahre alt. Und Magdalena neunzehn.
Andreas war nicht etwa erschrocken davon. Er dachte gar nicht daran, etwas Furchtsames zu sagen. Er hatte nur jedesmal, wenn das Klopfen an der Mauertür erscholl, zu Magdalena pfiffig gesagt: »Kein Mensch kommt in meine Festung!«
Und er war nur am Montage lieber gleich ganz von der Arbeit daheim geblieben.
Denn am Montag kam der Bauer zum dritten Male wieder und pochte. Und wie sich auch dieses Mal keinerlei Menschenlaute hinter der Mauer spüren ließen, kamen nach kurzer Zeit zwei.
Die Hütte lag ja ziemlich entfernt vom Dorfe, oben am Walde.
Da hatte Andreas nur wieder mit pfiffigem Lachen zu der etwas verängstigten Magdalena gesagt: »Kein Mensch kommt in meine Festung!« Nur hatte er dabei auch die Büchse aus dem Winkel hervorgegriffen, die er sich als lediger Mann gelegentlich gekauft hatte. Und hatte sie sauber zu machen angefangen und dann mit zwei Patronen sorglich versehen.
Denn dann waren noch andere Bauern, mit dem Gendarm zusammen, gekommen. Und der Gendarm hatte jetzt mit seinem Säbel klirrend an die Mauerpforte geschlagen.
Da sah Andreas wie ein Luchs wieder durch die Mauerluke hinaus und sah, daß eine ganze Schar Bauern schon im weiten Umkreise seine Festungswerke umstellt hatten. Und sah also, daß alles bis aufs letzte von seinen Fahrten erkannt und entdeckt war.
»Gehe du ruhig hinaus, Magdalena!« sagte er nur jetzt ganz nebenbei und sehr freundlich lächelnd. »Dich geht die Sache gar nichts an ... du bist völlig unschuldig daran!«
Die Junge begriff noch immer gar nichts. Sie weinte nur jetzt heftiger. Hatte die Kostbarkeiten in einen Kasten geworfen. Stand im armseligen Hauskleide und wagte keinen Schritt zu tun.
Da lachte Andreas noch wütender und rief hinaus: »Niemand kommt hier herein!« Zum ersten Male ganz laut und jähzornig.
So wußten die Bauern und der Gendarm, daß sie eine richtige Belagerung machen müßten. Zumal Andreas dabei sein Büchsenrohr über die Mauer hochgehalten und seine Worte noch einmal gehässiger wiederholt hatte.
»Niemand kommt hier herein!«
Es war Andreas blutiger Ernst, daß er seine Festung bis zum letzten Atemzuge verteidigen wollte.
Wie sie mit Äxten gegen die Mauerpforte zu schlagen und so im Hauf einzudringen versuchten, schoß Andreas eine Kugel warnend in die Lüfte.
Und weil auch der Gendarm sofort scharf dagegen schoß, obwohl sie durch die Mauer weidlich getrennt waren, wußte man nicht, wie die kleine Komödie noch enden sollte.
Und man wagte auch eine lange Weile nichts weiter.
Bis von drinnen das Hohnlachen Andreas Lubas durch die Mauerluke die Bauern wieder aufschreckte.
Einen ganzen Tag dauerte die unblutige, verhaltene, komische Belagerung. Denn niemand hatte Lust, sein Leben leichtsinnig aufs Spiel zu setzen. Und so lächerlich auch, man konnte doch das kleine Gehäuse mit der hohen Mauer nicht einfach mit der Hand zusammendrücken. Zumal Andreas schließlich zu wiederholten Malen immer noch wieder in die Luft geschossen hatte, sobald ein Bauerngesicht gewagt hatte, sich über der Mauer zu zeigen.
So stand der Bauernkordon auch noch eine ganze Nacht. Es war eine helle Sommernacht. Auch die Hirsche waren aus dem Walde in den Nachtglanz getreten.
Bis am beginnenden Morgen schließlich doch ein allzu kühner Bauer einen Streifschuß in den Oberarm bekam.
Da hatte man sich schnell entschlossen, eine kleine Kolonne Soldaten aus der nahen Garnison dazuzurufen. Denen es ohne große Mühe, wobei freilich noch immer hin und her vereinzelte Schüsse fielen, gelang, in das phantastische Reich einzudringen.
Der Garten blühte über und über. In der engen Stube drin die kleine heilige Figur stand still in der Nische. Und das Öllämpchen glimmte wie ein roter Stein. Die ärmliche Magdalena kniete am Boden, bleich und mit ausgebreiteten Armen über Andreas gebeugt. Und schluchzend. Denn Andreas hatte sich im letzten Augenblick die eigene Kugel ins Herz gejagt. Er lag mit lächelndem Gesicht tot auf der Diele hingestreckt.
Ein Bruder der Steine
Die langen Bauernjungen und der dicke, grobe Schulze im Dorf wußten gar nicht mehr, daß der alte Bettelmann noch eine Seele hatte.
Der alte Bettelmann war völlig verschrumpft. Aschfahl und erdig.
Und er hatte einen häßlichen Namen. Er hieß Grunze. Einmal sogar vollständig Adam Grunze.
Damit konnte er freilich von Anfang an in einem Salon keinen Staat machen.
Adam Grunze, das gehört so recht auf den faulig riechenden Düngerhaufen, wo auch Pferdemist und Strohhalme in der Luft herumfliegen. Oder noch besser: gleich in den Schweinekoben.
Aber der alte Grunze hatte gar keinen Geruch mehr.
Gegen die schlimmen Arome aus dem Dung- und Gemüllhaufen war er gewappnet, besser wie ein Stahlritter gegen Lanzenstiche.
Da war der Eingang in seine Seele fester verschlossen wie ein Geldschrank gegen Diebe.
Da konnte seiner Seele auf dieser Erde niemand mehr etwas anhaben. Schon seit zwanzig Jahren.
Schon seit zwanzig Jahren wußte er es gar nicht mehr, daß die jung umgeworfene, braune Scholle im Frühling riecht wie leicht ätzend und würzig. Und so frisch heimatlich. Und daß an der hinteren Mauer des Armenhauses, wo auch wilder Efeu kletterte, kleine Veilchen dufteten gar nicht wie irdische Dinge, eher wie ein Stück Himmelsblau.
Das mochte vor zwanzig und mehr Jahren alles einmal so gewesen sein.
Das war jetzt für den alten Bettelmann nicht einmal eine Sage mehr. Das war in Adam Grunze längst ausgeklungen und ausgesungen.
Denn die Tore in seine Seele waren total verschüttet.
Nicht Veilchenduft. Nicht Düngerduft. Nichts konnte Grunze auch nur daran erinnern, wenn er auf dem ausgetrockneten, in Sommerglut dörrenden Dungstroh Stunden und Tage hinter der Scheune am Bauernhofe lag.
Der alte Grunze hatte auch keinerlei Sorge vor Fliegen mehr. Oder vor Mücken. Oder vor Ohrwürmern.
Oder vor der Kreuzspinne, wenn die über seine klebrigen Lumpen und auf seiner borstigen Haut hinkroch.
Nämlich seine Haut konnte eine gewöhnliche Durchschnittsfliege allenthalben betreten ohne jede Gefahr. Der alte Grunze fühlte gar nichts mehr.
Eine gewöhnliche Durchschnittsmücke konnte ihn zwicken und stechen, so frech sie wollte. Da hätte sie einen ganzen Nachmittag arbeiten müssen. Nicht mit einem gewöhnlichen, zarten Mückenstechkolben. Gleich mit einem Drehbohrer. Und wäre doch nicht bis aufs Blut gekommen.
Man sah es ja dem alten Grunze schon im Gesicht an. Das war so erdfahl, lederhart und rissig, wie eine Rhinozerosschale.
Gar nicht Menschenhaut. Eher Baumrinde.
Ganz nur gemacht, damit der alte Bettelmann jetzt wenigstens ruhig in dem gedörrten Dungstroh schlafen konnte. Sich nicht zu rühren brauchte, wenn allerlei Gewürm und Ungeziefer friedlich auf seinem Hals und Gesicht spazierte. Mit seinen Fühlern seine verquollenen Augenlider untersuchte. Ihm in Taschen und Lumpen herumkroch. Und auf seinen wie aus trockener Bronze gemachten, sprüngigen Händen und Füßen herumhockte wie auf der Borke eines verwitterten Ahornbaumes.
Bei dem alten Grunze waren alle die Luken und Tore in die Seele total verschüttet.
Auch ein Kind hätte ihn am Halse, im Gesicht, an den Händen lange streicheln können. Und der alte Grunze wäre doch nicht wach geworden.
Auch ein Kind hätte ihn herzhaft an seinem Leibe anrühren können. Er wäre es nicht gewahr worden, wenn er nicht etwa wach gewesen und seinen Nebelblick nachlässig prüfend zufällig nach dessen Seite gedreht hätte.
Aber von Kindern, die zum Streicheln hätten kommen können, wußte er nichts mehr.
Ob er je Kinder gehabt, hätte man nicht mehr aus ihm erfragen können.
Höchstens kamen die großen Bauernjungen und strichen mit einem Holzspane in das rindige Furchengesicht, wenn der alte Grunze auf dem Dungstroh hinter der Scheune oder in den Quecken draußen in der Ackerfurche am Lehmteiche, vom Sommersonnenstrahl beschienen, mit den drei langen, gelben Zähnen im offenen Munde und den verharzten Haarbüscheln um den mächtigen Schädel dalag.
Dann sah der alte Grunze, wenn er am Abend endlich langsam in sein finsteres Mauerloch im Armenhause heimschlurfte, nur noch ein wenig schwärzer aus.
Aber niemand kümmerte das. Bis es ihm der Regen wieder abwusch.
Alle Luken und Tore in die Seele waren wirklich ganz verschüttet. Nicht nur verschüttet die seligen Pforten, darein wie durch rosenbekränzte Gartentürchen die liebliche Liebe von Seele zu Seele huscht. Darein das Streicheln zärtlicher Kinderhände einschlupft, einem Lachen ähnlich.
Auch sein Blick war nur noch ein Nebelblick.
Er sah nur noch eine Fläche in Grau, darin große, farblose Massen sich unbestimmt hin und her schoben. Gerade genug für ihn, daß er ausweichen konnte, wenn ein hoher, ährengetürmter Erntewagen die Dorfstraße mit Leben und Lärm entlangfuhr.