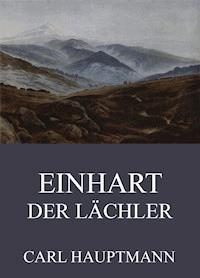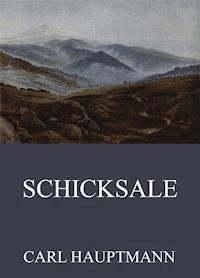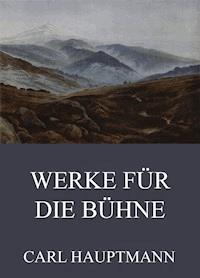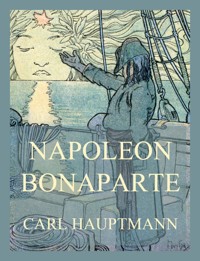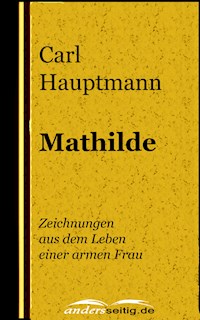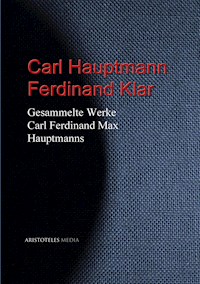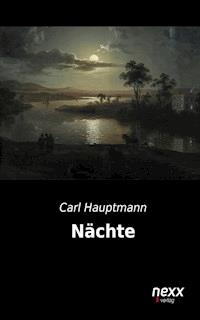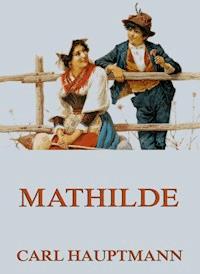
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hauptmanns Roman schildert anhand der Mathilde das Schicksal der in Armut lebenden Fabrikarbeiterinnen Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Meisterwerk der psychologischen Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mathilde
Carl Hauptmann
Inhalt:
Erstes Buch
Im Gemeindehaus
Der erste Brief nach Haus
Fabrikmänner
Wie Saleck sich nähert
Wie Skrupel erwachen
Mathildes heimliches Zögern
Saleck und Simoneit messen sich
Mathilde geht nun offen mit ihm
Mathildes Abschied von den Böhmischen
Zweites Buch
Sie wohnt bei frommen Alten
Das Weihnachtsfest
Wie sie sich Mutter fühlt
Salecks Krankheit
Mathilde sieht einen aus der Heimat
Wie Mathilde zum zweiten Male dem aus der Heimat begegnet
Heimliche Unruhe
Salecks Nöte
Unteroffiziers-Ball
Saleck irrt umher
Drittes Buch
Der alte Hallmann war ein Riese
Mathilde fährt Ernst auf Urlaub nach
Wie nun Mathilde heimlicher Kummer nagt
Mathilde ist zum zweiten Male Mutter
Der alte Hallmann kommt dahinter
Mathilde wartet auf Ernsts Brief
Mathilde fährt heim
Mathilde trifft Ernst heimlich
Mathilde wird nun klar
Viertes Buch
Mathilde lernt auf seltsame Weise Dominick kennen
Im Zirkus
Dominicks Irrgänge
Mathildes Kind stirbt
Die trauernde Mathilde bei Dominick
Dominicks Selbstverachtung
Dominick beginnt, sich ganz zu verlieren
Dominicks Wege
Dominicks Ende
Fünftes Buch
Die Heintken bringt Mathilde eine junge Schwester
Wie Mathilde mit der Schwester lebt
Die junge Schwester verwahrlost
Die junge Schwester kommt unter Kontrolle
Die alte Heintke starb
Sechstes Buch
Mathilde träumt vom Frühling
Simoneit ist einer der Haupträdelsführer
Mathilde versöhnt sich mit Simoneit
Mathilde ist entschlossen, Simoneit zu heiraten
Mathilde ist Simoneits Frau
Wie Mathilde Simoneit das erste Kind geboren
Mathilde wappnet sich
Wie aus Mathilde Leid hervorsah, wie aus einer Seherin
Wenn nun eine am Brunnentroge steht, kennt man sie
Mathilde, C. Hauptmann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849627232
www.jazzybee-verlag.de
Carl Hauptmann – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 11. Mai 1858 in Obersalzbrunn, Niederschlesien, verstorben am 4. Februar 1921 in Schreiberhau, Niederschlesien. Bruder von Gerhard Hauptmann. Nach dem Abschluss der Realschule 1880 studierte H. Naturwissenschaft und Philosophie an der Universität Jena und promoviert 1883 zum Dr. phil. Heirat mit Martha Thienemann ein Jahr später und Fortsetzung seines Studiums in Zürich. Erst 1889 kehrt H. nach Deutschland (Berlin) zurück und bezieht zwei Jahre später mit Bruder Gerhard ein Haus in Schreiberhau im Riesengebirge. 1908 Scheidung von Martha und erneute Hochzeit mit Maria Rohne.
Wichtige Werke:
1893 Metaphysik in der modernen Physiologie
1894 Marianne (Drama)
1896 Waldleute (Drama)
1897 Sonnenwanderer (Sammlung von Erzählungen)
1899 Ephraims Breite (Drama, erneut 1920 unter dem Titel Ephraims Tochter)
1902 Die Bergschmiede
1902 Mathilde. Zeichnungen aus dem Leben einer armen Frau (Roman)
1903 Des Königs Harfe (Bühnenspiel)
1905 Austreibung (Drama)
1907 Einhart, der Lächler (Roman, 2 Bände)
1909 Panspiele (vier Dramen)
1911 Napoleon Bonaparte (Drama)
1912 Nächte (Novellen)
1912 Ismael Friedmann (Roman)
1913 Schicksale (Erzählungen)
1913 Die lange Jule (Drama)
1913 Die armseligen Besenbinder (Drama)
1914 Krieg. Ein Tedeum (Drama)
1916 Tobias Buntschuh (Lustspiel)
1916-18 Die goldnen Straßen (Dramen-Trilogie)
1919 Rübezahlbuch
1919 Der abtrünnige Zar (Drama)
1920 Drei Frauen (Erzählungen)
1927 Tantaliden (Roman)
Mathilde
Erstes Buch
1
Im Gemeindehaus
»Redi ni vom Vater, Mutter! Besser, daß er überhaupt ni mehr heemkummt.« Mathilde sagte die Worte mit dem gänzlich harten Gesicht, das die Fünfzehnjährige fast niemals in ein Lachen legte, solange sie daheim war. Und daheim heißt dabei auch nichts weiter, als in einer großen Eckstube im Gemeindehaus, in der man fast immer Holz feuerte, und in der die beiden Öfen, ein alter Kachelofen und ein kleiner eiserner, mit hängenden Türen und Ritzen, die nie verschmiert wurden, im Winter oft so rauchten, daß man vor Qualm beim Eintreten keine Menschen sah, nur wie offene Feuer durch den Rauch, und Krachen und Prasseln der gestohlenen Scheite hörte, bis man dann langsam auch Insassen, die alte Heintke und ihre Schwiegertochter und ein paar kleine Gesichter mit Strickstrümpfen am Tisch, und endlich Mathilde, die frische Fünfzehnjährige, die unten in der Fabrik auf Arbeit ging, gewahr wurde, Mathilde immer mit einem harten Gesicht, jung und blond, wie sie war, mit energischen, vorwurfsvollen Lippen, barsch und ablehnend.
Die Wände der Stube waren wie die einer Räucherkammer, so schwarz und geteert, und in dem Raum stand auch schwarz und gebrechlich nur das Allergeringste, was eine Familie zur Lebensnotdurft wirklich haben muß: Ein Tisch und eine Lampe, die zum allgemeinen Stubenrauch ungehindert noch den ihrigen zugab, ohne daß eins gedacht hätte, sie einmal zu reinigen. Die Mädchenhände mußten sich ganz mit ihren Strickstrümpfen nahen, um auch nur einiges zu sehen, wenn in dem harten Widerpart der Stube, der immer zwischen Mutter und Schwiegermutter und zwischen Mutter und Mathilde herrschte, nicht alle Schlingen von der Nadel streichen sollten. Und in der Ecke stand ein Bett, fast bis auf die Bettbretter leer. Es lag unter ganz schwarzen Bettlaken, die nie gereinigt waren, ein Strohsack, auf dem die junge Heintke mit ihm die Nächte zubrachte, indessen die alte Mutter mit dem jüngsten Enkelkinde gegenüber in der elend zerschlitterten Bettstatt lag. Noch ein Schub und ein Schrank waren da, vergriffen wie altes Holz, das an der Luft und im Rauche schmutzig geworden, schief und hängend. Und was sonst an Kindern noch existierte, machte sich ein fliegendes Lager dort, wo es warm war, aus Kleiderlumpen und Schemeln und Stroh auf der Diele, einer alten Lehmdiele, die aussah wie der blanke, schwarze Erdboden, nur daß er nicht gerade vom Regen naß wurde, bloß vom Stürzen der Kartoffeltöpfe, und wenn man im Röhre kochte.
Aber der Mann, der junge Heintke, war diesen ganzen Winter nicht daheim. Er war im Gefängnis. So nahm die junge Frau – sie war gegen sechsunddreißig – ihre jüngsten Mädel zu sich ins Bett, und da es eben Schlafenszeit war, Mathilde ihr Töpfchen Kartoffeln für den kommenden Arbeitstag fertig gemacht und parat gestellt, war die allein daran, sich für die Nacht am Boden herzurichten, während Großmutter und Mutter mit den jüngeren sich bereits ins raschelnde, knackende Lager hingeworfen und Last und Mühsal barsch und grollend hinter sich.
Und Mathilde allein stand noch aufrecht. Die Feuer in den Öfen waren niedergebrannt, durch die Ritzen des Eisenofens glimmte es noch. Sie hatte sich die Lampe auf die Ofenbank gerückt und begann, sich langsam auszukleiden: ein junges frisches Ding, groß und kräftig für ihre Jahre, mit gesunden, starken Bewegungen, die keine Ermattung und Ermüdung verrieten, nur Spannung in Muskeln und Sehnen. Sie nahm lässig Nadeln aus dem hudeligen Haare und legte sie auf die Ofenbank – und lässig und Versonnen zog sie ihre Jacke aus, die aus ihrer Kinderzeit stammte und ihr bei der jungen Fülle offenbar viel zu eng geworden; und dann hing sie sie langsam an den Schrank und blickte sich nach den Ruhenden um. Es beschäftigte sie etwas. Sie sah sich in dem schwarzen Rauchfang um und überdachte hin und her. Aber die letzten Worte, die sie gegen die Mutter ausgespielt, waren hart gewesen und konnten die Härte der Mutter ebenso gut auch herauslocken. Deswegen schwieg sie und wagte nicht, zu neuen Worten sich aufzuraffen. Und die Mutter lag und sah sie durch die blinzelnden Lider, denn die junge Heintke war ein Weib mit allen Registern, das Fluchen im Hause ging ihr ebensogut wie das sich Bekreuzen und Beten und Demütigtung in der Kirche. Die Töchter, und besonders die, die nun frisch und jung aufgewachsen und aus sich aufkam in Groll, um dessentwillen, was jeder, wenn er ins Leben will, hoffen und erwarten soll, und was sie so gar nicht aus Mutter und Vater und Gemeindehaus finden konnte, die mußte auf der Hut sein. Deswegen schwieg auch Mathilde heute, so hart sie aussah und so geschickt sie sich sonst mit unbarmherzigem Hohn einem Schlage der Mutter zu entziehen wußte, wenn er sie gleich tückisch in Auge und Nase treffen wollte. Aber die Mutter schwieg auch und tat, als schliefe sie. Im Grunde umfing sie die wohlige Lage, das Stumme und Stille, die Losgebundenheit auch von den Kinderreden und dem Scheelsehen der alten Großmutter, und sie überlegte, und der Zorn schwand, die Müdigkeit kam, die blinzelnden Augen, die noch heimlich sehen wollten, drückte der Schlaf zu, so daß Mathilde bald merkte, daß alles in sich gesunken war, wie das glimmende Feuer in Staub und Asche. So ging auch in ihrer Seele das Licht der Wünsche und nagenden Sehnsucht aus – und ihre Mienen, rund und rosig, ihr Haar so blond wie Gold im Schein der Rauchlampe, und ihre junge Gestalt, weich und knospend wie ein junger Baum, alles nahm ein stilles, starkes, gesundes Leben nur für sich an. Die Härte war gewichen. Wie ein buchener Zweig im Frühlingsdrange, so dehnte sie sich in die Lumpen und legte ihren hellen Kopf auf die harte Lehne eines umgekehrten Schemels und deckte sich mit Oberrock und Lumpen – und zog leise ein Büchel heraus, das sie, wer weiß von wem, gehandelt hatte, und suchte so einige ungestörte Lebens- und Traumblicke zu tun, ehe sie einschlief.
Aber das Ungewohnte der brennenden Lampe im Stübel weckte die junge Heintke, und sie begann im Halbschlaf zu murren: »Werscht wull noch verrückt wer'n, Mädel.
Lösch de Lampe aus! De Nacht is zum Schlofen! Na? werd's bale? oder sull ich mit 'm Riemen kummen?« Mathilde löschte die Lampe. »Du wißt schun, ich mach mir nischt draus und hau dir's Leder noch amol ordentlich vull! – Nischte wie Tummheeta eim Kuppe – nischte, wie Frechheeta eim Kuppe! – Kumm mer ock morne mit den Ideen ni wieder! Du bist a Kind und gchierst ei's Haus!«
»Ei's Haus – ei's Haus,« sagte nun Mathilde plötzlich wütend gemacht, »ei was denn fir a Haus, etwa ei's Gemeenhaus!? Was? Oder gar ei's Zuchthaus, wie der Vater? – 's ock gutt, daß er ni mei Vater is!« setzte sie als Trumpf noch oben auf, und es war ihr nun egal, wenn auch die Mutter aus dem Bett gesprungen und sie rücksichtslos geohrfeigt hätte, wie vorgestern. Aber Frau Heintke war müder, als sie selbst dachte, so daß sie die Worte der Tochter nur noch halb auffaßte und sie nicht in Wut geriet. Auch war es warm im Bette, neben sich die kleinen, heißen, ineinander gekrochenen Mädchenleiber, und in der Stube begann die Kälte von den dünnen Fenstern her hereinzukriechen, sobald die Ofenfeuer erloschen waren. So blieb es ruhig in der Stube, und auch Mathilde legte sich auf die Seite, um zu schlafen. Trotzdem begann der Gedanke, den Mathilde angeregt hatte, in der jungen Heintke weiterzubrennen und von Zeit zu Zeit wieder aufzuflammen, auch wie kein Licht mehr auf der Ofenbank brannte. »Du werscht fortgiehn! Du hust Arbeit genung – dunda – ei inse Fabrik. Was sölltst du ei d'r Stadt? – a tummes Mädel wie du!! An – a frecher Balg wie du. – Mit a Mannsleuten sich rimtun – und eene Luderei hinter der andern machen, a Eltern Schande machen.« Mathilde mußte in der Dunkelheit hell auflachen vor Hohn. Sie war wirklich noch unverdorben. Was sonst an Unflätigkeit und niedriger Gesinnung um sie lag, floß noch ab von ihr, denn die Jugend in der Welt ist ein Panzer gegen alles Gemeine, und eine zarte Blüte ist stärker wie Winter und Modererde und drängt eine Zeit in strengster Reinheit aufwärts. Was Mathilde trieb – hinaus aus dem Unleben, das war eine ziellose Sehnsucht –, und nichts war ihr daran klar, als daß sie gerade daheim nur die Schande zu fliehen hätte.
Es war ja ein elendes Leben daheim. Die Mutter, eine von den Verwahrlosten, die jung und lebensgierig mit einem alten Leiermanne durch die Provinz gezogen und Liebe in jedem Straßengraben oder hinter jedem Strohschober gesucht und gefunden hatte. Dann hatte sie endlich, nachdem der Alte längst tot, dem sie den Leierkasten zog und die Pfennige sammelte, ein Ziel ihrer Reise im Gemeindehause und in der Ehe mit dem Heintke gefunden. Mathilde war das erste Kind, das sie im Beginne ihrer Laufbahn, noch jung und lockend, wie sie damals war, von einem jungen, heißblütigen Bauernsohne im Durchziehen durchs Dorf in einer heimlichen Nacht in der Scheune empfangen hatte. Die andern Kinder alle, die nachher kamen, waren elend, von jämmerlichen und jämmerlicheren Menschen, Vagabunden und Rumtreibern – und dann kam die edle Zucht aus Heintkes Blute. Nun ja – also, wenn Mathilde nicht daran dachte, ihren Eltern Schande zu machen, kann man es gern glauben. Hinaus wollte sie, mit hartem Sinn hinaus. Sie war jung und wollte hinaus. Weiter wußte sie nichts. Sie konnte die Welt und ihren Sinn nicht kennen. Sie wollte nur die Schande fliehen und den Moder des Lebens, in dem sie saß, und aus dem sie früh ausging, verachtet besehen von vielen, und abends heimkehrte, um in Zank und Groll einzuschlafen. Deshalb stand es in Mathilde auch fest, daß sie aus dem Hause ging. Mochte nun die Mutter reden und fluchen und schlagen. Eines Tages würde sie hinaus sein. Eines Tages würde sie eine Stellung in der Fabrik in B. genommen haben, nachdem sie sich heimlich Fahr- und Zehrgeld zusammengelegt. Und das ging ihr noch einmal im Sinne um, das war wie ein Aufgang. Das machte sie noch einmal wie für sich froh lachen, obwohl sie kaum ihre Mienen verändert fühlte. Denn hart war sie, kräftiges Bauernblut machte das faule Blut der Mutter lebendig und tüchtig in ihr. Und dann sagte sie nur, um die Mutter zu beruhigen: »Wenn ich euch wer' jede Woche a schienes Geld heemschicken, werd's 'm Vater und dir recht sein. Was vedient man denn hie unten?« Das beruhigte auch in der Tat die junge Heintke. Der Gedanke, sie könne wöchentlich einen guten Zuschuß erhalten, das derbe, kraftvolle Mädel würde nicht in Zorn und Verachtung hinaus in die Fremde gehen, sie würde an die Eltern denken und für sie arbeiten wie immer, gab einen plötzlichen und völligen Trost in ihre Gedanken. Und sie atmete noch einmal wie erlöst laut hörbar auf – und dann auch die Tochter – und beide sprachen an diesem Abend kein Wort mehr.
2
Der erste Brief nach Haus
Mathilde war jetzt in der Stadt. Sie war mit einem jungen, verliebten Kerle, und einer anderen Fabrikarbeiterin, die im Tale wohnte, dahingekommen. Sie hatten nicht unbesonnen sich schon vorher eine Arbeitsstelle zu verschaffen gewußt und strömten nun morgens, ehe Sonne und Tag die Welt erhellt und rege macht, im Dämmergrau des Laternenscheins, oder auch in Regen und Dunkel, wenn kaum nur ein Bäckerjunge mit übergroßem Korbe am Arme, oder ein verspäteter Säufer durch die leeren, stillen Straßen fegte, ein in das große Tor, wo der alte bärbeißige Portier jedes einzelnen Meldung in Empfang nahm. Sie arbeitete jetzt mit Hunderten, die ihr Los teilten, und verdiente gut. Sie lief in die Arbeit noch immer, wie sie in den Bergen gelaufen und morgens in Hast zu Tale geeilt war, um nicht zum Arbeitsbeginn zu spät zu kommen. Noch immer eng und ärmlich die Jacke, in der Farbe verschlissen und unkenntlich, den Rock zu kurz, wie eine, die zur Schule geht. – Sie sah frisch aus und gesund – stark und rosig – und wenn sie mittags oder abends im Strome der jungen oder verwelkten, frechen und höhnischen Arbeiterinnen aus dem Tore der Fabrik – unter Hunderten eine allein, für sich herausschritt, während die andern drei und vier und mehr unterfaßten und lachend und schwatzend vorwärtsstürmten – da stand mancher Junge und sah ihr nach und dachte daran, den harten und sicheren Zug in diesen jungen Mienen zu gewinnen – und die Werkmeister und der Portier, alle sahen oft heimlich auf sie, die wortkarg und entschlossen und doch wie ein Kind ihre Arbeit tat, willig und stark und geschickt, pünktlich kam, kaum von der Arbeit aufsehend und jeder Annäherung abhold wie eine Seele aus Erz.
Und immer schritt sie heim in eines der alten Hinterhäuser, die in der Nähe der Fabrik in einer schiefen Gasse eng aufeinander lagen, wo kaum ein Fleischerwagen einer Karre ausweichen konnte, so eng und alt – und wo in den Häusern, die kaum zwei, drei Fenster breit, schmal und niedrig waren, die alten schiefen Treppen bei jedem Tritte krachten, und allerhand seltsame Ecken und Winkelstuben lagen, zu denen man durch kleine Treppchen extra aufstieg. Dort wohnten ein paar böhmische Wäscherinnen, alte Mädchen mit Narben, die erfahren waren, bei denen lebte Mathilde. Diese Narbigen mit eingesenkten Nasen und häßlichen, heiseren Stimmen hatten ihr gleich Unterkunft geboten. Sie war froh, aus dem Gemeindehaus fort zu sein. Das lange Zimmer mit dem einen Fensterschlitz gefiel ihr fast, weil Sand auf der weißen Brettdiele lag, auch die Treppen im Hause weiß und gereinigt aussahen, und anständige Arbeiter, ein junger Schlosser aus der Fabrik mit Frau und Kind und andere junge und alte Familien hier wohnen mochten. Zudem hatte Mathilde nie bisher erfahren, daß ein Mensch einen andern zwecklos lieben kann. Die Wäscherinnen hatten Gefallen an ihr wie an einem Kinde. Sie hatten Gefallen an dem jungen, blühenden Leibe, der früh aus den Lumpen und dem zerflatterten Arbeitshemd licht aufstieg und vor der angeschlagenen, braunen Waschschüssel stand, um sich zu erfrischen. Auch Mathilde gefiel das. Daheim hatte sie es nicht gekannt. Waschschüsseln gab es nicht. Wer sich waschen wollte, mußte an den Trog laufen, hinaus ins Freie, und davor hütete sich in Winter und Kälte jedes. Nun empfand sie es wie ein Wunder, wenn sie Hals und Brust kühlte und sie rosiger wurden und blendend. Und die beiden narbigen Mädchen, deren Leben sie gar nicht kannte, und wonach zu fragen ihr nie in den Sinn kam, lagen in ihren Betten und sahen sie heimlich stehen, ein Bild ihrer eigenen, verlorenen Jugend, schlank und stählern, und liebten sie aus heimlichem und ungedeutetem Grunde – schenkten ihr kleine, liebe Dinge, brachten ihr Süßigkeiten, sie schlief in ihrem Bett. Es kam, daß Mathildens Züge daheim alle Härte vergaßen, daß sie grundlos auflachen mußte bei dem Gedanken, daß diese alten Mädchen beide welterfahren, sie froh zu machen suchten. Ja, sie begann selbst, sie zu lieben, so daß sie eine Zeit zugänglicher wurde daheim und kindlich und freundlich. –
»Morgen, wir gehn hinunter – in die Hallen«, sagte die eine Alte zur andern.
»Wenn Kind mitkummt«, gab die andere dawider.
Mathilde stand am Fensterschlitz und nähte an einem grünen Rocke, den ihr die Böhmische geschenkt hatte.
»Wie, Mädele? – Nun? – Wie ist?« – denn Mathilde hatte nicht von der Nähterei aufgeblickt und hörte kaum.
»Willst du nicht sagen, Kind?« tastete die Sprechende weiter.
»Oh, ich wiß nee!« Mathilde war es peinlich, daß man von den Hallen sprach. Einer der jungen Menschen, die in der Fabrik arbeiteten, ein kleiner, schmächtiger, dessen Kopf etwas in den Schultern steckte, aber der eine feine Haut und einen weichen Bartflaum besaß, hatte sie auch heimlich gebeten, hinzukommen, und sie hatte ihn verdrossen, fast feindselig angesehen. Sie wollte von so etwas nichts wissen. Wie sie von daheim fortzog, noch in der letzten Nacht, hatte sie dagelegen und Entschlüsse gefaßt – Oh – sie hatte genug; darüber war sie sich klar geworden. Der Mutter Leben sollte nicht das ihre werden. Lieber wollte sie tot sein. Und sie war auf der Hut – wie vor Gift und Feuer. Wenn sie nicht davon sprach, daß nun tausendmal Junge und Alte sie heimlich locken und zu allerhand Abwegen führen wollten, so war es nur, weil sie zu niemand von all ihren stillen Wünschen und ihren Rückblicken sagen mochte. Und außerdem wollte sie nicht beredet sein. Sie litt das Geschwätz nicht, das so leichtsinnig in allerhand Lüsternem hintändelt, deshalb auch mochte sie sich keiner ihrer Mitarbeiterinnen anschließen. Sie schreckte zurück. Sie schreckte im Grunde vor jedermann zurück und war mißtrauisch auf alle. Und blind feindselig gegen jede Annäherung, hart und ablehnend, wer es auch versuchen mochte. Deshalb sagte sie noch einmal ganz bestimmt und mit Härte, wie sie ihr daheim jetzt ungewohnt war: »Nee, ich will nee.«
Aber die Alte, fast erschrocken über die Zornblicke, die Mathilde dabei annahm, nahm sie in ihre Kniee, wie man ein liebes Kind zu sich nimmt und strich ihr die Härte aus dem noch schweißigen Gesicht, daß sie kindlich lachen mußte. – Es war Sonnabend Abend – der Tag noch hell – wie Mathilde eben aus der Arbeit heimgekommen war und es nicht erwarten konnte, sich hinzusetzen für ihren Sonntagsstaat.
»Warum, Liebe,« sagte die Dunkle zu ihr, »is sich Theater durt – man kann schauen – Suldaten sind sich durt – viel Vulk is sich durt – singen wirst du hören – komm mit, Kind! Bist du jung, wirst dich tanzen lernen – auch durt.«
»Nee, nee – das alles will ich ni lernen«, sagte sie, unwillig sich lösend, und so blieb es auch. Der Sonntag kam, sie saß am Morgen und wusch und nähte. Sie schrieb den Nachmittag an einem Briefe mit Zeichen hin und her, lang und groß – und es hieß darin: »Geliebte Mutter, Du wirst wohl denken, ich bin ganz nicht mehr wie Deine Tochter. Hier ist alles schön und man vergißt alles – auch, weil ich in tüchtiger Arbeit bin, wovon Du ein Zeichen hierbei findest, indem ich Euch schon zehn Mark schicken und noch mehr verdienen will – und immer schicken« – usw. Ein guter Brief, ein freundlicher Brief. »Geliebte Eltern.« – Sie war fast in einiger Sehnsucht. Sie saß reinlich gekleidet am Fensterschlitz auf dem Schube, und es mochte eine lange Zeit, Stunden des Sonntagnachmittags vergangen sein, so sank sie ein in das Bild ihrer Heimatwege – und nichts fiel ihr ein, als nur das Gute, daß da eine geliebte Mutter war, und Elend und Groll waren ausgewischt. Sie dachte auch an die kleinen Mädchen mit den Strickstrümpfen vor der Rauchlampe, und wie sie den Brief mit bedächtigen Zeichen adressiert und sorgfältig besiegelt hatte, mußte sie wohl ein über das andere Mal die Nase wischen und mit den Fingern die Augenlider ausdrücken.
3
Fabrikmänner
In der Fabrik ging es gut. Und wie die Räder schnurrten und surrten, und alles in Bewegung und Lärm und in Vorwärtsdrängen sich abspielte, machten die jungen Direktoren und Werkmeister und auch der Portier fröhliche Gesichter. Sie wußten, man verdiente, nun sollten alle ihren Teil haben. Es gab lange Arbeitszeit, und jeder einzelne Arbeiter trug am Sonnabend guten Lohn heim. Auch die Arbeiter machten gute Mienen, besonders die jungen. Und es ging auf den Sommer zu. Da war auch das Schlendern zum Feierabend wiedergekommen. Und wenn die Stadtuhren sieben schlugen, hastig oder feierlich, je nachdem es aus dem Stadthaus oder von den Kirchen klang – da eilte jung und alt und wußte, wo es sich zu finden hätte. Dann liefen die Mädel in Reihen um die entstehenden Neubaue, wo die jungen Maurergesellen froh warm, sie hinter Schuppen und Ziegelständen zu drücken, oder sie schlenderten ins Feld, paarweise, und manche saßen auf den Bänken, manchmal eine halbe kühle Frühlingsnacht, oder trieben sich lachend und schäkernd auf den Promenadengängen am Wasser und um das rauschende Wehr herum. Daß Mathilde nicht darunter war, gab bald Anlaß zu heimlichem Gered«. Man sah sie nie. Die Mädel ärgerte es, und sie erfanden sich allerhand Gründe, die sie höhnisch und fast innerlich beleidigt ihren Burschen zum besten gaben. »Die hält's mit 'n Grussen«, foppten sie. Und es kam auch in der Fabrik unter den jungen Männern und Weibern herum, »die hält's mit 'n Grussen«. Jeder wußte wohl, daß sie dem und jenem jungen Werkmeister gefalle, der sich mit ihr gern eine heimliche Lust machen würde. »Se is zu stolz mit insereens«, sagten manche. Und man erfand auch gleich wer. Es war nur Gerede. Aber man spannte dann auf den Bewußten und beobachtete sie, obgleich sie noch in der Arbeit die engen, ärmlichen Gemeindehauslumpen trug – und ärmlich und gar nicht nach einem Großen aussah. »Luß dr ock endlich amol a längeres Kleed schenka, Mädel«, höhnten die Mädels. Und sie versuchten, sie zu necken und zu ärgern. Mathilde sah es und hielt an sich, wie sie es im Gemeindehaus einst gelernt hatte. Was die Mädels da redeten, war Gemeinheit. Sie haßte die Brut und mit keiner mochte sie Umgang haben. Und eines Tages kam eine, die wußte zu erzählen, sie wäre eines jungen Kommis Gesponse – denn man wollte sie mit ihm im Dunkel haben verschwinden gesehen. So kindlich und bettelhaft arm sie noch immer aussah. Alles war Gerede, aber man machte sich eine Lust, um die junge, stolze Person einen ganzen Kreis Erfindungen auszustreuen. Sie litt unter dem Hohn, im Grunde störte sie's nicht. Sie dachte, das ist das Leben. Was wollte sie auch tun? Sie litt es, es kaum recht begreifend, weil keine vertraulich mit ihr war – und niemand ihr den wahren Grund aus den neidischen Quellen verraten mochten Sie dachte also: das ist das Leben und kam und ging – tat ihre Arbeit und sah stolzer und stolzer aus.
Und die jungen Männer buhlten heimlich um sie. Wer denkt, daß überall ein freier Sinn das Stolze und Tüchtige nur gewähren läßt, wie reine Bergluft das Aufwachsen eines jungen Baumes, der weiß nicht, daß die Menschen am Seile der Leidenschaften gefesselt und geführt sind. Jeder, der sich nach ihr sehnte, versuchte ihr etwas anzuhängen. Die jungen Burschen schrien ihr Namen nach, die sie vergaß – so schändlich waren sie. Einmal in einer kleinen Schenke, wo man an schmutzigen Tischen Schnaps trank, und der übermäßig dicke Wirt immer die Mütze auf dem Kopf trug, saßen viere, die eine Wette machten, daß sie Mathilde verführen könnten. »Das wer'n mir sehn«, sagte der eine, der Soldat gewesen war – und er wiederholte es noch einmal, als ein andrer vom Trottoir herein in die Schenkstube trat, schwerfällig und mit guten, einfältigen Zügen, der nur sagte: »Tag, Simoneit«, und dann gleich den Schnaps in den Hals goß und schmunzelnd zuhörte. »Das wer'n mir sehn!« rief Simoneit noch einmal. »Die kann noch a su stulz tun, die ha' ich – ei enner Woche, wenn ich wil« – und er riß die dunklen, sicheren Augen prahlerisch in die Höhe und stieß die Mütze in den Nacken, daß ein Strähn loser, dunkler Haare ihm in die Stirn fiel. Und es gab ein Lachen – und ein älterer Arbeiter sagte bedächtig: »Sag ock ni zuviel, Perschla – könnt'st afahren –« und die anderen lachten wieder und schrien: »A Alter wie du, freilich.« Und es kam ein Vergnügen unter die Leute, daß der Wirt auch hinzutrat und wissen wollte – und man erzählte ihm genau, daß sie jung und stolz und böse wäre, wie eine Katze. Und Simoneit schrie: »Ich fang se, wenn se mich au' krallt!« Und der Wirt sagte: »A Mädel, nee, das wär gar – nu ich ha mir au' Rat gewußt« – und er sagte, daß nun die andern noch einmal in helles Gelächter fielen, wie sie den Dickbauch, der sich nur mit mehreren Schritten noch um sich selber drehen konnte, seine Liebesabenteuer erzählen hörten – er sagte: »Je stulzer de Mädeln tun – desto wilder sein se«, und Simoneit schrie noch einmal: »Heinrich, was wettst de, ich ha se ei enner Woche ha ich se« – und sie wetteten.
Es waren alles junge, kräftige Männer, sie waren erhitzt im Gesicht und angetrunken und rücksichtslos – und wie sie hinaustraten auf die Gasse, mußten sich die Passanten vorsehen, weil sie in ihrer Wildheit jetzt auch Lust verspürten, sich am anständigen Rocke zu reiben, und Mädchen und Frauen mußten eilig und ohne sich umzublicken, hinübergehen auf die andere Seite, daß sie nicht Wort und Hohn aus ihnen neu herauslockten. Jung waren sie, und waren doch schon wie die Alten – sie kannten alles zur Genüge – und waren ausgenützt. Keine Seelen, die noch etwas anderes dachten und wünschten, als was kalt und trocken wie ein harter Stein zuletzt in ihren Händen blieb. Sie sahen Blumen nicht blühen – und sahen nicht, daß weiße Wolken am Himmel zogen – hoch über den engen Straßen – und Vögel zogen in den Lüften. Sie gingen hinein noch in die Destille, wo sie um den Schenktisch standen – und tranken sich zu, die Mützen hinten, und lachten und tollten wie oft.
Nur einer hatte nicht gesprochen, aber er war kränklich und schmächtig und klein. Er wußte, daß er nicht aufkam gegen die Gesunden. Deshalb schwieg er. Und vor der Destille hatte er sich von ihnen getrennt und war heimgegangen. Und es nagte an ihm. Er war dann noch einmal bis vor Mathildes Haus gelaufen, um zu sehen, ob er sie treffen könnte, und hatte vor ihren Fenstern gestanden. Derselbe, der sie versucht hatte, anzureden, den sie hart und unbarmherzig abgewiesen. Dem sie einen Zornblick zugeworfen und nie ein Wort mit ihm gewechselt hatte. Es nagte an ihm. Er empfand einen Gram. Er hatte den Wunsch, Mathilde zu warnen. Er versuchte, die Treppe im Hause aufzugehen und dann ging er doch nicht, weil jemand oben aus dem Zimmer trat – er eilte in die Nacht und ging nun tagelang, gequält von einem Gedanken.
4
Wie Saleck sich nähert
Mathilde lebte noch immer bei den beiden Wäscherinnen, still und häuslich. Ihre jungen Mienen waren frisch und stark. Sie liebte die Alten, die ganz selbstlos nur immer Gutes brachten, und sie empfand, daß sie kräftiger und weiblicher wurde. Am Hause war neben Schutt und Schuppen ein winziger Rasenplatz und es begannen Veilchen am Rande des Zaunes aufzusprossen. Und die Abende waren länger. Da saß sie und nähte manchmal auch. Und wenn sie sich abends ihren Leib waschend im Spiegel sah, erschien sie sich kräftig und schön, und dachte an den Frühlingsbaum, der im Hofe eingeschlossen, weiß schäumte. Sie wußte nicht, daß sie es war, die in der kleinen Scherbe widerschien. Wie eine am Brunnen, dachte sie. Und es fiel ihr ein, daß wiederholt eine Stimme heimlich sie neckend »Großmutter« rief, heimlich und freundlich. So wie sie dastand in der drängenden Frische des Lebens, sah sie nicht wie eine Großmutter aus. Aber wenn sie die Fabrik im Strome verließ, und Lachen und Hohn und gemeine Worte und lüsterne Fragen und Spöttereien der Jungen, wohl gar einmal ein wirkliches Angreifen und Festhalten und Geküßtwerdensollen eines Menschen, den sie nicht beachten mochte, und gegen den sie sich mit schneller Kraft wehrte, vorüber waren – hatte sich immer wieder eine freundliche Stimme heimlich, daß sie nie den Rufenden finden konnte, vorgewagt: »Großmutter, Großmutter.« Und nun sie dastand vor ihrem Waschschäffchen, mußte sie sogar darüber lachen. Es war ein Witz. Sie hatte zwar auch dabei immer mit Härte und sicher wie ein Vogel, der zum Auffliegen bereit ist, um sich geblickt. Aber im Grunde gefiel ihr, daß sie ein Zartes und Zurückhaltendes hörte, und daß jemand mit ihr einen freundlichen Witz machen konnte. Und wenn sie auch eilte und froh war, wenn der Schwarm hinter ihr verstummte, so erfüllte sie doch nur gegen die Menschen eine ganz ungedeutete und im Grunde unerfahrene Abneigung, die sie aus dem Gemeindehause mit in die Stadt gebracht hatte – es wäre ein Wunder gewesen in ihrer jungen Seele, wenn sie sich nicht schließlich heimlich gesehnt hätte, den zu finden, der so zurückhaltend und zärtlich »Großmutter« rief. So war es gekommen, daß sie eines Maiabends an die Stelle zurücklief, wo sie den Ruf hatte hören müssen, und daß im Schatten der alten Linde, die aus dem Direktorenpark über die Mauer und den Weg sich breitete, einer plötzlich heraustrat und sie festhielt. Sie war furchtbar erschrocken. Es ging ein Schrei aus ihr aus. Aber sie war stehengeblieben, weil sie gleich sehen konnte an den Schultern, die fast den Kopf hielten, daß es wieder nur der junge, schmächtige Mensch war, der dort heimlich gewartet hatte. »Scheer' dich«, sagte sie hart. »Rühr mich ni a.«
Der Huckige wagte auch nicht, sie festzuhalten, aber er war froh, daß er sie einmal allein vor sich sah.
»Warum biste denn a su?« sagte er nur ganz entschlußlos.
»Wie bin ich denn?« sagte sie – »was willste denn vo mir?«
»Nu Jeses,« sagte er, »ich will weiter nischt, du brauchst doch nee asu verächtlich zu tun.«
»Grade – ich tu ni a su – ich bin's.«
»Ich wiß gar ni, was hot denn das fir'n Zweck?«
»Zweck hot's nee« – lachte sie höhnisch, wie sie einst zur Mutter lachte.
»Wenn ich dir gutt bin, kannst du doch mit mir gihn«, sagte er, immer noch eingeschüchtert. Oh, sie war streng und hell wie eine klare Glocke.
»Ich geh ni mit jedem, an sulche bin ich nee. Heute und morne. Verstihste? Und wenn de mir noch amol an sulchen Schreckschuß eijagst«, sagte sie zögernd und sah, daß er fast verlegen niedersah – lachte auf einmal über die demütige Gebärde hell auf, und indem sie zurückgewandt wieder weiterzugehen versuchte, » n Zweck Hot's ni – gar keenen – ich bin a su –.« Aber weil er entschlossen bat und gütig und ohne Verlangen sagte:
»Nee, bleib ock – an Augenblick wenigstens – sei a su freundlich!« Da kam es ihr wie ein ganz warmer Hauch vor, der aus dem zarten, bartflaumigen Mannesgesicht ausströmte. Sie dachte gar nicht, daß das es wäre, worum sie stolz und hart sein wollte, und sie verstand auch gar nicht, was in ihr vorging – sie hatte auf einmal ihr Kaffeetöpfchen fester ergriffen und sich umgesehen, ob jemand in der Nähe wäre und war davongerannt –, ängstlich und scheu und unsicher und doch mit einem Glück, was ihr warm in den Gliedern rann.
Jetzt begann ein eigentümliches und neues Leben in ihr. Sie raffte sich. Sie sah nun alles, als hätte jemand ihr die Welt klarer gemacht. Sie ging auch noch eifriger in die Arbeit, versuchte Überstunden zu machen, daß sie reichlicher noch verdiente. Sie hielt auf sich. Die enge Jacke und den kurzen Rock hatte sie bald für ihre Geschwister nach Haus gegeben und kleidete sich wie eine Erwachsene, nur sauberer und frischer wie die andern. Ihr Haar legte sie in Zöpfe, reichlich wie es war und goldig, und in ihren Augen glänzte ein heimliches Aufmerken, wie auf etwas Frohes, was kommen konnte. Dabei schritt sie einher, ohne groß um sich zu blicken. Sie empfand es plötzlich fast wie einen Ekel: das Feile, das die andern jungen Mädchen und gar die alten darunter hatten, wenn sie aus dem Tore sich auf die Straße drängten und jedem Gutgekleideten nachblickten und nachlachten. Sie ging immer, als hätte sie ihr Ziel anderwärts. Nur sah sie alles doch um sich. Und alles empfand sie fein oder grob – daß es sie anzog, oder abstieß, bestimmter und klarer als je –, und sie hatte ganz das Gefühl verloren, auf der Hut zu sein. Als wenn sie jetzt ganz sicher wäre. So kam sie und ging sie. Und saß daheim. Und nähte und wusch, und wenn sie jetzt nach Hause schrieb, man konnte es fast nicht glauben, was da in die kalte, rauchige Stube für ein heller Schein aus einer jungen Seele sich wie eine weiße Taube niederließ: »Innig geliebte Mutter – oh – nun verdiene ich viel – und ich kleide mich gut – und die Menschen in der Stadt, Du kannst gar nicht denken, wie anständig die Menschen hier leben und gehen – und ich bin ganz sauber und anständig und halte wirklich darauf, daß ich Euch, geliebte Eltern, keine Schande mache« – usw. So klang es. Die Seele war voll jungen Lebens, die solche Worte sorgfältig auf einen schönen Bogen schrieb, einen extra schönen mit einer roten Blume, als wollte sie zum Geburtstage grüßen, oder sonst eine Feststimmung zum Auedruck bringen, wie sie in Unterrock und Hemd auf dem Schube hockte am Fensterschlitz. Und es war auch wieder Sonnabend, am frühen Nachmittag. Fast störte es sie, daß die narbigen Mädchen im Zimmer waren. Das Gefühl war ihr bisher noch fremd gewesen. Aber es begann sie zögern zu machen, daß die alten Dirnen sie ansahen, wenn sie, die Junge, Rosige, nackt am Waschfaß stand. Und sie begann zu horchen, ob sie daheim blieben. Sie war in Hemd und Rock sitzengeblieben und machte sich immer noch eine Beschäftigung. Sie zögerte. Es war in sie gekommen, wie ein plötzliches Aufblitzen, daß sie sich vor sich und andern verhüllen wollte, es war ein ganz unbekanntes, hohes Gefühl. Es erschien ihr zuwider, die Augen, die sie ansehen wollten und ihr junges Fleisch wohl gar berührten. Heimlich und tastend versuchte sie, ihre Zeit hinzudehnen. Und erst wie sie hinaus waren, wusch und kleidete sie sich rein und sah sich nicht an, als wenn sie selbst sich nicht feil wäre – und dachte nur an etwas, als wenn es am Horizont sich in Golde und Glanz nahte.
Und dann, am anderen Tage, stand sie fein und sauber im groben, guten, grünen Wollenkleid und hatte einen Hut mit Blumen und wußte nicht: – Sonntag – sie wollte ins Freie. Sie dachte an die Berge, wo die Menschen Sonntags auch in hellen Scharen kamen. Es war Sommer, und sie wußte auch, daß sie irgendwo hingehen mußte, wenn er nun wieder bittend auf sie lauern und sie erschrecken wollte. »Komm in de Hallen«, hatte er das erstemal gesagt. Die narbige Dunkle kam auch wieder und sagte: »Liebling, komm in die Hallen.« Es störte sie nicht, daß auch die Alte es zu ihr sagte, weil sie nur das Wort hörte und ganz sicher war. So kam sie mit ihnen. Der weite Tanzboden war voll Staub – alles wirbelte – es war ein Getümmel. Am Eingange standen Männer mit Bierseideln in der Hand, die Hüte in den Nacken geschoben. Junge Mädels saßen auf Bänken an der Saalmauer und warteten auf ihre Tänzer, lachten und hatten Biergläser neben sich. Und auch alte Frauenzimmer, mit ekeln Patronen am Arm, schlenderten heraus in den Garten. Die Freundinnen Mathildes hatten gleich einige gefunden, die mit ihnen anstießen – und es kam einer, der auch sie zum Tanze einlud –, einer, der nicht mehr nüchtern war und den sie nur ganz erschrocken ansah, und aus Angst und Eile auch schon in seinem Arme durch den Saal fegte. Und wie sie tanzte, drehte sich alles. Es ging. Sie hatte noch nie getanzt. Aber der Kerl hielt sie fest umschlungen, und es ging ganz außer maßen – sie mußte staunen und sich umsehen. Und wie sie blickte, erkannte sie den Kleinen mit der zarten Haut, der den Blick nicht von ihr wandte. Das hätte sie beinahe außer Ordnung gebracht, und sie war fast verwirrt, wie der Angetrunkene sie endlich losließ, und sie auf ihren Platz fiel, daß er prahlerisch lachte, ehe er sich mit einem Ruck wieder dem Saale zuwandte. Und nun blieb sie an derselben Stelle lange stehen und wagte keinen Blick. Und wieder kam eine Angst über sie. Sie war einige Male drauf und dran, wie unter der Linde, fortzulaufen, aber sie war auch gebannt und wagte nicht. Bis sie fast verstohlen sich hinausdrückte. Es war dunkel im Garten – das Getöse des Saales mit seinem Schein verlor sich im Schatten unter den alten Kastanien, unter denen Tische standen. Sie wollte jetzt doch heimgehen. Da trat wieder etwas aus dem Schatten zu ihr. Sie wäre in der Tat fast ohnmächtig geworden, so schwanden ihr in dem Augenblick die Sinne.
»Mich magst de nee – und mit an sulchen Kerle tanzt de«, sagte eine Stimme zornig. Sie war in solcher Glut, daß ihr zu heiß wurde vor Scham, und fand nicht ein Wort zu erwidern. Es war in einer Partie des Gartens, die am Wasser lag. Eine Grasbank stand da, sie sah zur Erde. Und dann in die im Sternenlicht vorbeischießenden Wellen und seine Hand suchte die ihrige.
»Nee – nee,« sagte sie ganz weich und schüchtern, »wenn ich nu eemol doch heem muß – luß mich – luß mich ock – a andermol – ich kann ja a andermol – meinetwegen will ich au ni so sein, wenn de gut zu mir bist.« Und sie dehnte sich langsam und unentschlossen und blieb doch feststehen, ihre Finger mit dem gesenkten Blicke zählend und hatte in der gänzlichen Verwirrung sogar auf die Grasbank sich niedergelassen. Bis dann zum ersten Male in ihrem Leben an ihr Ohr kam, was ein sehnsüchtiger, huckiger Verliebter in die Sterne und in die rauschenden Wasser, die in der Nacht blinkten und plauderten, heimlich mit fieberglänzenden Augen flüsternd und zitternd redete.
5
Wie Skrupel erwachen
Mathilde hatte die halbe Nacht mit Saleck zugebracht. Nicht viel sprechend, nur daß er, der ärmlich und kränklich war, und der unter seinen Kameraden in der Fabrik nichts galt, wenn sie schrien und tranken, nur dann und wann, wenn es hieß, ein besonnenes Wort mit sorglicher Stimme hinzuzutun – um Mathilde seinen langen Arm gelegt –, und so gewissermaßen Besitz genommen – und sie, verlegen über die Güte, und das Glück, das aus seinen zärtlichen und schmächtigen Mienen leuchtete, es ruhig und wortlos hingenommen. Sie war nicht gewöhnt, wenn jemand zwecklos gab, nur um Freude zu machen. Noch weit weniger jene stille Hingabe, die jetzt aus dem fremden Manne kam, und gar nichts wollte, als sie zärtlich berühren, und sie ließ den kränklichen Menschen gewähren, selbst in Scheu und Scham vor allem und wortlos, und wohl auch in sich hineinsinnend, und in die Sterne den Blick spinnend – oder auch auf seine Hände, die mit den ihrigen spielten, Finger um Finger besehend von der schwieligen, jungen Arbeitshand, niederblickend und verlegen lachend, wie als wenn sie fortfliegen und nicht bleiben könnte, so innerlich verwundert und unbegreiflich war ihr alles im Lichte der Sommernacht vorgekommen. Und was Saleck geredet, war klug und sinnig. Das war nun klar. Einer, wie die Gesunden, die roh wurden, und die lüstern und laut einherstürmten, war er nicht. Er gefiel ihr – so dürftig sein Ansehen, so sehr sein Kopf auch in den Schultern saß, so feucht und fiebrig seine Hände schienen, heiß und kränklich –, seine Augen sprachen so lebendig und froh und hatten sich in Mathildes helle, frische, steinige Blicke so fragend eingebohrt, daß sie nicht anders als nur schweigend und still und in Scham und Sinnen und in kaum geahnter, stummer Erwiderung seine Hingabe angenommen. Sie war spät durch die Straßen gegangen. Daß er sie begleitete, als sie aus dem Schatten der Promenadenbäume heraustraten, wollte sie nicht. Es war ihr ganz plötzlich eingefallen, daß sie nach Hause müßte.
»Nee – ich muß heem – nu muß ich – nu muß ich.« Und sie hatte sich aus seinen Armen schnell gelöst, daß die heiße Stelle, wo seine Hand um ihre Brust gelegen, nun ganz kühl wurde und sie das Tuch fester um sich zog.
»Und du bleibst«, sagte sie bestimmt. Es war wie ein Erwachen. Die Welt kam ihr wieder vor die Augen. Der Traum, in dem sie geschwommen war im stillen Sinnen und Erstaunen – nun wich er. Sie zog das Tuch fester und richtete sich auf. Saleck sah sie im Hellen stehen und fand kein Wort. Sie hatte ihn fast unsanft geweckt. »Du bleibst – ich geh nu heem.«
»Wenn sehn mir ins denn,« sagte er, »warum gihst de denn?«
»Oh,« sagte sie zögernd, »ei der Wuche kumm ich nee.«
»Warum sull ich dich denn ni bis zum Hause führen?«
»Ich will ni«, und der kleine Schmächtige hielt sie zurück.
»Nee, nee – ich will ni – 'S braucht's kees wissen –.«
»Mädel,« sagte er, »asu willste fort?« und er nahm und hielt sie am Handgelenk fest, und dann küßte er ihre Hand zärtlich, wie ein feiner Liebhaber, und plötzlich so inbrünstig, daß er ihr wehe tat. Sie machte sich los und begann eilig zu laufen.
»Uf de Mittwuch«, rief er, ihr nacheilend – und erwartete eine Antwort. Aber Mathilde war von fernen Schritten wie aufgeschreckt und war nicht zu halten, war längst um die Straßenecke und in das kleine Nebengäßchen eingebogen, in das ein altes Gitterfenster eines Fleischerladens wie ein Erker hineinragte, und vor dem eine scheckige Katze saß und heimlich über die Straße verschwand. Und Mathilde war nun in Unruhe. Wie sie in ihr Haus eintrat, fand sie es offen und im Hausflur tastete der Schlosser, der betrunken war und Unverständliches lallte, dreist nach ihr langte, wie sie in Angst an ihm vorbeistob in ihr Seitentreppchen, und dann höhnisch ihr nachrief: »Aha, aha, hust dr au a Vergnigen gemacht, Mädel, bist au eene vu da Wilden! Hahaha.« Mathilde schnitt es wie mit Messern. Sie war fast zu Tod erschrocken und in ihrer Angst hatte sie die Türe wie toll aufgerissen, daß jetzt die eine Narbige, die Dunkle, sich im Bette aufrichtete – die andere war noch nicht heimgekommen – und ganz erschrocken und verstört, als wenn sie ein Unheil sähe, in den Mondschein starrte, der um die Tür lag, wie Mathilde in plötzlicher Angst, und als wenn ihr ein Böser folgte, die Tür ins Schloß riß und von innen verriegelte.
»Oh«, sagte und stöhnte die Böhmische schlaftrunken. »Was? – wer? – wer ist denn? – Himmel – sag doch –«