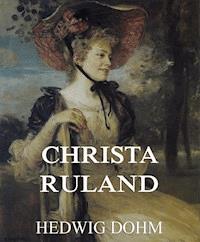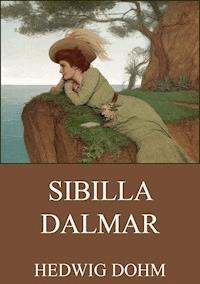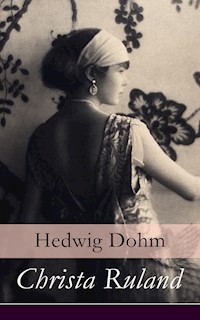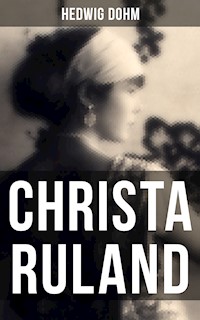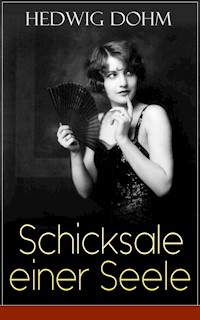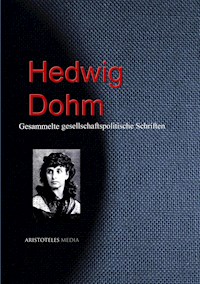Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In 'Schicksale einer Seele' von Hedwig Dohm taucht der Leser tief in das Leben einer Frau des 19. Jahrhunderts ein, die die Herausforderungen und Restriktionen der damaligen Zeit aufdeckt. Mit einem einfühlsamen und gleichzeitig provokanten literarischen Stil enthüllt Dohm die inneren Kämpfe und Sehnsüchte der Hauptfigur, während sie gegen gesellschaftliche Normen rebelliert. Ihr Werk stellt einen wichtigen Beitrag zur feministischen Literaturgeschichte dar und bietet einen einzigartigen Einblick in die psychologischen und soziologischen Dimensionen der Emanzipation. Hedwig Dohms Roman ist eine eindringliche Darstellung des Kampfes einer Frau für Selbstbestimmung und Freiheit in einer von Männerdominanz geprägten Welt. Hedwig Dohm selbst war eine avantgardistische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, die bekannt war für ihre radikalen Ansichten und ihr Engagement für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Als politisch aktive Feministin fand sie in der Literatur eine Plattform, um die Unterdrückung der Frauen anzuprangern und dazu aufzurufen, für ihre Rechte zu kämpfen. 'Schicksale einer Seele' spiegelt ihre persönlichen Überzeugungen und ihren unermüdlichen Einsatz für Frauenrechte wider, was das Werk zu einem wichtigen Manifest des frühen Feminismus macht. Dieses Buch ist ein absolutes Muss für Leser, die sich für die Geschichte der Emanzipation und die Entwicklung der feministischen Literatur interessieren. Mit einem fesselnden Erzählstil und einer tiefgreifenden Analyse der sozialen Strukturen seiner Zeit regt 'Schicksale einer Seele' zum Nachdenken an und ermutigt die Leser, über die Bedeutung von Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung nachzudenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schicksale einer Seele von Hedwig Dohm
Inhaltsverzeichnis
Schicksale einer Seele
Monatelang nun ohne Dich geliebtester Freund! Freund! Das Wort klingt fast hart, deckt sich nicht mit dem Begriff. Starkes und Zartes, eine ganze Milchstraße von Sternen ist in dem Begriff. Freundschaft! Labsal ohne Schaum und Bodensatz. Alles ist Inhalt.
Zuerst war ich betrübt, daß ich Dir so ewig lange nicht schreiben sollte; die gelegentlichen postlagernden Briefchen und Karten in die Ferne hinaus, von Ort zu Ort, in denen nichts intimes stehen durfte, zählen ja nicht. Nun habe ich das Betrübtsein überwunden, da Du ja die Olympierfahrt nach Griechenland – und gewiß gehts bis nach Indien – als ein so großes Glück empfindest, lieber, lieber Idealist Du! Eine Tempelfahrt zu heiligen Gräbern! Da dürften nur Gebete Dich begleiten. Sie sollen's auch. Aber nicht wahr, die leise Wehmuth in mir, die Dir nachzieht von Ort zu Ort, weil ich nicht mit Dir ziehen konnte, begreifst Du?
Wegen meines Katarrhs brauchst Du nicht ängstlich zu sein. Die liebe Julie und die gute Philomele, die pflegen mich und sorgen sich um das bischen Husten, als ob er lebensgefährlich wäre. Ein wenig greift er mich wohl an, nicht allzu sehr. Ich bin oft müde, eine angenehme Müdigkeit, in der das Dasein mich wie milde Luft umfließt, lind, einschläfernd.
Die Müdigkeit wird mich nicht hindern, mein Versprechen zu halten. Ich werde fleißig sein müssen, sehr fleißig, hurtig, hurtig schreiben! Drei Monate nur um meine ganze Lebensgeschichte zu Papier zu bringen!
Recht schlicht und einfach soll ich erzählen, wie Du es liebst. Versuchen will ich's; und laufen mir zu viel Bilder in die Feder, so streiche ich sie wieder aus.
Ich weiß wohl, Du hast mir die Aufgabe gestellt, damit ich vor lauter Beschäftigung nicht Zeit haben soll, melancholisch zu werden.
Auch darin hast du gewiß recht: das fehlte unserer Intimität, daß Du meine Vergangenheit so wenig kennst. Würdest Du nur nach allem gefragt haben, ich hätte schon geantwortet, aber wir zwei Beide sind wirklich etwas zu diskret, zimperlich diskret.
Und jetzt meintest Du, wäre der geeignetste Zeitpunkt für mich rückwärts zu schauen, da ich an einem Wendepunkt meines Lebens stände.
Ja, ein Wendepunkt, das hoffe ich. Alles alles muß sich nun wenden.
Es wird mir nicht leicht werden dir mein treues Selbstportrait zu zeichnen. Der Kontrast zwischen dem was ich war und wie ich geworden bin, ist zu groß: zwei Seelen, die kaum noch eine leichte Familienähnlichkeit miteinander haben. Ich kann mich nicht zurück denken zu der unschuldigen, mit etwas Romantik versetzten Naivetät meiner jungen Jahre. Du mußt mir nun schon glauben, was ich von mir berichten werde, auch wenn sich meine Worte von heute mit der Marlene, die ich einst war, nicht decken.
Als wir uns kennen lernten, fandest Du ja auch noch so vieles in mir, daß Du Dir nicht zusammen reimen konntest. Wenn Du zu Ende gelesen haben wirst, was ich hier schreibe, wirst Du es begreifen wie ich so verblödet, so jeder Individualität bar, so charakterlos und feig und geduckt werden konnte, und dabei so frechen Geistes, so schwer in meinem Denken und Fühlen zu beeinflussen, so ganz mein inneres Leben für mich lebend, selbständig und allein.
Ich komme mir selber oft wie eine Schnecke mit Flügeln vor. Sie nützen mir nichts – die Flügel, das Schneckenhaus ist zu schwer.
Habe ich eigentlich viel zu erzählen? Ich werde mir den Kopf zerbrechen müssen um aus der Tiefe meines Gedächtnisses herauszufischen, was etwa auf dem Grunde ruht, schwerlich Perlen – oder doch vielleicht Perlen, wenn es wahr ist, daß sie ein krankhaftes Produkt gesunder Muscheln sind. Bin ich krankhaft? weiß ich denn so recht wie und wer ich bin? Vielleicht, wenn ich all meine Erinnerungen nieder geschrieben habe, weißt Du es und Du sagst es mir dann wieder.
Tagelang, wochenlang soll ich mich nun mit mir beschäftigen, immerzu ich – ich! Müßte nicht Feinergearteten eine Art pudeur – mir fehlt im Augenblick das deutsche Wort – überkommen so die Seelenhüllen abzustreifen? Zu Hause in Berlin hätte ich's gewiß nicht gekonnt, hier aber, wo die Sonne in jeden Winkel hineinstrahlt und in ihrem Licht marmorne Götter ihre stolze keusche Nacktheit baden, geht es eher. Und wenn schon denn schon. Ich werde selbst vor Eigenlob nicht zurückschrecken, wenn ich auch nicht annähernd so brav bin wie Du es von mir denkst.
Anfangen! anfangen! Ja, gleich. Am Ende wird mein Geschreibsel eine förmliche, Antobiographie werden. Du hast's gewollt. Ganz am Schnürchen will ich erzählen und mit dem Anfang anfangen.
Wir schreiben jetzt 66. Ich bin 33 Jahre alt. Rechne aus, wann ich geboren bin. Daß es zu Berlin war weißt Du. Daß mein Vater Inhaber einer Kattunfabrik ist, daß ich unter acht Geschwistern das älteste Mädchen war, weißt Du auch.
Ich erzählte Dir einmal von meinen Geschwistern, erinnerst Du Dich? Du sagtest schmeichlerisch: ein Schwan im Ententeich. Ach Du Lieber, eher ein Kukuksei, das im fremden Nest ausgebrütet wurde.
Ich bin mit einem rothen Mal auf der Stirn geboren, ob ein stern- oder kreuzartiges, darüber sind die Gelehrten nicht einig. Es entstellt mich nicht, weil es nur sichtbar wird, wenn ich sehr erhitzt bin. Wahrscheinlich hast Du es nie bemerkt.
Wie ich zu dem Namen Marlene komme, da doch meine Geschwister alle so hausbackene Namen haben? Eins meiner Brüderchen erzählte der Mama eines Tages das Märchen vom Marlenechen. Und er soll es so drollig erzählt haben, daß meine Mutter Thränen lachte, und fast unter diesen Lachthränen kam ich zur Welt. Zum Andenken an diese wunderbare Begebenheit wurde ich Marlene getauft.
Bis zu meinem sechsten Jahr wohnten wir so gut wie auf dem Lande, in einer feldartigen, abgelegenen Straße, der Hirschelstraße, die nur aus kleinen, weit auseinanderliegenden Gärtnerhäuschen bestand. Jetzt ist sie stattlich bebaut.
Alle diese Häuschen hatten große, primitive Gärten, an die sich weite Wiesen schlossen. Die Wiesen wurden durch einen lang sich hinschlängelnden Bach begrenzt, der für uns Kinder die Grenze der Welt bedeutete. Er hieß der Schafgraben. Eine Fülle von Vergißmeinnicht blühte an seinem Rand, und allerhand Bäume, hauptsächlich Pappeln und Weiden umsäumten ihn.
Meine Eltern waren auf das Gärtnerhäuschen verfallen der vielen Kinder wegen, die sich da tüchtig tummeln konnten. Das Reisen mit Kindern war damals noch nicht üblich.
Meine ersten Kinderjahre haben nicht viel Spuren in meinem Gedächtnis hinterlassen. Nur hier und da, wenn ich nachsinne, tauchen vage Lichter aus dem Nebel auf, kleine Erlebnisse, die besonders stark auf mein Gemüth gewirkt haben müssen.
Ich erinnere mich nicht der Zimmer, die wir bewohnten, nicht wie meine Eltern, meine Geschwister aussahen, ich weiß nichts von all den Menschen, die in meinen Gesichtskreis traten.
Ich muß ein sehr furchtsames, feiges, kleines Geschöpf gewesen sein (eigentlich bin ich es ja heute noch). Meine ersten Erinnerungen hängen mit Angst und Furcht zusammen. Ein Kettenhund auf dem Hof, der schwarze Nero, eine Frau in einem Laden, bei der das Dienstmädchen, das mich an der Hand führte, einkaufte, und die mir meine schwarzen Kohlen von Augen aus dem Kopfe schneiden wollte, und – meine Mutter! ich fürchtete mich vor meiner Mutter. So lange ich zurück denken kann, lag diese Furcht wie ein Alpdruck auf meiner Brust.
In diese Schatten fiel aber auch Licht, romantisch angehauchtes. »Das rothe Glas – Meerfahrten – die Königbouquets – der Schafgraben« wären passende Titel für diese Lichtstrahlen.
Damals kam noch in Zwischenräumen von 4 bis 6 Wochen der Lumpenmatz auf die Höfe, der für ein paar Pfennige (auch für die Gegenleistung von Lumpen) allerhand Kram und Trödel an Dienstmädchen und Kinder verkaufte: Ringe, Perlenschnüre, Tüchelchen und ähnliche Kostbarkeiten. Unser Kindermädchen hatte mir vom Lumpenmatz ein Stück rothes Glas gekauft. Eine Zauberwelt erschloß es mir. Stundenlang konnte ich auf der Wiese unter einem Baum liegen – merkwürdiger Weise habe ich behalten, daß es ein Quittenbaum war – und durch das rothe Glas hinausschauen in die Welt – eine glühende, brennende Märchenwelt von unerhörter Pracht. Selbst die Mistbeete, den Kettenhund, den schmutzigen Erdboden an regnerischen Tagen verwandelte das Glas in flammende Visionen.
Rief man mich zu Tisch oder zum Vespern, so riß ich mich ungern von meiner Schwelgerei los, und mag dann wohl blöde und verwirrt drein geschaut haben, und ich glaube schon damals entstand die Mythe (es ist doch eine Mythe – nicht?) von meiner Dummheit, eine Meinung, die meine Familie wahrscheinlich bis auf den heutigen Tag festgehalten hat. Und nicht nur meine Familie – – aber ich wollte ja am Schnürchen erzählen.
Ich hütete meinen rothen Schatz wie ein köstliches Geheimniß, besonders vor den Geschwistern. Eines Tages war meine Mutter böse und schalt mich, ich weiß nicht mehr weßhalb. Ich konnte der Lust nicht widerstehen sie durch das rothe Glas anzuschauen, das doch alles so wunderbar verschönte. Die Mutter, die natürlich nicht wußte, daß es ein Zauberglas war, schlug es mir aus der Hand. Es zerbrach. Meine vermeintliche Frechheit wurde fürchterlich mit der Ruthe gerochen. Um mein zerrißenes kleines Herz kümmerte sich niemand.
Im Frühjahr waren häufig die Wiesen hinter unserm Häuschen überschwemmt. Da hatte nun mein älterer Bruder sich etwas herrliches ausgedacht.
Mit aller Anstrengung, deren wir fähig waren, schleppten wir Kinder ein großes Waschfaß auf die überschwemmten Wiesen: das war der Kahn, ein paar Wäschestützen dienten als Ruder, und die Meerfahrt begann. Weit wie das Weltmeer erschienen mir die überschwemmten Wiesen, eine Fülle von Kuhblumen blühten daraus empor. Ich pflückte davon, und warf sie dann wieder in's Wasser zurück, damit wir den Rückweg fänden: eine Reminiscenz aus dem Märchen vom Däumling. Ich kannte schon viele Märchen im sechsten Jahr. Columbus kann bei der Entdeckung von Amerika nicht mehr Entzücken empfunden haben, als wir es bei der Landung an einem benachbarten Grundstück empfanden. Kinder die wir kannten, standen da an der Hecke, und halfen uns beim Landen. Meine Brüder brachten den Kindern Gastgeschenke mit: Schachteln mit Maikäfern. Und dazu sangen sie den populären Vers: »Maikäfer fliege, dein Vater ist im Kriege, deine Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer fliege!«
So oft ich später diese sinnlosen Verse hörte, zog durch mein Gemüth ein wehmüthiges Singen und Klingen von einem verlornen Idyll, eine Sehnsucht nach Kuhblumen und Wiesen, nach Frühlingswinden und Abenteuern in die Ferne hinaus. Vor den Maikäfern aber fürchtete ich mich. Wie meine Brüder das merkten verfolgten sie mich mit den Thieren, setzten sie mir auf die Arme, in den Nacken und amüsirten sich königlich über mein Schreien. Fürchterlich waren mir diese krabbligen, klebrigen, kleinen Käferpfötchen. Auch meine Brüder kamen mir ziemlich gräßlich und gefährlich vor, nur dazu da, mich zu quälen und zum weinen zu bringen; und hatten sie es erreicht, so trimuphirten sie: »Die Pippe plinzt schon wieder.« Von ihnen stammt wohl diese Verunglimpfung meines Namens. Marlene war zu lang, man kürzte mich in Pippe ab.
Unsere Kahnfahrten wiederholten sich öfter, bis man bei der nächsten großen Wäsche das Waschfaß vermißte, und mit Ach und Krach und Prügeln wurde den Meerfahrten ein Ziel gesetzt.
Im Herbst florirten die Königbouquets. Ich weiß nicht, ob diese Art von Bouquets eine Mode der Zeit oder ein Privateinfall unseres Gärtners waren. Er nahm Spargelstauden, die hoch in's Kraut geschossen waren, – oft überragten sie meine kleine Person – hier und da rupfte er von den zarten Stenglein das Grünzeug ab, spitzte die Stengel scharf zu, spießte Astern und Georginen daran, und stellte so farbenreiche, blühende Büsche her.
Für mich gab's nichts schöneres als diese Bouquets. Er sagte, sie wären für den König und verwelkten nie. Ich glaubte ihm auf's Wort. Ich hielt ihm das Körbchen, in das hinein er die Blumen sammelte, und durfte dann die blühenden Büsche bis an die Gartenthür tragen. Und von da blickte ich ihm nach mit scheuer Ehrfurcht, bis er meinen Blicken entschwand. Er ging ja zum König.
Und nun geschah das Wunderbare, daß der Gärtner mir zu meinem Geburtstag ein solches Königbouquet schenkte – wenn auch nur ein kleines Miniaturding, mit kleinen Asterchen und Georginchen besteckt. Meine große Seligkeit dauerte aber nur bis zum andern Tag. Da war die ganze Herrlichkeit verwelkt.
Ja, sagte er, als ich ihm mein Leid klagte, das käme daher, daß ich kein Prinzeßchen wäre. Kein Prinzeßchen sein! wie traurig! Aber ich wollte eins werden, ich nahm es mir fest vor. Wenn ich groß geworden, würde ich schon erfahren, wie man es macht um ein Prinzeßchen zu werden.
Wir Kinder liefen meist unbeaufsichtigt in Garten und Wiese umher; von einer Bonne oder einem Fräulein war keine Rede, das Kindermädchen hatte vollauf mit den ganz Kleinen zu thun.
Da geschah es einige Male, daß ich – was streng verboten war – über die Wiesen bis hin zum Schafgraben lief, in meiner Vorstellung eine unermeßlich weite Reise in ein fernes Märchenland; in Wirklichkeit mag die Entfernung von unserm Garten bis zum Schafgraben 15 Minuten betragen haben.
Vergißmeinnicht wollte ich dort pflücken, und wohl auch meinen älteren Brüdern imponiren, daß ich schon so weit in der Welt herumgekommen wäre. Und dann der Reiz des Verbotenen, Geheimnißvollen.
Das Kindermädchen hatte uns gerade das Mährchen vom blonden Egbert vorgelesen, vielleicht kam mir deßhalb an dem wildwüchsigen Ort alles so verzaubert vor, so gruslich schön. Einen kleinen Sperling, der herumhüpfte hielt ich geradezu für den Wundervogel, der im Märchen so lieblich von der Waldeinsamkeit singt, als ob Waldhorn und Schalmei ineinander spielten, der Wundervogel, der Eier legte von Gold und Edelstein. Edelstein dachte ich mir immer unter der Form der funkelnden Ringe, wie sie der Lumpenmatz verkaufte. Ich suchte in den Büschen nach den goldenen Eiern, bis allmählich das Unheimliche die Oberhand gewann, und ich der Waldeinsamkeit und den goldenen Eiern in rasendem Galopp entlief.
Ich glaube mich zu erinnern, daß die unkindlichsten, gar nicht für Kinder geschriebene Märchen, wie Elfriede und der blonde Egbert am stärksten auf mich wirkten. Ich hörte wohl auch die Grimmschen Volksmärchen mit Andacht vorlesen, aber sie gingen mir nicht nach, wie die Märchen in denen Stimmung vorherrschend war, wo eine geheimnißvolle Psyche, in nebelzarten Dämmerungen leise ihre Flügel regt und in endlose Fernen hinausträumt. – Herr Gott mit der Psyche in nebelzarten Dämmerungen habe ich gewiß schon die Grenze der Schlichtheit überschritten. Ich wills nicht wieder thun.
Als ich ungefähr sechs Jahre alt war, wurde unser Gärtnerhäuschen niedergerissen. Die Hirschelstraße sammt dem Schafgraben sollten der Kultur gewonnen werden.
Meine Eltern bezogen in der Nähe des Halle'schen Thores, in der Friedrichstraße eine geräumige Bel-Etage. In jener Zeit eine stille Gegend; hinter dem Halle'schen Thor war die Stadt zu Ende, und die weiten Wiesen und Sandflächen des Tempelhofer-Feldes, aus denen der Kreuzberg emporragte, erstreckten sich weit ins Land hinaus.
Ein Hauch feiner, patricischer Bürgerlichkeit ruhte auf dem Stadttheil, der mit Vorliebe von Gelehrten, Dichtern, Professoren und höheren Beamten aufgesucht wurde.
Berlin W. war im Entstehen. Es gab im Westen schon Häuser und Straßen. In einer Zeit aber, wo die Verkehrsmittel noch nicht einmal beim Omnibus angelangt waren, galt die Gegend für abgelegen.
Unser Haus hatte wie die meisten Häuser des Stadttheiles einen großen Garten. Kein Ziergarten. Ein paar Beete mit Levkoien, Nelken und Reseda, dazwischen etwas Petersilie, Salat, Himbeer- und Johannisbeersträucher, und für jeden Miether eine mit Gaisblatt berankte Laube. Nur der hintere Theil des Gartens mit starken, alten Nußbäumen und vielen Veilchen war schön. Er gehörte uns ganz allein, und schloß mit einem Gartenhaus, das aus einem ziemlich großen Saal bestand, ab.
Und hier, in dieser Bel-Etage der Friedrichstraße spielte sich seit meinem sechsten Jahr mein Leben bis zu meiner Verheirathung ab.
Von meinem 6.-9. Jahr ist beinah eine Lücke in meinem Gedächtniß. Alles versunken und vergessen. Selbst die ersten verängstigten Tage in der Schule schweben mir nur noch dunkel vor.
Unsere Wohnung, wie ich mich ihrer zuerst erinnere (später wurde sie eleganter) trug ganz den nüchternen Charakter der meisten Einrichtungen wohlhabender Bürgerfamilien jener Zeit. Eine gute Stube mit rothen Plüschmöbeln. An der Decke ein Glaskronenleuchter. An der Wand, zwischen den Fenstern, ein Trümeau in schwerem broncenen Rahmen, darunter eine Marmorconsole, auf der eine Vase mit künstlichen Blumen stand. Ein paar kleine Tische mit Marmorplatte und vergoldeten Füßen. Und das Prachtstück: eine Servante mit den Familienkostbarkeiten: Silberne Becher, die Pathengeschenke waren, ein halbes Dutzend große Tassen, innen ganz vergoldet, auf der Außenseite seine Miniaturmalerei: einen Napoleon, einen König von Preußen im Schmuck des Lorbeerkranzes, Schäferspiele in Watteau-Art. Eine christallene Zuckerschale, die auf einem silbernen Delphin ruhte, schön bemalte Tellerchen, interessante Gläser mit goldenen Sprüchen u.s.w.
Daß wir diese Herrlichkeiten immer nur durch die Glasthüren anschauen durften, gab ihnen in unsern Augen einen besonders vornehmen Charakter, und daß sie nur bei den, in unsrer Familie so häufigen Taufen in Gebrauch genommen wurden, stärkte unseren Glauben an die Heiligkeit der Taufhandlung.
Der Kronenleuchter und die Polstermöbel der guten Stube wurden Alltags durch Leinwandhüllen geschützt.
Gemüthlicher nahm sich das Wohnzimmer aus mit den tüchtigen bequemen Möbeln und einigen Erbstücken vom Großvater oder Urgroßvater her: ein paar dunkel gebeizte Eichenschränke mit rothseidenen Vorhängen hinter den Glasthürchen, eine altmodische Chiffonniere mit Meßingbeschlägen und einige wirklich werthvolle Kupferstiche.
Besonders Sontags hielt ich mich gern im Wohnzimmer auf, wenn der Papa mit den gestickten Pantoffeln, dem Schlafrock von grauem Flausch und dem leicht um den Hals geschlungenen Tuch von gelblicher Seide zwischen den großblumig gestickten Sophakissen behaglich da saß, rauchend und vor sich auf dem großen, runden Tisch die Kaffeemaschine, die so anheimelnd summte.
Ganz häßlich war unsere Kinder- und Arbeitsstube mit dem unaustilgbaren Geruch von rindsledernen Knabenstiefeln. Ein großer, mit Wachstuch überzogener Tisch strozte von Tintenklecksen. Ihr einziger Reiz war eine Reihe von Bildern, die die Geschichte Benjamin's darstellten. Oftmals kniete ich auf dem Sopha, über dem sie hingen, und vertiefte mich in diese Geschichten. Und ich war so böse auf Pharao, daß er dem holden, blondlockigen Benjamin einen Diebstahl zutraute, und immer von neuem so froh, als endlich auf dem letzten Bilde seine Unschuld siegte. Später verschwanden die Bilder, ich habe mich immer vergebens bemüht zu erfahren, wo sie hingekommen sind.
Meine vier Brüder waren derbe, wilde, gewöhnliche Jungen, die gelegentlich, wenn sie Schaden im Haushalt stifteten, abgeprügelt wurden, was immer die Mutter besorgte. Sonst bekümmerte man sich nicht um sie, weder um ihr Fortkommen in der Schule, noch um ihre sittliche Erziehung. Zwei von ihnen sind als Jünglinge gestorben, die beiden andern leben in subalternen Stellungen an kleinen Orten. Meine drei Schwestern sind sämmtlich gut verheirathet.
Ich hatte als Kind keine Fühlung mit meinen Geschwistern. Seitdem ich das elterliche Haus verlassen habe, sind sie mir völlig fremd geworden.
Ich glaube nicht, daß Geschwisterliebe ein Naturinstinkt ist; ich glaube vielmehr, daß sie erst in der gemüthvollen Atmosphäre des elterlichen Hauses großgezogen wird.
Eine solche Atmosphäre gab es in unserm Hause nicht. Es gab nur eine große, geräuschvolle Haushaltung mit verschiedenen Dienstboten, mit Gezänk und Gepolter, mit viel Küche, Kohl und Rüben, mit schreienden, kleinen Kindern, und immer Lärm. Alles war derb hausbacken, nüchtern, tüchtig.
Ich sehe die Mutter noch vor mir Morgens in der Nachtjacke, mit fliegenden Haubenbändern und rothem Gesicht durch das Haus rasen. Ich sehe sie mit aufgestreiften Aermeln einen Teig einrühren, ich sehe sie bei der Entdeckung von Staub in einem Winkel dem Dienstmädchen das corpus delicti zu Gemüth führen. Immer war sie hinter den Dienstmädchen her. Immer führte sie mit ihnen Krieg bis auf's Messer. Daß sie alle wie die Raben stahlen, war selbstredend. Es gehörte zu ihren Lebensgenüssen, die Auguste oder die Lina mit ihrem Cousin oder Landsmann auf der Hintertreppe, oder beim widerrechtlichen Schmieren ihrer Morgenschrippe zu ertappen. Und jedes Mal wenn ein Mädchen »um sich zu verändern« fortzog, frohlockte sie: Gott sei Dank, daß ich das Geschöpf los bin.
Und ich denke mit einem Schauer zurück, wie ich immer auf der Flucht war vor ihr, vor ihrem Klapsen, ihrem Schelten, ihrem rothen Gesicht, ihrer grellen Stimme. Mit Schaudern denke ich auch an die Waschtage zurück. Das ganze Haus wie mit Seifenschaum überschwemmt. Meiner Mutter Haubenbänder flogen noch mehr als sonst, ihr Gesicht war noch röther, ihre Laune noch kriegerischer. An den Tagen gab es immer miserables Essen, alles war für die Waschfrauen berechnet, die wie es schien, feines nicht vertragen können. Und alles roch: die riesigen Butterbröde mit Kuhkäse oder ordinärer Leberwurst, rochen, Mittags der Kohl, der Cichorien, der Kümmel rochen. Meine Mutter hatte eigens eine, wie sie behauptete sehr wohlschmeckende Waschfrauensuppe ersonnen. In eine Casserolle kochenden Wassers wurde eine kleine Quantität Zucker und Butter gethan, und eine größere Quantität in Scheiben geschnittener Semmeln, wohlgemerkt alter Semmeln, und die Suppe war fertig.
Als Musterhausfrau war meine Mutter natürlich auch über die Maßen sparsam. Jede alte Semmel schloß sie in ihr Herz und in ihre Speisekammer. Einen wahren Rester-Cultus trieb sie. Niemand verstand wie sie, die Wurst in so durchsichtig dünne Scheibchen zu schneiden, und in der schlauen Kunst aus Fettstückchen, Knorpel, Sehnen und Abfall scheinbar appetitliche Fleischportionen – für die Dienstboten – herzustellen, war sie unnachahmlich.
Sie stammte aus einer armen Familie, und blieb ganz kulturfremd. Gerade nur über Volksschulbildung verfügte sie. Das Schreiben ist ihr zeitlebens schwer geworden. Aber rasch und resolut war sie, und ihr Haus hielt sie in musterhafter Ordnung.
Außer an den Dienstboten ließ sie die ungeheure Lebhaftigkeit ihres Temperaments auch ein wenig an dem Vater aus.
Ich glaube, daß meine Mutter Nachmittags eine sehr hübsche Frau war. Sie selbst behauptete bildhübsch gewesen zu sein. Mein Vater bestätigte es. Erst zur Kaffeestunde gegen 4 Uhr machte sie Toilette. Nach damaliger Mode frisirte sie ihr röthlich lichtbraunes Haar über den Ohren in einer Fülle geringelter Löckchen. Im Sommer trug sie meist weißgestickte Kleider, im Winter seidene. Ich habe meine Mutter nie in Wolle gesehen.
Mit dem Negligée wechselte sie auch ihre Laune. Das Zanken und Poltern hörte auf. Und wenn sie im Garten bei der Kaffeemaschine mit einer Handarbeit saß, nahm es sich beinah gemüthlich aus, besonders wenn das Korbwägelchen mit einem Säugling neben ihr stand, und sie mit einer schönen klaren Stimme eines ihr Lieder sang, etwa: »Brüderlein sein, Brüderlein fein, ach es muß geschieden sein« oder »was braucht man dann mehr um glücklich zu sein« oder: »wir winden Dir den Jungfernkranz von veilchenblauer Seide«. Dann verlor sich auch meine Furcht einigermaßen, und ich wagte mich in ihre Nähe.
Meine Eltern führten eine durchaus glückliche Ehe. Nach damaliger Sitte nannten sie sich Mama und Papa. Der Vater liebte seine Frau, wie sie war. Nur wegen des Wirthschaftsgeldes, mit dem die Mutter nie auskam, entbrannte zuweilen ein Streit, das heißt meine Mutter stritt, mein Vater brämelte nur vor sich hin.
Er war ein stiller, furchtsamer Mann, leicht eingeschüchtert, gutmüthig fremden Menschen gegenüber, unbeholfen, ängstlich, eine Null im Hause, ganz von seiner Frau abhängig, gern abhängig. Ich erinnere mich nicht, daß er sich jemals gegen das Joch aufbäumte.
Er ging völlig in seiner Fabrik auf, deren Geschäfte er, ohne jede Spur von Produktivität mechanisch abwickelte. Er hatte die Fabrik schon von seinem Vater geerbt. Als 13jähriges Bürschchen hatte man ihn in das Comptoir gesteckt, ohne daß man ihn hätte etwas lernen lassen.
Und da ist er bis jetzt geblieben. Und er wird hundert Jahr alt werden, unbekümmert um die ganze Welt, die ihn absolut nichts angeht.
Um nicht ungerecht zu sein, will ich aber erwähnen, daß er in jungen Jahren künstlerische Anlagen verrieth. Er zeichnete Portraits. Das Portrait meiner Mutter als Braut, und sein eigenes als Bräutigam, seine letzten künstlerischen Thaten, beweisen ein nicht gewöhnliches Talent.
Er dichtete auch Knittelverse, zu Geburtstagen, Taufen u.s.w. und wenn er diese Gelegenheitsgedichte vorlas erglänzten seine freundlichen grauen Augen und seine sonst apathischen Züge belebten sich. Er sah dann aus als wäre er jemand. Sein edelgeschnittenes Gesicht unterstützte ihn dabei.
Auch meine Mutter hatte eine Eigenschaft, die mit ihrer sonst derbbürgerlichen Art sonderbar contrastirte. Das war ihr Sinn für Toilette. Dabei streifte sie alles Hausbackene ab; und ihre Toilettenpassion war nicht etwa auf geschmacklosen Putz gerichtet, im Gegentheil, auf raffinirte und originelle Eleganz. Alles was ihr etwa an Phantasie, an höheren Aspirationen innewohnte, kam in der Toilettenangelegenheit zum Ausdruck. Wir führten einen dürftigen Tisch. Diätfragen waren böhmische Dörfer für meine Mutter. Wenn man nur satt wurde. Sie sparte sich und den Kindern am Munde ab, was sie für Toiletten ausgab. Darum kam sie auch nie mit dem Wirthschaftsgeld aus. Sie hatte aber die Genugthuung, daß, wenn sie mit uns Mädchen im Thiergarten spazieren ging, alle Welt sich nach uns umschaute.
Der Vater meiner Mutter war ein Franzose gewesen; auf dem Durchmarsch nach Rußland hatte er sich mit der Großmutter trauen lassen. Er fand wohl auf den russischen Schneefeldern den Tod, denn sie hat nie wieder etwas von ihm gehört. Ich habe von der Großmutter nicht erfahren können, wer und was dieser Franzose eigentlich war. Vielleicht wars ein Marquis oder er trug wenigstens den Marschallstab im Tornister, und daher der Instinkt meiner Mutter für Vornehmheit der Erscheinung. Dazu paßten ihre aristokratisch schöngeformten, blendend weißen Hände und Füße.
Daß ihr der Sinn für Toilette angeboren war, ist sicher. Eine Anregung von irgend einer Seite her war ausgeschlossen. Meine Eltern lebten ganz abseits von dem was man Welt oder Gesellschaft nennt. Ihr ganzer Umgang bestand, so weit ich zurückdenken kann, aus drei Ehepaaren: einem Bauinspektor, dem Hausarzt und einem Polizeihauptmann mit ihren respektiven Gattinnen, einfache Leute, wenn auch an Bildung meinen Eltern überlegen.
Uebrigens, wer weiß, vielleicht wäre meine Mutter mit ihrem Temperament, ihrer Lust am Regieren, unter gänzlich andern Verhältnissen eine bemerkenswerthe Persönlichkeit geworden.
Da die Fabrik des Vaters ziemlich entfernt von der Privatwohnung lag, kam er Mittags nicht nach Hause. Bald nach acht Uhr Morgens ging er fort und erst zwischen 7–8 Uhr Abends kehrte er wieder heim. Nur des Sonntags gehörte er der Familie. War das Wetter gut, so führte er uns größere Kinder in eine Conditorei, und ein jedes von uns durfte ein Stück Apfelkuchen essen, eine Schwelgerei, auf die wir uns die ganze Woche freuten. Und dieser Apfelkuchen – ach Gott, es klingt so pietätlos, und ich muß doch dabei in mich hineinlachen – war das einzige Gemüthsband zwischen uns und dem Vater.
Und so ganz befriedigte mich der Apfelkuchen auch nicht. Gleich überbot ihn meine Phantasie. Ich hätte gar gern zwei gegessen, oder wenigstens den einen mit Schlagsahne. Herrlich, dachte ich müßte es sein, wenn man einmal so viel Apfelkuchen essen könnte als man wollte.
Mein Vater hat mich weder je gescholten, noch je gelobt, noch je geliebkost. Ohnehin schweigsam, sprach er mit seinen Kindern eigentlich niemals. Vielleicht wußte er nicht einmal wie wir aussahen. Von unserm innern Leben hat er sicher nicht die leiseste Ahnung gehabt, etwas davon zu erfahren, trug er kein Verlangen.
Vater und Mutter hatten für ihre Kinder nur Zärtlichkeit so lange sie klein waren. Ehe mein Vater in die Fabrik ging pflegte er mit den Kleinsten ein Viertelstündchen zu spielen, immer dieselben stereotypen Spiele, mit der Tabaksdose, die er von ihnen auf- und zuklappen ließ, mit der Taschenuhr, die vor ihren Oehrchen Tick! Tick! machen mußte. Höchstens brachte er es in seinen zärtlichsten Momenten bis zu einem »Kuckuck – Mummum«. Damit waren seine Vaterfreuden abgethan.
Wenn er Abends nach Hause kam schliefen die Kinder schon. Und das waren wohl seine gemüthlichsten Stunden, in dem bequemen Schlafrock, mit Pantoffeln, bei warmen Abendbrot, mit seiner hübschen, plaudersamen Frau.
Sobald die Kinder schulpflichtig wurden, waren sie für ihn nur Individuen, für die das Schulgeld pünktlich zu entrichten war, und deren ungeheurer Consum an Stiefeln und Schulbüchern ihn in Erstaunen setzte.
Kein Haushalt konnte regelmäßiger und korrekter geführt werden, als der unsrige. Alle sechs Wochen große Wäsche, alle acht Tage kleine Wäsche, und natürlich alles immer im Hause. Alle drei Monate großes Reinmachen, bei dem das ganze Haus auf den Kopf gestellt und die Kinder in allen Winkeln herumgestupst wurden.
Bis auf die Menüs erstreckte sich die Regelmäßigkeit. Montags gabs Jahr ein Jahr aus Bouletten (von den Resten des Sonntags) mit Milchreis, Donnerstags Erbsen mit Pökelfleisch, Sonnabends Brühkartoffeln, Sonntags aber, da ging es hoch her, da aß der Papa zu Hause; aber auch an diesen Sonntagen kehrten mit unverbrüchlicher Regelmäßigkeit dieselben Menüs wieder: Kalbsbraten, Plumppudding und Apfelmus, oder Rinderbraten, Bisquit-Pudding und Apfelmus. Nur ab und zu lief ein Huhn oder eine Gans mit unter.
Ich gehörte zu den Kindern, die sich nicht besonders viel aus dem Essen machen. Den Bisquitpudding aber, den liebte ich mit Passion. Und da konnte ich recht abgünstig auf den Teller meiner Schwester Alice sehen, die immer ein größeres Stück als ich bekam, und eins mit so schöner brauner Kruste.
Meine Eltern führten ganz das halb vegetative Dasein, wie es wohl von jeher, besonders in Zeiten politischer Stagnation, die Mehrzahl der Menschen geführt hat.
In eine solchen Periode fiel meine Jugend. Mir ist nachträglich, als wären die Leute damals alle schon ältlich geboren worden. Ein goldenes Zeitalter für Philister und Spießbürger. Charakteristisch dafür waren die gute Stube, das Weißbier, die langjährigen Verlobungen, selten unter zwei Jahren, die nüchterne, dürftige Tracht des weiblichen Geschlechts: lange Schneppentaillen, enge Aermel, kurz und glatt weggezogene Scheitel. Die Haustöchter nähten emsig in Wolle und Perlen, mit Vorliebe Tragbänder in Perlenstickerei für Papa, Bruder oder Bräutigam.
Es war die Zeit, wo an den Winterabenden die Mama's strickten, während die Papa's im Schlafrock und gestickten Pantoffeln die Vossische oder die Spener'sche Zeitung lasen, und wo im Sommer große Landparthieen auf gemeinschaftliche Kosten in großen Kremsern unternommen wurden, hin an Orte, wo es zuletzt immer durch tiefen Sand ging, und wo Familien Kaffee kochen können. Der Kuchen wurde dazu mitgebracht. Und an Ort und Stelle spielte dann die Jugend mit so viel Vehemenz Fanchonzeck, Blindekuh, Katz und Maus, pflückte Blumen, und die Verliebten gaben sich alle Mühe sich ein bischen im Walde zu verlaufen, aus welchem Dickicht sie dann durch Hornsignale zur Moral zurückgeblasen wurden. Und zum Abendessen gab es immer Aale und Gurkensalat.
Am schönsten war die Heimfahrt, wo man so grenzenlos traurige Lieder sang, am liebsten mit Ade! Ade! und dabei ruckte man so nah aneinander und schwärmte den Mond und die Sterne an.
Besonders geistreich und vornehm waren ja diese Lustbarkeiten nicht, aber anspruchslos, billig und jung, so jung.
Erst das Jahr 48 schlug eine Bresche in die Zäune dieser bequemen Weideplätze der Bourgeoisie.
Meine Eltern merkten auch davon kaum etwas.
Genau in den Geleisen, die ihnen die Verhältnisse und die herrschenden Anschauungen vorzeichneten, bewegten sie sich, von keines Gedankens Blässe angekränkelt, keine erobernde Lust im Gemüth, die von Seiten meiner Mutter über die Erwerbung eines Hausgeräths oder eines Kleides, von Seiten meines Vaters über die eines neuen Kattunmusters hinausgegangen wäre.
An den Tod nicht denkend, kaum an ihn glaubend, immer gesund, waren sie der Ansicht, daß auch innerhalb des Hauses alles von selbst fein gerade gehen müsse.
Und es ging auch nicht allzuschlecht. In Betreff der Kinder kannten sie keine Vorsorge für die Zukunft, keine Aengstlichkeit für die Gegenwart, keine Verantwortlichkeit für ihre geistige und moralische Erziehung.
So viel Lärm und Arbeit es auch in unserm Hause gab, es war nur Gekräusel auf der Oberfläche.
In der Tiefe – Stille, Unbewegtheit. Meine Eltern – soll ich sagen die Glücklichen? – kannten eines nicht, den Schmerz. Selbst der Tod eines Kindchens, das bald nach seiner Geburt starb, rief keine bemerkenswerthe Erregung hervor. Ich war neugierig ob die Mutter weinen würde. Nein, sie weinte nicht. Ich versuchte aus dem Vorfall ein Gedicht zu machen: »Die Mutter die nicht weinen kann.« Inhalt: das todte Kind, das (umgekehrt wie im Märchen von dem Thränenkrüglein) im Grabe nicht eher Ruhe findet, als bis die Mutter seinen Hügel mit Thränen begießt.
Wessen Erbe war ich denn? – Vielleicht des Großvaters? Der soll etwas besonderes gewesen sein. Im Wohnzimmer hing ein feines Pastellbildchen von ihm, ein wundervoller alter Kopf, mit vollem weißen Haar und feurigen, schwarzen, geistsprühenden Augen. Die Pastellbilder sind aber so verlogen, sie idealisiren so sträflich. Ich war wohl schon acht Jahr, als er starb, er hat aber nie den Fuß über unsere Schwelle gesetzt, weil er dem Sohn wegen seiner Heirath mit meiner Mutter zürnte.
Fehlte in unserer Familie das tiefere Gemüthsleben, so gab es aber auch keine Heuchelei, keine Lüge, keine Masken. Meine Mutter handelte ganz impulsiv und redete, wie ihr der Schnabel gewachsen war. Mein Vater konnte die Fabrik, die er blühend übernommen hatte nicht heben, weil er es nicht über sich gewann, günstige Conjekturen benutzend, Waaren auf Credit zu nehmen.
Wir Kinder hatten von der Wesensart unserer Eltern den Vortheil, daß bei unserer Erziehung (eigentlich Nichterziehung) jede Dressur fehlte. Auch den Vortheil, daß wir uns körperlich abhärteten.
Winter und Sommer gingen wir mit denselben Fähnchen und Röckchen, wir Mädchen kurzärmlich, den Hals frei. Ob wir mit nassen Füßen durch Schnee und Regen patschten, oder uns von der Sonne braten ließen, niemand fragte darnach. War auch nicht nöthig. Wir verdankten unsern kerngesunden Eltern ein unschätzbares Gut: den widerstandsfähigen Körper.
Warum meine Brüder nichts lernten, weiß ich nicht. Sie besuchten gute Gymnasien oder Realschulen. Der Begabteste kam glücklich bis Tertia.
Warum wir Mädchen nichts lernten, weiß ich. Es wurde eben in den damaligen Mädchenschulen kaum etwas gelehrt, was über die Elementarkenntnisse hinaus ging.
Die Knaben hatten es gut. Sie turnten, sie exercirten. Sie durften sich auf Straßen und Plätzen in Freiheit tummeln. Ihnen gehörte Schnee und Eis im Winter, das Wasser im Sommer.
Wir Mädchen turnten nicht, wir schwammen nicht und ruderten nicht. Wir durften uns nicht mit Schneebällen werfen, ja, nicht einmal schlittern. Denke doch, der Strickstrumpf florirte noch. Die beneidenswerthen Jungen, die brauchten auch bei der großen Wäsche nicht die Strümpfe umzukehren, nicht auf die kleinen Geschwister aufzupassen, nicht nähen zu lernen. Nichts brauchten sie, sie thaten immer wozu sie Lust hatten. Von Knaben hatte ich damals die Vorstellung, daß sie rechte Rüpel seien, und sich nicht wuschen, und daß ihnen das Lernen in der Schule furchtbar sauer würde.
Erzähle ich schlicht genug? Schläfst Du dabei vor Langerweile ein? es geschieht Dir recht. Du hasts gewollt.
Ich war gewiß noch ganz klein, etwa 4–5 Jahr, als die Mutter mir das Amt übertrug, die kleinen Brüderchen oder Schwesterchen zu wiegen. Das Wiegen der Kinder, das heut für schädlich gilt, war damals etwas Selbstverständliches.
Die Wiege stand im Schlafzimmer der Eltern. Abends wurde das Zimmer von einer Nachtlampe schwach erhellt. In der ersten Zeit faßte ich dieses Amt als eine Strafe auf, und weinte still in mich hinein.
Ich glaube selbst ein Kind fröhlichen Temperaments wäre bei diesem stundenlangen einförmigen Wiegen im Halbdunkel, kopfhängerisch geworden, wie viel mehr ich, die ich allem Anschein nach schon als Traumbündel zur Welt kam.
Allmählich aber gewöhnte ich mich an das Wiegen, und nahm es als etwas Unabänderliches hin. Und dann kam die Zeit, wo ich mit Ungeduld darauf wartete, daß man mich zum Wiegen rufen sollte.
Warum die Mutter gerade mir dieses Amt übertrug? – weil sie es für ein sehr unangenehmes hielt. Meine Mutter – Du hast es wohl schon zwischen den Zeilen gelesen – konnte mich nicht leiden.
Alles an dieser Frau war impulsiv. Sie folgte nur ihren Instinkten, und ihre Instinkte waren gegen mich, ja ihre Lieblosigkeit mir gegenüber steigerte sich oft bis zu einem an Haß grenzendem Gefühl. Ich merkte bald, daß sie eine geheime Lust empfand, wenn sie mir weh thun konnte. Und doch war sie weder boshaft noch grausam. Ich wüßte nicht, daß sie jemals irgend einem Menschen positiv Böses zugefügt hätte. Sie hatte wohl auch kaum ein Bewußtsein von dem bitteren Leid, daß mir durch sie geschah.
Da ich ein sehr hübsches und sehr artiges Kind war, (nach dem eigenen späteren Zeugniß meiner Mutter) würde ich mir vielleicht heute noch den Kopf über die Ursache ihrer Abneigung zerbrechen, wenn sie selbst mich nicht darüber aufgeklärt hätte.
Eines Tages war eine Dame bei ihr zum Besuch, als ich aus irgend einem Grund ins Zimmer trat. Der Dame gefiel ich augenscheinlich. »Die Kleine ist gewiß Ihr Liebling« – sagte sie zu meiner Mutter.
Meine Mutter lachte. »Aber nein im Gegentheil«. Die Dame wunderte sich, weil ich doch gar so niedlich wäre. Nun erklärte ihr die Mutter, daß ich – ihr drittes Kind – das erste gewesen wäre, das sie nicht selbst nähren konnte. Und da hätte nun der kleine lieblose Balg nichts von ihr wissen wollen, hätte in seiner Gier immer nur nach der Amme verlangt, und wie am Spieß geschrieen, wenn sie, die Mutter, mich hätte nehmen wollen. »Und da kann man denn natürlich – schloß sie ihre Erklärung – so ein kleines Ekelbiest (sie nannte mich oft so) nicht leiden.«
Meine Mutter sagte das ganz einfach und laut vor mir. Es kam ihr nicht in den Sinn, daß sie damit dem zehnjährigen Kind bitterweh that.
Daß die Anhänglichkeit des Säuglings an die Amme naturgemäß ist, begriff sie nicht. Mein Abwenden von ihr schien ihr etwas durchaus Böses. Die ersten Eindrücke zu überwinden war sie außerstande, von Selbstbeherrschung und Selbstverantwortlichkeit wußte sie nichts.
Es gab aber noch andere Gründe für ihre Abneigung. Meine Schwester Alice, ihr Ebenbild äußerlich und in der Wesensart, war ihr Liebling. Und um dieser Alice willen, war sie eifersüchtig auf mich. Ich war sehr viel hübscher als die Schwester und kam in der Schule schneller vorwärts.
Noch maßgebender aber für ihre Abneigung mag der Antagonismus unserer Naturen gewesen sein. Größere Gegensätze als zwischen meiner Mutter und mir sind kaum denkbar. Dazu kam meine offenbare Scheu und Furcht vor ihr, die sie beleidigten.
Sie dichtete mir Fehler an, die ich nicht hatte, vielleicht um ihre ungerechte Härte vor sich selber zu beschönigen. War von einer Leckerei etwas genascht worden, so wurde ich der That beschuldigt und leugnete ich, so war ich eine Lügnerin. Ich wurde geschlagen, damit ich gestehen sollte. In den Familien ist die Folter noch nicht abgeschafft. In gut bürgerlichen Häusern wurde damals viel geprügelt.
Jedenfalls haftete mir als Kind der Ruf an eine verstockte Lügnerin zu sein, so daß ich später oft darüber sann, ob ich nicht wirklich gelogen, und es nur dann vergessen hätte.
Wir hatten eine alte, grimmig häßliche, unangenehme Tante. Es verging kaum ein Tag, ohne daß ich hören mußte: »die Pippe wird der Tante Berthel von Tag zu Tag ähnlicher.« Und ich glaubte es, und ich weinte heimliche Thränen über meine Scheußlichkeit. Hätte ich nicht mit der Zeit eine so große Virtuosität erlangt meiner Mutter aus dem Wege zu gehen, ich wäre eins der meistgeprügelten Kinder gewesen.
Meine bloße Anwesenheit schon reizte die Mutter zu Aeußerungen der Abneigung.
»Glotze mich nicht so impertinent an,« fuhr sie mich an. Ich hatte natürlich keine Ahnung, daß ich impertinent glotzte. Saß ich still mit niedergeschlagenen Augen da, so sah ich blödsinnig dumm aus.
Sie brauchte grobe Ausdrücke. Wenn sie mich anschrie: »Halts Maul!« oder: »Dumme Gans!« so zog ich unwillkürlich den Kopf zwischen die Schultern als schlüge man mich, und ich schämte mich, daß es meine Mutter war, die so redete.
Ich zitterte, sobald ich nur ihren Schritt oder ihre Stimme im Corridor hörte, und oft zog ich dann hurtig die Schuhe aus, und tappte leise die Hintertreppe herab, um in den Garten zu entkommen. Hatte ich dazu nicht mehr Zeit, so lauschte ich gespannt, wohin sie ihre Schritte lenken würde, und ging sie an meiner Thür vorbei, so athmete ich befreit auf.
Eine ihrer Härten bestand darin, daß sie mich zu essen zwang, was ich nicht mochte, während sie bei den Idiosynkrasien meiner Geschwister ein Auge zudrückte. Bis zum Rand füllte sie mir den Teller mit Speisen, die mir verhaßt waren. Ach ihr guten Erbsen und ebenso guten Brühkartoffeln, mit wie viel Thränen habe ich euch heruntergewürgt!
Die wohlhabendsten Bürgerfrauen gingen damals selbst auf den Markt, auch wohl mit einem Fischnetz und einem Körbchen für Obst. Eines Tages hatte meine Mutter mich mit auf den Markt genommen. Sie hatte Aale gekauft, und ich sollte sie im Netz nach Hause tragen. Andromache kann, als sich ihr der Drachen nahte um sie zu verschlingen nicht mehr Entsetzen empfunden haben, als ich bei der Vorstellung, daß ich diese glibbrigen, eklen Thieren berühren sollte. Ich, sonst der Gehorsam selbst, weigerte mich die Aale zu tragen, und als meine Mutter darauf bestand, gerieth ich so außer mir, und stieß einen so wilden Schrei aus, daß sie einen Auflauf befürchtend, das Netz selbst in die Hand nahm. Ich wäre eher ins Wasser gesprungen, als daß ich die Aale getragen hätte, und die Prügel, die ich zu Hause für meine Renitenz erhielt, und daß ich von den gekochten Aalen nicht essen durfte, hat die Thierliebe in mir nicht großziehen können.
Sonderbar meine Abneigung gegen Thiere, nicht? Ich weiß selbst keine Erklärung dafür. Jede, auch die geringfügigste Quälerei eines Thieres kann mich zu hellem Zorn reizen, ich mag mich aber selbst mit dem niedlichsten Thierchen nicht abgeben, vor der Berührung einer kalten Hundeschnauze schaudere ich zurück. Vielleicht wirkt bei dieser Antipathie mein feiner Geruchsinn mit, der schon durch den Dunstkreis eines Vogelkäfigs unangenehm afficirt wird.
Du kannst es glauben, Arnold, ich litt herzzerreißendes in meinen Kinderjahren. Der Schmerz des Kindes ist oft tiefer, trostloser als der des Erwachsenen. Es ist immer gleich ganz Nacht in der kleinen Seele, ohne Hoffnung auf Morgenröthe. Man sagt wohl, daß so ein Kinderschmerz nur ein Momentbild sei. Ist aber ein Kind besonders weich und eindrucksfähig, und wiederholen sich unablässig die schmerzlichen Einwirkungen, so schließen sich die Wunden nie ganz und bluten bei der leisesten Berührung.
Es giebt Kinder, die gleichsam gepanzert zur Welt kommen, Dickhäuter, von denen alle Pfeile abprallen, Kinder mit starken Instinkten der Selbsterhaltung. Andere aber sind wehrlos geboren mit so dünner Seelenhaut, daß schon ein Hauch sie verletzt. Ich war ein geistiger Bluter.
Man spricht so viel von dem großen Glück des Kindes, das die Mutterliebe ihm giebt, man spricht von dem trauervollen Geschick der Kinder, die früh die Mutter verloren. Aber man spricht nicht von dem viel größeren Unglück des Kindes, das eine Mutter hat, die keine Mutter ist.
Ich weiß nicht ob mein Schicksal ein Ausnahmeschicksal war. Ich glaube kaum.
Ich errinnere mich mit absoluter Sicherheit, daß in meiner Kindheit kein einziger Tag verging, ohne daß ich weinte. Es waren keine kindischen Thränen, ich weinte mit Bewußtsein, wie ein Erwachsener, über das was mir geschah, Thränen, die vergiften, Thränen, die für immer Spuren in der Seele hinterlassen.
Daß mein Gedächtniß so wenig Thatsächliches aus den Kinderjahren festgehalten hat, liegt wohl daran, daß ich mich immer vor der Wirklichkeit zu verkriechen suchte, daß mein eigentliches Wesen durch die rauhe Verständnißlosigkeit meiner Umgebung erstickt wurde, oder doch nur latent in mir fortlebte.
Nur nicht bemerkt werden. Bemerkt werden und verwundet werden, war eins für mich. Ungeliebt, ungehegt und gepflegt schmachtete ich nach Liebkosungen, und da ich in der Wirklichkeit keine fand, erträumte ich sie mir, wie der Hungrige im Traum in leckern Speisen schwelgt. In instinktiver Schlauheit erzwang ich mir einen außergewöhnlichen Zugang zum Lebensgenuß, da mir die gewöhnliche Thür verschlossen wurde. Es war eine völlige Umkehrung des realen Daseins. Der Traum war das Leben, das Leben ein wesenloses Hindämmern.
Meine Mutter sah ich im Licht einer Märchen-Stiefmutter. Bis in meine Backfischjahre hinein trug ich mich mit der Hoffnung, daß ich ein angenommenes, ein Findelkind sei, und ich wartete eigentlich immer auf die eigentliche Mutter.
Darauf hin spann ich lange Romane, die immer damit endigten, daß ich endlich, endlich meine Mutter entdeckte, die mich nun natürlich ganz unsinnig liebte.
Ich hätte so sehr gern meine Mutter »Sie« genannt.
Eine kleine Wohnung auf der andern Seite unsers Flur's hatte ein altes Fräulein mit ihrer Jungfer inne. Das alte Fräulein war eine Dichterin, eine berühmte, sagte man mir. Man sprach von ihr im Hause mit einer gewissen neugierigen Ehrerbietung. Daß sie von altem Adel war, erhöhte das Interesse für sie. Schon ihr Vorname »Elfriede« übte eine geheimnißvolle Anziehung auf mich aus. Die Stimmung des Tiek'schen Märchens »Die Elfen«, war noch in meinem Gemüth lebendig, ein Abglanz davon fiel auf die Dichterin.
Sie war sehr lang und sehr dünn, und kleidete sich eigenthümlich, mit weiten dunklen Umhängen, und nie habe ich sie ohne einen langen, wehenden, grünen Schleier und ohne Halbhandschuh gesehen. So wandelte sie im Garten auf und ab, in der Hand ein Büchelchen und einen Bleistift haltend. Ein Duft wie von Lawendel und Veilchen ging von ihr aus. Oft stand ich am Fenster des Berliner-Hinterzimmers, und wartete bis die Liebliche sich zeigte und mit ihren zarten Fingern den Vorhang zurückschob; er war auch grün.
Wie früher der verschlossene Bücherschrank, so zog mich jetzt dieses vergilbte Fräulein an.
Sah ich sie in den Garten gehen, so lief ich auch schnell hinab, und herzklopfend strich ich so nah wie möglich an ihr vorüber, damit sie mich bemerken sollte.
Allgemach spielte sie eine Rolle in meinen wachen Träumen. Ich ersann eine phantastische Combination: Sie war meine leibliche Mutter. Eine magische Verkettung hatte uns in demselben Haus zusammen geführt, und eines Tages entdeckte sie an einem geheimen Mal, – etwa an dem kreuzartigen rothen Mal auf meiner Stirn – ihre Mutterschaft mir gegenüber. Von dem Augenblick an liebte sie mich rasend, mußte es aber vor der Welt geheim halten.
Ueber das Warum dieser Geheimhaltung ließ ich mir keine grauen Haare wachsen. Im Gartensaal gaben wir uns zahlreiche Rendez-vous, und zerflossen dabei in Zärtlichlichkeit und Thränen.
So zur fixen Idee wurde diese Vorstellung, daß ich ein paar Mal, wenn sie im Garten war, mich durch schnelles Laufen in der Sonne zu erhitzen suchte, damit das Mal zum Vorschein kommen sollte. Meist aber, wenn ich an ihr vorüberging war sie so in sich versunken, daß sie mich gar nicht bemerkte.
Nur ein einziges Mal sprach sie mich an, streichelte mich, und gab mir aus einer eleganten Bonboniere ein Chokoladenplätzchen.
Als sie nach einem Jahr auszog, empfand ich es wie einen Schicksalsschlag, die Stimmung des Tiek'schen Märchens, nachdem die Elfen ihren Wohnort verlassen kam über mich. Zwar winselten keine Klagetöne durch die Luft, noch zitterte der Erboden unter den Rädern des Möbelwagens, der ihr Hausgeräth davon trug, der Garten aber kam mir doch eine Zeitlang entzaubert vor. Nicht mehr wehte der grüne Schleier durch das dürre braune Herbstlaub, und nicht mehr stand ich im Berliner-Zimmer bis die Liebliche sich zeigte. Mit Elfriede war mir ein Stück Romantik entschwunden, eine meiner heißersehnten Mütter zu Wasser geworden.
Uebrigens war meine gequälte Kinderseele durchaus nicht frei von Rachegefühlen meiner Mutter gegenüber. Aber nie hätte ich ihr ein Leid anwünschen, geschweige denn ihr eins anthun mögen. Im Märchen muß die böse Stiefmutter auf glühenden Pantoffeln sich zu Tode tanzen. Glühende Kohlen spielten auch in meinen Rachegedanken eine Rolle, aber ich wollte sie auf das Haupt meiner Mutter sammeln, sie mit Beschämung strafen. In besonders trübseligen Stimmungen nahm ich mir fest vor schmerzlich zu Grunde zu gehen, um das Herz meiner Mutter durch mein tragisches Geschick mit Reue zu zerfleischen.
Immer war ich in meinen Traumphantasien zuerst ein verelendetes, geknicktes Geschöpf, bis ein Zauber oder ein großes Schicksal etwas außerordentliches aus mir machten. Immer hatte meine Mutter mich aus dem Hause gestoßen, oder ich war davon gelaufen. Mich hungerte. Ich war in Lumpen gekleidet. Da ging ich auf die Höfe und sang. Irgend jemand hörte meine herrliche Stimme, war entzückt davon, ließ mich zur Sängerin ausbilden. Und ich wurde die erste Sängerin der Welt. Und eines Tages fuhr ich in der Friedrichstraße bei meiner Mutter in einem vergoldeten Wagen mit vier Pferden – nein mit 6 weißen Roßen – vor, so daß die ganze Friedrichstraße Kopf stand. Und neben mir im Wagen saß ein Prinz. Das war mein hoher Gemahl. Und zu spät sah meine Mutter ein wie sehr sie mich verkannt hatte. Die »dumme Gans« kam als Schwan daher, wohnte in einem Palast und war weltberühmt.
Furchtbar wars, wenn meine Mutter mich mit einem Rohrstock schlug, was ab und zu vorkam. In eine wilde tödtliche Aufregung gerieth ich dann. Die glühende Kohlen der Beschämung genügten mir nicht mehr, nicht mehr die Traumbestrafungen. In düsterem Pathos mischte ich Traum und Wirklichkeit. An eisigen Winterabenden, ehe ich ins Bett ging, stellte ich mich im Hemde ans offene Fenster, und entblößte meine Brust, sie der Kälte preisgebend. Ja, ich wollte mir eine tödtliche Krankheit zuziehen, und auf dem Todtenbett, im Fieberparoxismus, wollte ich der unnatürlichen Mutter zurufen – nein nicht zurufen – dazu war ich zu schwach, mit einem Finger wollte ich ihr das Kainszeichen auf die Stirn malen: Mörderin! Und mit wahrer Wollust malte ich mir ihre Gewissensqualen aus.
Oder ich siechte langsam an gebrochenem Herzen dahin. Ich lag auf der Todtenbahre, (Bett ein zu prosaisches Wort) ein Kranz von weißen Rosen auf dem gelösten rabenschwarzen Haar, marmorweiß das Gesicht. Ich sah so wunderschön aus und so furchtbar traurig, daß ich über mich selbst laut weinte. Und mein Bild als Todte, würde fortan das Leben meiner Mutter vergiften.
Kindskopf, der ich war. In Wirklichkeit würde die robuste Frau mich in wenigen Wochen vergessen haben.
Aber die eisigste Kälte schadete mir nicht. Gott! war ich gesund!
Meine Phantasie feierte wahre Orgien der Traurigkeit, in denen Tod und Wahnsinn, weiße Lilien und rothes Blut und nächtliche Kirchhöfe wild durcheinander spukten. Nichts konnte mir schaurig genug sein. Mit Vorliebe sah ich mich als Wasserleiche im rauschenden Strom dahintreiben, meine Rabenlocken das Bahrtuch, das mich einhüllte. Und Goldfische (die ja eigentlich in rauschenden Strömen selten vorkommen) und Delphine zogen mir nach auf der dunklen Spur. Ueber mir große Vögel, die Flügel ausgebreitet, lautlos schwebend – ein feierlicher Leichencondukt. Und auf meiner Stirn brannte in mystischem Licht das rothe Mal.
Eine Zeitlang stand ein gutes und kluges älteres Kindermädchen bei uns im Dienst, die mich lieb hatte. Das war die erste Person, die überhaupt merkte, daß ich zu meiner Mutter niemals Mutter, oder wie meine Geschwister »Mama« sagte.
Das gute Mädchen redete mir ins Gewissen. Sie stellte mir eindringlich vor, daß eine Mutter kein Herz zu einem Kinde fassen könne, daß so halsstarrig wäre, sie nicht Mama nennen zu wollen, und gewiß hielte sie mich darum für bös und trotzig.
Und mit so klugen, liebevollen Worten drang sie in mich, daß ich ihr versprach meinen Trotz (es war ja kein Trotz) abzulegen.
Aber ach, vom Entschluß zur That war noch ein weiter Weg. Ich hatte mir das »Muttersagen« nicht so schwer gedacht. Ich wollte nämlich gar nicht erst Mama, sondern gleich Mutter sagen. Das gefiel mir besser. In keinem meiner Märchen oder Träume gab es Mama's.
Tagelang, wochenlang kämpfte ich mit meiner Schüchternheit und einer herzbeklemmenden Angst, die mich jedesmal überfiel, wenn ich einen Anlauf zu der heroischen That nahm, und ich hätte sicher den Mut dazu verloren, wenn das Kindermädchen nicht auf ihren Schein bestanden hätte.
Sobald ich in dieser Zeit meine Mutter nur zu Gesicht bekam, stieg mir alles Blut ins Gesicht. Im Garten stellte ich Vorübungen an: »Mutter! liebe Mutter!« und es klang so zärtlich, so überwältigend, es rührte mich tief.
Inzwischen phantasirte ich wieder eine bewegliche Geschichte zusammen, über das, was nach vollbrachter That geschehen würde. Zuerst würde die Mutter, sobald das inhaltsschwere Wort gefallen, wie von einem elektrischen Schlag getroffen, sprachlos dastehen. Dann würde sie in Thränen ausbrechen, mich in ihre Arme pressen und mit Liebkosungen überschütten. Und von dem Augenblick an war ich ihr erklärter Liebling. Ich würde eine Mutter haben, eine Mutter! mein Herz jauchzte.
An einem Nachmittag mußte der verwegene Plan ins Werk gesetzt werden. Vormittags, da war die Mama ja nicht angezogen und schlechter Laune und ganz Wirthschaftsdrachen.
Die ersten Anläufe, die ich in einer Aufregung nahm als handle es sich um Tod und Leben, verliefen resultatlos. Einmal traf ich Alice bei ihr. Ein ander mal fuhr sie mich gleich, als ich eintrat, unsanft an. Endlich kam ein günstiger Moment. Sie war im Schlafzimmer bei dem kleinen Brüderchen, und ich hörte sie mit ihrer hellen Stimme eines ihrer hübschen Lieder singen: »Brüderlein fein, Brüderlein fein, ach es muß geschieden sein.« So lange meine Mutter sang, vergaß ich das Stiefmütterliche in ihr. Und nun wußte ich auch einen Vorwand um einzutreten.
Ich begreife heute noch nicht, daß sie nicht an meinem glühenden Gesicht, an meiner bebenden Stimme merkte, daß etwas Außerordentliches geschehen sollte.
»Mama«, sagte ich mit fliegendem Athem (ganz gegen meinen Vorsatz hatte ich das Wort »Mutter« nun doch nicht über die Lippen gebracht) »Mama soll ich nicht Fritzchen wiegen?« Eine Bergeslast fiel mir von der Brust. Es war vollbracht.
»Komm in einer halben Stunde wieder« sagte meine Mutter nicht unfreundlich, aber ganz gleichgültig. Sie spielte mit dem Kinde weiter. Ich stand noch ein paar Minuten und wartete – wartete! Es mußte doch etwas geschehen! es mußte doch.
Als sie sich nach einiger Zeit umwendete, und mich noch immer dastehen sah, sagte sie schon etwas schärfer: »Aber so geh doch« –
»Ja Mama.« Und ich ging langsam, ganz langsam, zögernd hinaus, immer noch hoffend – immer noch hoffend!
Nichts geschah. Nichts. O Gott, meine Mutter hatte es gar nicht bemerkt, daß ich nie Mama zu ihr gesagt und sie hatte auch jetzt nicht bemerkt, daß ich es that.
Ich legte diese tiefe, bitterste Enttäuschung zu den übrigen und weinte mich am Halse des Kindermädchens aus.
Seitdem habe ich oft Mama gesagt, aber ohne Hoffnung und Erregung.
Wie wenige Eltern wissen etwas von der Psyche ihrer Kinder. Wer hat sich je um das, was in mir vorging, gekümmert? Weil ich verblödet war, mußte ich dumm sein. Meine Wortkargheit war Trotz. Mein Fernstehen von den Geschwistern – Herzlosigkeit. Die Mama war ja selbst in ihrer Jugend von ihrer Mutter tüchtig geknufft worden, und sie hatte sich nichts daraus gemacht, und nicht im entferntesten daran gedacht es ihr nachzutragen.
Unsere Großmutter. Wie sich meine Eltern dieser Großmutter gegenüber verhielten, ist auch eine Illustration zu ihrer naiven, culturfremden Art und Weise.