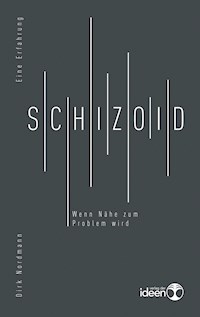
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag der Ideen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Prügel, Mobbing und Waffen in der Raucherecke – ignorante Eltern, Kampfsport, ausbeuterische Arbeitgeber und Bordelle – Problembeziehungen und lebensgefährliche Operationen … Dirk Nordmann hat es nie leicht gehabt mit den Menschen, die ihm meist bedrohlich vorkamen. Nähe war schon immer ein großes Problem für ihn. 'Ich habe massive Erfahrungslücken im Zwischenmenschlichen und ziehe mich wegen des Gefühls, autark bleiben zu müssen, sozial zurück. Ist das nicht schizoid?' 'Schizoid' – Der Weg einer Heilung, der noch nicht zu Ende ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
D i r kN o r d m a n n
S C H I Z O I D
W e n nN ä h ez u mP r o b l e mw i r d
E i n eE r f a h r u n g
D i r kN o r d m a n n,
g e b o r e nA n f a n gd e rS i e b z i g e r j a h r e ,w u c h si ne i n e mV o r o r tH a m b u r g sa u f .
F ü n f z e h nJ a h r ew a re ra l sM a s s e u ru n dm e d i z i n i s c h e rB a d e m e i s t e rt ä t i g .
2 0 1 2b e k a me re i n eE r m ü d u n g s d e p r e s s i o n .
I mZ u g ed e rT h e r a p i ew u r d ee i n es c h i z o i d eP e r s ö n l i c h k e i t s s t ö r u n gf e s t g e s t e l l t .E rl e b tm i ts e i n e rt r a n s s e x u e l l e nL e b e n s g e f ä h r t i ni nH a m b u r g .
D e rA b g r u n di mZ i m m e r b o d e n
D i eS p i n n ei mW a l d
D a sM o n s t e rm i td e mr o t e nD a c h
D e rH ö l l e n h u n d
D a sk l e i n eM ä n n c h e ni nm e i n e mH i n t e r k o p f
D i eV e r n i c h t u n gd e sD ä m o n e n k i l l e r s
D e rR ä c h e ra u sd e mG r o ß s t a d t d s c h u n g e l
D i eP a r t y k ö n i g i n
D e rV e r r ü c k t em i td e nz w e iC h i n e s e n
M e i n ee r s t eF r e u n d i n
D a si s tm e i nH a u s
D i eM a g i ed e sA u g e n b l i c k s
E i nT h a i l ä n d e rk o m m ts e l t e na l l e i n
N e u eL i e b e–a n d e r e rS t r e s s
M e i ne i n z i g e ru n db e s t e rF r e u n d
D i eF a l l ei mK e l l e r
M i td e mF r i t t e n k o c hi mM ä n n e r p u f f
D a sT r o s t p f l a s t e r
D e rb e i ß w ü t i g eD a c k e l
F e h l d i a g n o s eA D S
S c h w e r ed e p r e s s i v eE p i s o d e
D i eF r a ua u sd e rB a h n
M e i nb e r u f l i c h e rU n t e r g a n g
D e rR u fd e sU h u s
Ich stand auf dem Balkon des Reihenhauses, das mein Vater sechs Jahre zuvor gekauft hatte und starrte in die rabenschwarze Nacht. Es lag eine unwirkliche Endzeitstimmung in der Luft, Wolkenfetzen rasten im Zeitraffer über den Himmel und die Äste der Bäume pfiffen im Wind, während in der Ferne bedrohlicher Donner grummelte. Ich drehte mich um und ging durch die Balkontür ins Schlafzimmer meiner Eltern, in dem die Deckenlampe den Raum in ein diffuses und ungemütliches Licht tauchte. Kalt war es darin – wie in einem Leichenhaus. Ich war ganz alleine, niemand sonst befand sich noch in meiner Nähe, nicht meine Eltern und auch nicht meine Schwester. Um in mein Zimmer zu kommen, musste ich zwischen dem Fußende des Bettes und einem Kleiderschrank durchgehen. Mir stand dabei der Fernsehtisch im Weg, auf dem lauter bunte Holzbauklötze lagen, mit denen wir als Kinder immer gespielt haben. Ich stieß den Tisch um, damit ich daran vorbeikam. Die Klötze fielen zu Boden und der Drang, diesen Raum verlassen zu müssen, wurde plötzlich unerträglich, denn ich fühlte mich beobachtet und kontrolliert. Etwas Unsichtbares bedrohte mich und wollte mir nachstellen.
Nachdem ich das Zimmer verlassen hatte und mich umdrehte, sah ich mit Schrecken, dass sich über dem Bett meiner Eltern – blitzschnell und lautlos – eine graue Wolke zusammenbraute. Ich floh durch den Flur in mein eigenes Zimmer, doch die Wolke löste sich von ihrem Standort über dem Bett und verfolgte mich. Als ich in meinem Zimmer angekommen war, schob sie sich durch die Tür und verwandelte sich augenblicklich in einen gigantischen Totenschädel, der mich sarkastisch angrinste, während er die gesamte Türzarge ausfüllte. Völlig gelähmt starrte ich den Schädel an und hoffte, dass er einfach verschwinden würde, doch er rührte sich nicht von der Stelle. Mit dem Mut der Verzweiflung stellte ich mich ihm demonstrativ entgegen.
In diesem Moment öffnete sich der Kiefer des Schädels, aus dem mir gleißend blendendes Licht in die Augen schoss – wie aus einer OP-Lampe. Unter mir ging eine Falltür auf und ich fiel haltlos in einen schwarzen, gähnenden Abgrund, während ich meinen Körper dabei verließ und mich, aus der Position eines Beobachters, plötzlich auf dem Boden landen sah. Gott saß vor mir auf einem Thron und begutachtete interessiert den Erdenmenschen, der soeben vor seinen Füßen gelandet war.
Schweißgebadet wachte ich auf und starrte verstört in die beunruhigende Dunkelheit meines Kinderzimmers. Die Apokalypse hatte nicht stattgefunden, doch diese unheimliche Finsternis um mich herum zwang mich zu der Vorstellung, dass eine unsichtbare Macht mit ihren kalten Fingern nach mir greifen wollte, um mich in den imaginären Abgrund – mitten im Zimmerboden – zu ziehen.
Ich deckte mich ganz und gar zu und schlief irgendwann wieder unruhig ein, denn am nächsten Morgen musste ich zur Schule. Ich war gerade zwölf Jahre alt geworden.
In einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen saß an einem Spätsommertag des Jahres 1972 eine hochschwangere Frau mit ihrer Schwiegermutter im Garten hinter dem Haus. Mit einem Mal sprang die Schwangere auf und rannte in Richtung Terrassentür, um im Haus vor einer Wespe Zuflucht zu suchen, die sie aggressiv bedrängte. Die Schwiegermutter hatte noch vor gehabt die Schwangere zu warnen, doch es war zu spät: Die Frau stieß mit der Stirn gegen die teilweise heruntergelassene Jalousie der Terrassentür und kippte nach hinten über. Es gab einen dumpfen Schlag, als ihr Hinterkopf auf die Schieferplatten des Terrassenbodens prallte.
Sofort wurde sie zum Arzt gebracht, doch augenscheinlich war weder ihr noch dem Kind etwas passiert. Durch den Sturz hatte sich das Kind allerdings gedreht, was dem Arzt entgangen war. Einige Wochen später wurde die werdende Mutter in panischer Eile mit dem Auto ins Krankenhaus gebracht, die Wehen hatten bei ihr sehr plötzlich eingesetzt. Dass der Junge mit den Füßen zuerst auf die Welt kommen würde, bemerkte man erst vor Ort. Hektik kam auf und nach einer wohl durchgehend heftigen Geburt war er auf der Welt.
Er schrie nur kurz auf, verstummte aber gleich wieder und gab keinen einzigen Laut mehr von sich. Eilig brachte man ihn in einen Nebenraum und begutachtete ihn, da dieses Verhalten für Neugeborene sehr ungewöhnlich war.
Die Mutter merkte, dass etwas nicht stimmte. Sie fragte den völlig übermüdeten und dauernd gähnenden Arzt, ob mit ihrem Sohn alles in Ordnung war. Auf ihre erstmalige Nachfrage erhielt sie keine Antwort. Sie fragte den Arzt noch einmal: »Ist mein Sohn gesund?«
»Abitur hat er noch nicht«, bekam sie von ihm zur Antwort.
Plötzlich stürzte eine Hebamme in den Raum und rief dem Arzt zu: »Der Junge ist blau im Gesicht, er bekommt kaum Luft!«
Man organisierte schleunigst einen Notfalltransport in ein Kinderkrankenhaus, wo feststellt wurde, dass das Zwerchfell des Jungen durch den gewaltsamen Geburtsvorgang gerissen war. Die Bauchorgane drückten durch dieses Loch auf die Lunge und das Herz. Eine sofortige Operation war notwendig. Hinterher verblieb der Junge für einen Monat im Brutkasten auf einer Säuglingsstation, bis man einen komplikationslosen Verlauf der Nachsorge sicherstellen konnte. Erst dann durfte er zu seinen Eltern nach Hause.
Zwei Monate später erbrach er sich abends mit einem Mal heftig. Als die Mutter in der Nacht nach ihm sehen wollte, saß ihr Sohn mitten in seinem, von Galle grün gefärbtem, Erbrochenen aufrecht im Kinderbett und schaute sie an. Es wurde ein Arzt gerufen. Dieser untersuchte den Jungen und vermutete einen Darmverschluss als Ursache seiner akuten Beschwerden. Nun ging es ein zweites Mal ins Kinderkrankenhaus, wo die Diagnose des Arztes bestätigt wurde.
Durch die erste Operation hatten sich die Unterbauchorgane des Kindes verknotet. Es erfolgte eine weitere Operation, die länger dauerte und strapaziöser war als die erste. Das Leben des Jungen stand ernsthaft auf der Kippe, denn seine Energiereserven waren bereits sehr angeknackst. Diese Situation verlangte den völlig verstörten Eltern den letzten Nerv ab. Mit hochrotem Kopf und zusammengeballten Fäusten lag der Junge in seinem Brutkasten, während lauter Schläuche in ihn hineinführten. Er kämpfte offensichtlich ums Überleben – er wollte einfach nur leben.
Nach einem Monat hatte er den Kampf gegen den Tod gewonnen und durfte wieder nach Hause. In der Zeit danach aß er sich dick und rund, denn er war vorher künstlich ernährt worden. Später sah er wie alle anderen Kinder aus, allerdings entwickelte er sich ganz anders.
Viele Male erzählte mir meine Mutter diese Vorkommnisse aus den ersten Monaten meines Lebens, viele Male hörte ich gespannt zu und stellte mir immer die Frage, woher ich nur die Energie genommen hatte, die nötig war, dieses Martyrium zu überstehen.
Da ich mich an meine frühe Kindheit kaum erinnern kann, muss ich auf die Erzählungen meiner Mutter zurückgreifen. Sie erinnerte sich, dass ich nicht krabbelte, sondern gleich aufstand und lief. Ferner bekam ich weder die Brust noch habe ich je aus einer Nuckelflasche getrunken, ich wollte Brei essen und schlang ihn, wie ein halb Verhungerter, hinunter. Die dritte Auffälligkeit war, dass ich sehr früh sprechen konnte. Und zwar so, dass man den Eindruck gewann einen Erwachsenen mit einer Kinderstimme zu hören.
Einmal ging meine Mutter mit mir beispielsweise zum Einkaufen und in der Schlachterei wurde sie von der Verkäuferin gefragt, ob sie das Stück Leberkäse, das meine Mutter gerade für mich gekauft hatte, mir geben oder es erstmal einpacken sollte. Da sagte ich zur Verkäuferin, die mich noch nicht kannte, wortwörtlich: »Och, wissen Sie, geben Sie mir das doch gleich, das esse ich jetzt.« Die guckte aber vielleicht erstaunt.
In der Nähe der Geschäfte war auch der Eingang zur Bahnstation und ich wollte die Züge sehen, die ein- und abfuhren. Der Fußgängerzugang zum Bahnsteig war überdacht, hatte überall Fenster und ein Gleis führte unter ihm hindurch. Wenn wir uns darin befanden, hob mich meine Mutter hoch, damit ich durchs Fenster auf das Gleis sehen konnte. Meine ersten Träume handelten wiederholt von diesem Zugang zum Bahnsteig. In meinen Träumen war ich plötzlich ohne meine Mutter darin, wobei der Tunnel, ähnlich einem Gefängnis, keine Türen hatte. Schreckliche Angst überkam mich im Schlaf.
Ein andermal sah ich zufällig einen Teil der Sendung »XY-ungelöst« im Fernsehen. Es wurde ein junger Bankräuber mit einem weißen Mantel, schwarzen Haaren und einer Sonnenbrille gesucht. Er bedrohte den Bankangestellten im Film mit einer Pistole und forderte: »Da ist noch mehr Geld, los!« Der Angestellte musste das Geld in eine Tüte stopfen, die der Kerl ihm hinhielt, und der hinterher der Polizei in einem Kleinwagen entkam. Kurz danach begegnete mir dieser Mann plötzlich im Traum. Er stand an seinem Auto vor dem Schuhgschäft in unserer Straße, stützte sich lässig mit dem Ellenbogen auf dem Fahrzeugdach ab und musterte mich aufmerksam durch seine Sonnenbrille. Obwohl ich offensichtlich die Möglichkeit gehabt hätte wegzulaufen, weil er mich nicht festhielt, konnte ich das, in Anbetracht seiner dominanten Art, nicht. Mich lähmte die Angst, die ich vor ihm hatte. Ich bettelte weinend: »Lass mich bitte gehen.«
Ohne ein Anzeichen von Mitgefühl ignorierte er mein Flehen und meinte nur: »Wollen wir mal sehen.«
Als ich aufwachte, fühlte ich mich sehr einsam und krabbelte ins Bett meiner Eltern, was ich oft getan habe, bis meine Schwester auf die Welt gekommen ist.
Einige Male besuchten wir damals meine Großeltern, die Eltern meines Vaters, in Nordrhein-Westfalen. Sie hatten ein großes Einzelhaus, eben jenes, hinter dem meine Mutter stürzte, als ich noch in ihrem Bauch war. Ich bekam für die Zeit des Aufenthalts ein Zimmer im ersten Stock, gleich neben dem Schlafzimmer, in dem meine Eltern übernachteten. Dieses Zimmer roch fremd und sah fremd aus, es war in einem fremden Haus, in einer fremden Stadt. Ich kann mich noch vage erinnern, dass ich mich während der ersten Nächte mit einem Mal wahnsinnig vor den Knäufen der Gardinenstange fürchtete, was soweit ging, dass mein Vater die Stange abbauen musste. Eigentlich war an diesen Knäufen nichts Besonderes, doch auf mich wirkten sie so bedrohlich, als wären es Teufelsfratzen.
Das nächste Objekt, auf das ich mit Angst reagierte, war das Nachbarhaus. Es hatte ein schwarzes Schieferdach und mehrere, seltsam geformte, gleichfalls mit Schiefer verkleidete Schornsteine. Es erinnerte mich an ein dunkles Ungeheuer mit mehreren Köpfen und ich war froh, dass es weit genug weg war.
Und dann stand da noch dieser riesige Keramiktopf im Keller meiner Großeltern, der mit Waschpulver gefüllt war. Man kann es sich nicht vorstellen, was ich für eine Angst vor dem Ding hatte. Mehrere Jahre vermied ich es, den Keller meiner Großeltern zu betreten, weil ich »die Anwesenheit« des Topfs da unten »erspüren« konnte.
In der Tat kam es in meiner frühen Kindheit häufig dazu, dass viele Gegenstände meine Aufmerksamkeit erregten, die für andere Menschen uninteressant waren. Plötzlich konnte ich dann diffuse Ängste vor manchen dieser Objekte entwickeln.
Doch auch vor einigen Menschen fürchtete ich mich sehr. Besonders der sonderbar auftretende Günther fällt mir als Beispiel dazu ein. Er war der Ehemann einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Sie hatten auch eine Tochter und einen Sohn, die etwa in meinem Alter waren. Manchmal kam diese Familie zu uns, manchmal fuhren wir zu ihnen. Günther konnte mit Kindern nicht umgehen, auch nicht mit seinen eigenen.
Er erinnerte mich mit seiner empathielosen, trockenen Art an den Bankräuber aus der Fernsehsendung »XY-ungelöst«, von dem ich einmal geträumt hatte. Außerdem trug er eine seltsame Hornbrille, durch die er noch unheimlicher wirkte. Grausam war mir zumute, wenn Günther mit seiner Aura die Atmosphäre in unserer Wohnung verpestete. Öfter ergänzte er Anweisungen meines Vaters an mich mit dem trockenen Satz: »Sonst gibt’s Po voll!« Ich dachte, er meinte das ernst, zumal meine Eltern seinen überflüssigen Kommentar nicht kritisierten.
Sie gaben mir in der Situation nicht das Gefühl, ein Halt für mich zu sein und dass ich keine Angst vor Günther haben musste. Woher hätte ich vor diesem Hintergrund wissen können, ob er nicht das Recht dazu gehabt hätte, seine von mir als Drohung empfundene Bemerkung wahr zu machen? Ich konnte meine Angst vor Günther nicht direkt äußern, denn schon früh fiel es mir sehr schwer, eigene Bedürfnisse auszusprechen, also versuchte ich, sie auf einem anderen Weg zu zeigen.
Als mir versehentlich ein Trinkglas während eines solchen Besuchs herunterfiel und zerbrach, heulte ich, zur Belustigung aller Anwesenden, wie ein Schlosshund. Mein Gefühlsausbruch war der Versuch, meine Furcht vor Günther zu äußern. Das wurde aber von niemandem erkannt, denn meine Eltern fotografierten mich dabei sogar und lachten über meine vermeintliche Überreaktion.
Sie fotografierten mich oft, zum Beispiel beim Spazierengehen oder auch beim Essen sowie beim Versuch, mich sauber zu bekommen. Während ich meinem Stuhldrang in Anwesenheit meiner Eltern nachkommen sollte und sie gelegentlich dabei zusahen, war ich oft gar nicht in der Lage, mein Geschäft auf dem Plastiktöpfchen zu erledigen. Stattdessen stellte ich mich in ein ruhiges Versteck, zum Beispiel das Mülltonnenhäuschen hinter unserem Haus, und hielt meinen Stuhlgang so lange wie möglich zurück, was mir ein überaus befriedigendes Gefühl verschaffte.
Meine Oma mütterlicherseits sollte eines abends auf mich aufpassen, denn meine Eltern wollten gemeinsam ausgehen. Ich schrie und trotzte ihr, weil meine Eltern sich von mir entfernten, was wohl die Angst in mir hervorrief, dass sie mich verlassen wollten. Meine Oma war eigentlich immer sehr nett zu mir, doch als ich die Rolle des lieben Jungen nicht spielen wollte und mich nicht beruhigte, schlug sie mir auf den Hintern, den ich heulend wegzog. »Das ist die erste Klatsche, die du von Oma kriegst. Die erste Klatsche!«, rief sie dabei.
Als sie Jahre später versuchte mich zu streicheln, zog ich meinen Kopf weg und sagte: »Ich bin kein Stofftier, ich muss nicht gestreichelt werden.«
Es war nicht etwa so, dass ich nicht gerne angefasst werden wollte, ganz im Gegenteil, denn ich sehnte mich nach Zuwendung. Meine Reaktion war eine stille Bewährungsprobe. »Wenn sie mich immer noch streicheln will, nachdem ich sie abgewiesen habe, mag sie mich wirklich«, dachte ich wohl. Doch sie hat es danach nicht mehr versucht. »Du wirst später noch genug gestreichelt werden«, sagte sie nur. »Ich doch nicht«, dachte ich. Außerdem durchschaute ich ihr Verhalten, das irgendwie gekünstelt wirkte und nicht authentisch war.
Meine Kontaktaufnahme mit Kindern gleichen Alters ab der Zeit des dritten Lebensjahres sah so aus, dass ich anfing, sie zu schubsen. Wenn ich sie schubste, war das meine Art, sie zu begrüßen. Ich wartete, bis sie freudig ankamen, dann flogen sie auf den Hintern. Und was ich konnte, konnten die anderen allemal. Als ich wiederum geschubst wurde, war ich wie paralysiert und nicht in der Lage mich gegen ihre Angriffe zu wehren.
Eines Tages stellte man zu allem Überfluss noch einen Hodenhochstand bei mir fest, der vorerst durch Spritzen mit HCG, einem Hormon, behandelt werden sollte. Ich hatte panische Angst davor, was der Kinderarzt mit mir machen wollte und versteckte mich schon unter der Behandlungsliege, bevor er überhaupt das Sprechzimmer betrat. Wenn er eintrat, begrüßte ich ihn überfreundlich. Ich dachte, wenn ich nett zu ihm wäre, würde er mich vielleicht nicht piken. Doch da hatte ich mich verrechnet, denn meine Mutter musste mich festhalten und ich schrie wie am Spieß. Die Hormonspritzen bewirkten, dass ich an den Tagen danach schmerzhafte Dauererektionen bekam und verstärkt meine Schubsattacken gegen andere Kinder fortsetzte. Meine Mutter saß irgendwann wieder mit mir beim Kinderarzt und ich weinte, weil ich die hässliche Metallnadel in meinem Gesäß erwartete. Sie sagte zum Kinderarzt: »Ich will das nicht mehr, er hat so viele Spritzen gekriegt und nichts hat sich getan.«
Er erwiderte: »Wissen Sie was? Ich will das auch nicht länger mitmachen.«
Es folgte die dritte Einweisung in ein Kinderkrankenhaus, um die Hoden und den Leistenbruch zu operieren. Einige Tage vor diesem Termin fuhr ich mit meinem Vater zu einer Tankstelle und er werkelte irgendwas am Auto herum. Ich fragte ihn, was er macht und er antwortete mir: »Ich mache einen Ölwechsel«. Was auch immer das war, dieses Wort hörte sich gut an und ich merkte es mir. Was die Umstände im Kinderkrankenhaus betraf, erinnere ich mich nicht mehr an allzu viele Details, nur einige Gedankenschnipsel sind davon übrig geblieben.
Ich lag auf einem fahrbaren Bett und wurde von mehreren Personen durch einen langen Gang geschoben. Dabei wurde überhaupt nicht mit mir kommuniziert und ich fürchtete mich vor den vielen Personen. Dann schienen mir plötzlich grelle Lichter in die Augen und mir drückte eine Krankenschwester wortlos diese Plastikmaske ins Gesicht, aus der es so ekelig süß roch. Ihr Parfüm war das auf keinen Fall gewesen. Schon wieder verletzte man meinen Körper, ohne dass ich irgendetwas dagegen tun konnte.
Als ich später auf der Station vom Pflegepersonal neckisch gefragt wurde, wie ich denn heißen würde, antwortete ich: »Dirk Ölwechsel.« So wollte ich, über die gesamte Zeit die ich im Krankenhaus lag, auch angesprochen werden. Ich lieh mir wohl eine andere Identität als »Überlebensstrategie« für ein wiederholt durchlebtes Trauma. Dauernd wurden mir ohne jede Erklärung irgendwelche Dinge angetan, denen ich schutzlos ausgeliefert war und die mir wehtaten.
Meine Eltern waren dabei nie in meiner Nähe. Nur den Pfleger Michael fand ich nett, mit dem unterhielt ich mich andauernd, denn sprechen konnte ich ja fast wie ein Erwachsener. Bei meiner Entlassung schnatterte ich in einer Tour und man konnte mir anmerken, wie erleichtert ich war, diesem schrecklichen Moloch entkommen zu sein. Die Kälteallergie, die mich hinterher heimsuchte, war äußerst heftig und der Kinderarzt meinte erstaunt, dass eigentlich nur alte Menschen für so etwas anfällig seien, aber keine Kleinkinder.
Weil sich aus meinen traumatischen Erlebnissen Hospitalismus entwickelte, fing ich abends im Bett auch damit an, meinen Kopf auf dem Kissen hin und her zu bewegen. Irgendwann begann ich auch damit, bei dieser Wackelei zu singen: »Bier her, Bier her oder wir fall’n um!«
Das war mein erstes Lied, das ich singen konnte und ich steigerte mich bald auf eine beträchtliche Anzahl von Liedern, die ich beim allabendlichen Wackeln vor mich hin sang. Für mich war das völlig normal, ich schaukelte mich so in Trance, um einschlafen zu können. Dieses Ritual dauerte manchmal stundenlang und ich tat es bis zu meinem elften Lebensjahr; und zwar Nacht für Nacht.
Mich alleine in ein schönes Versteck zu stellen, das mir ein subjektives Schutzgefühl vermittelte, war auch eine weitere Verhaltensauffälligkeit von mir. Zum Beispiel zwischen die Büsche des Rasengrundstücks vor unserem Haus, die im Herbst so schön bunt waren. Ich hatte das Gefühl, dort stundenlang stehen bleiben zu können, ungesehen und unbeobachtet von den anderen. Dann hielt ich meinen Stuhlgang zurück so gut es ging, während mich das befriedigte.
Einmal gingen meine Eltern mit mir im Wald spazieren, ich denke, es war der Sachsenwald bei Hamburg, meine Mutter war gerade schwanger. Ich blieb plötzlich mitten auf dem Weg stehen und genoss dieses Gefühl von beruhigendem Blätterrascheln. Wahrscheinlich war ich von der faszinierenden Umgebung total überwältigt. Meine Eltern riefen nach mir, weil es ihnen mit mir wohl zu langsam ging. Doch ich konnte sie anscheinend nicht hören, denn ich war viel zu abgelenkt. Da gingen sie ein Stück weiter und plötzlich war mir klar, dass sie nicht mehr in Sichtweite waren, obwohl sich nur eine kleine Kuppe zwischen uns befand. Ich dachte, alleine gelassen worden zu sein. Meine Beine versagten mir den Dienst und waren wie einzementiert. Schreiend blieb ich auf der Stelle stehen statt hinterherzulaufen, wie andere Kinder es sicher getan hätten. Doch ich konnte nicht anders. Mein Vater war heimlich, ohne dass ich es gemerkt hatte, durch das Unterholz an mir vorbeigegangen und beobachtete mich von hinten. Auch meine Mutter war nicht zurückgekommen, um mir aus meiner Angststarre zu helfen.
Wahrscheinlich haben sie nicht verstanden, warum ich nicht hinter ihnen herkam, sondern nur schrie. Erinnern kann ich mich kaum noch daran. Mein Vater hat mir die Geschichte später einmal erzählt.
In dieser Zeit kam ich auch in den Kindergarten, wobei ich schon vorher mit anderen Kindern spielte und Kontakte zu einigen Jungs geknüpft hatte, die dann auch später mit mir in die Grundschule gingen. Doch mich mit den Erwachsenen zu unterhalten, war mir augenscheinlich wichtiger, als mit den Gleichaltrigen.
Besonders die junge Praktikantin Kerstin hatte es mir angetan. Sie erzählte mir einmal, wie sie mit ihren Eltern am Timmendorfer Strand gewesen war und diese plötzlich verloren hatte. Eine Stunde dauerte es, bis sie ihre Eltern wiederfand. Das Wachpersonal hatte ihr bei der Suche nach ihnen geholfen. Diese Geschichte wollte ich immer wieder hören.
Eines Tages schenkte mir jemand im Kindergarten eine große Gummispinne und ich war sehr stolz auf dieses Wabbelding. Mein Vater holte mich an diesem Tag ab und ich zeigte ihm stolz, was man mir geschenkt hatte. Er meinte: »Die zeigen wir mal Mutti.«
Als wir später im Auto saßen, forderte er mich dazu auf, während ich auf dem Rücksitz saß, meiner Mutter, die gerade auf der Beifahrerseite eingestiegen war, das Geschenk zu zeigen, das man mir im Kindergarten gemacht hatte. Erwartungsvoll hielt ich meiner Mutter die Spinne vor die Nase. Sie bekam einen hysterischen Schreianfall und wollte fast aus dem Auto springen, was mich sehr verunsicherte, denn ich hatte eine Anweisung befolgt, die mit Ablehnung »belohnt« wurde.
Irgendetwas Schlimmes musste an diesem Ding wohl gewesen sein, denn sonst hätte meine Mutter nicht so geschrien. Mein Vater grinste und die Spinne war später plötzlich einfach weg.
Ein paar Monate danach war ich wieder einmal irgendwo im Wald unterwegs, mein Vater sammelte gemeinsam mit einem Freund Pilze und ich war dabei. Ich begann damit, die Waldwege zu verlassen und durchs Unterholz zu stolzieren. In der Gegenwart von Erwachsenen fühlte ich mich dort sehr wohl.
Plötzlich stand ich aber vor dem gigantischen Radnetz einer Kreuzspinne, die mitten darin saß. Wie eine unüberwindliche Macht, gegen die ich scheinbar nichts unternehmen konnte, paralysierte mich dieser Anblick. Ich schrie wie meine Mutter beim Anblick der Gummispinne geschrien hatte, starrte die Kreuzspinne an und meine Beine gehorchten mir nicht mehr. Das arme Krabbeltier hatte keine Ahnung von der Macht, die es in dem Moment über mich hatte. Mein Vater und sein Freund forderten mich auf, um das Netz herumzugehen, aber ich schaffte es nicht, mich von der Stelle zu bewegen. Schließlich kam Peter, der Freund meines Vaters, zu mir und führte mich um das Netz herum. Erst da konnte ich meine Beine wieder bewegen.
Was ich bemerkenswert finde: Speziell mein Vater konnte mir wohl schon in meiner frühen Kindheit nicht das Gefühl geben, ein Halt für mich zu sein – im Gegenteil. Manchmal bekam ich zu spüren, wenn er »sich nicht mehr halten« konnte und mir dann zu verstehen gab, dass – seiner Meinung nach – nicht ich selbst Herr über mich war, sondern er.
Einmal wollte er zum Ohrenarzt gehen, was ich nicht wusste und mir vorher auch nicht mitgeteilt wurde. Ich stand, gemeinsam mit meinen Eltern, vor unserem Haus und plötzlich lief mein Vater einfach davon. Mich befiel mit einem Mal Panik, dass er nie wieder zurückkommen würde. Weinend rannte ich ihm nach, doch er ging einfach weiter.
Die Straße kam mir als Kind endlos lang vor, wie ein graues Asphaltband in die Ewigkeit. Die breitschultrige, untersetzte Silhouette meines Vaters wurde in der Ferne immer kleiner und mir war nicht bewusst, dass er nur einen Arzttermin wahrnehmen wollte. Ich lief zum Haus zurück, wo meine Mutter noch vor der Tür stand und mich erwartete. Ich schrie sie an, aber sie ging auf meine Gefühlsausbrüche nicht ein, weil sie in dem Moment offenbar keinen Draht zu mir finden konnte.
Daher lief ich wieder zur Straße und schrie erneut meinem Vater nach, der wegen meines Gebrülls zurückkam, mich bei der Hand nahm, in die Wohnung brachte und mir im Wohnzimmer den Hintern mit einem Bambusstock versohlte, weil ich so geschrien hatte. Der Stock lag immer griffbereit auf der Marmorplatte über der Heizung. »Ich bin lieb, ich bin lieb«, schrie ich dabei. Dann hörte er auf. Diesen Bambusstock habe ich noch einige Male mehr abgekriegt, woran ich mich sehr wohl auch heute noch erinnern kann. Als ich einmal die Gelegenheit dazu hatte, ihn kaputt zu machen, griff ich mir den Stock und zerbrach ihn, wobei hinterher sofort ein neues Exemplar dalag.
Der Druck musste weitergegeben werden: in dem Fall an unseren Papagei, der sich ebenfalls im Wohnzimmer befand. In ungestörten Momenten ging ich ins Zimmer und schüttelte den Käfig mitsamt Papagei dermaßen durch, dass dieser wohl dachte, sich im Karussell auf dem Hamburger Dom zu befinden. Bald schrie das machtlose Federvieh bereits auf, wenn ich nur das Zimmer betrat. Deshalb wurde der Vogel dann einem Bekannten geschenkt.
Weil Lothar in den Urlaub wollte brachte er den Vogel noch einmal zu uns. Ich stand schon an meiner Zimmertür und sagte, als er mit dem Papagei die Wohnung betrat: »Hier hinein, Lothar«, wobei ich spitzbübisch durch die offene Tür meines Zimmers in die gewünschte Richtung zeigte. »Ne, ne, Meister«, sagte Lothar und brachte den Käfig zielstrebig ins Wohnzimmer, das hinterher abgeschlossen wurde.
Als ich mitbekam, dass ich bald eine Schwester bekommen würde, schrie ich aufgebracht, dass ich sie in die Mülltonne werfen würde. Kaum das sie auf der Welt war, ärgerte ich sie bereits hin und wieder, indem ich sie zum Beispiel im Gesicht kratzte, wenn sie in ihrer Tragetasche auf dem Wickeltisch lag. Das kleine Bündel weinte natürlich unter den Schmerzen, die ich ihm mit meinen heimlichen Attacken zufügte. Meine Mutter merkte, was ich veranstaltete und wies mich zurecht. Aber ich versuchte, mich aus der Sache herauszureden, indem ich behauptete, meine »Konkurrentin« nur gestreichelt zu haben. Meine Mutter wusste natürlich, dass es so nicht war.
Schließlich baute ich mir doch einen kleinen Freundeskreis in der Nachbarschaft auf. Da war einmal Uwe, der zwei Blocks weiter wohnte. Irgendwann kam Sebastian dazu, den ich im Kindergarten kennenlernte und dann noch Oliver, der heute noch in dem Haus wohnt, in das seine Familie damals gerade einzog. Uwe und Oliver waren zwar kollegial, dann aber plötzlich wieder ruppig zu mir, wobei Uwe den Ton angab und Oliver lieber nur mitzog. Manchmal ritt sie der Teufel und Uwe schubste mich öfter. Ich heulte dann, konnte mich aber nicht gegen ihn wehren.
Einmal rutschte ich am Rand des Goldfischteichs, der vor seinem Haus lag, bei so einer Rangelei ab und landete im Wasser. Ein Glück, dass der Teich ganz flach war. Uwe und ich verkleideten uns auch als Cowboys und zogen so die Straße entlang. Wenn ich eine bestimmte Rolle spielte, war das wie ein Schutzpanzer für mich, unter dem ich meine traumatisierte Kinderseele verstecken konnte.
Gegenüber wohnten die Ottos. Herr Otto war im Zweiten Weltkrieg als Polizist bei der SS. Nach dem Krieg konnte er sich damit herausreden, als Polizeibeamter zum SS-Dienst gezwungen worden zu sein, also gab es für ihn keine strafrechtlichen Konsequenzen. In Wirklichkeit war und blieb er ein fremdenfeindlicher Rassist, der schon immer voll hinter seiner Einstellung gestanden hatte.
Er war ein kräftiger Mann mit Glatze und Segelohren. Seine riesigen Pranken kamen mir vor, wie Klodeckel mit angeklebten Gummiknüppeln. Wenn ich in das muffig riechende Wohnzimmer mit den alten Massivholzmöbeln kam, saß er in seinem Ohrensessel und trank Korn. Er begrüßte mich dann heiser mit den Worten: »Hallo, Herr Mücke!« Er nannte mich Mücke, weil ich so klein war. Angst hatte ich vor ihm, trotz seines barschen Auftretens, seltsamerweise gar nicht und ich glaube, das lag daran, dass ich ihn wie einen netten Onkel betrachtete, denn böse war er zu mir nie gewesen.
Ich war öfter bei ihm und seiner Frau in der Wohnung. Herr Otto war bis Anfang der achtziger Jahre weiterhin Leiter der örtlichen Polizeistation, und einer seiner Standardsprüche war: »Was die Juden hinter sich haben, haben die Türken noch vor sich.« Er hatte durchaus den Ruf, kein angenehmer Mensch zu sein.
Eines Tages betrat der Mitarbeiter einer Drückerkolonne unser Treppenhaus, und begegnete zufällig meiner Mutter, die gerade in den Keller musste. Der Mann sprach sie an und erzählte, dass er kurz zuvor aus dem Knast gekommen sei, und ob sie ihm nicht etwas abkaufen wollte. Sie verneinte das, und er fragte sie daraufhin: »Haben Sie was gegen Leute aus dem Gefängnis?«
»Nein, wir brauchen nur nichts zu lesen«, antwortete sie knapp. Dann klingelte der Typ bei den Ottos, Herr Otto riss die Wohnungstür auf, und fauchte sofort: »Was wollen Sie?«
Der Zeitschriftenheini zog seine Masche mit dem Knast ab, und Otto explodierte: »Gehen Sie erstmal arbeiten!« und er knallte dem Zeitschriftenheini die Tür krachend vor der Nase zu.
»Unverschämtheit!«, schnauzte der, und Otto riss die Tür sofort wieder auf.
»Was haben Sie gesagt? Passen Sie mal auf, dass ich nicht gleich meine Kollegen rufe, die buchten Sie dann nämlich wirklich ein.«
Peng! Die Tür knallte wieder zu. Der Zeitschriftenheini ging pöbelnd aus dem Treppenhaus, und Otto riss die Tür noch mal auf, weil er irgendetwas sagen wollte. Doch dazu kam er nicht, denn da öffnete ich unsere Wohnungstür, sah unseren Nachbarn an und sagte mit ruhiger Kinderstimme zu ihm: »Herr Otto, würden Sie bitte nicht so laut mit der Tür knallen, meine Schwester schläft gerade.«
Otto der Kampfkoloss wurde rot im Gesicht, japste nach Luft und schloss wortlos die Wohnungstür hinter sich. Ein Fünfjähriger hatte ihn kritisiert und der Zeitschriftenheini, vor dem er sich als Dorfsheriff aufplustern wollte, bekam das auch noch mit. Das war zu viel für ihn gewesen. Frau Otto machte meiner Mutter später den Vorwurf, dass ich mich Erwachsenen gegenüber nicht anständig benehmen würde – doch die sollte auch noch ihr Fett weg bekommen.
Einmal stand ich nämlich mit meinem neuen Spielzeuggewehr, dass ich geschenkt bekommen hatte, auf dem Rasen vor unserem Haus, während Frau Otto sich gerade auf ihrem Balkon befand. Ich richtete mein Gewehr auf sie und drohte: »Hände hoch, da sind echte Schrotkugeln drin!«
Sie fluchte fürchterlich und drohte verärgert zurück: »Ich komm da gleich mal runter und zerhack dein Gewehr, dann brüllst du aber!«
Zu meiner Mutter meinte sie: »Unmöglich, wie sie ihren Sohn erziehen, genau so werden Kinder zu Terroristen gemacht.«





























