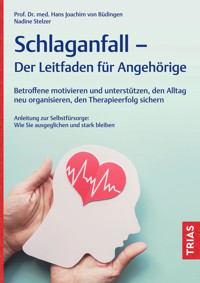
24,99 €
Mehr erfahren.
Schlaganfall-Betroffene zurück ins Leben begleiten
Wenn der Partner, die Mutter oder enge Freunde einen Schlaganfall erleiden, steht auch die Welt der Angehörigen Kopf. Sie wollen da sein und helfen, doch die Betreuung eines Schlaganfall-Betroffenen kann überfordern. Jetzt ist es wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren, denn Fortschritte Richtung Normalität sind zu jeder Zeit möglich.
Professor Hans Joachim von Büdingen, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie sowie Gründer der Deutschen Schlaganfallbegleitung gGmbH, kennt die Bedürfnisse und Schwierigkeiten von Angehörigen aus erster Hand. Zusammen mit Sprachexpertin Nadine Stelzer, die privat immer wieder mit dem Thema Schlaganfall in der Familie konfrontiert war, teilt er sein langjähriges Wissen.
- Wenn es ernst wird: Wie Sie im Akutfall schnell und richtig reagieren
- Nach der Reha: Im neuen Alltag ankommen. Tipps und Strategien zum Umgang mit körperlichen Beeinträchtigungen und Verhaltensänderungen
- Motivation, Unterstützung, Prävention: Therapietreue sicherstellen und einen erneuten Schlaganfall verhindern
- Selbstfürsorge: Sich gut um sich selbst kümmern – körperlich und seelisch
- Extra für Eltern: Schlaganfall bei Kindern und Jugendlichen
Der unverzichtbare Schlaganfall-Begleiter für Angehörige
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Schlaganfall – Der Leitfaden für Angehörige
Betroffene motivieren und unterstützen, den Alltag neu organisieren, den Therapieerfolg sichern. Anleitung zur Selbstfürsorge: Wie Sie ausgeglichen und stark bleiben
Prof. Dr. med. Hans Joachim von Büdingen, Nadine Stelzer
1. Auflage 2025
© SewcreamStudio/stock.adobe.com – edited and composed by Thieme |
Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Zusammenarbeit als Autor und Autorin begann 2021. Ein Neurologe und Schlaganfallexperte traf auf eine Lektorin mit mehreren Hirninfarkten in ihrer Familie.
Wir haben die Stimmen vieler Menschen gehört, denen es wahrscheinlich ähnlich geht wie Ihnen. Sie stehen jemandem nahe, der einen Schlaganfall erlitten hat. Nun gilt es, das Leben mit dieser chronischen Krankheit und ihren Folgen zu bewältigen.
Ob das ein Familienmitglied ist oder jemand, mit dem Sie freundschaftlich verbunden sind: Alle haben bestimmte Gemeinsamkeiten. Viele offene Fragen stehen im Raum. Sie müssen sich mit schwierigen Themen und Gefühlen auseinandersetzen. Es gilt, Informationslücken zu füllen, damit die Therapie gelingt und bürokratische Hürden ohne Angst genommen werden können. Dieses Wissen und unsere Antworten haben wir nun in ein Buch gepackt. Wir hoffen, dass die Inhalte für alle eine Unterstützung sind, die mit der Erkrankung Schlaganfall zu tun haben.
Besonders liegt uns die emotionale Unterstützung am Herzen. Wir möchten das Verständnis für Schlaganfallbetroffene und deren Sichtweise stärken. Und auch Sie benötigen Kraft, um den eigenen Herausforderungen zu begegnen. Praktische Tipps zur Selbstfürsorge haben daher einen hohen Stellenwert in diesem Leitfaden.
Ein weiteres persönliches Anliegen von uns ist es, das Wissen über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten des Schlaganfalls für alle zugänglich zu machen. Denn wer medizinische Zusammenhänge versteht, kann dazu beitragen, das Risiko eines (erneuten) Schlaganfalls zu verringern.
Dieses Buch gäbe es nicht ohne die Deutsche Schlaganfallbegleitung gGmbH und die Menschen, die ihre Erfahrungen als Angehörige oder Betroffene mit uns geteilt haben. Sie haben die Themen mit ihren Geschichten, Fragen, Bedürfnissen und Tipps inspiriert. Ihnen gebührt unser herzlichster Dank.
Prof. Dr. Hans Joachim von Büdingen und Nadine Stelzer im Frühjahr 2025
© Berit Kessler/stock.adobe.com – edited and composed by Thieme |
Teil I: Der Schlaganfall
Wie kommt es zum Schlaganfall und wie äußert er sich? Für ein besseres Verständnis beginnen wir mit der Beschreibung der Erkrankung, ihrer Risikofaktoren und Symptome.
Was ist ein Schlaganfall?
Das Wissen um das medizinische Phänomen »Schlaganfall« wird Ihnen helfen, einen Schlaganfall zu erkennen und entsprechend zu handeln, auch um den Therapieerfolg zu sichern.
Das Wort Schlaganfall ist der Sammelbegriff für eine schlagartig und akut auftretende Durchblutungsstörung des Gehirns. Abhängig von der Ursache werden vier Gruppen von Schlaganfällen unterschieden: die transitorische ischämische Attacke (TIA), der Hirninfarkt, die Hirnblutung und die Subarachnoidalblutung.
Der Gedanke ist beklemmend, dass etwas im Inneren unseres Körpers vorgeht, das sich nicht ankündigt, zum Teil nicht einmal Schmerzen verursacht und doch so starke Auswirkungen hat. Damit Sie besser einordnen können, was bei einem Schlaganfall eigentlich passiert, lohnt sich ein Blick auf die wichtigsten medizinischen Grundlagen.
In diesem Zusammenhang erklären wir auch Fachbegriffe, die Ihnen im Gespräch mit den Ärztinnen und Ärzten, in der Therapie oder beim Lesen von Befundberichten vielleicht schon begegnet sind und immer wieder begegnen werden.
Hirninfarkt (ischämischer Schlaganfall)
Der Hirninfarkt ist eine abgegrenzte Schädigung in einem Bereich des Gehirns mit neurologischen Störungen. Die Ursache ist eine Ischämie (Mangeldurchblutung). Eine meist nur wenige Minuten dauernde Durchblutungsstörung des Gehirns wird als transitorische ischämische Attacke bezeichnet, abgekürzt TIA.
In beiden Fällen kann das Blut in einem hirnversorgenden Blutgefäß, einer Arterie, nicht ungehindert fließen. Meist sind Blutgerinnsel oder Gefäßverengungen durch Arteriosklerose die Hauptursachen für die »Verstopfung«. Das von der betroffenen Arterie versorgte Hirngewebe wird dann im Extremfall nicht mehr durchblutet, dadurch wird diese Hirnregion unzureichend mit Energie versorgt. Vor allem Zucker und Sauerstoff fehlen als wichtigste Energiequellen.
Bei einer TIA löst sich die Durchblutungsstörung innerhalb kurzer Zeit wieder auf, sodass keine bleibenden Schäden entstehen. Trotzdem ist eine TIA ein wichtiges Warnsignal, da sie das Risiko für einen späteren Hirninfarkt erhöht.
Bei einem Hirninfarkt dagegen bleibt die Durchblutung zu lange unterbrochen. Infolgedessen sterben Nervenzellen in der betroffenen Region ab, wodurch Teile des Hirngewebes ihre Funktion verlieren. Diese Funktionsstörungen äußern sich durch unterschiedliche körperliche, geistige und seelische Symptome. Hirninfarkte und TIAs treten meistens ohne Kopfschmerzen auf.
Blutversorgung des Gehirns
Vier große Arterien transportieren das Blut zu unserem Gehirn. Die beiden Halsschlagadern (Karotiden) sind für die Durchblutung der Augen und der vorderen und mittleren Anteile des Großhirns verantwortlich. Der Hirnstamm, das Kleinhirn und der hintere Anteil des Großhirns werden von zwei Wirbelarterien (Vertebralarterien) versorgt, die sich nach dem Eintritt in den Schädel zur Arteria basilaris vereinigen. Durch den Arterienkreis an der Hirnbasis sind die Karotiden und Vertebralarterien miteinander verbunden.
Wie schwer die neurologischen Auswirkungen eines Hirninfarkts sind, hängt auch von der Möglichkeit der Kollateralversorgung ab. Als Kollaterale wird ein Umgehungskreislauf bezeichnet, der den Blutmangel in der direkt betroffenen Hirnregion kompensieren kann. Zum Beispiel kann bei einem arteriosklerotischen Verschluss der inneren Halsschlagader im Halsbereich die Hirndurchblutung über die gegenseitige innere Halsschlagader und/oder die Wirbelarterien aufrechterhalten werden.
Die Blutversorgung des Gehirns
Transitorische ischämische Attacke (TIA)
Meistens dauern die Symptome dieser Mangeldurchblutung einer Hirnregion nur wenige Minuten an. Medizinisch gesehen handelt es sich aber um einen Schlaganfall. Die Symptome einer TIA bilden sich allerdings immer vollständig innerhalb von 24 Stunden zurück.
Wie ist das möglich? Hier leistet unsere natürliche, körpereigene Blutgerinnung ganze Arbeit. Der Körper löst kleinere Gerinnsel in Blutgefäßen ohne ärztliches Eingreifen auf. Selbst mit einer Computer- oder Kernspintomografie des Gehirns ist meistens keine Schädigung von Hirngewebe erkennbar.
Die TIA wird auch als leichter Schlaganfall oder »Schlägle« bezeichnet. Was sich so harmlos anhört, ist in Wahrheit oft die Vorwarnung für einen Hirninfarkt. Sie sollten daher auch bei einer TIA alle Notfallmaßnahmen ergreifen. Damit es nicht zu einem nachfolgenden Schlaganfall kommt, muss ein Schlägle auf der Stroke-Unit (Schlaganfallspezialstation) untersucht und behandelt werden.
Hirninfarkt und Hirnbereiche
Das Gehirn und seine verschiedenen Bereiche
Hirninfarkte können alle Bereiche des Gehirns betreffen. In der Medizin unterscheiden wir – abhängig von der betroffenen Hirnregion – zwischen Infarkten im Bereich des Großhirns, Hirnstamminfarkt, Ponsinfarkt, Kleinhirninfarkt, Stammganglieninfarkt und Thalamusinfarkt. Die Folgen der Hirnschädigung hängen also davon ab, an welcher Stelle des Gehirns und in welchem Ausmaß die Durchblutungsstörung stattgefunden hat.
Wir beschreiben im Folgenden die Hirnregionen und ihre Funktionen, damit Sie sich eine bessere Vorstellung von den Auswirkungen machen können.
Hirninfarkte im Bereich des Großhirns
Die meisten Hirninfarkte betreffen das Großhirn. Anatomisch wird es in vier Regionen oder Lappen mit sehr unterschiedlichen Funktionen eingeteilt:
Stirn-, Scheitel- und Schläfenlappen werden über den vorderen Hirnkreislauf, das Karotissystem, versorgt. Der hintere Hirnkreislauf, das vertebrobasiläre System, ist neben dem Hirnstamm und Kleinhirn für den Hinterhauptslappen unseres Gehirns zuständig.
Verschließt eine der Arterien im vorderen oder hinteren Hirnkreislauf, führt das zu charakteristischen neurologischen Ausfällen. Dazu gehören Sehstörungen bis zur Erblindung, halbseitige Lähmungserscheinungen und Gefühlsstörungen, Sprach- und Sprechstörungen sowie Beeinträchtigungen des Bewusstseins. Durch die infarktbedingte Hirnschwellung (Ödem) kann es zu einer Steigerung des Hirndrucks kommen.
Auf eine Mangeldurchblutung von Arterien des vertebrobasilären Systems folgen oft beiderseitige motorische oder sensible neurologische Ausfälle. Auch Störungen der Augenmotorik, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen, Sprech- und Schluckstörungen, Schwindel, Sturzattacken oder Bewusstseinsstörungen sind möglich.
Hirnstamminfarkt
Der Hirnstamm setzt sich anatomisch aus dem Mittelhirn, der Brücke (Pons) und dem verlängerten Rückenmark (Medulla oblongata) zusammen. Durch ihn verlaufen alle Nervenbahnen, die den Körper mit dem Groß- und Kleinhirn verbinden.
Ein Schlaganfall in diesem Bereich kann lebensbedrohliche Komplikationen als Folge haben, denn der Hirnstamm ist für die Kontrolle lebenswichtiger Funktionen wie Atmung, Herzschlag und unseren Schlaf-Wach-Rhythmus verantwortlich.
Kleinhirninfarkt
Das Kleinhirn regelt die Steuerung unserer Motorik: Es plant und koordiniert Bewegungsabläufe. Mithilfe dieser Hirnregion lernen wir außerdem, uns auf bestimmte Arten zu bewegen.
Das Kleinhirn ist mit dem Großhirn und dem Rückenmark verbunden. Es wurde festgestellt, dass dieser Bereich unter anderem an Denkprozessen und der Bewertung von Sachverhalten beteiligt ist. ▶ [1] Nach einem Kleinhirninfarkt können daher auch Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit, sogenannte kognitive Störungen, auftreten.
Ponsinfarkt
Der Pons (Brücke) ist ein Teil des Hirnstamms, der als Schaltzentrale zwischen Großhirn, Kleinhirn und Rückenmark dient und wichtige Funktionen wie die Steuerung der Atmung, den Schlaf-Wach-Rhythmus und motorische Prozesse unterstützt. Oft trifft ein Schlaganfall in diesem Teil des Hirnstamms auch umliegende Gebiete im Kleinhirn oder im verlängerten Rückenmark. Es gibt eine Form des Ponsinfarktes mit schweren Folgen und Symptomen durch die Basilaristhrombose, den Verschluss der Arteria basilaris. Ihre Äste versorgen den Hirnstamm und das Kleinhirn mit Blut.
Stammganglieninfarkt
Als Stammganglien bezeichnen wir Ansammlungen von Ganglien (Nervenzellen), die auf beiden Seiten tief im unteren Bereich des Großhirns und im Mittelhirn liegen.
Sie spielen eine wichtige Rolle für den geordneten Ablauf unserer Bewegungen. Das betrifft unter anderem unseren Gang, handwerkliche Tätigkeiten, Klavierspielen, Fahrradfahren oder Sportarten wie das Tennisspielen. Die Stammganglien sind auch für unwillkürliche Bewegungen wie Mimik und Gestik verantwortlich.
Mögliche Symptome eines Stammganglieninfarkts sind ein einseitig herabhängender Mundwinkel, eine Halbseitenlähmung auf der Gegenseite, Sprachstörungen, eine Gesichtsfeldeinschränkung, ein Zittern im Bereich der Extremitäten oder des Kopfes (Tremor), Koordinationsstörungen, die Einschränkung oder der Verlust von Empfindungen wie Berührung, Schmerz oder Temperatur (Sensibilitätsstörungen) oder kognitive Einschränkungen im Rahmen einer vaskulären Demenz.
Thalamusinfarkt
Wir bezeichnen den Thalamus nicht ohne Grund auch als »Tor zum Bewusstsein«. Er ist die größte Ansammlung von Nervenzellen des Zwischenhirns und koordiniert alle Sinneseindrücke aus der Um- und Innenwelt unseres Körpers. Eindrücke des Sehens, Hörens und der Körperempfindungen wie Temperatur, Berührung und Schmerz werden dort gefiltert und zur Bewusstwerdung an die Großhirnrinde weitergeleitet.
Unsere Berührungsempfindung zeigt, wie wichtig diese Filterfunktion ist. Wir spüren Kleidung an unserem Körper erst dann bewusst, wenn wir uns auf deren Berührung konzentrieren. Wenn der Körper allerdings im Alltag beansprucht ist, nehmen wir diese Berührung nicht wahr. Sie wird herausgefiltert.
Die Blutversorgung des Thalamus erfolgt über die hinteren Halsarterien und ihre Verzweigungen im Gehirn.
Ein Thalamusinfarkt kann sich über Symptome äußern wie Doppelbilder, Gesichtsfeldausfälle, Schluckstörungen, Schwindel, Bewusstseinsveränderungen, Gedächtnisstörungen, Sprachstörungen und Leseschwierigkeiten, Gefühlsstörungen auf der Gegenseite des Thalamusinfarkts oder die Lähmung der Muskulatur (Hemiparese) der Gegenseite.
Hirnblutung
Wenn eine Arterie im Gehirn brüchig wird, der Blutdruck außergewöhnlich hoch ist oder eine Gefäßmissbildung (Angiom) vorliegt, kann es zum Einreißen der Gefäßwand mit Einblutung in das Hirngewebe kommen. Bei dieser sogenannten intrazerebralen Blutung verdrängt das Blut Hirngewebe und erhöht den Hirndruck. Das verursacht meist sehr starke Kopfschmerzen.
Nicht selten tritt bei einer Hirnblutung ein einmaliger epileptischer Anfall auf. Die neurologischen Störungen nach einer Hirnblutung richten sich nach der betroffenen Hirnregion und sind identisch mit denen nach einem Hirninfarkt. Anhand der Beschwerden und dem Ergebnis der neurologischen Untersuchung kann nicht entschieden werden, ob es sich um einen Hirninfarkt oder eine Hirnblutung handelt. Diese Unterscheidung ist mit der Computertomografie des Schädels (CT) möglich.
Subarachnoidalblutung (SAB) oder Aneurysmablutung
Als SAB wird eine schlagartig auftretende Blutung in den Nervenwasserraum (Subarachnoidalraum) bezeichnet. Die häufigste Ursache ist der Einriss einer dünnwandigen Gefäßaussackung (Aneurysma) einer hirnversorgenden Arterie.
Eine SAB kann eine akute Bewusstlosigkeit auslösen. Auch neurologische Störungen können auftreten, wenn durch die Blutung Hirngewebe zerstört wird. Wichtigste Alarmzeichen sind stärkste, ungewohnte Schmerzen im Hinterkopf- und Nackenbereich, nicht selten mit Übelkeit und Erbrechen.
Alle Schlaganfälle sind ein Notfall
Je länger unser Gehirn ohne Blutversorgung auskommen muss, desto schwerer können die bleibenden Schäden sein. Es ist also wichtig, den Schlaganfall möglichst schnell zu erkennen und notfallmedizinisch behandeln zu lassen. Auch eine nur kurz andauernde TIA kann Vorbote eines Schlaganfalls sein.
Wie kommt es zu einem Schlaganfall?
Aus heiterem Himmel ist nichts mehr wie vorher. Die Frage nach dem Warum treibt die Betroffenen um – und die Menschen, mit denen sie in engem Kontakt leben.
Für die Behandlung eines Schlaganfalls spielt die Ursache eine zentrale Rolle. Doch auch in der Nachsorge nimmt sie einen hohen Stellenwert ein. Schließlich geht es darum, einen weiteren Schlaganfall zu verhindern. Bei einigen der Hirninfarkte oder TIAs kann trotz intensiver Untersuchungen keine Ursache gefunden werden. In den übrigen Fällen ist die Kenntnis der Ursache eines Hirninfarkts oder einer Hirnblutung die Grundlage für alle Entscheidungen zur Behandlung.
Ursache und Entwicklung: Ätiologie und Pathogenese
Ätiologie bezeichnet die Ursache einer Erkrankung. Wenn Sie im Arztbericht die Aussage »ätiologisch ungeklärt« finden, bedeutet das, dass die Ursache nicht gefunden werden konnte.
Der Begriff Pathogenese beschreibt die Entwicklung körperlicher und psychischer Erkrankungen oder den Verlauf eines krankhaften Prozesses seit dessen Auftreten.
Beispiel einer Pathogenese: vom Bluthochdruck zum Hirninfarkt
Der Risikofaktor Bluthochdruck entwickelt sich meist schmerzlos, unbemerkt und schleichend. Die Folge ist eine langsam fortschreitende Wandveränderung in den Arterien, die Arteriosklerose: Fette, Kalk und andere Ablagerungen sammeln sich in den Arterienwänden an. Dies führt zur Einengung (Stenose) oder zum Verschluss (Okklusion) von Gefäßen, der Blutfluss wird behindert. Oft sind die hirnzuführenden Arterien betroffen.
Nehmen wir die Halsschlagader: An einer Stenose der Halsschlagader kann sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) bilden. Löst sich dieses ab und verstopft eine Arterie im Inneren des Gehirns, unterbindet es die lebenswichtige Sauerstoff- und Nährstoffversorgung einer Hirnregion. Es kommt zu einem Hirninfarkt.
Das Blutgerinnsel ist also die Ursache der Durchblutungsstörung. Die Risikofaktoren, die Entwicklung der Arteriosklerose und die Stenose mit Bildung eines Blutgerinnsels erklären den pathogenetischen Prozess.
Ursachen eines Hirninfarkts
Die Kenntnis der Ursache eines Hirninfarkts ist die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung und Nachsorge. Überwiegend sind es krankhafte, meist arteriosklerotische Veränderungen der hirnversorgenden Arterien oder Blutgerinnsel, die zum Blutmangel in einer Hirnregion führen und damit einen Hirninfarkt auslösen.
Arteriosklerose und Stenosen hirnversorgender Arterien
Arteriosklerotische Wandveränderungen in arteriellen Blutgefäßen entwickeln sich über Jahre hinweg, ohne dass Betroffene davon etwas bemerken.
Viele kennen die Arteriosklerose auch als Gefäßverkalkung. Die Innenwand einer Arterie verdickt sich zunehmend durch Einlagerung von Kalk und Blutfetten wie Cholesterin. Diese Ablagerungen werden als Plaque bezeichnet. Das Gefäß wird eingeengt und eine Stenose entsteht. Diese Einengung kann bis zum Verschluss führen.
Plaques bilden sich oft an Aufzweigungen der Arterien. Nach der Stenose können Verwirbelungen des Blutes auftreten, die die Entstehung von Blutgerinnseln begünstigen.
Die Arteriosklerose betrifft vor allem die hirnversorgenden Arterien im Halsbereich. Das bekannteste Beispiel ist die Karotisstenose. Auch die Herzkranzarterien, Becken-Bein-Arterien und die Hauptschlagader Aorta sind bevorzugte Gefäße für die Arteriosklerose.
Verengungen von Arterien mit großem Durchmesser bezeichnet man als Makroangiopathie. Betroffen sind häufig die vorderen und die hinteren Halsschlagadern. Wenn kleine Arterien mit geringem Durchmesser betroffen sind, wird von einer Mikroangiopathie gesprochen.
Thrombose und Thromboembolie
Ein Thrombus ist ein Blutgerinnsel, das sich innerhalb des Gefäßsystems an Arterien, Venen oder im Herzen bildet. Verschließt er teilweise oder vollständig ein Gefäß, kann eine Thrombose entstehen. Das wohl bekannteste Beispiel ist die tiefe Beinvenenthrombose.
Als Embolie oder genauer gesagt als Thromboembolie wird der Verschluss eines Blutgefäßes durch einen losgelösten und fortgeschwemmten Thrombus bezeichnet. Auf diese Art kann ein thrombo-embolischer Hirninfarkt entstehen: durch ein Blutgerinnsel aus dem Herzen bei Vorhofflimmern oder aus einer Stenose mit Gerinnselbildung im Bereich der Halsarterien.
Herzerkrankungen
Alle Herzerkrankungen erhöhen das Risiko für einen Schlaganfall.
Vorhofflimmern: Besonders häufig ist die Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern, bei der sich Blutgerinnsel im linken Vorhof des Herzens bilden können.
Herzklappenerkrankungen: Auch durch Erkrankungen der Herzklappen oder nach Einsetzen einer mechanischen Herzklappe kann es zur Thrombenbildung mit der Folge einer Embolie im Hirnkreislauf kommen.
PFO: Bei manchen Betroffenen lässt sich ein persistierendes Foramen ovale (PFO) nachweisen. Das Foramen ovale ist eine vorgeburtliche Öffnung zwischen dem rechten und linken Herzvorhof. Besteht dieses ovale Loch nach der Geburt als PFO weiter, können Blutgerinnsel aus dem venösen System vom rechten in den linken Herzvorhof und damit in das arterielle System gelangen. Dies wird auch als Rechts-Links-Shunt bezeichnet.
Wenn Blutgerinnsel in den Hirnkreislauf gelangen, ist ein Hirninfarkt die Folge. Liegt neben der offenen Trennwand noch eine Aussackung (Vorhofseptumaneurysma) vor, ist das Risiko für eine Embolie zusätzlich erhöht.
Gefäßeinriss an den Halsarterien (Dissektion)
Die Einblutung in die Gefäßwand einer hirnversorgenden Arterie verursacht eine zunehmende Gefäßverengung, zum Teil mit Gerinnselbildung. In vielen Fällen kommt es sogar zu einem Verschluss der Arterie im befallenen Bereich.
Oft ist die Ursache einer Dissektion nicht erkennbar. Man spricht dann von einer spontanen Karotis- oder Vertebralis-Dissektion. Auslöser kann aber auch eine schwere stumpfe Verletzung im Halsbereich, wie ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule, sein.
Sinusthrombosen und Venenthrombosen des Gehirns
Wenn ein Blutgerinnsel eine Hirnvene verstopft, kommt es zum Rückstau von Blut und Durchblutungsstopp in der vorgelagerten Hirnregion. Es entstehen »Stauungsinfarkte«, also Hirninfarkte durch den gestörten Blutabfluss. Man spricht dann von einer Hirnvenenthrombose oder Sinusvenenthrombose.
Im Gegensatz zu einem schlagartig auftretenden Hirninfarkt oder einer Hirnblutung treten die Symptome einer Sinusthrombose schleichend und oft mit diagnostisch nur schwer einzuordnenden Symptomen auf. In den meisten Fällen beginnt die Erkrankung mit ungewohnten, zunehmenden Kopfschmerzen. Sie verstärken sich im Liegen und können von Übelkeit und Erbrechen begleitet sein. Später können dann neurologische Symptome wie eine Sprachstörung oder Halbseitenlähmung auftreten.
Bei den Sinusthrombosen wird zwischen septischen Thrombosen durch eine bakterielle Infektion im Gesichts- und Nasennebenhöhlenbereich und nichtseptischen Thrombosen unterschieden. Letztere sind häufiger und werden zum Beispiel durch Störungen der Blutgerinnung, Nikotinmissbrauch, die Anti-Baby-Pille, durch Druck eines Tumors auf eine Hirnvene oder eine Schädel-Hirn-Verletzung verursacht. Die Diagnose wird durch die Darstellung der Blutgefäße des Gehirns mittels der Computer(CT)-Angiografie oder der Magnetresonanztomografie (MRT) gestellt.
Weitere Ursachen
Seltene Ursachen für einen Hirninfarkt sind Blutgerinnungsstörungen mit verstärkter Gerinnungsneigung oder eine Migräne. Auch Autoimmunerkrankungen und entzündliche Gefäßerkrankungen (Vaskulitiden) durch bakterielle Erreger wie Tuberkulose oder Pilze und Viren können Erkrankungen der Hirnarterien verursachen.
Ursachen einer Hirnblutung
Die häufigsten Ursachen für Blutungen ins Hirngewebe sind ein stark erhöhter Blutdruck, angeborene Gefäßmissbildungen (Angiome) oder arteriosklerotische Gefäßwandveränderungen.
Wenn Blutgefäße platzen oder die Gefäßwand einreißt, wühlt sich das austretende Blut ins umliegende Hirngewebe. Es zerstört dort Nervenzellen und Nervenbahnen. Platzt ein Hirngefäß durch extreme Blutdruckspitzen, sprechen wir von einer hypertensiven Blutung.
Bei älteren Menschen kann es in den Gefäßwänden zur Ablagerung des Eiweiß-Abbau-Produkts Amyloid kommen. Amyloide können die Gefäßwände schwächen und eine Blutung in die Hirnsubstanz auslösen.
Mögliche Verursacher von Blutungen sind außerdem Schädelverletzungen, Hirntumore, Metastasen oder Entzündungen der Hirngefäße. Teilweise sorgt auch der Konsum von Drogen für krankhafte Gefäßentzündungen und gefährlich erhöhte Blutdruckwerte.
Blutet es nach einem Hirninfarkt in das abgestorbene Hirngewebe, spricht man von einem blutig umgewandelten oder hämorrhagischen Infarkt.
Mögliche Auslöser für einen Hirninfarkt oder eine Hirnblutung
Aneurysmen
Die häufigste Ursache für eine Subarachnoidalblutung in den Nervenwasserraum (Liquorraum) des Gehirns ist ein Aneurysma an einer hirnversorgenden Arterie. Platzt diese dünnwandige Erweiterung oder Aussackung (Ausbuchtung) des Blutgefäßes innerhalb des Schädels, strömt Blut in den Raum zwischen Gehirn und Schädelbasis. Das führt zu einem plötzlichen Anstieg des Hirndrucks.
Meist sind Aneurysmen angeboren. Sie können aber auch in höherem Alter durch eine Schwächung der Gefäßwand entstehen. Sie bleiben in der Regel symptomlos und werden zufällig im Rahmen einer Computer- oder Kernspintomografie des Schädels entdeckt. Dann entsteht oft der Entscheidungskonflikt, ob das Aneurysma operiert oder belassen und sein Wachstum kontrolliert werden soll. Die Frage ist also: Ist das Risiko des Platzens (Ruptur) höher als das Risiko eines Eingriffs?
Der Kryptogene Schlaganfall
Manchmal bleiben die Untersuchungen zur Ursache ergebnislos oder uneindeutig. Der medizinische Begriff dafür ist kryptogener Schlaganfall. In der Fachliteratur wird auch der Begriff ESUS verwendet. Die englische Abkürzung steht für einen embolischen Schlaganfall ungeklärten Ursprungs. Diese Bezeichnung trifft nur zu, wenn als Ursachen eine Stenose, eine Dissektion, Vorhofflimmern, ein Herzklappenfehler oder ein Verschluss kleinster tiefer Hirnarterien ausgeschlossen sind.
Unbemerkte Ursachen
Häufig kommt es vor, dass Risikofaktoren für eine Arteriosklerose nicht bemerkt, erkannt und dadurch nicht behandelt werden. Vor allem Bluthochdruck, Diabetes und Cholesterinerhöhung entwickeln sich meistens ohne besondere Beschwerden und sind deshalb so gefährlich.
Inzwischen ist bekannt, dass 80–90 Prozent der Schlaganfälle durch Vorbeugung (Prävention) verhindert werden könnten, da sie durch bekannte und behandelbare Risikofaktoren ausgelöst werden. ▶ [2]
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen decken diese Risikofaktoren wahrscheinlicher auf und bieten Möglichkeiten zur Kontrolle und Behandlung. Doch manchmal werden die Risikofaktoren zu spät entdeckt.
Manche Patientinnen und Patienten erzählen stolz, dass sie ewig nicht mehr bei einer ärztlichen Untersuchung waren. Es zwicke manchmal an der ein oder anderen Stelle, aber sonst gäbe es keine gesundheitlichen Probleme. Sie fühlten sich körperlich und geistig fit und bräuchten keine Medikamente.
Nicht selten stellt sich erst auf einer Intensivüberwachungsstation bei der Behandlung eines Schlaganfalls heraus, dass ein anhaltend erhöhter Blutdruck, eine Herzrhythmusstörung, ein Diabetes oder ein erhöhter Cholesterinwert vorliegt. Von alldem wissen Betroffene oft nichts.
Arztbericht checken
Vielleicht haben Sie Interesse daran, den Arztbericht Ihres oder Ihrer Angehörigen mit den Ursachen zu vergleichen, die wir Ihnen in diesem Kapitel vorgestellt haben. Beim gemeinsamen Prüfen lernen Sie beide mehr über den Schlaganfall. Voraussetzung ist natürlich das Einverständnis der betroffenen Person.
Noch keinen Arztbericht erhalten? Fragen Sie im Krankenhaus oder in der Hausarztpraxis nach.
Wenn Sie ganz sichergehen wollen, ob Sie alles verstanden haben, richten Sie Ihre Fragen an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte.
Tipp
Für zurückliegende, nicht aktuelle Erkrankungen wird im Arztbericht häufig die Abkürzung Z. n. verwendet. Sie steht für den Zustand nach …
Ein Beispiel: Nach einem Herzinfarkt, der einige Jahre zurückliegt, steht dann im Befund »Z. n. Myokardinfarkt«.





























