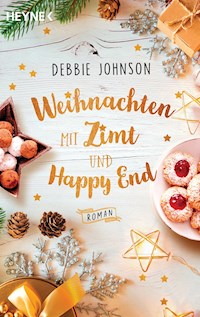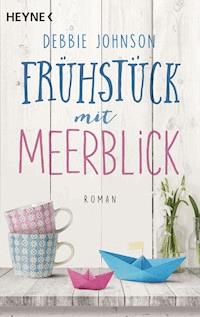9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Comfort Food Café-Reihe
- Sprache: Deutsch
Herzlich Willkommen im gemütlichen Comfort Food Café!
Als Zoes beste Freundin Kate an Brustkrebs stirbt, stellt das ihre Welt auf den Kopf. In nur wenigen Stunden wird sie von der verrückten Nachbarin, die kaum eine Pflanze am Leben erhalten kann, zu einer Frau, die Verantwortung übernehmen muss. Denn sie ist nun die Erziehungsberechtigte für Kates sechzehnjährige Tochter Martha. Zoe zieht zusammen mit Martha in das kleine Dörfchen Budbury, in der Hoffnung, dass die frische Seeluft und das beschauliche Leben ihnen helfen, Kates Tod zu verarbeiten. Und die beiden haben Glück: Die Menschen dort sind sehr freundlich und haben stets ein offenes Ohr und eine Schulter zum Anlehnen. Als plötzlich Marthas lange verschwundener Vater auftaucht, sind die beiden umso mehr auf die Liebe und Unterstützung ihrer neuen Freunde angewiesen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
DAS BUCH
Alle Bücher sind zerlesen und stehen kunterbunt durcheinander in den Regalen. Das ist zwar völlig im Einklang mit der Atmosphäre des Cafés, doch trotzdem verspüre ich dieses berufsmäßige Verlangen, sie nach Alphabet und Sachthemen zu ordnen. Merkwürdigerweise mag ich ordentliche Bücherregale, auch wenn ich mich sonst liebend gern vor der Hausarbeit drücke. Einen klitzekleinen Augenblick lang vermisse ich meine Arbeit: Die enorme Tragweite der Veränderungen wird mir schlagartig bewusst. Mir war Karriere nie wichtig, doch ich habe meine Arbeit gemocht. Ich habe es geliebt, in der Nähe von Büchern zu sein, mit Menschen über Bücher zu sprechen und sie zu riechen, wenn ich eine neue Lieferung mit dem Teppichmesser geöffnet habe. Jetzt bin ich arbeitslos und zanke mich nur noch mit einem Teenager herum. Ehe die miese Stimmung mich richtig erfassen kann, taucht ein riesiges Stück Biskuitkuchen vor meinem Gesicht auf. Der Kuchen liegt auf einem Teller, den eine Hand festhält, die, als ich mich verdutzt umdrehe, Laura gehört. Sie grinst und hält ihn mir verführerisch unter die Nase. Der Kuchen ist noch warm, zarter Dampf steigt von ihm auf, und er riecht einfach … köstlich. Fast so gut wie neue Bücher.
»Apfel?«, frage ich stirnrunzelnd, während ich versuche, die weiteren Aromen zu identifizieren. »Zimt? Und … noch was. Was ist das?«
»Kürbis«, antwortet sie und freut sich, mich reingelegt zu haben.
»Ab jetzt wird es ruhiger«, erklärt sie und führt mich zu einem kleinen Tisch in der Ecke. Sie lässt mich auf einem Stuhl Platz nehmen und stellt mir den Kuchen zusammen mit einer Kuchengabel, einem Löffel und einer kleinen Schüssel mit frischer Schlagsahne hin. »Dann werde ich kreativ. Letzten Winter habe ich alle möglichen Geschmacksrichtungen in puncto heißer Schokolade ausprobiert – Chili, Orange, Minze, Rum … du verstehst schon.«
Während ich ihr zuhöre und fast schon zu sabbern beginne, gibt sie mir mit einer Geste zu verstehen zu essen.
»Du hast bestimmt noch nicht gefrühstückt, oder?«, fragt sie und zieht eine Augenbraue hoch. Ihr Gesicht weist hier und da Mehlspuren auf, und auf ihrer gestreiften Schürze sind mehlige Handabdrücke zu erkennen. Sie riecht nach Zucker, Gewürzen und allen möglichen leckeren Zutaten. Im Grunde ist sie so was wie eine zum Leben erwachte Lebkuchenfrau.
DIE AUTORIN
Debbie Johnson ist eine preisgekrönte Autorin, die in Liverpool lebt und arbeitet, wo sie ihre Zeit zwischen dem Schreiben von Büchern, dem Umsorgen einer ganzen Bande von Kindern und Tieren und dem Aufschieben jeglicher Hausarbeit aufteilt.
LIEFERBARE TITEL
Weihnachtspunsch und Rentierpulli – Frühstück mit Meerblick – Weihnachten mit dir
DEBBIE JOHNSON
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Coming Home to the Comfort Food Café bei HarperImpulse.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 11/2018
Copyright © 2018 by Debbie Johnson
Copyright © 2018 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Hanne Hammer
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München unter Verwendung von Shutterstock (baibaz); Bigstock (tashka200, Mangpor_2004, worldofvector, Green Art Photography, olindana, Natalia Zakharova, Nadianb)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-23587-1V002
www.heyne.de
Dieses Buch widme ich Helen Shaw –
der Großartigsten unter den Rothaarigen!
ERSTER TEIL
1. KAPITEL
Liebe Zoe,
ich weiß nicht, warum ich dir diesen Brief schreibe – ein überfallartiger Anfall einer Depression, vermute ich. Eine der unerwarteten Begleiterscheinungen des Mutterseins, vor denen einen niemand warnt. Plötzlich geht die Fantasie mit dir durch, als würde ein Jack-Russel-Terrier nach deinem Verstand schnappen und damit herumwedeln wie mit einer Stoffpuppe, sodass du am Schluss ein dem Wahnsinn verfallenes Häufchen Elend bist.
Aus irgendeinem Grund habe ich mir heute Abend darüber Gedanken gemacht, was aus Martha wird, wenn ich einmal nicht mehr bin. Also, »aus irgendeinem Grund« stimmt eigentlich nicht – den Grund kenne ich ganz genau. Prinzessin Diana. Ich habe noch Klassenarbeiten korrigiert und dabei diese Dokumentation gesehen – zu ihrem zehnten Todestag.
Der Anblick der beiden Jungs auf der Beerdigung – der kleine Will und Harry – hat diese Gedanken wohl ausgelöst. Sie haben sich so sehr bemüht, tapfer und erwachsen zu sein – und dabei doch nur wie zwei kleine, verlorene Seelen ausgesehen, die sich fragten, wo ihre Mum war. Am liebsten hätte ich sie in den Arm genommen und ganz fest gedrückt. Meine Begeisterung für die Monarchie hält sich ja in Grenzen, aber so ein Schicksalsschlag hat nichts mit Geld oder Gesellschaftsschicht zu tun, oder? Die Mutter zu verlieren – eine Mutter, die ihre Kinder über alles geliebt hat, so wie Diana ihre Jungs offensichtlich geliebt hat – ist einfach schrecklich.
Und so habe ich schließlich aufgrund der Sendung, des Weins und der späten Stunde total aufgelöst dagesessen. Du hättest mich sehen sollen – tränenverschmiert habe ich die Kissen an mich gedrückt und mich vor Trauer um eine Frau geschüttelt, die ich nie kennengelernt habe, und um ihre beiden mutterlosen Jungs. Abgedreht.
Danach konnte ich stundenlang nicht einschlafen und habe nachgedacht – über dich, über Martha und darüber, welche Lieder auf meiner Beerdigung gespielt werden sollen. Herausgekommen ist dabei nichts – ich weiß, es sollte was Würdevolles sein, aber … na ja, würdevoll sind wir ja wohl eher nicht, oder? Sind’s nie gewesen. Mir kommt immer nur was Albernes in den Sinn, wie Boom Boom Boom von den Vengaboys oder Disco 2000 von Pulp, und die Leute tanzen beim Herausrollen des Sargs.
Egal. Letztendlich beschloss ich aufzustehen und stattdessen diesen Brief hier zu schreiben. Ich werde ihn morgen zu einem Anwalt bringen, zusammen mit ein paar anderen Unterlagen, und mein Testament machen. Kein fröhliches Thema, ich weiß, aber ich denke, dass ich mich danach besser fühlen werde. Ich handele ausnahmsweise mal wie ein verantwortungsvoller erwachsener Mensch – nicht gerade mein Fachgebiet, aber es muss sein.
Am allerwichtigsten ist natürlich Martha. Ihr Vater lebt am anderen Ende der Welt. Sie hat ihn bisher nicht einmal kennengelernt, und meine Eltern sind verklemmte Kontrollfreaks. Der einzige Mensch, der sie liebt und sie genauso gut kennt wie ich, bist du, Zoe. Ich habe keinen Schimmer, was die rechtliche Seite betrifft. Ob man ein Kind in einem Testament vermachen kann wie einen alten Ring oder die Erstausgabe der gesammelten Werke von Charles Dickens. Da muss ich mich noch erkundigen.
Doch egal was dabei herauskommt, im Grunde meines Herzens – meines vor Tränen triefenden Herzens, angesichts der beiden mutterlosen königlichen Prinzen – weiß ich schon jetzt, dass sie bei dir aufwachsen soll. Du bist ihre zweite Mum. Du wirst ihr helfen, alles durchzustehen, so wie wir uns geholfen haben in unserer verrückten Jugendzeit. Nichts war perfekt – doch wir haben es geschafft, da wir uns hatten. Du kannst das Gleiche für sie tun. Das weiß ich.
Hoffentlich wirst du diesen Brief nie lesen müssen, Zoe. Hoffentlich bin ich noch da, wenn wir hundert sind und uns im Pflegeheim den Gin hinter die Binde gießen und den Chippendales auf der Bühne zujubeln, mit den dritten Zähnen im Mund. Hoffentlich kichern wir darüber, wie peinlich wir Martha sind, und erinnern uns an die Zeit, als wir noch wussten, welcher Wochentag war.
Doch … ich wollte das hier … einfach nur mal vorsichtshalber schreiben. Du sollst wissen, dass ich dich lieb habe und dass du für mich meine Familie bist, mehr als meine eigene. Sollte es hart auf hart kommen, also sollte ich bei einem Autounfall sterben oder aus der Achterbahn fallen oder sonst was, brauche ich dich. Für Martha. Der Gedanke wird dir Angst einjagen. Ich weiß. Du hast es sogar geschafft, diesen Kaktus umzubringen, den wir damals aus unserem Urlaub auf Ibiza mitgebracht haben und der angeblich nicht totzukriegen war. Das weiß ich auch. Du kannst nicht kochen, fährst wie eine Irre, trägst unterschiedliche Socken, verlierst dreimal am Tag deine Schlüssel und bürstest dein Haar alle Jubeljahre mal, sodass du Dreadlocks bekommst. All das weiß ich.
Doch ich weiß auch, dass du da, wo es drauf ankommt, alles hast, um für ein Kind zu sorgen – weil du sie nämlich genauso sehr lieben wirst wie ich. Du wirst sie weder in einen Menschen verwandeln wollen, der sie nicht ist, noch in eine Form hineinpressen, die nicht zu ihr passt. Du wirst sie lieben, egal wie groß das Chaos ist, das in ihrem Zimmer herrscht. Und das ist, ehrlich gesagt, sehr viel wichtiger als gleichfarbige Socken – also glaub mir, wenn ich dir sage, dass du das kannst.
Wie auch immer, ich bin jetzt ziemlich erledigt. Ich trinke noch einen Schluck Wick MediNait, rede mir ein, es wäre Absinth, lege mich wieder hin und hoffe auf das Beste. Morgen ist Marthas Aufführung in der Vorschule. Sie spielt … einen Ninja-Fisch. Frag besser nicht! Ich muss frisch wie der Frühling sein und so tun, als würde ich mich über die Auftritte der anderen Kinder genauso freuen wie über ihren (was eine Lüge ist, die alle Eltern erzählen müssen – in Wahrheit warten alle nur darauf, dass der eigene zauberhafte Superstar auf der Bühne erscheint).
Ein paar Sachen muss ich dir noch sagen, obwohl mir klar ist, dass die Auswahl zufällig ist. Martha isst am liebsten Sandwiches mit Fischstäbchen. Das Weißbrot muss gebuttert sein und die Scheiben so fest zusammengedrückt, dass Fingerabdrücke zurückbleiben.
Ihre Lieblingssendung ist noch immer Spongebob Schwammkopf. Insgeheim mag sie aber auch In the Night Garden, obwohl sie das schon ein bisschen kindlich findet. Sie zieht sich gern wie Stephanie aus Lazy Town an und wird versuchen, mit der pinkfarbenen Perücke ins Bett zu gehen, wenn du das nicht verhinderst, was du aber tun wirst. Ihr eigenes Haar wird nämlich dadurch derart zerzaust, dass du es mit Kindershampoo waschen musst. Eigentlich soll damit ja nichts mehr ziepen, doch meine Erfahrung hat mich was anderes gelehrt.
Wenn sie nicht schlafen kann, hört sie gern eine CD mit den Geschichten dieser sprechenden Hamster. Darüber nickt sie dann ein. Ihr momentaner Lieblingsschlafanzug ist der mit Shaun dem Schaf. Sie trägt ihn auch schon mal gern tagsüber. Ich habe da kein Problem mit, und ich weiß, dass du auch keins haben wirst.
Wenn sie irgendwas aufregt, sing das Titellied von Postbote Pat. Aber laut und mit Schmackes, sonst funktioniert es nicht. Mag sein, dass sie anfangs noch zu wütend ist, doch irgendwann fängt sie an mitzusingen und vergisst ihren Kummer. Obwohl sie die Sendung nicht mehr sieht, hat sich das Lied scheinbar in ihr Gedächtnis eingebrannt und beruhigt sie, egal was ist.
So, mit diesem nützlichen Hinweis verabschiede ich mich. Ja, ich weiß, ich bin irre – aber das war ich schon immer, oder? Die arme Prinzessin Diana.
Vergiss nicht – das Titellied von Postbote Pat. Laut, mit Schmackes. Das heilt sämtliche Übel.
Hab dich schrecklich lieb,
Küsschen, Kate
Ich lese den Brief zum gefühlten millionsten Mal und falte ihn wieder zusammen. Er beginnt langsam zu zerfleddern. Dagegen muss ich was machen. Irgendwas. Ihn laminieren oder so, um die kostbaren Worte, die kostbare Handschrift, die kostbare Verbindung zwischen mir und meiner mittlerweile toten Freundin zu erhalten.
Die wichtigste Verbindung zwischen uns ist genauso kostbar. Na ja, noch kostbarer, da sie ein Mensch ist und kein Stück Papier – allerdings ist sie nicht annähernd so leicht zu beschützen. Mein Blick wandert zu Martha, die in sich zusammengesackt auf dem Wohnzimmerboden liegt, die Kleider vollgespritzt mit Erbrochenem, und ich frage mich, ob ich sie vielleicht auch laminieren kann. Auf jeden Fall würde ich mir so eine Menge Wäsche ersparen.
Dieser Brief wurde vor Jahren geschrieben. Gefühlt vor einem Jahrtausend. Damals war Martha noch ein unbeschwertes, liebenswertes, kleines Mädchen, das sich anzog wie Stephanie, einschließlich der pinkfarbenen Perücke, während ich Sportacus gemimt habe. Wir aßen Satsumas und leckten uns den Saft von den Fingern, als würden wir den Nektar der Götter kosten.
Mittlerweile ist Martha sechzehn, und ich könnte die Badewanne bis zum Rand mit Kindershampoo füllen und sie darin einlegen, es würde nichts bringen. Sie würde wahrscheinlich bloß davon trinken, um auszuprobieren, ob sie davon high wird. Sie lebt nicht mehr in der Welt von Lazy Town, sondern in der von Crazy Town.
Und ich lebe ebenfalls in Crazy Town. Nur ohne Kate. Ohne meine beste Freundin. Ohne den Menschen, der mich so viele Jahre davor bewahrt hat durchzudrehen. Meine Schulter, an der ich mich ausweinen konnte. Meine Vertraute. Meine andere Hälfte. Wir haben beide nie geheiratet, hatten beide nicht einmal eine ernsthafte Beziehung – wohl auch deshalb nicht, weil niemand unserer Freundschaft je hätte das Wasser reichen können, denke ich. Wir waren Freundinnen seit dem sechsten Lebensjahr, in guten wie in schlechten Zeiten. Siamesische Zwillinge, egal was ihre Eltern auch unternahmen, um die krankhafte Zuneigung ihres Sonnenscheins zu diesem Pflegekind mit der Zottelmähne zu unterbinden, das in einer sozialen Wohnungsbausiedlung lebte, die sie für den Vorhof der Hölle hielten.
Martha stöhnt. Ich knie neben ihr auf dem Boden. Mittlerweile bin ich geübt darin, sie in die stabile Seitenlage zu drehen, und darauf zu achten, dass ihre Atemwege frei sind. Nur für den Fall, dass sie auf Joplin macht und an ihrem Erbrochen zu ersticken droht.
Das gefärbte Haar klebt an den blassen Wangen, die Haut ist voller kleiner lila Sprenkel, wahrscheinlich von einem alkoholischen Mixgetränk mit schwarzem Johannisbeersaft. Sie hat mehrere Piercings, eines in der Nase und mehrere in den Ohren. Der Eyeliner, der vor ein paar Stunden noch auf eine Tim-Burton-Batgirl-Weise cool ausgesehen hat, ist mittlerweile verschmiert, sodass sie wie eine Leiche aussieht. Sie trägt eine schwarze Netzstrumpfhose mit Löchern, die da absichtlich drinnen sind, einen kurzen, inzwischen hochgerutschten schwarzen Jeansrock und ein Nirvana-T-Shirt, auf dem vorne ein Smiley-Gesicht ist und hinten »flower sniffin kitty pettin baby kissin corporate rock whores« steht.
Ich bemerke ein Gekritzel auf ihrem Arm und kneife die Augen leicht zusammen, um es zu lesen: Fuk You. Hoffentlich ist es nur Filzstift und kein Tattoo. Insbesondere da das erste Wort auch noch falsch geschrieben ist.
Ihre dünnen Beine liegen noch immer auf dem Sofa, einer ihrer Füße steckt noch in dem Doc-Martens-Stiefel, der andere ist halb ausgezogen. Vermutlich ist sie hereingekommen und hat sich auf die Couch gesetzt, um sich bettfertig zu machen. Dann ist ihr wahrscheinlich von der Riesenmenge Alkohol schlecht geworden, die sie heute Abend in sich hineingeschüttet hat. Vielleicht hat sie auch noch Drogen eingeworfen – zu meiner Zeit wären es Ecstacy und Speed gewesen. Heute haben sie alle möglichen ausgefallenen Namen, die wie die Namen niedlicher Schulmädchen aus japanischen Anime-Büchern klingen.
Ich streiche eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht, die an der Wange klebt. Sie öffnet die Augen – leuchtende, dunkelbraune Augen – und starrt mich an, als wäre ich eine Kreatur aus einem Horrorfilm. Vor nicht allzu langer Zeit hätte noch der Schalk aus diesen Augen geblitzt, und sie hätten vor purer, unbändiger Lebensfreude gestrahlt. Doch jetzt nehmen sie einfach nur enttäuscht wahr, dass ich mich über sie beuge – dass ich nicht die Person bin, die Martha sich wünscht –, und verschleiern sich.
Martha macht die Augen wieder zu. Dicke Tränen rollen seitlich über ihr Gesicht, vermischen sich mit dem Eyeliner, sodass sie einen schmutzigen Streifen hinter sich herziehen.
Ich murmele ein paar hoffentlich beruhigende Worte und weiß nicht einmal selbst, ob ich sie glaube.
Ich denke wieder an diesen Brief. An Kates Ratschläge, an die Worte der Frau, die wir so geliebt haben. Wie lange ist das schon her, wie falsch erscheinen diese Ratschläge heute. Ich schaffe das nicht. Martha entgleitet mir, sie geht unter einer Lawine von Trauer und schlechten Lebensentscheidungen unter. Und ich weiß nicht, wie ich sie retten soll. Ich weiß nicht einmal, wie ich mich selbst retten soll.
Ich kauere vor ihr und beginne die Titelmelodie von Postbote Pat zu summen. Doch ich singe sie nicht mehr mit Schmackes. Der ist mir abhandengekommen.
So kann es nicht weitergehen. Etwas muss sich ändern, bevor wir alles verlieren. Bevor ich meine beste Freundin auf eine Weise enttäusche, die ich mir niemals würde verzeihen können.
2. KAPITEL
Als ich am nächsten Morgen aufwache, habe ich Kopfschmerzen. Und einen Plan. Einen Plan, unser Leben zu verändern.
Die Kopfschmerzen sind verständlich. Ich habe zwar im Bett gelegen, als Martha in den frühen Morgenstunden polternd heimkehrte, aber ich habe nicht wirklich geschlafen.
Das war früher anders. Da war ich Weltmeister im Schlafen. Ich hatte einen ruhigen Job in einer Buchhandlung und wohnte in einem Einzimmerapartment, das auf der anderen Straßenseite des Hauses von Kate und Martha lag. Ich verdiente genug Geld, um die Hypothek abzuzahlen, mir Eis von Ben & Jerry’s zu leisten und auch noch was auf die hohe Kante zu legen.
Ich hatte sämtliche Verbindungen zu meiner grässlichen Vergangenheit gekappt und führte ein ruhiges Leben. Andere mögen es für bescheiden und langweilig gehalten haben – ich nicht. Aufregung hatte ich in meiner Jugend genug. Mir ging es besser ohne.
Ich fand mich äußerst clever, als ich mir dieses kleine, beschauliche Leben aufbaute. Zweitmutter für Martha. Keine Verpflichtungen, die mich überforderten. Ein schlichtes, einfaches Leben. Genau das gefiel mir. So wie es mir auch gefiel, dass mein aufreibendstes Erlebnis der letzten Jahre ein zu Bruch gegangener Becher mit Instantnudeln war. Sein Inhalt, eine breiige Hähnchen-Pilz-Masse, ergoss sich auf die Küchentheke. Mit achtunddreißig hatte ich mein persönliches Nirvana erreicht: Beständigkeit.
Deshalb waren der Schlaf und ich beste Freunde. Früher wachte ich morgens auf, fühlte mich frisch und hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich freute mich darauf, mit dem Fahrrad zur Buchhandlung zu fahren und keiner anspruchsvolleren Tätigkeit nachzugehen, als ein paar zusätzliche Exemplare von Dan Browns jüngstem Roman zu bestellen und die drei Kunden, die täglich vorbeischauten, zu überreden, das Buch eines einheimischen Autors zu kaufen.
Mittlerweile hat sich mein Leben völlig verändert. Ich bin unbeabsichtigt Mutter geworden. Eine Rolle, die ich echt schlecht ausfülle. Ich vermisse Kate und bin ein völliger Versager im Behüten von Martha. Wenn ich wach bin, wünsche ich mir meistens, ich würde schlafen. Und wenn ich schlafe, bin ich meistens halb wach. Ich habe stets ein Ohr offen, um zu hören, ob sie gerade nach Hause kommt oder sich davonschleicht oder die Küche in Brand setzt.
Kate ist vor einem halben Jahr gestorben. Vor zehn Monaten entdeckte sie den Knoten. Als sie mit der Chemotherapie begann, zog ich vorübergehend bei ihr ein. Als sie starb, endgültig.
Martha denkt wahrscheinlich, dass sie mit sechzehn Jahren erwachsen ist. Das dachte ich auch, als ich so alt war wie sie. Doch sie muss sich damit abfinden, dass ich da bin, ob ihr das nun passt oder nicht. So wie ich mich damit abfinden muss, die Tage zu überstehen wie ein unter Schlafmangel leidender Zombie.
Martha ist eine Sechzehnjährige, die äußerst konkrete Vorstellungen hat, was ihre Lebensweise betrifft. Sie war schon immer »willensstark«, um es einmal diplomatisch auszudrücken, was Kate und ich für positiv hielten. Anders als Barbara, Kates Mum. Sie erachtete es als eine Charaktereigenschaft, die Lepra gleichkam.
Doch Barbara läuft schon ihr ganzes Leben lang mit einem Riesenstock in ihrem Allerwertesten herum, um ehrlich zu sein. Sie hat sich stets Gedanken darüber gemacht, was andere »denken« könnten: die Nachbarn, der Pfarrer, der Schuldirektor, die Passanten, irgendwelche Leute, die uns gerade auf Google Earth entdeckten … die Meinung von Hinz und Kunz war ihr wichtig, außer unserer. Außer der von Kate. Das, was sie für einen verabscheuungswürdigen, schlimmen Charakterzug bei Martha hielt, empfanden wir als etwas Gutes.
Wir waren stolz auf unsere kleine Rebellin. »Man muss als Frau in dieser Welt eine gewisse Haltung an den Tag legen«, meinte Kate immer, und ich pflichtete ihr bei. Dann stießen wir an und lachten über Marthas Mätzchen.
Heute ist Martha nicht mehr »willensstark«, sondern eher »ein totaler Albtraum«. Sie bestraft sich, mich und die gesamte, verfluchte Welt – vornehmlich im hellen Schein des silbrigen Monds. Martha ist nämlich eine Nachteule – und ich seit Neustem daher auch.
Gestern Abend sollte sie um elf Uhr zu Hause sein. Um Mitternacht begann ich dann meinen telefonischen Rundruf. Freunde. Kneipen, in denen ich sie vermutete. Die Polizistin, die sie vor einem Monat nachts nach Hause gebracht hatte und mit der ich in Kontakt geblieben war. Ich simste sogar die Eltern einiger Freundinnen an.
Ihr geht’s schon gut, sagte ich mir mit müden Augen, hin- und hergerissen zwischen Sorge und Wut. Nein, geht’s ihr nicht, widersprach ich mir selbst, setzte mich auf die Bettkante und holte erneut den Brief heraus. Den Brief von Kate, in dem sie schreibt, dass ich das schaffen kann.
Ich war gerade an der Zeile angelangt, in der sie davon spricht, dass ich Martha in keine Form hineinpressen würde, die nicht zu ihr passe, als ich schließlich die sich öffnende und wieder zuschlagende Haustür hörte. Ich vernahm das stapfende Geräusch ihrer Stiefel im Flur, den auf- und wieder zugedrehten Wasserhahn in der Küche sowie ein paar Flüche, die sie ausstieß, als sie sich auf das Sofa fallen ließ. Erst als es wieder still war, trat ich aus meinem Schlafzimmer hervor und schlich in meinen uralten Crocs und einem schäbigen, in die Jahre gekommenen Nachthemd die Treppe hinunter, um nach ihr zu sehen. Dabei hielt ich noch immer Kates Brief umklammert.
Natürlich ging es ihr letztendlich gut. Teenager sind zwar einerseits beängstigend zerbrechlich, andererseits aber auch erstaunlich robust. Ich brachte sie ins Bett, flößte ihr ein paar Schlucke Wasser ein und legte ihr eine Packung Paracetamol und eine Dose Coca-Cola light auf den Nachttisch. Nicht gerade die Art mütterlicher Fürsorge, die in Zeitschriften beschrieben wird, doch in dem Moment war es das Beste, was ich für sie tun konnte.
Ich hätte mich ebenfalls mit Cola und Schmerztabletten eindecken sollen, ging es mir durch den Kopf, als ich an diesem Morgen in die Küche schwankte, müde und mit so heftigen Kopfschmerzen, dass ich es bedauerte, selbst keinen Wodka getrunken zu haben. Dann hätte ich es wenigstens verdient gehabt, mich derart mies zu fühlen.
Die Kopfschmerzen sind für mich mittlerweile normal. Sie sind mein treuer, nächtlicher Begleiter, bis der nächste, wundervolle Tag zu dämmern beginnt. Der Plan jedoch – Der Plan, Unser Leben Zu Verändern – ist neu. Neu und drastisch. Und ich glaube absolut notwendig, wenn ich Martha vor sich selbst retten will.
Der Auslöser war ein Traum. Anscheinend besaß ich noch Resterinnerungen an eine Folge von Countryfile. Auf jeden Fall spazierte ich in meinem Traum endlose Küstenwege entlang, die an endlosen Klippen vorbeiführten. Dabei sah ich auf ein endloses Meer. Und verspürte einen unendlichen Frieden. Da wurde mir klar, dass ich träumte – denn ich habe diese Art von Frieden schon seit Langem nicht mehr verspürt.
Als ich aufwachte, versuchte ich an diesem Traum festzuhalten, wie man das nun mal so macht mit schönen Träumen: Also wenn man gerade Daniel Craig vernascht, eine Dose Sprühsahne dabei im Spiel ist und man nicht will, dass der Traum vor dem Höhepunkt endet. Oder wenn man wie ein Vogel durch die Lüfte schwebt.
Das war so ein schöner Traum. Und ich wollte dieses Gefühl in die reale Welt mitnehmen. In meinen Tag. In mein gesamtes Leben und in das Leben von Martha. Wir beide brauchten unbedingt Frieden – und Martha wohl auch noch einen Aufenthalt in einer Ausnüchterungszelle.
Die Lage war schlimm und wurde immer schlimmer. So schlimm wie noch nie zuvor, und ich habe schon viel Schlimmes erlebt, womit ich es vergleichen kann. Meine Kindheit war alles andere als beschaulich. Während meine Eltern mal im Gefängnis saßen und mal nicht, wuchs ich mal in Pflegeheimen auf und mal nicht, und meine Vernunft zeigte sich mal und mal nicht. Ich war wild. Ich war verrückt. Und ich habe vieles von dem, was Martha gerade anstellt, selbst angestellt – und aus ähnlichen Gründen. Aus Schmerz, aus Einsamkeit, aus Wut. Aus dem Gefühl heraus, dass man der Welt völlig schnuppe ist. Warum also sollte man sich umgekehrt um die Welt scheren?
Doch als ich so alt war wie Martha, hatte ich Kate. Das hat einen großen Unterschied gemacht. Unsere Freundschaft hat mich gerettet. Das ist keine Übertreibung! Wenn andere über mich urteilten – die verwahrloste Göre mit dem frechen Mundwerk und der rauen Schale, die als vorbeugende Maßnahme erst mal alle Menschen ablehnte –, blies sie nicht in dieses Horn. Mich zu mögen war nicht einfach. Das erkenne ich jetzt – ich war kratzbürstig und schwierig. Und ich lief stolz mit der Einstellung herum, dass die Welt »mich-mal-kann«. Kate durchschaute mich; sie hatte Röntgenaugen. Sie war magisch.
Jetzt gab es keine Kate mehr – weder für mich noch für Martha. Kein Wunder, dass wir beide aus der Spur geraten und in einen Abgrund gestürzt waren, sodass alles im Chaos versank. Wir hatten uns so oft auf Kate verlassen – was in Marthas Fall auch völlig in Ordnung war; in meinem eher nicht.
Kate hatte mir ihre Tochter anvertraut – und so gerne ich Marthas Kopf auch manchmal in die Toilette getaucht hätte, konnte ich wirklich ehrlich behaupten, ich wäre anders gewesen, hätte es Kate nicht gegeben? Nein, vermutlich nicht.
Ich musste die Zügel in die Hand nehmen und diesen Frieden finden, den wir beide so dringend brauchten. Und ich musste ihn bald finden. Bevor eine von uns zusammenbrach – was uns offen gesagt beide treffen konnte. Martha mag zwar diejenige sein, die die ganzen Piercings hat und Death Metal hört, doch ich stehe genauso kurz davor durchzudrehen. Ginge es hier nur um mich, wäre es egal – doch es geht hier nicht um mich, sondern um dieses kostbare, kleine Mädchen, das einmal Spongebob geliebt, eine Stephanie-Perücke getragen und sehr viel Freude in unser Leben gebracht hat. Es geht darum, sie zu retten.
Und jetzt, nachdem ich davon geträumt habe, weiß ich zumindest, wie ich es versuchen werde: Wir werden umziehen. Wir werden unsere Sachen packen und diese Stadt verlassen. Wir werden einen Ort finden, an dem wir uns ausruhen und an dem unsere Wunden heilen können. Einen Ort, der uns nicht an all das erinnert, was wir verloren haben. Einen Ort, an dem es weder Geister noch Nachtklubs gibt, denen es völlig egal ist, ob Jugendliche gefälschte Ausweise vorzeigen. Einen Ort mit endlosen Klippen, einem endlosen Meer und unendlichem Frieden. Einen Ort, der uns den notwendigen Trost spenden wird, den wir uns scheinbar gegenseitig nicht geben können.
Das wird ihr nicht passen, geht es mir durch den Kopf, als ich ein paar Ibuprofen einwerfe und zu meinem Laptop gehe. Natürlich nicht. Andererseits passt ihr nie etwas – ich habe also nichts zu verlieren.
3. KAPITEL
Ich hole mir eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank. Als ich die Tür schließe, sehe ich – zum millionsten Mal – das Foto, das dort unter einem kitschigen Magneten hängt und auf dem »Ich liebe Bristol« steht.
Das Foto zeigt Kate, Martha und mich und ist in unserem Urlaub in Dorset gemacht worden. Wir waren vor drei Jahren dort – nur drei Jahre ist das her, doch es erscheint mir wie eine andere Wirklichkeit. Meine rote, lockige Mähne verdeckt wie immer den größten Teil meines Gesichts; Kate steht in der Mitte, blond, hübsch, voller Leben. Martha schmiegt sich an sie.
Sie hält ihre Hand hoch und macht die klassische Black-Sabbath-Geste, doch es wirkt nicht rebellisch, sondern einfach nur witzig. Ihr Haar hat noch seine natürliche Farbe – dunkelblond –, und ihre Augen strahlen vor Glück. Wir waren ein seltsamer kleiner Haufen, der eine Familie bildete, aber wir waren eine Familie – und nun liegt es an mir, diese Familie aufrechtzuerhalten. Ich möchte dieses einfache Gefühl der Freiheit wieder verspüren. Und ich möchte, dass Martha die Unschuld und Sicherheit wiederfindet, die ihr durch den Tod ihrer Mutter gestohlen wurden.
Dorset. Das könnte der perfekte Ort sein. Nicht zu weit weg, aber ein anderes Universum. Ich taumele zu meinem Laptop und beginne zu recherchieren.
Innerhalb weniger Minuten schaltet sich das Schicksal ein – oder Google, wie manche Leute beharrlich behaupten. Ich suche nach einem Haus, das ich mieten kann, und ein Objekt springt mir sofort ins Auge. »Kommen Sie zu uns ins sonnige Dorset. Dorthin, wo das Leben noch einfach ist und Sie Ihre Sorgen hinter sich lassen können«, heißt es da.
Wow. Das wäre klasse. Ich klicke die Bilder an, die eine hübsche Ferienhaussiedlung zeigen. Sie heißt The Rockery und liegt in der Nähe von Budbury. Der Ort wirkt idyllisch, und binnen Minuten male ich mir unser Leben dort aus – ohne unsere Sorgen. Ich schwelge so sehr in dieser Vorstellung, dass ich nicht einmal bemerke, wie Martha das Zimmer betritt.
»Wo zum Teufel liegt denn das Kaff?«, fragt sie plötzlich in die Stille hinein, sodass ich zusammenzucke und ein Glas Wasser auf dem Tisch umstoße. Ich fluche äußerst erwachsen, springe auf wie eine Irre und halte den Laptop hoch, damit er nicht nass wird.
Martha lehnt sich gegen die Spüle und grinst, während ich einen Handschuh aus Küchenkrepp forme, um die Schweinerei aufzuwischen. Ich denke kurz darüber nach, ihr eine Backpfeife zu geben, wie fast jeden Morgen, lasse es dann aber doch.
Sie schält sich eine Banane, beißt hinein und beobachtet meine Reinigungsbemühungen, als würde ich gerade eine Performance veranstalten.
»Danke für deine Hilfe«, sage ich, als der Tisch schließlich wieder trocken ist und das vollgesogene, klatschnasse Küchenkrepppapier an meinen Fingern klebt.
»Gern geschehen«, antwortet sie lässig und wirft die Bananenschale in Richtung Mülleimer, verfehlt ihn aber, sodass sie stattdessen auf dem Boden landet. Angesichts meiner hervorragenden hausfraulichen Fähigkeiten und weil sie als Teenager um jeden Preis cool bleiben will, könnte das durchaus ihr endgültiger Aufbewahrungsort bleiben.
Ich setze mich wieder hin. Die Sonne scheint auf Marthas Gesicht, sodass ich blinzeln muss, als ich sie ansehe. Das Wetter ist noch immer strahlend schön in dieser dritten Augustwoche. Unser Küchenfenster geht auf unseren kleinen Garten hinaus. Das Licht fällt in leuchtenden, goldenen Streifen auf Martha und hüllt sie ein. Ich stelle fest, dass sie es wenigstens geschafft hat zu duschen; ihr zombieartiges Make-up von vergangener Nacht ist verschwunden, und ihr Haar fällt nass und sauber auf ihre Schultern. Sie trägt einen alten Glastonbury-Hoodie, der Kate gehört hat. Ich bin sofort milder gestimmt.
Sie ist noch ein Kind, rufe ich mir ins Gedächtnis, was scheinbar mehrfach am Tag notwendig ist. Ein Kind, das seine Mutter vermisst. Ein Kind, das ich lieb habe. Ich war dabei, als sie schreiend und blutverschmiert zur Welt kam, und ich war dabei, als ihre Mutter starb; jetzt bin ich immer noch da – da, wo ich sein soll.
»Das da«, sage ich und zeige auf den Bildschirm, »ist ein Ort namens Budbury. Er liegt in Dorset. Ich habe mir gedacht … dass wir dort hinfahren, um eine Auszeit zu nehmen.«
Ich sage die Worte beiläufig, halte aber die Luft an, während ich auf ihre Antwort warte. Mir steht ein harter Kampf bevor, das weiß ich, und ich will ihn gewinnen.
»Wie? Eine Auszeit? Urlaub machen, oder was?«, fragt sie und verzieht angewidert das Gesicht, als sie auf die Fotos schaut. Budbury liegt an der Juraküste, in der Nähe der Grenze zu Devon. Ein absoluter Bilderbuchort mit einem Gemeindehaus, netten Läden und sogar einem Tierfriedhof; es gibt ein paar Pubs und ein wunderschön aussehendes Café, das auf einer Klippe liegt. Eine weiterführende Schule ist nur wenige Meilen entfernt. Sie war ein wichtiger Gesichtspunkt für mich.
Wir hatten am Vortag einen Brief von ihrer alten Schule erhalten, in dem man uns mitteilte, dass die von Martha gewählten Kurse »leider« alle belegt seien. Was ich allerdings bezweifle – man will sie einfach nur loswerden. Ich bin im Namen von Martha wütend, kann es aber auch verstehen – sie war äußerst schwierig in diesem Schuljahr. Ich habe gefühlt Stunden im Büro der Rektorin verbracht, bin auf der Armesünderbank hin und her gerutscht und habe ihr zugehört, wie sie sich über Marthas Probleme ausgelassen hat.
Ich bin überhaupt nicht überrascht, dass die Schule sie abgelehnt hat. Martha tut zwar so, als wäre es ihr egal, doch ich vermute, dass der Brief der auslösende Faktor für ihr gestriges Besäufnis gewesen ist. Denn er war der Beweis, dass sich alles geändert hat – und das nicht zum Besseren.
Sie starrt auf den Bildschirm meines Laptops. Budbury liegt eingebettet in eine verblüffende Landschaft – eine Million Lichtjahre weg von unserer zugegebenermaßen sehr behaglichen kleinen Ecke hier in Bristol. Ich fühle mich allein vom Betrachten der Strände schon besser, der winzig kleinen Buchten und der Wege, die an den Klippen entlangführen – und sehne mich danach, dort zu sein, die frische Luft einzuatmen, spazieren zu gehen und einfach nur … zu leben. Vielleicht schaffe ich mir einen Hund an, lerne Surfen, schreibe wunderschöne Gedichte und trinke Cider.
Martha blättert die Bilder durch. Ihrem Gesichtsausdruck nach teilt sie nicht unbedingt meine Gefühle.
»Erinnert an einen Horrorfilm«, sagt sie verächtlich. »Das Dorf der Verdammten. Ich wette, das Kaff steckt auch noch in einer Zeitschleife – wahrscheinlich dürfen Rothaarige nicht mal einen Fuß in den Ort hineinsetzen, weil die Bewohner glauben, dass sie keine Seele haben. Da könnte allerdings was dran sein.«
Ich klemme mir eine rote, lockige Haarsträhne hinters Ohr und beiße mir auf die Innenseite meiner Lippe. Dann mal los …
»Wenn ich von einer Auszeit spreche, meine ich keine Ferien«, erkläre ich, stehe auf und entsorge die Bananenschale im Mülleimer, so nervös bin ich. »Damit meine ich … einen längeren Zeitraum.«
Mittlerweile ist es fast Mittag. Ich bin schon stundenlang auf und plane unser neues Leben. Ein Leben voller Glück und Lachen, in dem wir Kräfte sammeln, etwas aufbauen und nach vorne blicken können. Nicht zurück. Aus irgendeinem Grund – wahrscheinlich Verzweiflung – ist es zu einem Symbol für all das geworden, was wir meiner Meinung nach brauchen. Doch diese große Veränderung unseres Lebens kommt für die arme Martha natürlich komplett unerwartet.
»Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Ich würde nicht einmal für ein Wochenende dort hinfahren geschweige denn da leben. Und du kannst mich nicht dazu zwingen, Zoe! Ich bin sechzehn. Das kannst du nicht!«
Ich fülle den Wasserkocher. Ich brauche noch einen Kaffee – ich hatte heute erst siebzehn. Ich bleibe ruhig, ordne meine Gedanken und höre Martha zu, die im Hintergrund schäumt und wütet. Sie schreit derart herum, dass ich um meine Trommelfelle besorgt bin. Einen Augenblick lang auch um meinen Laptop, doch dann stelle ich fest, dass sie nur den Deckel zugeschlagen hat. Als wäre damit die Diskussion beendet, und Budbury würde ins Meer fallen, wegtreiben und in Vergessenheit geraten.
Sie ist sechzehn. Und ich kann sie nicht zwingen. Das ist die Neuauflage einer Unterhaltung, die wir schon viele Male gehabt haben. Und es sind die Argumente, die sie stets als letzte Waffe einsetzt – eine Waffe, die ich ihr nicht wegnehmen darf, denn sie hat wirklich fast keine Waffen mehr. Nehme ich ihr auch noch ihre Fähigkeit weg, mich zu verletzen, wird das nur dazu führen, dass sie sich selbst noch mehr verletzt.
Ich erinnere mich daran, wie ich mit sechzehn war: Ich übernachtete bei Freunden auf dem Sofa, versteckte mich mit einem Schlafsack in Kates Garage, bis ihre Eltern mich fanden und rausschmissen, und hatte weder Geld noch einen Job oder ein Zuhause. Ich hatte nur meinen Mut – und den festen Willen, der Welt zu entfliehen, in der ich groß geworden war, und meinen eigenen Lebensweg zu finden. Hätte man mir auch noch diese Hoffnung genommen, diesen Glauben an die eigene Unabhängigkeit, hätte ich nichts mehr gehabt.
Martha ist nicht ich. Sie braucht mich noch, egal wie sehr sie das auch leugnet. Unter der Schminke, den Piercings und dem aufsässigen Verhalten steckt noch immer ein Kind – schreiend und blutverschmiert –, das darf ich nicht vergessen.
»Ich weiß, dass ich dich nicht zwingen kann«, erwidere ich, während der Dampf aus dem Wasserkocher mein Gesicht umwabert. »Doch ich kann wenigstens mit dir darüber reden, oder?«
»Das kannst du, aber erwarte nicht, dass ich dir zuhöre!«, brüllt sie und verschränkt die Arme vor der Brust. Sie hält das wohl für eine herausfordernde Geste, doch eigentlich wirkt sie dadurch nur verängstigt und defensiv. »Hier ist alles, was mir wichtig ist. Mein Zuhause, meine Freunde, mein Leben – und du wirst mich nicht daraus wegzerren, nur weil du irgendeine Midlifecrisis hast, okay?«
Ich gieße das kochend heiße Wasser auf den Kaffee und spritze es mir dabei auf die Finger. Damit könnte sie nicht ganz unrecht haben. Ich glaube zwar, dass ich das für sie mache – doch bin nicht eigentlich ich diejenige, die von hier wegmuss? Um dem Druck dieser Stadt zu entfliehen und all ihre Erinnerungen, einer Vergangenheit, die mich zum Weinen bringt, und einer Zukunft, die mich in Panik versetzt?
»Hör zu, Martha«, sage ich so ruhig wie möglich. »Ich weiß, dass ich dich zu nichts zwingen kann. Und ich weiß auch, dass du nicht einmal zuhören willst. Aber deine Mum hat mich gebeten, mich um dich zu kümmern, und genau das werde ich tun.«
Ihr Gesichtsausdruck verrät mir sofort, dass ich das Falsche gesagt habe. Mir vermacht worden zu sein hat sie schon immer wütend und wahrscheinlich auch traurig gemacht. Bei mir gefangen zu sein, ohne an das Geld aus der Lebensversicherung heranzukommen, oder an den Gewinn, den der Verkauf des Hauses bringen würde. Ohne die Unabhängigkeit, die sie glaubt, haben zu wollen.
»Abgesehen davon ist das nicht der Grund, warum ich hier bin«, füge ich schnell hinzu, ehe sie eine Schimpftirade loslassen kann. »Ich bin hier, weil ich dich lieb habe. Du kannst dich von mir aus darüber lustig machen oder mir ins Gesicht spucken, aber das ist die Wahrheit – ich hab dich lieb. Ich kenne dich von klein auf, und ich werde dich immer lieb haben. Ich weiß, ich bin nicht deine Mum, und das werde ich auch nie sein, aber bitte, denk niemals, auch nicht eine einzige Sekunde, dass ich bloß hier bin, weil ein Anwalt mich darum gebeten hat. Ich wäre nämlich auch so hier.«
Tränen steigen ihr in die Augen. Sie wischt sie wütend weg. Martha hält weinen für ein Zeichen von Schwäche. Sie kämpft dagegen an. Mein Herz quillt förmlich über vor Gefühl. Am liebsten würde ich sie in den Arm nehmen, ihr über das nasse Haar streichen und ihr sagen, dass alles gut wird. Doch ich weiß, dass sie das nicht zulassen wird. Das würde ihr den Rest geben, und sie würde es mir nie verzeihen.
»Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du mich …«, murmelt sie und formt ihre Hände zu Fäusten, als versuche sie so, ruhig zu bleiben und das Wort, das mit L beginnt, zu vermeiden. »Das weiß ich, aber ich will trotzdem nicht von hier weg. Ich werde mich bessern. Ich … ich werde nicht mehr auf den Wohnzimmerboden kotzen. Ich werde mich anstrengen. Ich werde nur noch Mentholzigaretten rauchen … was immer du willst. Aber in die Pampa ziehen und wie in den 1950er-Jahren leben – nein, das mach ich nicht, okay?«
Ich verkneife es mir, nach dieser kleinen Rede in unangebrachtes Gelächter auszubrechen. Nur noch Mentholzigaretten? Um mal eine gängige Abkürzung der Chatsprache heranzuziehen, die die heutige Jugend gern benutzt, WTF? Wie schlimm muss es um die Welt bestellt sein, wenn Martha glaubt, dass sie durch den Austausch eines Sargnagels gegen einen anderen ein neues Leben beginnen würde?
Zumindest ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Das einzige Problem ist nur, dass ich fest entschlossen bin, sehr viel mehr Schritte in diese Richtung zu machen, zusammen mit ihr – und zwar bis nach Dorset. Ich habe den ganzen Vormittag darüber nachgedacht, und wir können es uns leisten. Kate hat unmittelbar nach ihrer Diagnose mit ihrem Bankberater und ihrem Anwalt gesprochen – genauer gesagt, unmittelbar nachdem wir zusammengesessen und eine Flasche Wodka getrunken haben.
Sie war keineswegs reich, aber sie hatte einen ordentlichen Beruf – Leiterin des Fachbereichs Englisch an einer höheren Schule – mit Pensionsansprüchen. Und als sie damals das Haus kaufte, traf sie ein paar Entscheidungen, die sehr durchdacht waren, eher untypisch für sie, und schloss unter anderem eine hohe Lebensversicherung ab. Geld war deshalb fürs Erste kein Thema. Die Hypothek war gesichert, Martha würde, wenn sie älter war, einen gewissen Geldbetrag erhalten, und für die nächsten beiden Jahre, in denen Martha noch bei mir lebte, stand uns eine gewisse Summe zur Verfügung.
Nachdem Kate sich rechtlichen Rat eingeholt hatte, regelte sie ihren Nachlass so, dass ich das Bargeld verwaltete und es meinem Ermessen unterlag, ob Martha es mit ihrem achtzehnten oder einundzwanzigsten Lebensjahr erhalten sollte.
Diese Regelung allein brachte uns, trotz allem, schon zum Lachen, so unwahrscheinlich erschien sie uns. Wir saßen beide auf dem Sofa und versicherten uns gegenseitig, dass es dazu nicht kommen würde. Dass die Behandlung anschlagen und sie als brustloses Wunder weiterleben würde. Dass wir bis ans Ende unserer Tage zusammenbleiben würden, als alte, übel riechende Spinatwachteln.
Sollte es aber doch anders kommen … würde Marthas finanzielle Zukunft »meinem Ermessen« unterliegen.
»Ich weiß, das ist nur ein rechtlicher Begriff«, sagte Kate damals und grinste trotz der Düsterkeit der Situation. »Aber ganz im Ernst? Du bist echt verrückt, Zoe. Erinnerst du dich noch, wie du für eine Eintrittskarte zu einem Konzert der Fun Lovin’ Criminals einen ganzen Wochenlohn hingelegt hast? Oder mit dem Taxi von London hierhergefahren bist, nur weil die Frau, die neben dir im Zug saß, ein Solei gegessen hat?«
»Ja, aber du musst zugeben, dass der Song Scooby Snacks damals ein Klassiker war … und wenn du diese Soleier gerochen hättest, ich schwöre dir bei Gott, du hättest dir auch ein Taxi genommen …«
»Okay. Aber als du mit neunzehn beschlossen hast, durchs Land zu trampen, um alle Little-Chef-Raststättenrestaurants auszuprobieren, weil du ihre Kirschpfannkuchen so gern gemocht hast?«
»Stimmt, das war schon ein bisschen schräg. Aber ich hab’s nur bis Bath geschafft. Aber du hast recht … ich bin verrückt. Bist du dir sicher, was mich und Martha betrifft … und mein Ermessen?«
Sie griff nach meiner Hand und drückte sie, als müsse sie mich beruhigen. »Hundert Prozent«, sagte sie. »Ich würde dir mein Leben anvertrauen – also kann ich dir auch das von Martha anvertrauen.«
An diese Worte denke ich, als ich Martha betrachte – das Kind, das gerade völlig uneigennützig vorgeschlagen hat, Mentholzigaretten zu rauchen, um mich zu beschwichtigen – und ich frage mich, ob Kate nicht selbst verrückt war. Oder ob sie etwas in mir gesehen hat, das ich selbst nicht so recht sehen konnte.
»Ich glaube, dass du mit dem Rauchen ganz aufhören musst«, sage ich zu Martha, die mir den Becher mit dem Kaffee aus der Hand genommen hat und ihn erfreulicherweise selbst trinkt. »Du bist sechzehn. Wahrscheinlich hast du noch keine Raucherlunge. Also hör besser auf, solange du da noch im Vorteil bist. Und was Dorset betrifft – krieg jetzt bitte keinen deiner Diva-Anfälle, mein Schatz, aber im Moment geht es dir nicht so gut, oder?«
Martha öffnet den Mund, um mit mir zu diskutieren – was momentan der einzige Grund für sie ist, ihn zu öffnen, außer wahrscheinlich noch, um sich eine Mentholzigarette hineinzustecken –, doch ich hebe abwehrend die Hand.
»Nein! Keine Diskussion! Ich streite mich mit niemandem, dessen Gesicht ich gestern Abend noch aus seinem eigenen Erbrochenen gezogen habe, okay? Dir geht es gerade nicht so gut. Basta. Mir auch nicht. Also müssen wir was ändern. Wir brauchen eine neue Weltordnung, denn die hier nervt.«
Ein Klopfen an der Tür rettet mich vor der Schimpftirade, die im nächsten Augenblick auf mich niedergegangen wäre. Bestürzt starren wir uns einen Augenblick lang an, ehe eine vertraute Stimme erklingt: »Hu-hu! Ich bin’s nur!«
Ausnahmsweise sind wir uns einmal völlig einig. Wir verdrehen im Duett die Augen und seufzen verzweifelt.
»Heute ist Sonntag, oder?«, sage ich und blicke auf meine Uhr. Genau zwölf. Unsere gemeinsame Erzfeindin ist überaus pünktlich.
»Ja. Mist! Das haben wir vergessen. Wie kann es nur sein, dass so oft Sonntag ist?«, erwidert sie und schaut wirklich verwirrt drein.
»Ich weiß es nicht … scheinbar stecken wir in einer Art Hölle fest, in der wir zu ewigen ›Huhu‹-Rufen und Klopfgeräuschen verdammt sind, und …«
»Und gleich … gleich kommt’s …«
Wir halten kurz inne, neigen die Köpfe zur Seite wie neugierige Wellensittiche und grinsen, während wir auf das Unvermeidliche warten.
»Ich bin’s nur!«, ruft Barbara noch einmal, und ich sehe sie im Geiste vor der Haustür stehen. Sie nestelt an ihrem Schal herum, tastet nach ihrer Brosche und hält die Nase in die Luft wie ein Bluthund auf der Fährte nach moralischem Frevel. »Will euch nicht stören«, trällert sie. »Benutz nur schnell meinen eigenen Schlüssel …«
Martha starrt mich an. Ich starre zurück.
»Das ist gelogen«, sagt Martha und trinkt ihren Kaffee aus. »Sie liebt es, uns zu stören. Du solltest die Schlösser austauschen.«
Sie stapft davon, um sich was Ordentliches anzuziehen. Ich versuche, meine widerspenstigen Locken zu glätten, damit Barbara sich nicht bekreuzigen muss bei meinem Anblick.
Es ist Sonntag. Schon wieder. Für Martha bedeutet es das einzigartige Vergnügen eines Mittagessens mit ihren Großeltern – für mich bedeutet es, ein paar Stunden mehr zu haben, um unsere Flucht in den Südwesten von England zu planen.
4. KAPITEL
Als Martha nach Hause kommt, habe ich der Vermieterin von The Rockery eine E-Mail geschrieben, die Kurse an der weiterführenden Schule überprüft und im nächstgelegenen Tierheim nach Hunden geschaut. Ich habe mir Notizen gemacht, einen Blick auf unsere Finanzen geworfen und darüber nachgedacht, meine Wohnung zu vermieten, um noch länger über die Runden zu kommen.
Eigentlich brauche ich meine Wohnung nicht mehr. Sie liegt auf der anderen Straßenseite im Erdgeschoss eines Reihenhauses aus Sandstein. Allerdings ist sie zurzeit eher ein Museum, das mein früheres Leben beherbergt, als eine funktionsfähige Wohnstätte. Vollgestopft mit Büchern und Klamotten, die ich nie wieder anziehen werde, und billigem Schmuck im Hippie-Look, den ich auf Festivals getragen habe und mit dem ich mir cool vorgekommen bin. Die Wohnung ist überflüssig – im Prinzip zumindest.
Trotzdem habe ich sie behalten – wahrscheinlich weil ich meine Rückversicherung brauche, so wie Martha. Während sie sagt, dass man sie mit sechzehn zu nichts zwingen kann, habe ich die Möglichkeit wegzulaufen, wenn mir alles zu viel wird.
Ich bin in der Tat schon ein paarmal rübergeflitzt – habe mich an den Wertstofftonnen und Nachbarskatzen vorbeigeschlängelt, um ins Haus zu gelangen und mich auf mein eigenes Bett zu legen. Um in meinem eigenen Reich zu sein. Letztendlich entscheide ich mich gegen einen Verkauf – ich werde die Wohnung behalten und stattdessen meine Ersparnisse anzapfen. Ich habe ein Sparbuch angelegt – auf Kates Drängen hin. Darauf befindet sich die eher bescheidene Summe von fünftausend Pfund. Doch da ich kein anspruchsvoller Mensch bin, kann ich locker ein paar Monate davon leben und für mich selbst aufkommen, statt nur Kates Geld zu verbrauchen.
Es gibt noch viel zu regeln. Doch darüber muss ich später nachdenken – denn jetzt höre ich das gekünstelte Geschnatter von Barbara und ihrem Mann, Ron, im Flur.
Ich schließe den Deckel meines Laptops und verstecke die Unterlagen. Barbara hat Adleraugen und entdeckt jede Kleinigkeit – besonders die, die ihre Ansicht untermauern, dass ich ein schrecklicher Mensch bin, der unfähig ist, sich um ihre kostbare Enkelin zu kümmern.
Martha kommt ins Zimmer geschlichen. Sie wirkt verlegen, fast schon beschämt. Wahrscheinlich haben Barbara und Ron ihr in den letzten Stunden immer wieder gesagt, wie wundervoll sie ist, und sie hat sich auf das Spiel eingelassen. Ich mache ihr keinen Vorwurf – das ist sicher der Weg des geringsten Widerstands.
Sie hat ihre Piercings abgelegt und das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ein zufälliger Beobachter könnte sie für einen ganz normalen Teenager halten. »Normal« im Sinne des Wortes, wie Barbara und Ron es benutzen würden. Ich weiß, dass Martha sich dafür hasst. Unser Verhältnis mag zwar stürmisch sein, doch sie kann zumindest sie selbst sein, wenn sie zu Hause ist – und muss sich nicht in einen Stepford-Teenager verwandeln wie für ihre Großeltern.
Barbara trägt einen schicken Tweedanzug, in dem sie wie eine der Moderatorinnen der Antiques Roadshow aussieht. Ihre perfekt toupierte Frisur ist umhüllt von Haarspray, das schimmert wie eine Eisschicht. Sie ist eine ansehnliche Frau und entsprechend ihrem Alter von Anfang sechzig geschminkt. Während ihre Laseraugen mich durchdringen, setzt sie ein Lächeln auf, das fast ebenso eisig daherkommt wie ihr Haar.
Wahrscheinlich würde auch mich ein eisiges Gefühl überkommen, wenn ich mich aus ihrer Perspektive betrachten würde. Sie hat mich nie gemocht. Ich war der schlechte Einfluss, die eigenwillige Zigeunerin, der Fleck in Kates ansonsten perfekt organisierter Kindheit.
Barbara war schon immer davon überzeugt, dass die wilden Kapriolen in Kates Leben auf mein Konto gingen – ihre Reise nach Abschluss des Studiums, die anfangs miesen Jobs, die Freunde, die so eigenartige Namen hatten wie Chili Pepper, das Dasein als alleinerziehende Mutter.
Das war selbstverständlich nicht der Fall. Es gab einen Grund, warum Kate und ich uns auf Anhieb verstanden.
Einen Grund, warum Kate – schlau, hübsch, beliebt und aus stabilen Verhältnissen kommend – mich sofort unter ihre Fittiche nahm, obwohl ich keine dieser Eigenschaften besaß. Die Wirklichkeit sah anders aus. Kate hatte selbst schon immer eine wilde Ader – die sogar meine manchmal in den Schatten stellte. Sie war verwegen und mutig und sehnte sich danach, aus der Enge ihres behüteten Lebens zu Hause auszubrechen. Diese Reise – auf der sie Marthas Vater kennenlernte (eine höfliche Formulierung für einen One-Night-Stand im betrunkenen, zugekifften Zustand) – war nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich war nicht einmal dabei.
Die miesen Jobs dienten bloß dazu, um herauszufinden, was sie wirklich machen wollte, ehe sie sich schließlich für den Lehrerberuf entschied. Die Freunde mit Namen wie Chili Pepper … gut, mindestens ein paar davon waren auf mich und meine obdachlosen Kumpel zurückzuführen, die es mit der Körperhygiene nicht so genau nahmen und ihre Hunde an Seilen führten.
Entweder weiß Barbara nichts davon, oder sie ignoriert es geflissentlich. Ist ja auch einfacher, einen Sündenbock zu haben. Einen Sündenbock, der gerade am Küchentisch sitzt, immer noch im Bademantel, aufgeputscht von Kaffee, mit einer Frisur, die an Struwwelpeter erinnert.
»Zoe!«, sagt sie und mustert mich von oben bis unten. »Wie nett von dir, dass du dir so viel Mühe gibst! Ist spät geworden gestern Abend, was?«
Ja, denke ich. Ist es. Weil ich mich um deine tugendhafte, kein Wässerchen trübende Enkelin kümmern musste. Aber das sage ich natürlich nicht – insbesondere, weil Martha mir schon flehentliche Blicke über die Schulter zuwirft. Ich hole tief Luft und erinnere mich daran, dass Barbara die Mutter von Kate ist. Dass sie ihr einziges Kind verloren hat und sich wahrscheinlich nie von diesem Schicksalsschlag erholen wird. Ihr Make-up übertüncht ihre Falten, so wie sie ihren Schmerz und Kummer übertüncht. Und den Verlust.
»Habt ihr ein schönes Mittagessen gehabt?«, frage ich unschuldig und beiße auf den Köder nicht an. Ich habe die Kunst der Kriegsführung gelernt, was Barbara betrifft – ich gewinne meine Schlachten, indem ich trotz ihrer Sticheleien gnadenlos höflich bleibe, was sie, offen gesagt, auf die Palme bringt. Früher bin ich ständig mit ihr aneinandergeraten – genau genommen mit der ganzen Welt –, doch heute? Da bin ich eine Zen-Meisterin im Bademantel.
»Ganz wunderbar, danke, Zoe«, antwortet Ron, der sich diskret im Hintergrund hält. Er trägt eine Freizeithose und ein perfekt gebügeltes Polohemd. Das schüttere Haar ist kunstvoll über die kahlen Stellen des Kopfes drapiert. Ron ist gar kein so übler Mensch. Ich habe einmal spontan einen Abend mit ihm im Pub verbracht, und er hat sich als ziemlich witzig herausgestellt. Leider gehört er jener Gattung von Männern an, deren Schicksal es ist, im Schatten ihrer sehr viel stärkeren Frauen zu stehen.
»Ja«, wirft Martha ein, da sie unbedingt das Gespräch von meinem späten gestrigen Abend und ihren Schwindeleien weglenken will. »Wir sind zu diesem Restaurant außerhalb der Stadt gefahren, wo es diese richtig guten frittierten Zwiebelringe gibt.«
»Das kenne ich«, erwidere ich lächelnd. Und noch während ich lächele, wird mir bewusst, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe. Mein Magen beginnt zu grummeln, und Barbara rümpft die Nase, als hätte ich mir gerade in der Öffentlichkeit in die Hose gemacht.
»Okay, Ron«, verkündet sie. »Wir gehen dann mal besser. Ach ja, und Zoe? Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, ein Bleichmittel für diese Küche zu kaufen. Du weißt ja, Sauberkeit kommt gleich nach Gottesfurcht.«
Ich nicke begeistert, als wäre das der beste Ratschlag, den ich je gehört habe, und warte, während Martha ihre Großeltern zur Tür begleitet.
Als sie zurückkehrt, ist sie still. Ernst. Nachdenklich. Normalerweise verbinde ich keines dieser Wörter mit meinem Wirbelsturm Martha.
»Alles in Ordnung?«, frage ich und berühre kurz ihre Hand. Wie nicht anders zu erwarten, zieht sie sie sofort weg. Doch sie setzt sich mir gegenüber an den Küchentisch und zeigt auf den Laptop und die darunter hervorlugenden Unterlagen.
»Planst du noch immer die große Flucht?«, fragt sie mit dumpfer Stimme. Sie ist blasser als üblich, und ihre dunkelbraunen Augen sind Sammelbecken flüssigen Leids. So sollte sie sich weder fühlen noch aussehen. Mich erfasst Traurigkeit angesichts unserer erbärmlichen Situation.
»Ja«, antworte ich entschieden. »Ich weiß, dass du darauf nicht scharf bist, Martha, und ich verstehe deine Gründe. Aber du musst mir in dieser Sache mal vertrauen. Oder es zumindest versuchen.«
Sie ist ein paar Sekunden lang still und kaut so fest auf der Innenseite ihrer Wange herum, dass sie bestimmt blutet. Schließlich nickt sie unvermittelt.
»Ich werd’s versuchen. Gran hat heute … na ja, nicht lockergelassen, verstehst du?«
»In welcher Beziehung?«, frage ich stirnrunzelnd. Natürlich war Barbara zutiefst traurig, als Kate ihr eröffnete, dass Martha mit mir leben würde, sollte das Undenkbare eintreten. Als es dann tatsächlich eintrat, dachte Barbara darüber nach, rechtliche Schritte einzuleiten, um mir Martha wegzunehmen. Das weiß ich. Nur ein Brief, den Kate ihr hinterließ, und Marthas Wunsch, in ihrem Zuhause zu bleiben, hielten sie davon ab.
Doch sie hat nie aufgehört, Martha zu beschwatzen. Sie überschüttet sie mit Geschenken, Geld und grenzenloser Liebe, um sie so dazu zu bringen, bei ihr und Ron zu leben statt bei der rothaarigen Teufelin.
»In der Beziehung, dass sie doch nur ›das Beste‹ für mich wollen«, antwortet Martha. »Du weißt schon. Ich würde dann bei ihnen leben, viele rosa Freizeitklamotten tragen, lernen, Kuchen zu backen, und dürfte am Wochenende als besondere Belohnung My-Little-Pony-Videos sehen …«
Ich pruste los und bekomme einen dieser dreckigen Lachanfälle, bei denen man fast erstickt. Die Vorstellung, dass Martha in einem zuckerwattefarbenen, samtenen Trainingsanzug vor dem Fernseher sitzt und Zeichentrickfilme sieht, ist derart komisch, dass ich meine Belustigung darüber herauslassen muss. Marthas Lippen zucken fast unwillkürlich, was dieser Tage einem dröhnenden Lachen gleichkommt.
»Das ist überhaupt nicht lustig«, sagt sie, klingt aber nicht überzeugt.
»Doch. Ist es«, entgegne ich und kichere noch immer. »Zumindest ein bisschen. Aber … hör mal, ich weiß, dass es schwer ist. Deine Großmutter ist eine Frau … mit einer starken Persönlichkeit. Aber sie liebt dich. Und sie hat deine Mum geliebt.«
»Das weiß ich! Aber eigentlich versteht sie uns nicht, oder?«
»Nicht mal ansatzweise. Das hat sie noch nie. Doch das macht sie zu keinem schlechten Menschen. Aber … auch zu keinem Menschen, mit dem man zusammenleben will. Fakt ist, dass wir uns alle diese Situation hier nicht gewünscht haben und uns nach deiner Mum sehnen. Ich habe meine beste Freundin verloren. Du deine Mutter. Wir werden nie wieder die sein, die wir einmal waren – doch wir müssen weiterleben. Ich mache mir Sorgen. Um dich. Um die Schule. Um dein Umfeld. Um deine Orthografieschwäche, denn du kannst ›Fuck‹ nicht richtig schreiben. Ich mache mir um alles Sorgen – und deshalb glaube ich, dass sich unser Leben ändern muss.«
Sie nickt erneut und steht auf. Martha ist nicht groß, aber gertenschlank. Sie erinnert mich immer ein bisschen an Bambi, weil sie nie so genau weiß, was sie mit ihren Beinen machen soll.
»Okay«, sagt sie und geht zur Tür. »Ich werde darüber nachdenken. Und mach dir keine Sorgen darum, dass ich ›Fuck‹ nicht richtig schreiben kann – immerhin kann ich es richtig aussprechen, und darauf kommt’s doch an!«
5. KAPITEL
Die nächsten Tage vergehen ziemlich ruhig. Martha zeigt sich von ihrer besten Seite, was schon fast beängstigend ist.
Sie hat den Umzug nicht mehr erwähnt. Ich auch nicht – sie will mich wohl auf diese Weise besänftigen und unter Beweis stellen, dass sie doch ein gutes Mädchen sein kann. Wahrscheinlich hofft sie, dass ich die Sache wie durch ein Wunder wieder vergessen habe.
Das habe ich natürlich nicht. Im Gegenteil. Ich habe an nichts anderes gedacht, dabei auf vielen Bleistiften herumgekaut, noch mehr Kaffee getrunken und auf die Rückseite der Quittungen von Bargain Booze, dem Spirituosenladen, Bilder von rosenumrankten Ferienhäusern gekritzelt.
Ich stehe weiterhin in E-Mail-Kontakt mit Cherie Moon, der witzigen Vermieterin von The Rockery, nehme Kontakt zu der weiterführenden Schule in Budbury auf und schicke Marthas früherer Schulleiterin eine äußerst infantile Nachricht, in der ich ihr mitteile, dass wir uns beide freuen, nie wieder zurückzukehren.
Mein Vorhaben kommt schon bald weiter voran. Cherie Moon – meine neu gewonnene beste Freundin – bestätigt mir, dass wir eines ihrer beiden Ferienhäuser mit zwei Schlafzimmern für sechs Monate mieten können. Dazu auch noch zu einem ausgezeichneten Preis, wie es scheint. Sie stellt alle möglichen Fragen, die ich nicht erwartet habe. Scheinbar ist sie viel mehr an dem Grund unseres Umzugs interessiert als an meiner Kreditwürdigkeit, was für eine Vermieterin ungewöhnlich ist.
Ich habe Cherie von Kate und Martha erzählt und dass wir uns mit diesem Schritt einen Neuanfang erhoffen. Warum, weiß ich nicht. Sie hat sehr mitfühlend reagiert und gemeint, dass Budbury und das Café, das sie an der Küste betreibt, »auf Neuanfänge spezialisiert« seien.
Ich grübele kurz darüber nach, ob sie vielleicht eine Sektenführerin ist – den richtigen Namen dafür hat sie ja – und ob sie uns in ihre quasireligiöse Gemeinschaft locken will, in der von uns erwartet wird, dass wir ein Zehntel unserer Einkünfte abgeben, mit dem Hohepriester schlafen und Marmelade aus Teeblättern und den Innereien von Ratten kochen. Andererseits habe ich schon immer eine blühende Fantasie gehabt.
Stolz auf meine Fortschritte, belohne ich mich mit mehreren Folgen Game of Thrones und einem Glas Wein – es könnte schlimmer sein, Martha könnte in Sansa Starks Haut stecken. Vielleicht bin ich kurz dabei eingenickt. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall muss irgendetwas passiert sein, denn als ich mir das nächste Mal meiner Umgebung bewusst werde, ist es draußen dunkel, mein Kinn versabbert, und auf meiner Jeans ist ein roter Fleck. Klasse.
Ich komme langsam wieder zu mir, wische mir das Gesicht ab, hebe das leere Weinglas neben dem Sofa auf und verdecke die Augen mit der Hand, als ich den Fernseher ausschalte. Die Folgen von Game of Thrones waren auf automatische Wiedergabe eingestellt – der schlimmste Spoiler überhaupt.
Ich sehe auf die Uhr. Kurz nach elf. Da habe ich doch tatsächlich ein mehrstündiges Nickerchen gemacht. Ein traumloser, tiefer Schlaf völliger Erschöpfung.
Aus Marthas Zimmer dringt noch immer das wummernde Geräusch des Basses. Da drinnen muss eine ohrenbetäubende Lautstärke herrschen. Durchaus möglich, dass ihr ein Leben mit defekten Trommelfellen bevorsteht, wenn sie so weitermacht.
Ich räume kurz die Küche auf – damit meine ich, dass ich noch mehr Teller in die Spülmaschine stopfe und auf das Beste hoffe – und beschließe, schlafen zu gehen. Oder mich zumindest ins Bett zu legen, mit einem guten Buch. Ich schlafe im früheren Gästezimmer. Einem ziemlich kleinen Raum mit Blick auf den Garten. Ich habe mich nie dazu durchringen können, in Kates Zimmer zu schlafen, obwohl es mit Abstand das größte ist. Es ist immer noch zu sehr … ihr Zimmer. Das gilt gewissermaßen für das gesamte Haus, das uns stets an unser früheres Leben erinnert; an die Frau, die wir geliebt haben und die diesem Ort Kraft, Wärme und Geborgenheit verliehen hat. Die Frau, die wir verloren haben.
Doch wir leben im Rest des Hauses. Wir benutzen es; wir kochen, machen Unordnung, waschen, lassen Bücher herumliegen und knallen unsere Taschen in die Diele. Der Rest des Hauses ist nicht in der Zeit stehen geblieben – er wächst weiter, mit uns und um uns herum.