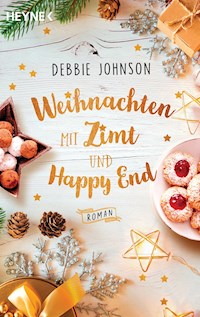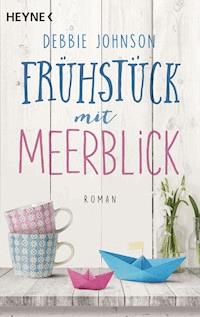9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Comfort Food Café-Reihe
- Sprache: Deutsch
»Genauso heimelig wie gebuttertes Teegebäck« Sunday Times
Ich heiße Willow Longville. Ich lebe in einem Dorf namens Budbury an der umwerfenden Küste Dorsets, zusammen mit meiner Mutter Lynnie, die manchmal vergisst, wer ich bin. Ich arbeite als Kellnerin im Comfort Food Café, was tatsächlich so viel mehr als nur ein Café ist … es ist mein Zuhause.
Das baufällige Café mit Blick auf den Strand und seiner warmherzigen Gemeinde hat für Willow täglich Freundschaft im Angebot und immer ein herzliches Willkommen auf der Karte. Als aber ein gut aussehender Fremder mit einer Sommerbrise hereingeweht wird, wird Willow bald klar, dass sich ihr stilles Landleben für immer ändern wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DAS BUCH
Ich heiße Willow Longville. Ich lebe in einem Dorf namens Budbury an der umwerfenden Küste Dorsets, zusammen mit meiner Mutter Lynnie, die manchmal vergisst, wer ich bin. Ich arbeite als Kellnerin im Comfort Food Café, was tatsächlich so viel mehr als nur ein Café ist … es ist mein Zuhause.
Das baufällige Café mit Blick auf den Strand und seiner warmherzigen Gemeinde hat für Willow täglich Freundschaft im Angebot und immer ein herzliches Willkommen auf der Karte. Als aber ein gut aussehender Fremder mit einer Sommerbrise hereingeweht wird, wird Willow bald klar, dass sich ihr stilles Landleben für immer ändern wird …
DIE AUTORIN
Debbie Johnson ist eine Bestsellerautorin, die in Liverpool lebt und arbeitet. Dort verbringt sie ihre Zeit zu gleichen Teilen mit dem Schreiben, dem Umsorgen einer ganzen Bande von Kindern und Tieren und dem Aufschieben jeglicher Hausarbeit. Sie schreibt Liebesromane, Fantasy und Krimis – was genauso verwirrend ist, wie es klingt.
DEBBIE JOHNSON
ROMAN
Aus dem Englischen
von Irene Eisenhut
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Sunshine at the Comfort Food Café bei HarperCollins.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 05/2019
Copyright © 2018 by Debbie Johnson
Copyright © 2019 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Hanne Hammer
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München
unter Verwendung von Stefan Preuss/www.mare-me.de;
iStockphoto (Jakkapan21);
Bigstock (KateRybina, Anna Denisova, Seregam, Roman Sotola)
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-24161-2V003
www.heyne.de
Für Terry und Norm, in Liebe
Prolog
Sommer 2000
»Da drinnen spukt’s«, sagt Auburn und stößt Willow derartig fest in die Rippen, dass sie fast umfällt. Sie hält sich an ihrem Bruder Angel fest, der fast genauso dünn ist wie sie, um sich aufzurichten, und versucht, völlig unbeeindruckt von dem ganzen Abenteuer auszusehen.
Angel schubst seine Schwester weg, um seine Tapferkeit unter Beweis zu stellen, die aber nur vorgetäuscht ist. Willow ist einige Jahre jünger als ihre Geschwister – immer die Kleine, immer die Stille, immer die Zielscheibe ihres Spotts. Und immer entschlossen zu beweisen, dass sie nicht das schwächste Glied in der Kette ist, was sie fast immer in Schwierigkeiten bringt.
»Nein!«, entgegnet Willow, taumelt nach hinten und prallt gegen die holzverkleidete Wand. »Da drinnen spukt’s nicht!« Das Haus ist alt und groß. Überall nur dunkle Tapeten, hohe Decken mit Stuck und labyrinthartige Flure voller Geheimnisse. In diesem Sommer ist es auch ihr inoffizieller – und etwas furchterregender – Spielplatz.
»Nein!«, beharrt sie noch einmal und starrt Auburn trotzig an. »In so einem Riesenhaus wie dem hier kann es nicht nur in einem Zimmer spuken. Das macht überhaupt keinen Sinn!«
»Natürlich kann es das«, hält Auburn dagegen und sieht ihren großen Bruder an auf der Suche nach Rückendeckung. Sein rotes, schulterlanges, fettiges Haar leuchtet in dem schummrigen Licht. Van ist fünfzehn, der Älteste der Bande, und schon über ein Meter achtzig groß. Er trägt ein unmodernes Nirvana-T-Shirt und hat die Muskulatur einer Stangenbohne. Er findet sich richtig cool, was nicht so recht zu der Tatsache passen will, dass ihn alle anderen für einen Volltrottel halten.
Die achtjährige Willow ist beträchtlich kleiner als ihr Bruder und betrachtet ihn aus ihrer Perspektive. Lange hat sie zu ihm aufgeblickt, doch mittlerweile hegt sie den Verdacht, dass er ein widerlicher Kerl sein könnte. Auf jeden Fall riecht er so. Sie mustert die Flecken auf seinem T-Shirt. Ihr ist klar, dass man von ihr erwartet, dieses T-Shirt zu tragen, sobald sie hineinpasst. Denn das Vererben alter Kleider gehört zum Lebensstil der Familie Longville.
Die drei jüngeren Geschwister starren Van an und warten auf sein Urteil. Auburn blickt grimmig, während Angel zittert und auf seinen vollen Lippen herumbeißt. Willow hat die Arme über dem schon mehrfach weitergereichten Barney-der-lila-Dinosaurier-T-Shirt verschränkt.
»Möglicherweise«, beginnt er und schleicht zu der Tür am Ende des Flurs, »… haust das Gespenst nur in diesem einen Zimmer. Vielleicht ist da drinnen ja mal was Schreckliches passiert.«
»Ach ja? Was denn?«, fragt Willow und versucht unerschrocken zu klingen, obwohl sie am liebsten zu ihrer Mum laufen würde. Was sie aber nicht kann, denn Auburn würde ihr das immer wieder aufs Brot schmieren. Außerdem ist ihre Mum gerade im Garten, wo sie einen Meditationskurs abhält. Sie würde sie umbringen, wenn sie da jetzt hineinplatzte. Na ja, nicht direkt umbringen – wahrscheinlich wäre es schon was Zenartigeres, aber bestimmt nichts Angenehmes.
»Vielleicht«, flüstert Auburn ihr ins Ohr, »ist da mal jemand gestorben. Hat sich erhängt oder ist verhungert, weil er eingemauert wurde. Oder ein kleiner, behinderter Junge ist in dem Zimmer verkümmert, weil seine Eltern sich wegen ihm geschämt und ihn deshalb sein ganzes Leben lang dort versteckt haben.«
Angel scheint mittlerweile den Tränen nahe. Seine blonden Locken wippen über sein pausbackiges Gesicht. Van nickt weise, als wäre das, was Auburn gerade gesagt hat, seinem fast Erwachsenenverstand nach völlig einleuchtend.
»Du … du redest völligen Mist!«, erwidert Willow und wird ein bisschen rot, da sie weiß, dass sie gerade etwas Ungezogenes gesagt hat. Sie hat zwar nicht so schlimm geflucht, dass sie deshalb ins Bett geschickt werden müsste, oder Vans Lieblingswort benutzt, das mit »Sch« anfängt, trotzdem hat sie geflucht. Und das gibt ihr genügend Selbstvertrauen, das zu tun, was sie als Nächstes tut.
»Dann beweis es!«, stichelt Auburn und zeigt auf die Tür. »Geh rein und schau nach, was drinnen ist. Wenn du dich traust!«
Vor wenigen Minuten erschien besagte Tür noch völlig normal, doch jetzt – nach der ganzen unheimlichen Geschichte, die ihre vierzehnjährige Schwester ersponnen hat – sieht sie absolut grauenerregend aus. Dunkles Holz, Messinggriff, leeres Schlüsselloch. Quasi das Tor zur Hölle.
Das ist bloß eine Tür, sagt sich Willow und wirft Auburn einen Blick zu, in dem ein Hass liegt, den nur eine jüngere Schwester für jemanden empfinden kann, den sie lieb hat.
Das ist bloß eine Tür. Dahinter spukt es nicht, denn es gibt keine Gespenster. Und selbst wenn, könnten sie freundlich sein. So wie Casper.
Willow holt tief Luft und klemmt die strähnigen, braunen Haare hinter die Ohren. Im Augenblick wünscht sie sich nichts mehr, als dass dieses Spiel nie begonnen hätte. Sie und ihre Geschwister kennen die meisten Kinder in diesem Haus – sie leben hier, weil ihre Mütter oder Väter bereits gestorben sind. Sie kennen ihre Namen und ihre Geschichten. Und sie spielen mit ihnen, während ihre Mum Kunst und Yoga unterrichtet oder den Kindern beim Lesen hilft.
Sie kennen die meisten – aber nicht den Jungen, der hinter dieser Tür wohnt. Sie war noch nie offen. Der Junge ist ihnen noch nie begegnet. Der einzige Beweis dafür, dass er existiert, ist ein Schatten, den sie gelegentlich von draußen durch das Fenster sehen.
Damit hat alles begonnen – mit der Diskussion, ob es ihn tatsächlich gibt oder ob er nur ein Gespenst ist. Anfangs war das noch witzig, aber jetzt? Jetzt ist es nur noch unheimlich. Eigentlich will Willow diese Tür nicht aufmachen. Sie will weder den Geist von jemandem sehen, der am Dachsparren baumelt und dessen lila Zunge aus dem Mund hängt, noch will sie einem halb verhungerten Kind begegnen, das bestimmt ein bisschen wütend ist auf die Welt.
Noch weniger will sie allerdings Schwäche vor ihrer Schwester zeigen. Auburn ist stets gemein zu ihr, was sie aber gut vor ihrer Mum zu verheimlichen weiß, sodass es so aussieht, als würde Willow ständig wegen nichts jammern. Wenn sie jetzt einen Rückzieher macht, wird Auburn sie immer wieder daran erinnern. Wie aufs Stichwort hört sie ihre Schwester hinter sich ein ängstlich gackerndes Huhn nachmachen. Ihre Brüder stimmen innerhalb von Sekunden ein und ahmen mit ihren Armen einen Flügelschlag nach.
Willow wischt sich das Gesicht mit Barney ab – der Schweiß steht ihr mittlerweile auf der Stirn, obwohl es in dem dunklen Flur kühl ist – und macht einen ersten zögerlichen Schritt. Sie ignoriert den gackernden Chor. Ihre Schritte werden zielstrebiger, während sie sich über den abgenutzten Teppich langsam dem Ende des Flurs nähert. Der Tür nähert, hinter der entweder sagenhafter Ruhm oder vielleicht der Tod auf sie wartet – was von beidem, ist sie sich noch nicht so ganz sicher.
Sie bleibt vor der Tür stehen und wartet einen Augenblick. Ihre Finger liegen auf dem Griff. Sie blickt nach hinten in die Gesichter ihrer Geschwister. Van wirkt amüsiert, Angel runzelt die Stirn, und Auburn starrt sie an, als würde sie wissen, dass sie einknicken wird.
Dieser Blick bestärkt Willow nur noch mehr, und so dreht sie schließlich den Griff herum und drückt die Tür auf. Sie knarrt und quietscht, bis endlich – endlich – das Zimmer zum Vorschein kommt.
Es ist dunkel darin. Die Vorhänge sind zugezogen, aber nicht ganz bis zur Mitte – nur ein schmaler Streifen Licht dringt hindurch und leuchtet auf einen unaufgeräumten Schreibtisch. Einen Schreibtisch, auf dem Spulen, Federn und ausgebaute Geräteteile liegen, die ihr junger Verstand sofort mit einer Projektarbeit in Verbindung bringt, die ihr Bruder Angel im Jahr zuvor zu mittelalterlichen Folterinstrumenten verfasst hat.
An dem Schreibtisch sitzt ein Junge, der sich zu ihr umgedreht hat. Vielleicht ist er real, vielleicht ein Gespenst. Das kann sie in der Dunkelheit nicht so genau sagen. Er ist älter als sie, hat blasse Haut, dunkles Haar, hohe Wangenknochen und riesige, entsetzt dreinblickende braune Augen. Er hält einen Schraubenzieher in der Hand und sieht fast genauso ängstlich aus wie sie, während er sie anstarrt und durch das plötzlich vom Flur hereinfallende Licht blinzelt, das seine Gestalt wie einen unheimlichen Schatten erscheinen lässt.
Auch wenn er kein Gespenst ist, macht er einen gequälten Eindruck – und das reicht, um Willow den Rest zu geben.
Sie beginnt zu schreien, laut und schrill, und schlägt die Tür wieder zu. Dann bricht sie wie ein kleines Häufchen Elend auf dem Boden zusammen und schüttelt sich. Willow sieht ihre Geschwister an, die sich um sie drängen.
Sie schütteln sich ebenfalls. Aber vor Lachen. Auburn zeigt mit dem Finger auf sie und hält sich den Bauch fest. Van rollen tatsächlich die Tränen über die Wangen. Angel ahmt wie immer seine älteren Geschwister nach.
Willow rappelt sich hoch. Gedemütigt, verängstigt und auf wackligen Beinen stößt sie ihre beiden Brüder weg, als sie davonläuft. Sie hasst sie in dem Moment – sie alle.
Ihre kurzen Beine jagen die Holztreppe hinunter. Hätte die große Haustür nicht schon offen gestanden, wäre sie vielleicht durch sie hindurchgeschossen wie eine Comicfigur und hätte ein Loch in der Gestalt ihres Körpers in dem Eichenholz hinterlassen.
Sie rennt aus dem Haus, über den Kiesweg an der Seite des Hauses entlang in den Wald hinein und zu dem versteckt liegenden Teich, den sie so gern mag. Dort lässt sie sich auf einen moosbedeckten Baumstamm fallen. Missmutig stößt sie die auf dem Boden liegenden Blätter, Stöcke und Schiefersteine mit ihren Sportschuhen weg.
Es tut ihr gut, allein zu sein, und sie wird ruhiger. Sie weiß, dass ihre Angst bald verfliegen wird. Immerhin war der Junge kein richtiges Gespenst. Gespenster benutzen nämlich keine Schraubenzieher und blicken verängstigt drein, wenn kleine Mädchen in ihr Zimmer hereinplatzen, oder?
Sie verbringt den restlichen Vormittag allein am Teich und spielt. Denn ihre Geschwister, diese wilde Meute, kann sie noch nicht ertragen. Und diese großen, braunen Augen und dieses blasse Gesicht verfolgen sie auch noch immer.
1. Kapitel
Heute
Ich heiße Willow Longville und bin sechsundzwanzig Jahre alt. Ich lebe mit meiner Mum, Lynnie, in einem Dorf namens Budbury und arbeite als Bedienung im Comfort Food Café. Ich betreibe meinen eigenen Reinigungsdienst namens Will-o’-the-Wash. Ich habe eine Hündin, die auf den Namen Bella Swan hört, und ich liebe mein Leben. Das hier sind die Ereignisse der letzten vierundzwanzig Stunden:
1. Meine Freundin Cherie hat es geschafft, uns glauben zu machen, dass sie schwanger ist. Mit Zwillingen, was eine ziemliche Überraschung war, denn Cherie ist vierundsiebzig. Sie hat uns erzählt, dass sie in einer Kinderwunschklinik in Montenegro gewesen sei, und wir haben es ungefähr fünf Minuten für wahr gehalten.
2. Bella Swan hat einen Frosch gefressen.
3. Der Buchladen im Comfort Food Café ist offiziell eröffnet worden, was wir mit sehr vielen Kuchen gefeiert haben, alle verziert mit den Konterfeis berühmter literarischer Figuren wie Oliver Twist, Tess von den D’Urbervilles, Mr. Darcy und Pennywise, dem furchterregenden Clown aus Es. Der Clown ist meine Idee gewesen, und sein Gesicht zu essen war ziemlich gruselig.
4. Meine Mutter ist mit einer Bratpfanne auf mich losgegangen, da sie mich für eine Einbrecherin gehalten hat.
5. Ich muss danach wohl für drei Minuten bewusstlos gewesen sein, denn sie hat auch noch die Polizei gerufen.
6. Ich bin heute Morgen aufgewacht und die Sonne hat geschienen, was in mir Glücksgefühle ausgelöst hat. Zum Frühstück habe ich dann die Reste des Harry-Potter-Kuchens gegessen, was noch mehr Glücksgefühle in mir ausgelöst hat.
7. Ich bin zu The House on the Hill gefahren. Obwohl das Gebäude noch immer angsteinflößend ist, kommt es mir jetzt sehr viel kleiner vor. Das muss wohl daran liegen, dass ich kein Kind mehr bin. Zumindest im Prinzip.
8. Ich habe zuerst einen Spaziergang zum Teich gemacht und einen nackten Mann im Wasser gesehen. Das Sonnenlicht schien auf ihn herab, und seine Haut funkelte wie Diamanten – jetzt bin ich ein bisschen besorgt, dass ich vielleicht einen echten Edward Cullen heraufbeschworen habe.
Ich halte inne und beschließe, mit der Liste aufzuhören. Ein eingebildeter Edward Cullen in einem Teich ist kaum noch zu überbieten, oder?
Stattdessen sitze ich still und leise auf dem Rand des versiegten Springbrunnens und genieße den Augenblick.
Heute ist der erste wirklich warme Frühlingstag, und Mutter Natur hat sich vorgewagt, um ihn zu feiern. Genau genommen hat sie sich eine ganze Flasche Wodka genehmigt und lässt es so richtig krachen – frisches Laub hüllt den Wald ein, das Gras leuchtet satt und üppig, und Glockenblumen schießen aus dem Boden, bilden auf den Lichtungen wahre Teppiche und winken unbekümmert.
Der Anblick ist unglaublich schön, was meine Lebensgeister derartig beflügelt, dass ich abheben könnte. Wenn ich denn Flügel hätte.
Dieser Tag wird ein guter Tag werden, sage ich mir, auch wenn er erst mal schlecht begonnen und dann eine Wendung ins Seltsame genommen hat. Jetzt ist es meine Aufgabe, das Ruder herumzureißen, damit der Rest davon doch noch gut werden kann.
Klingt allerdings einfacher, als es ist, denn hinter mir türmt sich The House on the Hill in all seiner grässlichen Pracht auf.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass es wie aus einem Horrorfilm aussieht. Einem Horrorfilm, in dem die Eltern ihrem Kind unbekümmert die gruseligste Puppe der Welt schenken und man ihm am liebsten sofort zubrüllen möchte: »Los, verschwinde! Lauf in ein Hotel und rühr dich bloß nicht vom Fleck!«
Eigentlich heißt dieser Amityville-Backsteingebäude-Statist Briarwood – aber wir Einheimischen nennen es The House on the Hill. Warum wir dem Gebäude diesen Spitznamen gegeben haben, ist furchtbar kompliziert. A: weil es ein Haus ist, und B: weil es auf einem Hügel liegt. Ja, ich weiß – diese Logik ist bezwingend. So sind wir nun mal, wir Landpomeranzen, total pfiffig.
Allein der Hügel ist schon ziemlich furchterregend – ein wahrer Dämon, der im ersten Gang bezwungen werden muss, sodass die Kupplung glüht. Wagt man sich dabei auch noch zu niesen oder zu Katy Perry’s »Roar« ein bisschen zu leidenschaftlich mitzusingen, kann man nur inständig beten, nicht wieder rückwärts herunterzurollen.
Ich bin schon seit einer Ewigkeit nicht mehr hier gewesen – genauer gesagt, seit meiner Kindheit, was sich an Jahren und Erfahrungen tatsächlich wie eine Ewigkeit anfühlt. Seitdem sind fast zwanzig Jahre vergangen. Verrückt. Ich blicke wieder auf das Gebäude und mache wahrscheinlich genau das gleiche Gesicht, das ich mache, wenn ich Hundehaufen einsammele und meine Finger sich dabei durch den Müllbeutel bohren.
Vor der roten Backsteinfassade steht ein Gerüst, doch von Handwerkern fehlt jede Spur. Die große blaue Holztür existiert noch, allerdings müsste sie mal neu gestrichen werden. Auch die alten Fenster mit den gotischen Steinornamenten gibt es noch. Und auf dem Dach fehlen noch immer ein paar Wasserspeier, damit das Haus richtig aussieht wie aus American Horror Story. Ein aus Stein gemeißelter, von Unkraut und Algen umrankter Cherub ziert die Mitte des Springbrunnens, auf dessen Rand ich gerade sitze.
Der Garten und die Sträucher sind zugewuchert, doch es hat sich anscheinend jemand durch das Gestrüpp gekämpft. Wer immer das war, muss eine Machete und wahrscheinlich auch noch ein Heer von Oompa Loompas zu Hilfe gehabt haben. Ich beginne automatisch das Oompa-Loompa-Lied zu singen, was nicht ganz so melodisch klingt wie das Gezwitscher der Vögel und das im Wind raschelnde Eichenlaub.
Es ist sehr seltsam, wieder hier zu sein. Und bis ich etwas als seltsam bezeichne, braucht es viel. Wenn ich die Augen schließe, das Gesicht zur Sonne drehe und nicht mehr das Oompa-Loompa-Lied singe, taucht die Zeit von damals vor meinem inneren Auge auf. Ich höre meine Geschwister lachen und über den Kies jagen und meine Mutter etwas wahnsinnig Törichtes psalmodieren, das sie den Menschen als ein Zeichen tiefen spirituellen Erwachens weismachen will, während eine Horde Jugendlicher verzweifelt darum bemüht ist, ihr Kichern zu unterdrücken.
Vor allem diese Erinnerung – die meiner sehr viel jüngeren Mum – ruft einen Hauch von Traurigkeit in mir hervor. Ich stopfe sie in eine Kiste und springe auf den Deckel. Dann trampele ich mit meinen Doc Martens, die ich jetzt sowohl an den Füßen als auch im Kopf trage, ordentlich darauf herum, damit der Deckel ja unten bleibt.
Die vergangenen vierundzwanzig Stunden waren völlig verrückt. Und so scheint es weiterzugehen, wie sich an meinem kurzen und möglicherweise halluzinogenen Abstecher zeigt, den ich vorhin in den Wald zum Teich gemacht habe. Ich weiß, dass ich müde bin, auch wenn ich die Müdigkeit nicht wirklich spüre – ich habe es mir in den vergangenen Jahren antrainiert, sie einfach nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen, doch sie ist da und hält sich versteckt wie ein Schachtelteufel, der nur darauf wartet, aufzuspringen und mich zu fangen. Außerdem neigen meine Gedanken dazu, über sich zu stolpern, wenn ich müde bin, sodass man ihnen unmöglich folgen kann.
Ja. Mein Tag hat seltsam begonnen – deshalb muss er jetzt besser werden, was nur ich bewerkstelligen kann. Und dafür muss ich mich auf den Sonnenschein und den Gesang der Vögel konzentrieren, statt eine Reise in die Vergangenheit zu machen, an deren Ende ich an einem einsamen Bahnhof abgesetzt werde.
Ich lese die Liste noch einmal durch und komme zu dem Schluss, dass sie meinen Tag ziemlich gut zusammenfasst. Anscheinend habe ich mir auch noch zufällig meinen eigenen, psychedelischen LSD-Trip verschafft, ohne dass irgendwelche Pillen dabei im Spiel gewesen sind: mein neonrosa Schreibblock und mein hellgrüner Gelschreiber liegen auf meinen Knien, und ich trage Leggings, auf denen gelbe Minions sind. Abgefahren.
Ich strecke mich und genieße das Gefühl der Sonne auf meiner Haut. Mir kommt es vor, als hätte Gott sich zu mir herabgebeugt, um mein Gesicht zu streicheln. Und das mit richtig warmen Ofenhandschuhen.
Der Winter war lang und schrecklich, und ich bin stets aufs Neue erstaunt, wenn der Frühling dann doch wiederkommt. Seltsam, denn es geschieht ja jedes Jahr – und trotzdem verblüfft es mich immer wieder. In unserer ruhigen Ecke hier in Dorset hat es in den letzten Monaten sehr viel geschneit, sodass ich es gewohnt bin, lange Unterhosen und siebzehn Paar Handschuhe zu tragen. Aber jetzt ist es zu meiner großen Überraschung wieder warm … wer hätte das gedacht?
»Was meinst du, Bella?«, sage ich zu meiner Hündin, die zu meinen Füßen schläft. »Zeit zu arbeiten?«
Bella antwortet nicht, was hauptsächlich daran liegt, dass sie eine zehnjährige, nicht gerade gesprächige Border Terrierin ist. Sie bellt nicht einmal, von Reden ganz zu schweigen.
Aber immerhin steht sie auf und sieht mich an. Dann hockt sie sich hin, um Pipi zu machen, als wollte sie mir auf diese Weise antworten.
»Wie schön, dass du mir zustimmst«, sage ich und gehe zu meinem Transporter, um mein Putzzeug zu holen.
Mein Transporter ist klein und weiß und hat einen Regenbogen auf einer Seite, den meine Mum gemalt hat, und auf den wir beide sehr stolz sind. In der Windschutzscheibe hängt ein Traumfänger und an der Rückscheibe kleben irgendwelche alten, vergilbten Aufkleber, die sie in einer Schublade gefunden hat. Sie haben Aufschriften wie »Stopp der Atomkraft«, »Rettet die Wale« und »Umarmt die Bäume«. Alles vernünftige Ratschläge, solange man sie nicht verwechselt und am Schluss eine Atombombe umarmt und die armen Wale stoppt.
Wann immer ich mit meinem Transporter unterwegs bin, erwecke ich den Eindruck, als wollte ich Tramper zu einem Festival im Jahr 1976 mitnehmen oder auf dem Militärflugplatz Greenham Common demonstrieren oder mit Led Zeppelin auf Tour gehen. Dabei ist der Wagen vollgestopft mit Putzmitteln, von denen ich einige vor meiner Mutter verstecke, da sie Chemikalien enthalten, die stärker sind als Backpulver. Meine Mum hat Alzheimer und weiß oft nicht, wer ich bin – aber ein umweltschädliches Reinigungsmittel erkennt sie aus dreihundert Meter Entfernung.
Erschöpft von ihrem anstrengenden Toilettengang, liegt Bella auf dem Rasen. Ihr Blick schweift ziemlich desinteressiert zu einem kleinen Schwarm von Schwalben, der ebenfalls die unverhoffte Rückkehr des Frühlings feiert. Sie lässt einen sehr damenhaften Furz los und rollt sich dann zu einem plüschigen Knäuel zusammen. Ich bezweifle nach wie vor, dass ihr Erbgut auch nur im Geringsten von einem Wolf abstammt.
Als ich meinen Schreibblock auf den Vordersitz lege, stelle ich fest, dass ich schon bald einen neuen beginnen muss. Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Art von Tagebuch so viel Spaß machen würde. Meine Einträge beginnen immer gleich – Name, Rang, Dienstnummer –, ehe ich meine »Was-ist-Willow-heute-passiert«-Liste erstelle.
Eine etwas langweilige Form, die aber zu einer Gewohnheit geworden ist – von denen es schlimmere gibt, wie zum Beispiel Crack rauchen oder den eigenen Popel in der Öffentlichkeit essen (im privaten Bereich ist das was anderes – da haben wir das alle schon gemacht).
Ich führe diese Notizen, seitdem Mums Therapeutin vorgeschlagen hat, dass sie mithilfe ihrer eigenen Biografie Erinnerungspflege betreiben soll. Mums Biografie schien damals – zumindest in ihrem Kopf – ungefähr im Jahr 1999 zu enden, sodass ich es für eine gute Idee hielt.
Das Nachdenken darüber, wer sie ist und wer sie war, hilft ihr, mit ihren Erinnerungen in Kontakt zu bleiben und eine gewisse Kontrolle über ihr Leben zurückzuerlangen. Manchmal bekomme ich mit, wie sie in dem Buch liest, still und leise, und mich dabei gelegentlich anschaut. Dann weiß ich, dass sie wieder versucht, das kleine Mädchen mit der erwachsenen Frau in Verbindung zu bringen, die sie da sieht.
Ja, das ist traurig – aber auch irgendwie gut, auf seine eigene Weise. Meine Mum war schon immer ein Mensch mit einer künstlerischen Ader, und aus diesem Buch ist eine wunderschöne Collage aus Fotos, Postkarten und alten, abgerissenen Eintrittskarten geworden. Sogar diese kleinen Plastikarmbänder, die Neugeborene im Krankenhaus erhalten, hat sie eingeklebt. Zum einen dokumentiert dieses Buch ihr Leben, zum anderen ist es ein Tagebuch. Darüber hinaus erfüllt es auch noch einen praktischen Zweck – zwischen die Erinnerungsstücke fügt sie kleine Spickzettel ein mit ihrer Adresse, meiner Handynummer und dem Namen unserer Hündin. Wir haben eine Reihe von Border Terriern gehabt, sodass sie ihre Namen manchmal durcheinanderbringt.
Ich habe meine Notizen anfangs nur deshalb geführt, weil ich ihr Gesellschaft leisten und der ganzen Sache einen normaleren Anstrich verleihen wollte. Doch dann habe ich Gefallen daran gefunden – und wer weiß? Vielleicht brauche ich dieses Tagebuch irgendwann ja mal selbst. Huh, eine gruselige Vorstellung. Im Moment ist es jedenfalls so was wie eine kostenlose Therapie für mich.
In der Regel verfasse ich Listen, da ich nicht sehr viel Zeit habe, mich hinzusetzen und in literarischen Ergüssen zu ergehen. Listen sind daher das Einfachste, und sie bringen mich gewöhnlich zum Lachen, wenn ich sie noch einmal durchlese. Ich habe einmal den Satz geschrieben: »Würstchen im Schlafrock sind klasse«, und das zehnmal hintereinander. Sie müssen mir an diesem Tag wirklich besonders gut geschmeckt haben.
Aber heute … heute hatte ich viel zu berichten, oder? Insbesondere von dem eingebildeten Edward Cullen, der real sein kann. Oder auch nicht. Und der der neue Besitzer von Briarwood sein kann. Oder auch nicht.
Auf jeden Fall war er schon Dorfgespräch, dieser neue Besitzer. Wer könnte es sein? Wann wird er oder sie hier auftauchen? Wird er oder sie sich in die Gemeinschaft einfügen oder sich als Schlossherr beziehungsweise Schlossherrin aufspielen? Wieso hat er oder sie das Haus überhaupt gekauft? Immerhin ist es in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Wir haben im Café Stunden damit zugebracht, diese Fragen zu diskutieren. Tja, was soll ich sagen? Hier passiert eben nicht viel.
Frank, Cheries Mann, vermutet, dass ein ausländischer Investor sich das Haus unter den Nagel gerissen hat, um es zu einem piekfeinen Tagungshotel für gestresste Manager aufzumotzen. Frank ist Farmer, doch er hat eine lebhafte Fantasie. Edie May, fast zweiundneunzig, hat eine noch lebhaftere Fantasie und glaubt, dass Tom Cruise das Haus gekauft hat, um es als Feriendomizil zu nutzen – aber irgendwas stimmt nicht mit ihr, seit ihre Nichte ihr die DVD-Box mit Mission Impossible gekauft hat. Laura, die das Café betreibt und einen großen Hang zur Romantik hat, ist davon überzeugt, dass ein junges Paar sein Traumhaus gefunden hat und eine Familie hier gründen will.
Ich bin hier in Briarwood, weil ein Immobilienmakler in Bristol mir Geld dafür zahlt, es sauber zu machen. Meine Mum ist bei Cherie im Café. Sie warten bestimmt schon alle sehnsüchtig auf mich, um auf den neuesten Stand der Dinge gebracht zu werden.
Es gibt da nur ein Problem. Nach dem gegenwärtigen Stand werde ich ihnen erklären müssen, dass The House on the Hill von einem ewig jugendlichen Vampir gekauft worden ist, der sich vegetarisch ernährt. Diese Neuigkeit wird mir wohl die eine oder andere hochgezogene Augenbraue einbringen.
2. Kapitel
Das Innere des Hauses ist nicht ganz so beängstigend, wie ich es in Erinnerung hatte. Seitdem Mr. und Mrs. Featherbottom – ja, das ist ihr richtiger Name – vor mehr als zehn Jahren in Rente gegangen sind, steht es leer.
Sie sind in eine Wohnung nach Lyme Regis gezogen, nachdem sie viele Jahre lang Briarwood als eine Art privates Kinderheim geleitet haben. Das klingt schrecklich, doch ich habe nur nette Erinnerungen an die beiden. Mrs. F. war eine rundliche Frau, und ihre Kleider waren oft mit Mehl bestäubt. Mr. F. schien immer mit einer Angel herumzulaufen. Vielleicht bringe ich da aber auch gerade was durcheinander und stelle mir die beiden als zum Leben erwachte Gartenzwerge vor.
Nach meinen eigenen Erinnerungen und nach dem, was die älteren Bewohner wie Frank und Edie erzählt haben, hat in dem Haus immer eine fröhliche Atmosphäre geherrscht – wenn man die Lebensumstände der meisten Kinder bedenkt. Einige waren Waisen, was sich wie aus einem Roman von Charles Dickens anhört. Andere waren in Briarwood untergebracht, weil ihre Eltern sich nicht um sie kümmern konnten, sei es aufgrund von einer Krankheit oder einer Arbeit im Ausland. Es war teils Internat, teils Zuhause.
Manche Kinder hatten schlimmen seelischen Kummer, als sie hier eintrafen – und es war bestimmt nicht förderlich, dass das Gebäude, vor dem sie hielten, aussah, als würde es in der Nacht von Dementoren patrouilliert.
Das war einer der Gründe, warum meine Mum früher hierhergekommen ist. Sie wollte diesen Kindern helfen. Sie war schon immer etwas anders – einen sogenannten »richtigen« Job hat sie nie gehabt. Meine älteren Geschwister – Van, Angel und Auburn – haben die ersten Jahre ihres Lebens in einer Hippie-Kommune in Cornwall verbracht, bis ich ein paar Jahre später dann zur Welt kam. Wir haben nicht denselben Vater – was zumindest teilweise erklärt, warum ich stets das fünfte Rad am Wagen gewesen bin.
Als Mum mit mir schwanger war, zog die ganze Familie nach Budbury. Sie jobbte hier und da – das Geld reichte, um uns geschlechtsneutral zu kleiden, damit die Garderobe an den Nächstjüngeren weitergereicht werden konnte, und um uns Pitabrot und Hummus zu kaufen, was wir damals immer aßen. Mum war, denke ich, in vielerlei Hinsicht ihrer Zeit voraus – sie versuchte, uns dazu zu bringen, Biokost zu essen, suchte nie einen Arzt mit uns auf, außer der Verlust eines Beines drohte, und gab uns seltsame Namen, lange bevor Gwyneth Paltrow auf die Idee kam.
Sie hat alles Mögliche hier in Briarwood gemacht – sowohl Kunst und Yoga unterrichtet als auch Kurse in Meditation und kreativem Schreiben gegeben. Für uns war sie einfach nur Mum, doch vielen anderen Kindern muss sie wie ein wahnwitzig exotisches Wesen vorgekommen sein mit ihren wilden Locken, ihren gebatikten Kleidern und ihrem Duft nach Räucherstäbchen und Patschuliöl.
Während ich durch die Flure des Hauses gehe, entdecke ich noch immer überall die Spuren des Lebens, das hier einmal geherrscht hat – der vielen jungen Leute, die in den Zimmern zusammen wohnten, während Mr. und Mrs. F. ihr Bestes taten, um es ihnen so schön wie möglich zu machen.
An den Wänden im Erdgeschoss hängen noch immer Schwarze Bretter mit rostigen Reißzwecken, unter denen zerrissene Papierstücke klemmen. Ich weiß, dass ich diese Reste der Vergangenheit entfernen muss, doch fühlt es sich an, als würde ich einen heiligen Ort entweihen. Oder ein Museum verwüsten.
Ich nehme ein Blatt herunter, das daraufhin teilweise in sich zerfällt, aber der Text lässt sich noch immer entschlüsseln: Mr. F. nimmt an einem gesponserten Fish-a-Thon-Wettbewerb teil, um Geld für Save the Children zu sammeln. Ich lächele und stecke das Stück Papier zwischen zwei Seiten in meinen Schreibblock, da ich es einfach nicht übers Herz bringe, es in eine Mülltüte zu werfen. Das erklärt vielleicht auch, warum mein Schlafzimmer derartig unordentlich ist, dass ich mich als Kandidatin für eine dieser Reality Shows über Messies eigne.
Ich führe meine Erkundungstour fort und lasse die Haustür offen, indem ich einen Backstein dazwischenstelle – es gibt zwar Strom, wie ich festgestellt habe, doch viele Glühbirnen sind kaputt oder geben nur noch ein flackerndes Licht ab. Das brummende Geräusch der Deckenlampen und die immer wieder ausgehenden Lampen sind nicht gerade förderlich, denn meine Nerven sind schon angespannt genug. Glücklicherweise habe ich meine furchtlose Wachhündin dabei – Bella Swan flitzt herum, die Nase über dem Boden. Sie schlägt seltsame Haken, die nur sie versteht, und schnauft wie ein Seehund, was irgendwie beruhigend ist in dem ansonsten stillen Haus.
Ich steuere ein Zimmer an, das ich als Büro in Erinnerung habe, und die Wohnräume von Mr. und Mrs. F., in denen es ebenfalls aussieht, als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Möbel sind zwar größtenteils verschwunden, doch steht hier und da noch Kleinkram herum: ein Stapel verstaubter Taschenbücher, leere Aktenschränke und die Überreste einer vertrockneten Topfpflanze, die in ihrem früheren Leben möglicherweise einmal ein Usambaraveilchen war. Das Erkerfenster ist dreckig. Trotzdem dringt Sonnenlicht hindurch und strahlt auf die im ganzen Zimmer schwebenden Staubpartikel.
Das Gefühl von Melancholie droht in mir aufzusteigen, und ich versuche es abzuschütteln, indem ich beginne, professionell zu denken. Die oberen Stockwerke sind leer geräumt, wie ich von dem Immobilienmakler erfahren habe. Also mache ich dem Teil meines Hirns klar, der für das logische Denken zuständig ist – ein äußerst kleiner, extrem selektiv hörender Teil bei mir –, dass das der Ort ist, an dem ich jetzt besser loslegen sollte.
Der Immobilienmakler hat mich für mehrere Tage beauftragt, sodass ich später noch genügend Zeit haben werde, mich um die unteren Stockwerke zu kümmern. Ihre Reinigung wird einfacher sein, wenn sie leer geräumt sind – außerdem werde ich mich so davon abhalten, alles anzustarren, als hätte ich seltsame telepathische Fähigkeiten, die mich befähigen, mit toten Zimmerpflanzen zu reden.
Bella schnüffelt aufgeregt an den Büchern herum. Mir ist klar, worauf das womöglich hinausläuft.
»Nein!«, sage ich entschieden und kraule sie hinter den Ohren, um sie abzulenken. »Wir sind hier nicht draußen, auch wenn es so riechen mag. Also keine Pfützen, okay?«
Sie sieht mich unter ihren grauen, buschigen Augenbrauen hervor an und trottet zurück in den Flur. Ich schwöre, sie versteht jedes Wort.
Ich greife nach meinem Putzzeug – das übliche, aufregende Sammelsurium an Lappen, Reinigungsmitteln und Mülltüten – und gehe die Holztreppe hinauf ins oberste Stockwerk. Das hier wird größtenteils ein Erkundungseinsatz sein – ich werde mit dem schweren Bodenreinigungsgerät wohl später wiederkommen und vielleicht auch ein paar kräftige Männer aus dem Dorf dazu einspannen müssen, um es nach oben zu schleppen. Glücklicherweise sind wir mit derartigen Exemplaren reich gesegnet. Budbury scheint auf einem geheimnisvollen Stück Erde zu liegen, das diese Sorte von Männern anzieht.
Ich bemerke die dicke Staubschicht auf dem sich nach oben windenden Geländer, als ich die Stufen hinaufsteige. Früher glänzte es so sehr, dass man sein Gesicht darin verzerrt sehen konnte, was wohl zum einen an der Politur lag, die Mrs. F. verwendete und zum anderen an den Hintern der Jugendlichen, die regelmäßig darauf hinunterrutschten.
In Briarwood herrschte immer Trubel – es war laut und wuselig, von überallher klang Musik, und angenehme Küchendüfte waberten durch die Luft. Jetzt ist es traurig und still hier drinnen, und es riecht muffig – daher freue ich mich sehr, dass jemand das Haus gekauft hat und hoffe, dass Tom Cruise sich ordentlich darum kümmern und es in keinen Scientology-Bunker verwandeln wird.
Ich erreiche das obere Stockwerk und stelle fest, dass es kleiner ist als in meiner Erinnerung. Damals türmte Briarwood sich riesig vor mir auf, aber mir ist früher auch ein Mars-Riegel größer vorgekommen. Ich hielt es für ein riesiges Herrenhaus mit unzähligen geheimen Flügeln und spukenden Treppenhäusern. Auf jeden Fall hat es sich damals so angefühlt, insbesondere im Vergleich zu unserem vollgestopften Cottage.
Jetzt, wo das Gebäude geschrumpft ist – beziehungsweise ich gewachsen bin –, stelle ich fest, dass es vermutlich nicht mehr als zwanzig Zimmer hat, verteilt auf drei Etagen. Es sieht ein bisschen aus wie eine kleinere Version von Professor Xaviers Institut für begabte Jugendliche, nur leider ohne Wolverine im eng anliegenden, ärmellosen T-Shirt. Bestimmt ist unten auch noch ein Keller. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich da allein hinuntergehe, ist genauso groß wie die, dass ich einen Doktor in Astrophysik mache.
Auf dem Boden ist erkennbar, wo der Teppich einmal gelegen hat. Die Dielen rund um die Stelle sind verblasster und staubiger. Die Wände sind kahl und die Zimmer, in die ich einen Blick werfe, leer. Sie haben unterschiedliche Größen, sind aber ansonsten gleich ausgestattet – und zwar mit einem verschlissenen, blauen Teppichboden und einer mit mittlerweile vergilbten Fußbällen gemusterten Tapete. Ich erinnere mich daran, dass auch Mädchen hier gewohnt haben. Wahrscheinlich waren sie eine Etage tiefer untergebracht, in Zimmern mit Märchenprinzessinnentapeten und rosa Teppichböden.
Ich denke, der neue Besitzer wird das alles herausreißen. Doch ich bin hier nicht als Expertin für den Feuchteschutz oder als Innenarchitektin engagiert – ich soll den magischen Will-o’-the-Wash-Touch versprühen und einmal durch das Haus wischen, das später bestimmt noch richtig renoviert werden wird. Aber dem Inneren ein hübscheres Antlitz zu verleihen, ist zumindest ein Anfang und mein Beitrag, diesen Ort wieder zum Leben zu erwecken.
Ich beschließe, mit den Fenstern zu beginnen – ein Aufenthalt im Haus wird durch saubere Fenster für alle angenehmer. Genauer gesagt, für mich. Das Gebäude macht durch die dreckigen, verschmutzten Scheiben einen noch vernachlässigteren Eindruck. Heute ist ein wunderschöner Tag mit viel Sonnenschein, der auch hier hereindringen sollte.
Ich arbeite mich durch fast alle Zimmer und öffne die Fenster beim Putzen. Einige sind derartig verdreckt – entweder durch alte Farbe oder durch Schmutz, der an der Scheibe haftet –, dass ich mit Schmackes rangehen muss. Dabei schließe ich enge Freundschaft mit einigen seltsam geformten Moosklumpen.
Ich werfe einen Blick nach draußen, während ich putze, in der Hoffnung, dass der Mann noch mal auftaucht, den ich vorhin am Teich gesehen habe. Er hat nicht mitbekommen, dass ich da war – und ich bin so leise wie möglich davongeschlichen, als ich ihn bemerkt habe. Wer will schon beim Baden in einem Teich gestört werden? Niemand, oder? Außerdem besteht noch immer die Möglichkeit, dass ich ihn mir nur eingebildet habe, denn ich sehe kein in der Nähe geparktes Auto.
Obwohl ich das eigentlich nicht glaube. Derart neben der Spur bin ich normalerweise nicht. Die letzten Tage waren jedoch ziemlich anstrengend, weshalb ich sehr müde bin und es daher nicht ganz ausschließen kann. Natürlich kann dieser Mann auch einfach nur den Teich mögen und auf dem Gelände von Briarwood spazieren gegangen sein – ich habe alte Ciderflaschen, Zigarettenstummel und Müllreste entdeckt, was üblicherweise dafür spricht, dass stinknormale Jugendliche dort abgehangen haben.
Der Mann sah aber nicht aus wie ein Jugendlicher – seine Statur war eindeutig die eines erwachsenen Mannes –, aber er könnte ein Spaziergänger gewesen sein, von denen es hier massenhaft gibt. Budbury liegt an der Juraküste und ist Teil eines Netzes von Küstenwanderwegen, die kreuz und quer durch die gesamte Region verlaufen. Daher kehren auch alle möglichen Leute ins Comfort Food Café ein. Sie tragen Signalwesten über ihren Anoraks und benutzen Trekkingstöcke beim Gehen. Vielleicht war er einfach nur einer von diesen Wanderern.
Ich versuche, nicht mehr an ihn zu denken und mich stattdessen auf meine Arbeit zu konzentrieren. Bella hat eine Ecke gefunden, deren Geruch sie mag. Während ich weiterputze, hält sie ein Nickerchen. Der Zitronengeruch des Reinigungsmittels verdrängt langsam den Geruch nach Vernachlässigung. Alle Zimmer haben ein Waschbecken – sie sind schmutzig und stehen als Nächstes auf meiner Liste, aber zumindest gibt es noch Wasser, sodass ich meinen Eimer nach Herzenslust neu füllen kann, auch wenn die Rohre knacken.
Die Arbeit ist todlangweilig, was, ehrlich gesagt, einer der Gründe ist, warum ich sie mag. Denn so werden meine Gedanken daran gehindert, abzuschweifen. Außerdem kommt ein konkretes Ergebnis dabei heraus. Macht man was sauber, wird es sauber. Oft ist das im Leben anders. Da müht und müht man sich in einer Sache ab, ohne dass sich etwas zu ändern scheint.
Ich finde meinen Rhythmus und bereite mich innerlich darauf vor, das letzte Zimmer auf dem Flur in Angriff zu nehmen. Ich wünschte, ich hätte Lautsprecherboxen oder ein Radio mitgebracht, dann könnte ich jetzt Kopfhörer aufsetzen und Musik hören – aber he, ich habe Horrorfilme gesehen. Ich weiß, was jungen Frauen zustößt, wenn sie allein in einem alten, leer stehenden Haus sind und nicht aufpassen. Es gibt nur noch eine Sache, die schlimmer ist, als Kopfhörer aufzusetzen – rumzuknutschen. Wenn man das macht, wird man bestimmt vom Butzemann erwischt und erstochen, während man nur noch BH und Unterhose anhat. Klappe zu, Affe tot!
Ich habe nicht vor, mit jemandem rumzuknutschen, doch ich wünschte, ich hätte Musik dabei. Vielleicht was von Meatloaf oder ein paar Songs von Neil Diamond – etwas mit einem tollen Refrain, um mitzusingen.
Diese Ablenkung täte mir jetzt gut, denn ich bin vor dem letzten Zimmer angekommen. Dem Zimmer, das ich bisher noch nicht betreten habe. Dem Zimmer, in dessen Tür sich mein Blick hineinbohrt, als müsste ich demonstrieren, wer hier der Chef ist.
Bestimmt ist dieses Zimmer nicht anders als all die anderen Zimmer – nur haben wir eine gemeinsame Geschichte, dieses Zimmer und ich. Als ich mich hier in Briarwood zum letzten Mal länger aufgehalten habe, damals in jenem Sommer, haben meine lieben Geschwister mir eingeredet, dass es dort spukt. Sie haben mich aufgefordert, in das Zimmer zu gehen, um es herauszufinden.
Ich kann mich noch immer lebhaft daran erinnern, wie viel Angst ich damals hatte. Obwohl es heute albern erscheint, so wie fast alle dramatischen Erlebnisse der Kindheit im Nachhinein albern erscheinen, zögere ich leicht, als ich mich dem Zimmer nähere, eine Mülltüte in der einen Hand, eine Sprühflasche in der anderen. Nur für den Fall, dass ich einem Dämon Reinigungsmittel in die Augen sprühen muss.
Ich habe meine Geschwister schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Sie haben sich wie Schafe verteilt und sind an unterschiedlichen Orten gelandet, an denen sie Unterschiedliches machen. Nur ich bin hier in Budbury geblieben – mit unserer Mum. Ich mache ihnen keine Vorwürfe. Sie sind älter als ich und waren schon lange weggezogen, ehe Mum erste Anzeichen ihrer Krankheit zeigte. Ich mache ihnen keine Vorwürfe – aber ich vermisse sie.
Auch wenn sie zu mir richtig gemein waren an jenem Tag, geht es mir durch den Kopf, als ich vor der Kammer des Schreckens stehe – sie haben mir eine Riesenangst eingejagt, mich gezwungen, in das Zimmer zu gehen und sich kaputtgelacht, als ich völlig verschreckt wieder herausgeschossen kam und davonlief. Das war das Ende der Beziehung zwischen mir und Briarwood – Mum hat auch danach noch gelegentlich dort gearbeitet, aber ich habe stets dafür gesorgt, dass ich etwas anderes vorhatte, und sei es, dass ich mich meiner bösen, großen Schwester angeschlossen habe.
Im Laufe der Jahre habe ich schon gelegentlich darüber nachgedacht, wie grausam Kinder untereinander sein können, ohne sich dessen bewusst zu sein, was sie anrichten.
Und natürlich habe ich auch daran gedacht, wie ich weggerannt bin, zu Tode erschrocken – ich habe nicht einmal was zu dem Jungen gesagt, der genauso verängstigt war wie ich. Wer wäre das nicht, wenn irgendein unbekannter Wildfang zu einem ins Zimmer stürmt, aus vollem Hals schreit und dann ohne eine Erklärung wieder abhaut?
Ich glaube, ich habe ihm einen Schaden fürs Leben zugefügt – und das in einer Situation, in der seine seelische Verfassung wohl sowieso schon nicht die beste war. Denn immerhin lebte er in einem Kinderheim. Wir waren einfach zwei Menschen, deren Lebenswege sich für den Bruchteil einer Sekunde kreuzten. Ich habe noch immer ein schlechtes Gewissen deswegen und würde am liebsten die Uhr zurückdrehen, um ihm wenigstens einen Zettel mit einer Entschuldigung unter die Tür zu schieben.
Ich zwinge mich dazu, keine Zeit mehr zu schinden und öffne die Tür. Erstaunlicherweise passiert nichts. Ich sehe mich keinem gespenstischen Jungen, erhängten Menschen oder Dämonen gegenüber. Nicht einmal diese unheimliche Chormusik aus Das Omen erklingt. Es ist einfach nur ein Zimmer – dunkel, muffig und trist.
Der Schreibtisch von damals, der aus meiner heutigen Sicht mit Teilen eines auseinandergeschraubten Computers oder nachgebauten Toastern übersät gewesen sein muss, ist nicht mehr da. Genau wie der Drehstuhl, auf dem der Junge saß und herumwirbelte, als ich hereingeplatzt kam. In keinem der Zimmer gibt es etwas, das auf die Kinder hindeutet, die das einmal ihr Zuhause genannt haben.
Ich spüre erneut, wie mich Melancholie erfasst, und schüttele sie ab. Nostalgie ist nicht mehr das, was sie einmal war. Außerdem bin ich wahrscheinlich mangelhaft gerüstet, um mich ausführlich mit der Vergangenheit zu befassen. Ich habe schon genug Schwierigkeiten damit, die Gegenwart zu bewältigen.
Ich trete zum Fenster, um es wie all die anderen zu öffnen, und verharre in meiner Bewegung. Durch die verschmierte Fensterscheibe erkenne ich draußen einen Mann. Er steht ganz still da und sieht hinauf. Wahrscheinlich denkt er genau das Gleiche wie ich: Bilde ich mir das nur ein, oder gibt es tatsächlich noch jemand anderen außer mir im Land der stehen gebliebenen Zeit?
Mich erfasst plötzlich Angst, und ich erstarre. Dann wische ich mit einem Lappen eine Stelle auf der Fensterscheibe sauber.
Nein, ich bilde mir das nicht ein – da steht tatsächlich ein Mann. Ein großer Mann mit dunklem Haar und einem verdammt riesigen Hund. Ich winke ihm zu, woraufhin er zögerlich zurückwinkt. Er sieht wahrscheinlich nur einen kleinen Teil meines Gesichts, was seltsam wirken muss.
Der Hund bellt, laut und dröhnend. Bella stürmt daraufhin los, und ihre Krallen scharren über die Holzdielen.
Ich folge ihr und vergewissere mich dabei, dass mein Handy in meiner Schürzentasche ist. Normalerweise laufe ich nicht durchs Leben und gehe davon aus, dass die Menschen, denen ich begegne, Serienmörder sind – doch Briarwood hat wieder einmal geschafft, seinen angsteinflößenden Zauber auf mich auszuüben. Daher ist es beruhigend zu wissen, dass ich mit der Außenwelt kommunizieren kann, sollte dieser unbekannte Mann plötzlich auf die Idee kommen, sich mir unverhüllt zu zeigen.
Ich laufe die Treppe hinunter und binde dabei die Mülltüte zu. Bella rennt vor mir her, ihr Schwanz zuckt vor Aufregung. Mein Look macht dem von Aschenputtel Konkurrenz – verschmiertes Gesicht, riesiger, wuscheliger Pferdeschwanz, eine Schürze mit King Kong vorne drauf und Doc Martens, aus denen unterschiedliche Socken hervorlugen. Das Leben ist einfach zu kurz, um sich darüber Gedanken zu machen.
Ich trete hinaus in den Sonnenschein und muss durch das plötzliche, helle Licht, das in meine an Innenräume gewöhnten Augäpfel dringt, blinzeln.
Der Tag war bisher surreal. Kein Schlaf, häusliches Chaos, Putzen eines Geisterhauses, und jetzt stehe ich hier draußen und lächele einen Mann an, der eindeutig nicht Edward Cullen ist.
3. Kapitel
Das habe ich natürlich gewusst. Edward Cullen ist eine Romanfigur, was der Mann hier augenscheinlich nicht ist.
Er ist groß – einen Kopf größer als ich, und ich bin schon knapp ein Meter achtzig –, trägt eine verwaschene Levi’s und ein T-Shirt mit Godzilla vorne drauf. Dem alten schwarz-weißen Godzilla, nicht einen dieser harmlosen, computeranimierten Godzillas von heute. Seine Füße, die in einem Paar abgetragener, nicht zugeschnürter Chucks stecken, sind nackt – das Leben ist offenbar zu kurz für ihn, um sich über Socken Gedanken zu machen.
Sein Haar ist kurz geschoren, als hätte er bis vor Kurzem einen supergeheimen Posten beim Militär bekleidet oder würde aus bitterer Erfahrung wissen, dass seine Frisur in einem riesigen Afrolook enden würde, wenn er das Haar wachsen ließe. Es ist so dunkel wie das Fell eines Maulwurfs und sieht weich aus. Ich weiß, dass ich das Verlangen unterdrücken muss, darüber zu streichen, denn das wäre für uns beide seltsam.
Er ist schlank, hat aber breite Schultern und muskulöse Arme, die er sich in einem Fitnessstudio antrainiert haben muss – für einen Naturburschen ist er zu blass. Die Augen sind braun, die Wangen und Kieferpartie ausgeprägt. Die Nase ist leicht gebogen, aber trotzdem ansehnlich, der Mund breit. Genau genommen ist er ein Prachtexemplar von einem Mann. So eines, das als Modell für eine Skulptur dienen könnte. Der Lockruf von Budbury hat anscheinend wieder einmal bewirkt, dass ein seltsam-aber-gut-gebautes Mannsbild auf die heidnische Anziehungskraft des Dorfes reagiert hat.
»Hallo«, sage ich, während ich auf ihn zugehe. Er sieht aus, als würde auch er sich Gedanken darüber machen, ob ich eine Serienkillerin sein könnte. Mein Erscheinungsbild kann durchaus beunruhigend sein, wenn ich unerwartet Menschen begegne. »Ich bin Willow.«
Als ich mich ihm nähere, stelle ich fest, dass sein Augenmerk gar nicht auf mich gerichtet ist – er starrt vielmehr Bella an. Sie hat erst ein paar Schritte auf seinen Hund zugemacht, ihre Nase dabei schnuppernd in die Luft gestreckt und ist dann wieder zu mir zurückgetrottet. Die ganze Situation scheint ihn anzuspannen, und er umfasst das Halsband seines Hundes.
»Okay …«, antwortet er nervös. »Könntest du deinen Hund vielleicht bitten, wieder reinzugehen? Rick Grimes ist nicht besonders erpicht auf Gesellschaft.«
Rick Grimes sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Rottweiler und einem Schäferhund. Er hat das Gesicht eines Teddybären, einen äußerst muskelbepackten Körper und ein seltsam schwarz-braun geflecktes Nackenfell, das an eine Löwenmähne erinnert. Rick zieht leicht an der Hand seines Besitzers, knurrt aber nicht oder fletscht die Zähne. Noch nicht.
»Du hast deinen Hund nach einer Figur aus einer Fernsehserie benannt, in der Zombies vorkommen?«, frage ich und trete schützend vor Bella. Ich bin nicht allzu sehr besorgt – Bella, die kleine Hexe, hat eine supersexy Ausstrahlung, die normalerweise dafür sorgt, dass alle Rüden sie anbeten –, doch ich bin darauf eingestellt, sie ins Haus zu scheuchen, sollte es nötig sein.
Er sieht mich an und grinst. Seine ganze Miene verändert sich dadurch, und ich schmelze leicht dahin. Achtung, Achtung – heißer Nerd-Alarm!
»Ja, habe ich«, bestätigt er und krault Ricks Ohren, um ihn zu beruhigen. »Wieso? Wie heißt dein Hund?«
Hmm. Berechtigte Frage.
»Ähm … Bella Swan«, antworte ich und spüre, wie ich ein bisschen in mich zusammensacke. Nicht jedem ist sofort klar, dass es sich dabei um den Namen von Edward Cullens großer Liebe handelt – dem Kerl aber bestimmt, da bin ich mir sicher.
»Aha«, sagt er und blickt amüsiert. »Das ist natürlich ein sehr viel vernünftigerer Name. Wenn deine Hündin mal Welpen bekommt, nennst du dann einen davon Renesmee?«
»Sei nicht albern!«, entgegne ich. »Das ist ein dämlicher Name für einen Hund.«
»Oder für ein Kind.«
»Ja, oder für ein Kind. Ich weiß nicht, was sich Edward und Isabella dabei gedacht haben … Wie es scheint, hat sich Rick Grimes mittlerweile ein bisschen beruhigt. Willst du es wagen, ihm Bella Swan vorzustellen? Ganz ehrlich, sie ist so was wie eine Femme fatale in der Welt der Hunde. Ich habe schon erlebt, wie sie die wildesten Bestien mit nur einem Blick gezähmt hat. Und sie kann wirklich schnell laufen, wenn sie will.«
Seine Miene verrät mir, dass er die unterschiedlichen Varianten des gegenseitigen Kennenlernens in seinem Kopf durchspielt: Rick verliebt sich in Bella. Sie leben glücklich zusammen bis ans Ende ihrer Tage und bekommen kleine Welpen, die schönere Namen haben als Renesmee. Rick schnüffelt an Bellas Hintern herum, und sie werden für immer beste Freunde. Rick reißt Bella in einem blutigen Gemetzel sämtliche flauschigen Gliedmaßen aus.
Letztendlich trifft Bella für ihn die Entscheidung. Offensichtlich hat sie genug von den bescheuerten Menschen und ihrem dämlichen Geschwafel. Sie steht auf, spaziert selbstbewusst auf Rick zu und beschnuppert ihn flüchtig. Rick zuckt zwar ein bisschen, lässt es aber über sich ergehen. Zufrieden, dass sie nun alles weiß, was es über ihn zu wissen gibt, legt sie sich wieder hin, rollt sich gelangweilt ein und blickt ihn an, eine Augenbraue aufreizend lässig hochgezogen.
Ich glaube, das ist es, womit sie die anderen Hunde immer wieder rumkriegt – mit ihrer völligen Gleichgültigkeit. Meine Freundin Laura, aus dem Café, hat Hunde, seitdem ich sie kenne. Genauer gesagt, zwei schwarze Labradore. Der erste, Jimbo, ein älterer, wunderbarer Herr, ist kurz nach ihrem Umzug hierher gestorben. Jetzt hat sie Midgebo, einen schon fast zwei Jahre alten Rüden, der sich aber noch immer so benimmt wie ein Riesenwelpe. Jimbo hat Bella angehimmelt, und bei Midgebo ist es nicht anders. Sie hingegen tut immer so, als würden sie in ihrem Universum nicht existieren.
Der Mann kauert neben Rick und lockert vorsichtig seinen Griff um das Halsband. Allerdings nur so viel, dass der Hund Bella zwar erreichen, er ihn aber trotzdem noch immer wegreißen kann, sollte er sich auf sie stürzen.
Wie vorherzusehen, entfaltet Bella ihren Zauber – und innerhalb von Sekunden ist dieser Riesenhund ihr Sklave. Er leckt sie überall, als würde er sie putzen, ehe er sich neben ihr niederlässt. Sein gewaltiges Kinn ruht auf ihrem Rücken, er schließt seine Teddybäraugen und genießt den Sonnenschein zusammen mit seinem neuen Schwarm.
»Wow«, sagt Ricks Besitzer. »Das habe ich noch nie erlebt. Normalerweise muss ich ihm in der Öffentlichkeit einen Maulkorb anlegen. Er liebt Menschen, ganz besonders Kinder – er leckt ihnen die Köpfe, als wären sie Lutscher –, doch bei anderen Hunden dreht er völlig durch. Das hier ist definitiv ein Novum. Danke.«
Er klingt äußerst dankbar, und ich gratuliere mir selbst, einen Greta-Garbo-Hund großgezogen zu haben. In einem Leben, das mir manchmal so vorkommt, als hätte es vor allem riesige Niederlagen zu bieten, habe ich gelernt, mich über kleine Erfolge zu freuen.
»Nichts zu danken. Und da das nun geklärt ist – wie heißt du?«
Er richtet sich auf und schaut kurz verwirrt drein, da er mich anscheinend zum ersten Mal wirklich wahrnimmt. Die Verwirrung in seinem Gesicht verwandelt sich in ein Stirnrunzeln, als er mein Erscheinungsbild erfasst und versucht, sich einen Reim darauf zu machen.
»Oh! Entschuldigung. Ich war so tief in die Welt der Hunde abgetaucht, dass ich meine Manieren offenbar vergessen habe … Ich heiße Tom. Tom Mulligan. Und ich bin der stolze, neue Besitzer dieses Hauses …«
Er zeigt auf Briarwood. Mir kommt der Gedanke, dass er nicht sehr viel älter sein kann als ich – so um die dreißig, würde ich sagen, wenn ich schätzen müsste. Briarwood ist ein großes Haus mit sehr viel Land drumherum, das selbst in seinem jetzigen Zustand noch immer eine ordentliche Summe gekostet haben muss. Vielleicht ist er ein millionenschwerer menschenfreundlicher Playboy oder ein Internetmogul, oder er hat im Lotto gewonnen.
»Aha, toll«, sage ich, ohne weiter nachzuhaken, obwohl ich vor Neugierde platze – in meinem Kopf schwirren ständig tausend Fragen herum. Doch da mein Leben schon kompliziert genug ist, habe ich gelernt, sie nicht zu stellen.
Wir haben alle unsere Geschichten – insbesondere die Menschen, die in unsere kleine Ecke hier an die Küste gespült werden –, wollen sie aber nicht unbedingt sofort teilen. Doch das sieht nach fünf Minuten mit Cherie und Laura anders aus. Sie werden alles aus der Tiefe seiner Seele hervorholen und dabei sämtliche Mittel anwenden. Die beiden sind wie die Spanische Inquisition, nur ist ihr Folterinstrument die Sprühsahne.
Er mustert mich jetzt intensiv. Seine Umgangsformen lassen zweifellos ein bisschen zu wünschen übrig, denn seine Neugierde ist ihm anzusehen. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass er keine Gesellschaft gewohnt ist, die über seine eigene und die von Rick Grimes hinausgeht.
»Äh … arbeitest du hier?«, fragt er schließlich und runzelt die Stirn.
»Ja. Ich putze das Haus, damit es picobello ist, wenn der neue Besitzer eintrifft. Na ja, das war zumindest mal der Plan.«
»Aha. Wie ich gehört habe, soll der neue Besitzer ein ziemlicher Depp sein, der auch schon mal gern eine Woche früher als angekündigt auftaucht und in einem Wohnmobil im Wald kampiert, damit er sich an die Umgebung gewöhnen kann …«
Ein Wohnmobil. Na, das erklärt wenigstens teilweise das Rätsel um das morgendliche Nacktbaden im Teich. Nicht, dass er was davon wissen muss.
»Du hast sehr, sehr rosa Haare«, sagt er nach einem Moment der Stille.
»Ja, ich weiß«, antworte ich und fahre mir mit der Hand durch meinen Pferdeschwanz. »Flamingo-Schick – ist hier in der Gegend der letzte Schrei. Alle in Budbury haben hellrosa Haare.«
»Das stimmt nicht, oder?«
»Nein, kein einziges Wort. Tja … schön, dich kennengelernt zu haben, aber ich sollte jetzt besser weitermachen. Die Fenster werden nicht von allein sauber.«
Er nickt, und sein Blick wandert zurück zur dritten Etage. Zu dem Zimmer, wo er mich vorhin entdeckt hat. Zu meinem schmutzigen Hochsitz, von dem aus ich ihn angestarrt habe.
Als ich mich umdrehe, um zu gehen, frage ich mich, ob Bella mir folgen oder noch ein bisschen bei Rick Grimes bleiben wird. Sie tut zwar immer so, als wäre sie unnahbar, doch ich glaube, dass sie es insgeheim liebt, wenn sich alles um sie dreht.
»Das war früher mein Zimmer«, sagt Tom, als ich ihm zum Abschied winke. Er sagt es ganz leise. So leise, dass ich es fast überhöre.
Ich erstarre und blinzele ein paar Mal mit den Augen, ehe ich mich noch mal zu ihm umdrehe. Sein Zimmer? Das Zimmer? Wenn er jetzt so um die dreißig ist, würde das altersmäßig ungefähr passen … wow. Könnte er tatsächlich der Junge von damals sein? Wenn ja, wäre das völlig abgefahren, nicht? Vor wenigen Minuten habe ich noch an ihn gedacht … und ich frage mich erneut, ob ich ihn heraufbeschworen habe. In der einen Minute ist er Edward Cullen, in der nächsten das Gespenst aus meiner Kindheit. Ich sollte besser auf der Hut sein, sonst verwandelt er sich noch in den riesigen Marshmallow-Mann aus Ghostbusters.
Er sieht noch immer zu dem Fenster hinauf und scheint sich in der Zeit zu verlieren, eingehüllt in einen Mantel der Erinnerungen. Genau wie ich vorhin. Sein schwermütiger, ernster, melancholischer Gesichtsausdruck verrät mir, dass eine Reise in die Vergangenheit für ihn genauso beunruhigend ist wie für mich.
»Wirklich?«, sage ich verhalten, um nicht noch durchgeknallter rüberzukommen, als ich sowieso schon auf ihn wirken muss. »Wann war das denn?«
»Ende 1999. Ich bin hierhergekommen, nachdem meine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. 2003 habe ich Briarwood dann wieder verlassen. So merkwürdig das auch jetzt klingen mag … aber das Leben hier war für lange Zeit das stabilste, das ich je gehabt habe. Ich weiß, das Haus sieht aus wie Draculas Junggesellenbude, doch das Leben hier war gut. Die Menschen, die es geleitet haben, waren freundlich. Sie haben versucht, uns das zu geben, was wir gebraucht haben. Dass es in meinem Fall nicht funktioniert hat, war nicht ihre Schuld … Egal. Das ist alles eine Ewigkeit her und interessiert niemanden, außer mir. Tut mir leid.«
Er schüttelt den Kopf, als würde er versuchen, diese Gedanken zu vertreiben, was ich vollkommen nachempfinden kann. Mittlerweile bin ich mir auch vollkommen sicher, dass dieser Mann – mit seinem Godzilla-T-Shirt, das meine King-Kong-Schürze komplementiert, seinem verrückten, Zombies bekämpfenden Hund und seinem im Wald versteckten Wohnmobil – tatsächlich der Junge von damals ist. Der Junge aus dem Zimmer. Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt, und ich bin froh, dass ich ihm wenigstens dieses Mal nicht ins Gesicht geschrien habe und weggelaufen bin.
»Sag mal, in deinem Wohnmobil«, sage ich schließlich, »kann man da auch Tee kochen?«
4. Kapitel
Von außen betrachtet, sieht es aus wie ein Gefährt, womit die Famous Five herumfahren könnten, wenn sie sich der Gang von Scooby Doo anschließen würden. Das Wohnmobil ist ein auf Oldtimer getrimmter VW Campingbus. Er hat dieses Aufstelldach und diesen unverwechselbaren Ersatzreifen vorne auf der Kühlerhaube. Die eine Hälfte ist in leuchtendem Hellrot lackiert, die andere in prächtigem, glänzendem Cremeweiß. Auch wenn der Bus aussieht wie ein Oldtimer, verraten das viele glänzende Chrom und das neue Nummernschild, dass er brandneu ist.
Der Wagen steht, umgeben von dicht belaubten Bäumen, auf einer Lichtung im Wald, am hinteren Ende des Teichs. Das durch die Äste dringende Sonnenlicht reflektiert den glänzenden Lack in einem kuriosen, zuckenden Muster.
Der Platz ist wunderschön – ich erinnere mich daran, dass meine Mum mir von den alten Haselnussbäumen erzählt hat. Sie wurden irgendwann mit Eichen und Eschen ergänzt, sodass diese idyllische Ecke in einer Gegend entstand, die sowieso schon herrlich ist. Ein Teppich aus lila, weiß und gelb blühenden Glockenblumen und Anemonen überzieht den Boden. Schmetterlinge mit orangenen Flügelspitzen flattern umher, und von überall dringt das Gezwitscher der Vögel herüber.
Ich bleibe stehen, atme den Anblick ein und lasse die Freude, die ich dabei spüre, durch mich hindurchströmen. Dieses Fleckchen Erde ist so saftig grün, so malerisch, so vollkommen.
»Ist es nicht erstaunlich, dass der Frühling immer wiederkehrt?«, sage ich zu Tom, drehe mich zu ihm um und lächele ihn an. »Jedes Jahr?«
Er schmunzelt und sieht nicht beunruhigt aus. Das ist doch ein guter Anfang. Ich kann nicht anders, als mich einfach nur wohlzufühlen. Und die Schönheit dieses sinnlichen Orts lässt mich die Strapazen der vergangenen Tage vergessen. Im Willow-Universum mag zwar vieles verkehrt sein – doch genau hier, genau jetzt, fühlt sich alles großartig an.
»Ja, das ist es«, antwortet er. »Selbst für einen Stubenhocker wie mich. Das ist ein Grund gewesen, warum … ich diesen Campingbus gekauft habe und hierhergekommen bin. Ich könnte mich in einem schicken Hotel an der Küste einquartieren, aber ich wollte versuchen … ich weiß nicht so genau, was. Locker zu werden, denke ich.«
Diese Antwort verwirrt mich zuerst ein bisschen. Ich meine, immerhin trägt er ein Godzilla-T-Shirt, bindet seine Schuhe nicht zu und hat einen Hund, der Rick Grimes heißt. Das alles deutet darauf hin, dass dieser Typ ein Mega-Freak ist. Einer von denen, die kleine Elfen zeichnen und zu Comic Cons fahren.
Wo er zugegebenermaßen der attraktivste Kerl sein dürfte – er könnte sogar in einer dieser Serien wie Supernatural oder Vampire Diaries mitspielen, in denen immer diese wie aus Stein gemeißelten Typen mit einer schmerzlichen Vergangenheit herumlaufen und brillante Einzeiler von sich geben. Trotzdem hat er … diese coole Ausstrahlung. Und die muss eigentlich nicht aufgelockert werden.
Doch als ich ihm in den Campingbus folge, begreife ich sofort, was er meint. Bella und Rick jagen draußen Raupen und schnuppern an interessanten Holzstücken herum.
Von außen sieht der Bus hippiemäßig aus – teuer, aber hippiemäßig. Retro in Reinkultur. Drinnen herrscht allerdings eine völlig andere Atmosphäre. Das Innere als aufgeräumt zu bezeichnen wäre eine Untertreibung. Nichts steht herum. Der kleine Tisch und der Kochbereich sind blitzblank. Das heruntergeklappte Bett ist derart akkurat gemacht, dass man sich an den Ecken ein Auge ausstechen kann. Nichts deutet darauf hin, dass hier jemand wohnt.
Die Vordersitze sind mit makellosem, cremefarbenem Leder überzogen, und die Polster der Möbel sehen brandneu aus. Okay, der Bus ist brandneu – doch wenn ich hier leben würde, wäre er mittlerweile um einiges unordentlicher.
Die Müslidose würde herumstehen, vielleicht ein Buch auf dem Bett liegen, meine Doc Martens würden von der Decke herunterbaumeln oder ein paar Fotos an den Wänden hängen. Ich mag meinen Putzjob – doch in meinen eigenen vier Wänden habe ich es gern … na ja, wenn ich ein bisschen mehr von mir selbst umgeben bin.
Nachdem bei Mum Alzheimer festgestellt wurde, was an sich schon ein langer und qualvoller Weg war, hat man uns davor gewarnt, dass sie mit fortschreitender Krankheit ihr räumliches Bewusstsein verlieren und selbst in ihrer gewohnten Umgebung Probleme haben könnte, sich zurechtzufinden. Wir sollten uns auf Hüftprellungen einstellen, zugezogen durch Stöße gegen Tische oder Türen, die sie aufgrund ihres geistigen Zustands mitunter nicht mehr zu öffnen wissen würde.