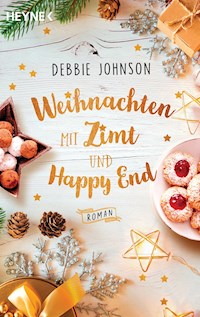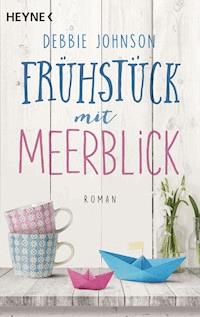14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Maggie war Weihnachten schon immer ein Familienereignis mit quirliger Herzlichkeit und Mistelzweigen. Aber dieses Jahr ist Maggie allein über die Feiertage mit nichts als einer Flasche Baileys und einem Tiefkühltruthahn. Bis Marco Cavelli auf den verschneiten Straßen Oxfords buchstäblich in ihr Leben kracht. Ein Mann mit traumhaft braunen Augen – verlockender als frisches Weihnachtsgebäck. Dabei war es für Maggie bislang ein ungeschriebenes Gesetz, niemals einen Mann im Rentierpulli zu küssen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Maggie liebt Weihnachten über alles: ihre Tochter Ellen füllt das Haus mit quirliger Herzlichkeit und Mistelzweigen, ihr Vater Paddy trinkt zum Fest einen über den Durst, und der traditionelle Weihnachtsbaum sieht aus, als hätte ein besoffener Elf einen Regenbogen draufgekotzt. Aber dieses Jahr sind Ellen und Paddy über die Feiertage nicht zu Hause, und Maggie steht ein wirklich trostloses Weihnachtsfest bevor – ganz allein, mit nichts als einer Flasche Baileys und einem Tiefkühlessen.
Bis Marco Cavelli auf den verschneiten Straßen Oxfords mit seinem Fahrrad buchstäblich in ihr Leben kracht und samt seinem gebrochenen Bein ihr unerwarteter Hausgast wird. Ein Gast mit traumhaft braunen Augen, eins fünfundneunzig groß, heißer und verlockender als duftendes Weihnachtsgebäck. Maggie hat es sich zum Ziel gemacht, diesem Mann zu widerstehen. Doch wird ihr das gelingen? Schließlich ist Weihnachten!
Die Autorin
Debbie Johnson ist eine Bestsellerautorin, die in Liverpool lebt und arbeitet. Dort verbringt sie ihre Zeit zu gleichen Teilen mit dem Schreiben, dem Umsorgen einer ganzen Bande von Kindern und Tieren und dem Aufschieben jeglicher Hausarbeit. Sie schreibt Liebesromane, Fantasy und Krimis – was genauso verwirrend ist, wie es klingt.
DEBBIE JOHNSON
ROMAN
Aus dem Englischen
von Irene Eisenhut
Wilhelm Heyne Verlag
München
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Never kiss a man in a Christmas Jumper bei HarperCollins Publishers Ltd.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2015 by Debbie Johnson
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Hanne Hammer
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik·Design, München
unter Verwendung von Loreta Jasiukeniene
(http://loretablog.blogspot.de)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-20090-9V002
www.heyne.de
KAPITEL 1
Als sie dem Mann zum dritten Mal begegnete, von dem sie mittlerweile wusste, dass er Marco Cavelli hieß, bescherte sie ihm ein denkwürdiges Weihnachtsgeschenk. Ein gebrochenes Bein und zwei gebrochene Rippen. Dazu noch ein paar Gesichtsabschürfungen und ein äußerst festliches blaues Auge als Geschenkverpackung.
Es war natürlich alles nur seine Schuld. Er fuhr bei heftigem Schneefall auf der falschen Straßenseite Fahrrad und hörte laut Musik, die ihre warnenden Schreie übertönte, als sie aufeinander zusteuerten. Zwei unaufhaltsame Kräfte, eingehüllt in Mützen, Handschuhe, Schals und weiße Flocken. Nur einer von ihnen blickte auf die Fahrbahn.
Er nahm ausgerechnet in dem Moment die Ohrhörer heraus, als sie zu schreien begann. »Sie Vollidiot, was zum Teufel haben Sie sich nur dabei gedacht …, o Mist …, warten Sie, ich rufe einen Krankenwagen.« Ganz Dame meine Ausdrucksweise, dachte sie. Und fügte in ihrem Kopf noch ein paar schlimmere Schimpfworte hinzu.
Als sie über den glatten Boden zu ihm krabbelte und mit klappernden Zähnen und zitternden Fingern ihr Handy aus der Jackentasche zog, die Jeans klatschnass vom Schnee, kam sie zu dem Schluss, dass Murphys Law sie beide gehörig aufs Kreuz gelegt hatte.
Es war ihr erster freier Tag seit einem Monat. Der erste Tag ohne Pailletten, Schleifen, Samtschlaufen, verdeckte Reißverschlüsse, Haken, Ösen, Taft und Spitze. Der erste Tag ganz ohne Nadelstiche in die Finger, ohne aufgeregte Bräute, angetrunkene Schwiegermütter und Nervenzusammenbrüche in allerletzter Minute.
Und er hatte so verheißungsvoll begonnen. Wunderbar kalt und frostig, mit einem klaren, strahlend blauen Himmel und unberührtem Schnee, der ihren Garten und die Straßen um das Haus in eine stimmungsvolle Landschaft verwandelt hatte, die aussah wie mit Puderzucker bestäubt.
Oxford im Schnee. Ein atemberaubender Anblick, der es stets vermochte, sie aus den Socken zu hauen. Wenn auch nicht wortwörtlich, denn sie trug zwei Paar. Vorsichtig radelte sie in die Stadt, um ihre Einkäufe zu erledigen. In dem antiquarischen Buchladen in der Nähe der Broad Street lag etwas für sie bereit, weshalb sie vor Aufregung völlig aus dem Häuschen war. Sie hatte es über Monate hinweg in Raten abbezahlt. Jetzt gehörte es endlich ihr. Zumindest für ein paar Wochen. Dann würde es Ellen bekommen. Sie konnte es kaum erwarten. Während sie die St. Giles Street entlangradelte, stellte sie fest, dass sich ein Rollentausch zu Hause vollzogen hatte, langsam und schleichend. Ellen war mittlerweile zu cool für Weihnachten. Maggie war jetzt diejenige, die sich wie ein kleines Mädchen auf das Fest freute.
Ach, was soll’s, dachte sie, als sie ihr Fahrrad über die glatten Straßen lenkte, wobei sie die blindlings herumlaufenden, unbekümmerten Touristen mit ihren Rucksäcken auf dem Rücken und die wenigen Studenten, die noch da waren, im Auge behielt.
Tags zuvor war das Semester zu Ende gegangen und der Verkehr zum Erliegen gekommen, als die vielen Autos der Studenten sich in Bewegung gesetzt hatten, um nach Hause zu fahren, alle bis unters Dach beladen mit Bettdecken, schmutziger Kleidung und krümelnden Toastern. Oxford war anders, wenn sie weg waren. Ruhiger, nicht so überfüllt, aber auch sehr viel trister. Die Studenten waren von dem Schnee verschont geblieben, der sich angeschlichen hatte wie ein Dieb in der Nacht und auf fast allen belebten Straßen eine Schneedecke von drei Zentimetern hinterlassen hatte.
Maggie hatte Kavanagh’s Book of Note sicher, wenn auch ein bisschen durchnässt, erreicht, wo sie das in braunes Packpapier eingewickelte Paket freudestrahlend in Empfang genommen und in ihren Rucksack gesteckt hatte, ehe sie wieder auf den Sattel gestiegen war, um zum Covered Market zu fahren. Dort wollte sie sich mit einer Tasse heißer Schokolade und einem Riesenstück Torte verwöhnen. Immerhin war Weihnachten. Na ja, fast.
Sie fuhr über die Broad Street am Balliol und am Trinity College vorbei und bog dann auf den mit Kopfstein gepflasterten Radcliffe Square ab. Als sie über den Platz ruckelte und sich ihren Weg um die in Schals gehüllten Gelehrten herum bahnte, die zu der majestätischen Bodleian Library spazierten, bemerkte sie, dass die Lampen dort noch brannten. Es war bereits nach neun Uhr morgens, doch die heiligen Hallen der Bildung erstrahlten noch immer in elektrischem Licht, das winzige Neonwolken durch die Fensterscheiben warf. Es musste wohl an der dunklen Holzvertäfelung der Räume liegen, die das helle Sonnenlicht absorbierte. Auf den Treppenstufen lag eine dünne, pudrige Schneeschicht, während der Schnee auf dem Kopfsteinpflaster schwer und nass war.
Maggie radelte an der Kirche St. Mary the Virgin vorbei, die durch den flauschigen Schleier des noch immer fallenden Schnees erst recht wie ein Postkartenidyll wirkte mit ihrer aufragenden Turmspitze und der schwindelerregenden Treppe. Aus dem Inneren drang der Klang engelsgleicher Stimmen, die gerade Weihnachtslieder probten. Eine Horde von Jungen, die sonst bestimmt nicht so engelsgleich waren, verwandelte The Holly and the Ivy gerade in ein wunderbares, magisches Erlebnis.
Sie fuhr gerade zur High Street weiter, als ihr der Gedanke kam, dass Ellen das Buch womöglich gar nicht mögen würde und sie ihr stattdessen vielleicht besser das Geld schenken sollte. Vielleicht war ihr schnöder Mammon lieber als eine Erstausgabe. Möglicherweise klammerte sie sich an das Bild eines kleinen Mädchens, das es schon lange nicht mehr gab, das bei lebendigem Leib verschlungen worden war von der ausgelassenen, jungen Frau, mit der sie inzwischen ihr Zuhause teilte. Wenn diese junge Frau überhaupt einmal zu Hause war.
Später gestand sie sich ein, dass sie eventuell, aber auch nur eventuell, etwas abgelenkt gewesen war. Das belebte Stück hinunter zur High Street war verhältnismäßig schneefrei, und sie hatte ihre Geschwindigkeit ein kleines bisschen erhöht. Ein so winzig kleines bisschen, dass ihre Beine den Unterschied kaum bemerkt hatten.
Unglücklicherweise führte diese winzig kleine Beschleunigung jedoch dazu, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als wie am Spieß zu schreien und das Beste zu hoffen, als sie das andere Fahrrad erblickte, das mit einer Geschwindigkeit auf sie zusteuerte, die ihr unmöglich erschien für ein nicht motorisiertes Fahrzeug. Das Beste zu hoffen, war irgendwie ihr Lebensmotto. Sie sollte es sich auf ein T-Shirt drucken lassen.
Während sie kurz in entsetzt schauende, haselnussbraune Augen schaute und der entgegenkommende Fahrer begriff, was gleich passieren würde, versuchten beide auszuweichen. Zu spät.
Ehe Maggie sichs versah, flog sie schon durch die Luft, und ihr Fahrrad schleuderte im Leerlauf gegen ein schmiedeeisernes Geländer, sodass die Speichen knirschten und sich verbogen. Sie presste die Augen zusammen, da die Welt sich zu drehen begann, und bereitete sich auf eine Bruchlandung vor, die nur eine Sekunde später mit einem dumpfen Schlag erfolgte. Ihr Rücken schlitterte über Eis und Schneematsch, und ihr Helm donnerte mehrfach auf den Boden, sodass sie kurzzeitig schielte.
Einen Augenblick war sie zu verblüfft, um sich zu bewegen. Regungslos lag sie da und spürte, wie die Feuchtigkeit durch die zahlreichen Schichten ihrer Kleidung zu kriechen begann. Die lähmende Nässe des eiskalten Schnees legte sich wie ein Film auf ihre Gliedmaßen. Wenn diese Szene hier ein Cartoon wäre, würde Tweety jetzt um meinen Kopf flattern, dachte sie. Mit Ohrenschützern.
Sie blieb noch ein paar Sekunden still liegen, bis der Schleier sich verzogen hatte. Dann blinzelte sie und überprüfte körperlich und geistig die Funktionstüchtigkeit ihrer ramponierten Körperteile.
Beine: Bewegen sich noch. Arme: Eindeutig in Ordnung. Kopf? Ein bisschen lädiert, aber eigentlich okay. Wahrscheinlich in keinem schlimmeren Zustand als vorher. Lediglich ihr Steißbein tat höllisch weh. Sie war auf ihrem Allerwertesten gelandet, der glücklicherweise so dick gepolstert war, dass er sie vor schlimmeren Verletzungen bewahrt hatte. Ein dreifaches Hoch auf Mädels mit dicken Hintern.
Sie blickte auf und sah sich um. Mehrere Passanten kamen auf sie zu. Sie sah den Mann, diesen dämlichen Kerl mit den großen haselnussbraunen Augen und der unmenschlichen Fähigkeit, mit einer Geschwindigkeit von 700 Kilometern die Stunde Rad zu fahren. Er lag ein paar Meter von ihr entfernt, Arme und Beine gespreizt. Mit den wenigen gequälten, ruckartigen Bewegungen seines riesigen, verdrehten Körpers schuf er einen abstrakten Schneeengel.
Auf Händen und Knien krabbelnd arbeitete sie sich zentimeterweise in seine Richtung vor, wobei sie ihn wütend und besorgt zugleich anschrie. Er hatte sie von ihrem Fahrrad katapultiert, der Idiot, und verdiente einen ordentlichen Anschiss.
Ihr Rucksack hatte sich bei dem Sturz geöffnet, und der Inhalt war herausgeflogen. Ihre kostbare Erstausgabe von Alice im Wunderland lag zerfleddert, zerrissen und schmutzig im Schnee, die wunderschön bebilderten Seiten nass vom Matsch. Außerdem tat ihr der Hintern weh. Richtig weh. Am liebsten hätte sie ihm einen ordentlichen Karateschlag in seine Weichteile verpasst. Wenn er nicht … solche Schmerzen zu haben schien. Sein Bein sah irgendwie verdreht aus. Verflucht noch mal, wo war ihr Handy? Und warum spürte sie ihre Finger nicht?
Als sie nah genug war, um sein Gesicht zu erkennen, sah sie, wer er war. Er war Er. Der heiße Papa vom Park. Der Mann mit dem Smoking. Der Kerl, der einen Rentierpulli in ein sexy Kleidungsstück verwandeln konnte. Der umwerfende amerikanische Traumtyp, der ihr schon mehrfach in den letzten Tagen über den Weg gelaufen war.
Sie blickte sich um und sah sein Fahrrad mit dem Kindersitz hinten auf dem Gepäckträger. Krumm und verbogen lag es verwaist an der Rückwand des Brasenose College.
»Das Kind!«, schrie Maggie völlig panisch, als sie schließlich bei ihm war. »Wo ist das Kind?«
KAPITEL 2
Ihre erste Begegnung war zwar nicht ganz so dramatisch verlaufen, aber gleichermaßen denkwürdig gewesen. Auf ihre eigene Art und Weise. Maggie hatte zusammen mit ihrer Tochter auf einer Bank im Park gesessen. Vor drei Tagen.
»Wenn das so weitergeht, werde ich noch an Östrogenvergiftung sterben«, hatte Ellen gesagt, nachdem sie die Ohrhörer herausgenommen hatte. Ihr angewiderter Blick war auf die Szene gerichtet gewesen, die sich vor ihren Augen abspielte.
»Scheinbar sind alle tollen Mamis gestorben und im Himmel der dämlichen Schnallen gelandet. Keine einzige sieht nach ihrem Kind. Ihre süßen Kleinen könnten Crack rauchen oder sich Hundekacke in den Mund stopfen, und sie würden es nicht einmal merken. Wahrscheinlich denken diese Mütter gerade alle nur ans Vögeln. Ich glaube, ich muss mir gleich das Hirn mit Bleichmittel auswaschen. Ehrlich, der Typ trägt einen Rentierpulli! Eine der Regeln im Buch der Feministinnen lautet bestimmt, nie einen Mann in einem Rentierpulli zu küssen, oder?«
Es war der erste Dezember, und die Temperaturen waren über Nacht gefallen, als hätte der Wettergott einen Blick in den Kalender geworfen und beschlossen, noch eine Schippe draufzulegen. Ellens Schmähungen wurden begleitet von kleinen Atemwolken, die aus ihrem Mund drangen, und dem ungeduldigen Trippeln ihrer Füße auf dem reifbedeckten Boden unter der Bank.
Während sie schimpfte, verzog sie verächtlich das normalerweise hübsche Gesicht und schüttelte bedauernd den Kopf, als sie ihre Wasserflasche aufschraubte.
Sie hatten gerade ihre vier Kilometer lange Joggingrunde im Park beendet. Außer leicht geröteten Wangen und ein paar kastanienbraunen Haarsträhnen, die an der feuchten Haut klebten, war Ellen keinerlei Anstrengung anzusehen.
So war das nun mal mit süßen achtzehn, wenn der Körper noch nicht gekennzeichnet war vom Leben, Kinderkriegen und zu vielen einsamen Abenden mit Colin-Farrell-Filmen und einer Schachtel Schillerlocken, dachte Maggie O’Donnell.
Diese drei Dinge hatten ihr reichlich zugesetzt, obwohl sie mit vierunddreißig noch ziemlich gut in Schuss war. Zumindest innerlich. Allerdings nicht gut genug, um noch genügend Luft zu haben und Ellen zu antworten. Stattdessen versuchte sie, ihre unverschämt athletische Tochter anzulächeln, die ausgestreckt neben ihr auf der Bank saß, und blickte zu dem Geschehen auf dem Spielplatz hinüber, das Ellen so verärgert und schließlich zu ihrem Anti-Vagina-Monolog geführt hatte.
Maggie musste zugeben, dass ihre Tochter irgendwie schon recht hatte, auch wenn sie äußerst kritisch war. Dort drüben stand ein Mann. Ein richtiger, waschechter Mann, der in das zumindest an Wochentagen der weiblichen Spezies vorbehaltene Revier eingedrungen war.
Es war auch nicht irgendein alter Knacker oder einer dieser gestressten, nicht berufstätigen Väter, die ab und zu auftauchten, von oben bis unten bekleckert mit Erbsenpüree, und mit der Lebensfreude eines an einem Leistenbruch erkrankten Nilpferds von der Windeltasche zur Schaukel trippelten.
Nein, dieser Mann … war einfach nur umwerfend. Er war groß, auf jeden Fall größer als ein Meter fünfundachtzig. Breitschultrig. Muskulös. Und trug eine Levis-Jeans, einen Pullover mit einem riesigen Rentier auf der Vorderseite und eine teuer aussehende marineblaue Weste. Das dunkle Haar begann sich zu locken und schien normalerweise kürzer getragen zu werden. O ja, sie konnte durchaus verstehen, warum die anderen Mütter auf dem mit Raureif bedeckten Rasen begonnen hatten, in einer kollektiven Hormonlache dahinzuschmelzen. Er sah aus wie aus einer romantischen Komödie entsprungen, in der er die Hauptfigur spielte, einen talentierten, aber leidgeprüften Rugbyspieler.
Maggie nahm einen ordentlichen Schluck aus ihrer Wasserflasche und holte tief Luft, um wieder zu Atem zu kommen. Dann beäugte sie den Mann so unauffällig wie möglich. Leider jedoch nicht unauffällig genug.
»Mum!«, rief Ellen empört, und der Blick ihrer grünen Augen bohrte sich in ihre Mutter. »Du machst genau das Gleiche! Wie widerlich! Reiß dich zusammen! Du benimmst dich, als hättest du noch nie einen Mann gesehen.«
»Na ja, mein Schatz. Ich bin mir nicht sicher …, ob mir so ein Exemplar in meinem Leben schon mal begegnet ist. Und du hast offensichtlich noch nie Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück gesehen. Ein Mann in einem Rentierpulli kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen.«
Ellen schnaubte und starrte wenig überzeugt auf den Pullover und dessen Träger.
»Auf jeden Fall solltest du etwas nachsichtiger sein mit einem Mädel meines Alters«, fuhr Maggie fort. »Weißt du, ich bin auch nur aus Fleisch und Blut. Es ist nicht so, als würde man nichts mehr um sich herum wahrnehmen, nur weil man jenseits der dreißig ist. Aber das wirst du eines Tages noch selbst herausfinden. Außerdem … ein Hingucker ist er schon.«
Als sie die Worte aussprach, marschierte genau in dem Moment eine der verzückten Mütter schnurstracks in die Rutsche, da sie weiter fasziniert den Mann betrachtet hatte. Sie stieß sich den Kopf und errötete heftig. Die Szene erinnerte an eine Slapstickkomödie. Maggie biss sich auf die Lippe, um nicht laut loszuprusten. Das hätte mir auch passieren können, dachte sie.
»Hör auf, so zu stieren!«, sagte Ellen, wenngleich sie es nicht ganz schaffte, das Kichern in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Du bist kein Mädel … du bist eine alte Schachtel. Dein Verfallsdatum ist schon lange abgelaufen.«
»Ist es nicht!«, widersprach ihr Maggie und eiste schließlich ihren Blick von dem attraktiven Fremden los. »Ich habe vielleicht gerade mein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, mehr aber auch nicht.«
»Aha. Sagt die Expertin für Ernährungsfragen. Und worin besteht bitte der Unterschied?«
»Wenn man etwas isst, dessen Verfallsdatum abgelaufen ist, dann ist es schlecht. Richtig schlecht. So schlecht, dass man sich eine Lebensmittelvergiftung einfangen kann. So wie dein Großvater, als er an diesem Grillabend das ganze alte Hühnerfleisch verbraucht hat und dann mit dem Radio aufs Klo verschwunden und zwei Tage lang nicht mehr heruntergekommen ist. Das Mindesthaltbarkeitsdatum aber … ist eher eine Richtschnur. Wenn man etwas über dieses Datum hinaus verzehrt, bedeutet das lediglich, dass es nicht mehr im allerbesten Zustand ist. Womöglich schmeckt es nicht mehr ganz so gut, aber man muss sich deshalb nicht übergeben.«
»Und so verhält es sich bei dir, oder was?«
»Genau. Würde mich jemand vernaschen, wie zum Beispiel dieser Mann dort drüben, würde ihm anschließend nicht übel werden, aber es könnte sein, dass er schon Besseres probiert hat.«
Ellen verzog das Gesicht und machte mit den Fingern eine Geste des Erbrechens.
»Ich glaube, es kann sein, dass ich jetzt gleich kotze. Begreifst du nicht, dass du als meine Mutter die Pflicht hast, den Rest deines Lebens als völlig geschlechtsloses Wesen zu verbringen? Ich gehe mal davon aus, dass du nur einmal Sex hattest, und ich aus dieser erhabenen Vereinigung entstanden bin. Mit mehr bin ich ohne entsprechende Traumabewältigung nicht bereit, mich auseinanderzusetzen. Also, hör auf, ihn anzuhimmeln und lass uns nach Hause gehen. Ich glaube, du brauchst eine kalte Dusche. Wenn du willst, kannst du gern den Rest der untersexten Horde nach Hause einladen.«
»Okay«, erwiderte Maggie und lachte innerlich bei dem Gedanken der »erhabenen Vereinigung«, die dazu geführt hatte, dass sie mit sechzehn schwanger geworden war. Das war nicht gerade die Beschreibung, die die meisten dafür benutzt hätten, was auf dem Rücksitz eines auf dem Rastplatz der A40 geparkten Datsun Sunny stattgefunden hatte.
»Botschaft angekommen und verstanden, Hüterin der Sitten. Gib mir nur noch fünf Minuten, in denen ich mich wie ein geschlechtsloses Wesen benehmen kann, das einen völlig Fremden mit den Blicken verschlingt. Dann machen wir uns auf den Weg.«
Ellen brummte missbilligend vor sich hin, schlug ihre schlanken Beine übereinander, steckte die Ohrhörer wieder ein und hörte Musik. Wahrscheinlich, um das Geräusch der Seufzer in ihrer Umgebung zu übertönen.
Maggie betrachtete sie von der Seite und sah anschließend wieder zum Spielplatz. Einmal abgesehen von dem Mann, stimmte der Anblick sie etwas traurig. Melancholisch. Der Park lag nur zehn Minuten von ihrem Haus in Jericho entfernt. In der Ferne waren die verträumt aussehenden Turmspitzen im Stadtzentrum von Oxford zu sehen. Sie ragten verschwommen aus dem Nebel und wirkten wie ein beleuchteter Weihnachtsbaum aus weichem, gelbem Stein. Es war ein wunderschöner Anblick. Einer, der sich scheinbar nie änderte.
Sie kam schon seit vielen Jahren in diesen Park und konnte sich sogar noch dunkel daran erinnern, wie sie ihn als Kind mit ihrer eigenen Mutter besucht hatte. In ihrer Teenagerzeit war er ein beliebter Treffpunkt gewesen. Wild und ungestüm war sie Karussell gefahren und hatte dabei Cider aus Plastikflaschen getrunken. Ein Umstand, der möglicherweise nicht ganz unschuldig war an der späteren erhabenen Vereinigung auf dem Rücksitz des Datsun Sunny. Möglicherweise aber auch nicht.
Als sie dann selbst Mutter war, unglaublich jung noch, war sie mit ihrem eigenen süßen Baby im Kinderwagen im Park spazieren gegangen und hatte so die endlosen Stunden ihres Lebens gefüllt. Sie fütterte die Enten und fragte sich, was ihre Freundinnen wohl gerade machten. Sie hatte den Park immer wieder mit Ellen besucht. Als Kleinkind, als kleines Mädchen und jetzt als fast erwachsene junge Frau. Wenn Maggie die Augen schloss, zog alles noch einmal an ihr vorbei, wie episodenhafte Traumsequenzen in einem Film.
Die Schaukeln waren zwar in der Zwischenzeit neu gestrichen und die Bänke ersetzt worden, doch für Maggie waren die Geister vergangener Weihnachten noch überall zu spüren. Sie wickelten sich um die mit Raureif bedeckten Äste und hallten in jedem aufgeregten Kindergeschrei wider, das sie hörte.
Ellens Kindheit, die Zeit, in der man es als selbstverständlich erachtete, im Mittelpunkt des Leben seines Kindes zu stehen, schien ewig weit weg zu sein. Die Mütter auf dem Spielplatz sahen müde, schluderig und erschöpft aus, so wie alle Mütter. Sie hatten noch nicht begriffen, wie kostbar die Zeit mit ihren Kindern war und wie schnell sie vorbeiging.
Sie riss sich von den sinnlosen, bittersüßen Erinnerungen los und kehrte in die Gegenwart zurück. Er war noch immer da. Der Mann. Das Prachtexemplar. Dunkelhaarig und gut aussehend. Es war nicht nur sein Blick, der die Frauen hinriss, sondern auch seine liebevolle Art mit dem kleinen Jungen umzugehen. Seinem Sohn wahrscheinlich.
Dieser pausbäckige Engel mit den widerspenstigen, dunklen Locken war eindeutig das, was Erziehungsfachkreise als »Wildfang« bezeichnen würden. Im elterlichen Fachjargon konnte das alles bedeuten. Angefangen von einem dynamischen Kleinkind bis hin zu einem vom Teufel besessenen Außerirdischen, der den Kopf um dreihundert Grad drehen konnte und dabei die Titelmelodie der Kindersendung In the Night Garden summte.
Der Junge war circa zwei. In diesem Alter bestand das Leben aus drei Aktivitäten: laufen, hinfallen, schlafen. Der Mann sah jedoch überhaupt nicht müde aus. Und auch nicht erschöpft. Kein einziger Klecks Erbsenpüree war auf seiner Kleidung zu sehen. Er strotzte vor Gesundheit und Vitalität und hielt lachend mit dem Kleinen Schritt, der abwechselnd zu Schaukel, Rutsche und Klettergerüst rannte.
Eine Hand des Mannes war stets da, um den Jungen zu halten, ihn aufzufangen, wenn er fiel, den Schmutz von den Knien seiner Jeans abzuklopfen oder ihn hochzuheben und im Kreis zu drehen, bis das Kichern des Kleinen alle angesteckt hatte, die in Hörweite waren. Der Akzent des Mannes klang amerikanisch, und er nannte das Kind Luca, was dem unerwarteten Zauber seiner Anwesenheit an einem grauen, frostigen Tag Anfang Dezember in einem Park in Oxford nur noch eine weitere wunderbare Note hinzufügte.
Sollte er sich der Tatsache bewusst gewesen sein, dass jede Frau auf dem Spielplatz hoffte, ihm mit einem Feuchttuch oder der Wegbeschreibung zu den Toiletten behilflich sein zu können, ließ er es sich nicht anmerken. Er konzentrierte sich nur auf eins: ein toller, lustiger Vater zu sein.
Ja, dachte Maggie, stand von der Bank auf und begann sich zu dehnen, weil sie bereits Muskelkater bekam. Geschlechtslos. Verfallsdatum überschritten. Und zu spät für die Arbeit.
Zeit, mit dem Anschmachten aufzuhören und sich fertig zu machen für den Tag.
KAPITEL 3
Bei ihrer zweiten Begegnung steckte Maggies Kopf gerade unter dem Rock von Gaynor Cuddy, der ersten ihrer Weihnachtsbräute. Sie war vorbeigekommen, um ein letztes Mal ihr Kleid anzuprobieren. Gaynor war eine echte Prachtwumme und hatte sich ein noch prächtigeres Brautkleid ausgesucht, von dem Maggie überzeugt war, dass es in einer Folge von Big Fat Gypsy Wedding hätte mitwirken können. Auch wenn Gaynor keine Zigeunerin war, soweit Maggie wusste, sondern ein Call Center leitete und zusammen mit ihrem Freund, Tony, in einer ziemlich schicken Wohnung in der Nähe der Woodstock Road lebte.
Das mit einem Reifrock ausgestattete und fast überall bestickte Kleid war so gut wie fertig. Es zu nähen hatte mehr als ein Jahr gedauert und Unmengen an Satin und Tüll verschlungen. Maggie hatte die Kunstperlenvorräte sämtlicher Händler im Umkreis von einhundert Kilometern verbraucht und mit ihrem mühevollen Annähen eine dauerhafte Krümmung ihres Rückgrats riskiert.
Jetzt, nach zahlreichen Irrungen und Wirrungen und Gaynors ausführlichen Schilderungen ihrer nahezu gänzlich eingestellten Nahrungsaufnahme im letzten Monat, war es perfekt. Oder genauer gesagt, es war perfekt für Gaynor. Einige ihrer anderen Kundinnen wären vor Entsetzen in Ohnmacht gefallen, doch Gaynor war glücklich, und das allein zählte für Maggie.
Der Grund für ihren auf Tauchstation gegangenen Kopf war der, dass sie an der Brautunterwäsche herumwerkeln musste. Ihrem bombastischen Hochzeitskleid entsprechend hatte Gaynor beschlossen, einen Strumpfgürtel zu tragen, der gleichzeitig als Halfter für eine kleine Spielzeugpistole dienen sollte, die sie dort verstecken und als witzige Einlage nach der Trauzeremonie herausziehen wollte. Es war zwar keine alltägliche Bitte, aber mit ein paar schnellen Nadelstichen und einem hier und da aufgetragenen kleinen Tropfen Sekundenkleber durchaus machbar.
Normalerweise hätte Maggie diese Arbeit in der Ankleidekabine erledigt, doch die war einfach nicht groß genug für ein derartig opulentes Kleid und Gaynor. Und so befanden sie sich mitten in ihrem Laden, Ellen’s Empire. Maggie kroch auf den weggeworfenen Stofffetzen und Garnfäden herum, die den Fliesenboden stets zu bedecken schienen, egal wie oft sie fegte.
Während sie mit dem Reifrock über dem Kopf an dem Strumpfhalter herumbastelte, schnatterte Gaynor von dem Hochzeitsempfang (200 engste Freunde, einschließlich Maggie), den Flitterwochen (die Seychellen, ohne Maggie) und ihrem Plan nach Entledigung ihres Kleids so viele Marzipanpralinen zu essen, wie es ihrem Körpergewicht entsprach, und das noch ehe es zu irgendwelchen anderen Hochzeitsnachtaktivitäten kam. Tony fand dieses Vorhaben bestimmt genauso toll.
Maggie konnte nicht alles klar verstehen und gab nur ab und zu ein aufmunterndes Geräusch von sich, während sie ausprobierte, ob die kleine Waffe sich problemlos in den Halfter schieben ließ und schnell herausgezogen werden konnte. Ja, es schien gut zu klappen, und es würde bestimmt für das eine oder andere unterhaltsame Foto sorgen.
Zufrieden zog sie schließlich die Pistole heraus, die ebenfalls mit Kunstperlen verziert war und von einem Cowgirl-Karnevalskostüm stammte, das Gaynor im Internet aufgetrieben hatte. Maggie holte noch einmal tief Luft, bevor sie sich ihren Weg zurückbahnte. Vorsichtig hob sie den Reifrock, hörte das Rascheln unzähliger Meter Stoff und kroch heraus.
Genau in dem Moment, als ihr Hintern sich zentimeterweise nach draußen vorarbeitete, der Kopf aber noch unter Gaynors Rüschen steckte, bimmelte die Ladenklingel. Perfektes Timing. Sie hätte wirklich das Schild auf »Geschlossen« umdrehen sollen.
Maggie rappelte sich hoch, strich sich die verschiedenfarbigen Garnfäden von den Knien ihrer Jeans und drehte sich zu ihrem Kunden um. Gaynor kicherte, und Maggie bemerkte, dass sie die Spielzeugpistole in dessen Richtung hielt.
»Nicht schießen!«, rief er. »Ich werde friedlich wieder gehen.« Sein Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Einem Grinsen, das sie wiedererkannte. Es gehörte dem Mann aus dem Park.
Maggies Wangen waren durch die unmittelbare Nähe zu Gaynors bestrumpften Oberschenkeln bereits gerötet, und sie versuchte, nicht verlegen auszusehen. Sie schob eine widerspenstige Haarlocke hinter das Ohr. Es gab nichts, was ihr peinlich sein musste, sagte sie sich. Na gut, sie war zwar gerade aus dem Schritt einer anderen Frau aufgetaucht, und ja, sie richtete eine Spielzeugpistole auf ihn, aber er wusste nicht, dass sie ihn kannte. Dass sie von ihrer Tochter unbarmherzig verhöhnt worden war, weil sie ihn angehimmelt hatte. Dass sie sich mehrfach ertappt hatte, an ihn zu denken, häufig spät abends. An seine stattliche Größe, an die breiten Schultern, an die Leichtigkeit, mit der er seinen imposanten Körper bewegte. An die mitreißende Liebe, die er offensichtlich für seinen kleinen Sohn empfand.
Der fragliche kleine Bursche war ebenfalls da und stand neben ihm. Er betrachtete mit großen Augen das riesige Kleid. Als er den Anblick verarbeitet hatte, wackelte er zu dem Tisch, auf dem Maggies kleiner, perfekt gewachsener Weihnachtsbaum stand. Sie hatte den gesamten Weihnachtsschmuck aus Seide- und Taftresten selbst gefertigt und ihn mit Glitzer bestäubt. Der Baum war … geschmackvoll. Auf jeden Fall geschmackvoller als der bei ihr zu Hause. Der sah aus, als hätte eine Elfe in sämtlichen Regenbogenfarben darauf gekotzt.
Der kleine Kerl streckte die Hand aus, die von einer schokoladenhaltigen Nascherei verschmiert war. Der Mann hastete sofort zu ihm und zog die Hand sanft, aber bestimmt weg.
»Nein, Luca. Du musst erst chemisch gereinigt werden, bevor du so etwas anfassen darfst.«
Das Kind blickte ihn an und überlegte offenbar hin und her, ob es gelingen könnte, Reißaus zu nehmen.
»Nich dusche!«, erwiderte er trotzig und stampfte mit einem Fuß auf, der in einem Gummistiefel steckte.
»Ich weiß, dass du nicht duschen möchtest, aber das wird dir nicht erspart bleiben. Sobald wir hier fertig sind, heißt es für dich ab ins Bad.«
Er hob den kleinen Mann hoch in seine Arme, die wunderbar groß und muskulös waren, wie Maggie nicht umhinkonnte festzustellen. Einen Augenblick lang stellte sie sich ihn in Russell Crowes Kostüm aus »Der Gladiator« vor und merkte, wie ihre Wangen noch mehr glühten. Sie erinnerte sich daran, dass er stattdessen in einem weiteren Weihnachtspulli steckte, auf dem dieses Mal ein Weihnachtsmann mit einer Pudelmütze prangte. Er musste eine ganze Sammlung davon zu Hause haben.
»Ist schon in Ordnung«, sagte sie, ging zu dem Baum und nahm einen Weihnachtsschmuck herunter. »Die Schleifen haben Weihnachtsfeen gemacht. Sie haben ganz viele dagelassen. Du kannst dir eine mitnehmen, wenn du möchtest.«
Der kleine Kerl sah erst sie an und anschließend die glitzernde Schleife, die sie ihm hinhielt. Dann wanderte der Blick seiner großen, hoffnungsvollen Augen zu dem Mann. Nachdem dieser zustimmend genickt hatte, griff der Junge so schnell nach dem Schmuck wie ein Frosch in einem Naturfilm eine Fliege fängt. Beängstigende Reflexe.
»Danke«, sagte der Mann. »Das ist wirklich nett. Er wird wahrscheinlich versuchen, die Schleife zu essen, aber was soll’s … Ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht einen Anzug ändern können. Meiner ist auf dem Flug von den Staaten hierher verloren gegangen, und ich muss zu einer Taufe. Ich habe ein sehr ähnliches Modell gefunden, aber … na ja, er ist etwas eng.«
Maggie unterdrückte ein leichtes Schlucken und legte eine Hand auf den Weihnachtstisch, um sich abzustützen.
»Das glaub ich Ihnen sofort!«, meldete sich Gaynor zu Wort, das Timing perfekt und komisch. »Sie haben die Maße von Superman!«
»Nich Tuperman!«, entgegnete Luca, bevor er prompt eine Ecke der Weihnachtsschleife in seinen schokoladenverschmierten Mund schob.
»Äh … hm, ich verstehe. Das tut mir wirklich leid, aber Männer sind nicht mein Fachgebiet …«, stotterte Maggie. In dem Moment, als sie Worte ausgesprochen hatte, begriff sie, dass sie möglichweise damit einen falschen Eindruck erweckte. Beziehungsweise ungewollt den richtigen, denn Männer waren tatsächlich nicht ihr Fachgebiet. Sie hatte schon seit Jahren keinen Mann mehr gehabt. Ihre Freundin Sian war überzeugt, dass »es« mittlerweile wieder zugewachsen war, so wie Ohrlöcher, wenn man zu lange keine Ohrringe trägt. Sian drückte sich stets sehr gewählt aus.
Er runzelte die Stirn, und sein breiter Mund verzog sich zu einem schiefen Lächeln. O Gott, dachte sie, dieser Mund ist umwerfend.
»Ich meine natürlich, dass Männerkleidung nicht mein Fachgebiet ist.«
»Natürlich«, antwortete er und schien ihre anhaltende Röte zu genießen. »Können Sie mir jemanden empfehlen? Jemanden, dessen Fachgebiet Männer sind?«
»Männer sind mein Fachgebiet!«, ertönte Gaynors Stimme erneut, bevor sie wie ein Schulmädchen zu kichern begann.
Luca stimmte ein, obwohl er keine Ahnung hatte, worüber er lachte. Er war wirklich bezaubernd, wenn auch auf eine leicht furchterregende Art.
»Sie können es bei Lock versuchen, in der Nähe der Cornmarket Street. Er müsste Ihnen helfen können.«
Er bedankte sich und hielt länger Blickkontakt als nötig. Bitte gehen Sie, dachte Maggie, damit mein Gesicht wieder eine normale Farbe annimmt. Doch aus irgendeinem Grund bewegte er sich nicht. Er stand mit seinem massigen Körper zwischen ihr und der Tür. Sie kam sich vor wie in einer Falle. Ihr war heiß, und sie war viel zu nervös.
Er hielt diesen lästigen, intensiven Blickkontakt und grinste sie verschmitzt an, als könnte er ihre Gedanken lesen.
Maggie versuchte, freundlich aber bestimmt zu lächeln, während ihr durch den Kopf ging, dass sie wahrscheinlich dem Elefantenmenschen ähnelte. Ihr Bauch fühlte sich irgendwie komisch an, und in ihren Ohren klingelte es eigenartig. Sie hatte das Gefühl, als sollte sie noch etwas sagen, und zumindest versuchen, wie ein einigermaßen intelligenter Mensch zu wirken, doch ihre Stimmbänder hatten beschlossen zu streiken. Dieser Mann war einfach so … wunderbar. Und groß. Und kräftig. Ihn umgab eine Art Leuchten, dass es ihr die Sprache verschlug.
»Ich muss mal Aa«, sagte Luca.
Wenigstens einer, der nicht um Worte verlegen war.
KAPITEL 4
Ihm tat alles weh. Die Rippen, das Gesicht. Das Bein. Besonders das verdammte Bein. Marco hatte viel Sport in seinem Leben getrieben und einige Verletzungen einstecken müssen. Häufig waren sie ihm von Männern von der Größe eines kleinen SUVs zugefügt worden. Doch nichts hatte je so Schmerzen verursacht wie das hier. Er fühlte sich von Kopf bis Fuß … zerbrochen. Wie ein Glas, das in tausend Scherben zersprungen war.
Alles war so schnell gegangen. In der einen Minute radelte er noch über die Straße, lauschte der Playlist, die ihm Leah geschickt hatte, die Gedanken immer mal wieder bei dem Vortrag, an dem er gearbeitet hatte, um dann in der nächsten Minute … rums, vielen Dank gnädige Frau, von seinem Fahrrad zu fliegen, im eisigen Schnee zu landen, nach Luft zu schnappen und am liebsten wie ein Riesenbaby zu weinen, während aus seinen Ohrhörern noch immer Love is an Elevator von Aerosmith tönte. Äußerst unpassend. Wahrscheinlich waren nur die daran schuld. Die Rockmusik hatte ihn zu schnell Rad fahren lassen.
Doch zu all den Schmerzen, dem Durcheinander und der verdammten Kälte brüllte ihn diese Irre auch noch so laut an, dass ihm die Ohren anfingen wehzutun. Sie schrie eindeutig lauter als noch vor wenigen Minuten Steven Tyler.
Neben ihm im Schnee kniend rüttelte sie an seinen Schultern. Jedes Mal wenn sie an ihm zerrte, schossen noch stechendere Schmerzen in sein linkes Bein, die sich anfühlten wie ein Elektroschock. Das Schlimmste war, dass er nicht richtig verstehen konnte, was sie sagte. Wahrscheinlich stand er unter Schock. Oder er hatte eine Gehirnerschütterung. Oder er befand sich gerade in einer Art Schwebezustand, da der Chef ganz oben noch nicht entschieden hatte, ob er hinauf zu den himmlischen Chören oder hinab zu den glühend heißend Schürhaken geschickt werden sollte. Nicht Love in an Elevator, sondern Dead in an Elevator. Aerosmith lässt grüßen.
Aber selbst das wäre noch besser als diese Folter, ging es ihm durch den Kopf, und er versuchte, sich auf den aus ihrem Mund dringenden Wortschwall zu konzentrieren. Er blinzelte ein paarmal und ballte die Hände zu so festen Fäusten, dass er spürte, wie sich seine Nägel in die Handflächen bohrten. Dann blickte er sie an. Komm schon, Junge, sagte er sich. Reiß dich zusammen!
Er konnte Sirenengeheul im Hintergrund hören und hoffte, dass Hilfe unterwegs war. Hilfe mit Morphium. Hilfe, die ihn in einen Zustand des Vergessens versetzen würde. Selbst wenn das mit glühend heißen Schürhaken einherging. Er musste nur noch ein bisschen länger durchhalten. So lange seinen Mann stehen, bis die Sanitäter ihn in den Wagen verfrachtet hatten.
»Ja, ja …, okay! Hören Sie auf, mich zu schütteln, verdammt noch mal!«, schaffte er zu sagen. »Das tut höllisch weh!«
Die Frau ließ seine Schultern augenblicklich los und streckte ihre zitternden, blau angelaufenen Finger mit einer Geste der Kapitulation in die Luft. Ihre Augen waren hellgrün und schimmerten feucht von nicht vergossenen Tränen. Wilde rote Locken lugten aus den Ritzen ihres Fahrradhelms hervor und bildeten einen struppigen kastanienbraunen Kranz um ihren unversehrten Kopf. Sie kam ihm … durchgeknallt vor. Und irgendwie bekannt.
»Tut mir leid!«, rief sie und beugte sich nahe zu seinem Gesicht. »Aber wo ist der kleine Junge? Wo ist Luca?«
»Er ist nicht hier, okay? Ihm geht’s gut! Mir … aber nicht! Haben Sie sich nicht mal gefragt, ob mein Rückgrat vielleicht verletzt sein könnte, ehe Sie angefangen haben, mich durchzurütteln, Sie Wahnsinnige? Ich könnte für den Rest meines Lebens gelähmt sein!«
Sie fiel zurück auf ihren Hintern. Erleichterung machte sich auf ihrem Gesicht breit. Dann rollten ihr schließlich die Tränen über die Wangen. Er bemerkte, dass sich ihr Gesichtsausdruck schmerzhaft verzog und dass sie sich auf dem Schnee wand, um eine angenehmere Sitzposition zu finden. Er kannte diese Haltung. Ein geprelltes Steißbein. Er hatte schon häufig genug einen Schlag darauf abbekommen, um die Symptome zu erkennen. Hätte er in dem Moment nicht selbst so unsägliche Schmerzen gehabt, hätte er Mitleid für sie empfunden. Er versuchte, das Bein ein paar Millimeter zu bewegen, und war froh, als es reagierte. Wenigstens würde er nicht den Rest seines Lebens gelähmt sein. Doch auf den Schmerz, der ihn dann durchfuhr, war er nicht vorbereitet.
Marco stieß einen Schrei aus und biss sich anschließend so fest auf die Lippe, dass er Blut schmeckte. O Mann. Das war nicht gut. Gar nicht gut.
Die Frau, mit der er zusammengestoßen war, beugte sich zu ihm vor, woraufhin er so weit wie möglich zurückwich. Wahrscheinlich zückte sie gleich einen glühend heißen Schürhaken.
»He, fangen Sie nicht wieder an, mich zu schütteln, okay? Lassen Sie mich einfach nur in Ruhe!«
Sie nickte, blieb aber an seiner Seite. Er spürte, wie ihre eisigen Finger zu seinen wanderten, während sie ihm mit der anderen Hand sanft eine Haarsträhne aus der Stirn strich.
»Es tut mir leid«, sagte sie noch einmal. Der Ton in ihrer Stimme war jetzt leise und beruhigend, überhaupt nicht mehr angsteinflößend wie noch eben. »Ich habe den Kindersitz hinten auf dem Fahrrad gesehen. Sie waren gestern in meinem Laden, und da habe ich gedacht … na ja, ich bin vom Schlimmsten ausgegangen.«
Er umklammerte ihre Finger. Ihr war noch kälter als ihm. So kalt, dass ihre Tränen drohten, auf den Wimpern festzufrieren. Sie hatte wunderschöne Augen. Riesig. Klar. Dunkelgrün wie Gras. Ihre Augen passten zu der hellen, sommersprossigen Haut und dem langen, dunkelroten Haar. Als er den Fahrradhelm gedanklich entfernte, fiel es ihm wieder ein. Sie war die Frau aus dem kleinen Geschäft mit den Brautkleidern im Schaufenster. Die Schneiderin mit dem Lächeln und der Spielzeugpistole, die Luca die Weihnachtsschleife geschenkt hatte, die er so gern mochte. O Mann! Wie klein die Welt doch war, dachte er, während eine weitere Welle von Schmerzen ihn durchzuckte.
Zumindest erklärte das ihre Reaktionen. Wen kümmerte schon der Zustand eines Riesenochsen wie ihm, wenn das Leben von einem zweijährigen süßen Fratz in Gefahr sein könnte? Wären ihre Rollen vertauscht gewesen, hätte er sie genauso geschüttelt.
»Es ist alles okay. Er ist in Sicherheit. Und jetzt, sagen Sie mir bitte … wie sieht mein Bein aus? Ist damit alles in Ordnung? Denn so fühlt es sich nicht an.«
Sie schaute an ihm herunter und gab sich die größte Mühe, ihr Entsetzen zu verbergen.
»Ja, soweit ganz gut. Nichts, was ein paar Nadelstiche nicht wieder in Ordnung bringen könnten.« Zusätzlich zu ein paar Metallplatten und einer Hauttransplantation, dachte Maggie, während sie versuchte, beruhigend zu lächeln. Das Bein war ein grässlicher Mischmasch aus seiner Jeans und einer riesigen, offenen Fleischwunde. Sie hatte nicht zu lange darauf gestarrt, um zu vermeiden, irgendeinen hellen, weißen Knochen zu erkennen, der eigentlich überhaupt nicht sichtbar sein sollte.
»Gut«, antwortete er und verstärkte den Griff um ihre Finger. »Ich nehme Sie beim Wort. In puncto Nadelstiche kennen Sie sich ja aus. Hören Sie, behalten Sie mich im Auge, ja? Mein Personalausweis ist in meiner Tasche. Genauso wie mein Handy. Suchen Sie die Nummern von Rob und Leah heraus und richten Sie den Typen vom Krankenhaus aus, dass sie sie anrufen sollen, ja?«
»Seien Sie nicht albern!«, entgegnete sie. »Sie werden sie sicher selbst anrufen können.«
»Nein«, erwiderte er. Sein Kopf fiel zurück in den Schnee und rollte zur Seite. »Ich glaube, ich werde jetzt ohnmächtig. Und ich glaube, ich werde es genießen.«
KAPITEL 5
Die Frau, die Maggie einen Kaffee reichte, war einige Zentimeter kleiner, wahrscheinlich ein paar Jahre jünger, aber auf jeden Fall um einiges schwangerer als sie.
Sie war auch ungemein hübsch, fand Maggie. Blondes Haar, zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden. Makellose Haut. Riesige, bernsteinfarbene Augen, knapp über ein Meter fünfzig. Nach ihrem Riesenbauch zu urteilen, konnte es jeden Moment losgehen.
Sie setzte sich langsam auf den Plastikstuhl neben Maggie. Keuchend und schnaufend nahm sie die allgemein beliebte Haltung hochschwangerer Frauen ein, bei der man aussah, als hätte man eine Bowlingkugel zwischen den Beinen.
»So was werde ich auch bald brauchen«, sagte sie und zeigte auf den aufblasbaren Sitzring, auf dem Maggies Hinterteil ruhte. »Nach Lucas Geburt konnte ich drei Tage lang nicht sitzen. Die ganze Zeit lag ich seitlich auf meinem Schwabbelbauch, verlangte nach Kaviar und Champagner und sah mir mit einem Riesenhass auf die ganzen dünnen Mädels die Wiederholungen von America’s Next Top Model an.«
Maggie lächelte zaghaft, denn sie war sich nicht ganz sicher, ob die Frau neben ihr scherzte oder nicht.
»Kleiner Witz«, sagte sie und stellte die Sache klar. »Aber ich hatte ziemliche Wundschmerzen, und die dünnen Mädels hasse ich noch immer. Sie wissen doch, wie das ist, oder? Haben Sie Kinder?«
»Eine Tochter«, antwortete Maggie und nahm den Becher mit dem brühend heißen Kaffee in die andere Hand, um zu verhindern, dass sie sich neben ihrem geprellten Steißbein noch Verbrennungen dritten Grades zuzog. »Aber sie ist mittlerweile schon achtzehn. Und eins dieser dünnen Mädels.«
Die Frau, die Leah hieß, wie Maggie mittlerweile wusste, und Marco Cavellis Schwägerin war, musste nach diesem Satz ein zweites Mal hinsehen, so wie alle anderen. Doch sie versuchte erst gar nicht, ihr Erstaunen zu verbergen, was herzerfrischend war. Leah wirkte nicht wie jemand, dem schnell etwas peinlich war. Sie fühlte sich viel zu wohl in ihrer Haut, um sich darüber überhaupt Gedanken zu machen.