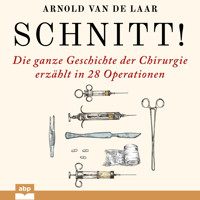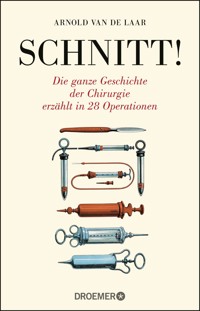
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pattloch eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Von den dunklen Anfangszeiten der Chirurgie, als noch ohne Betäubung amputiert wurde, über königliche Operationen bis zu den heutigen High-Tech-OPs – der Chirurg Arnold van de Laar beschreibt in seinem Buch so packend wie allgemeinverständlich die Geschichte der Chirurgie. Ohne Fachbegriffe zu scheuen, aber doch leicht lesbar und gespickt mit zahlreichen interessanten Details gibt van de Laar einen spannenden Einblick in sein Fach. In 28 Kapiteln erzählt er anhand berühmter Operationen, was genau im Operationsaal geschieht. Eingehend widmet er sich Erkrankungen und Verletzungen bekannter Persönlichkeiten wie Bob Marley, Kaiserin Sissi, Lenin, Königin Victoria, Einstein und Präsident Kennedy. "Schnitt" ist eine faszinierender Reise durch die Königsdisziplin der Medizin, fesselnd erzählt von einer Koryphäe auf dem Gebiet der Chirurgie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Arnold van de Laar
SCHNITT!
Die ganze Geschichte der Chirurgie erzählt in 28 Operationen
Aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Von den dunklen Anfangszeiten der Chirurgie, als noch ohne Betäubung amputiert wurde, über königliche Operationen und den Luftröhrenschnitt des Jahrhunderts bis zu den heutigen High-Tech-OPs – der Chirurg Arnold van de Laar beschreibt in seinem Buch so packend wie allgemeinverständlich die Geschichte seines Fachs. In 28 Kapiteln erzählt er anhand von berühmten Fällen aus Historie und Gegenwart, was genau im Operationssaal geschieht.
Inhaltsübersicht
Einleitung: Handwerker, Wundärzte und Chirurgen
1. Lithotomie
2. Asphyxie
3. Wundheilung
4. Schock
5. Adipositas
6. Stoma
7. Fraktur
8. Varizen
9. Peritonitis
10. Narkose
11. Gangrän
12. Diagnose
13. Komplikationen
14. Dissemination
15. Abdomen
16. Aneurysma
17. Laparoskopie
18. Kastration
19. Lungenkarzinom
20. Placebo
21. Nabelbruch
22. Short stay, fast track
23. Mors in tabula
24. Prothese
25. Carotis
26. Gastrektomie
27. Fistula ani
28. Elektrizität
Nachwort: Der Chirurg der Zukunft
10. Viktor Frankenstein
9. Miles Bennell
8. Doktor Blair
7. Helena Russel
6. Männer in weißen Kitteln
5. Drei schlafende Ärzte in »kryogener Hibernation«
4. Leonard McCoy
3. Der Roboterchirurg
2. Doktor Ash
1. Peter Duval
Glossar
Schlussbemerkung
Quellen
Bücher, Biografien und Publikationen
Medizinische Publikationen
EINLEITUNG
Handwerker, Wundärzte und Chirurgen
Kriegsverwundungen nach Ambroise Paré. Abbildung aus seinem Buch Opera chirurgica (1594).
In einer Nacht im Jahre 1537, nach einem langen Kriegstag in der Schlacht um Turin, wurde der junge französische Militärchirurg Ambroise Paré von ernsthaften Sorgen geplagt. Das Schlachtfeld war mit Opfern von Hakenbüchsen- und Gewehrschüssen übersät gewesen, Ambroise aber hatte noch nie zuvor eine Schusswunde behandelt. In einem Buch hatte er gelesen, man solle wegen des giftigen Schießpulvers kochendes Öl in die Wunde gießen. Daher hatte er das brodelnde Fett mit einer Kelle in die blutigen Fleischwunden geschöpft, wo es wie in einer Frittierpfanne aufspritzte. Die Zahl der Verwundeten war jedoch so groß, dass ihm das Öl schon auf halbem Wege über das Schlachtfeld ausgegangen war. Nun trieb ihn die Sorge um das Los der restlichen Soldaten um, deren Wunden er nur notdürftig mit einer Salbe aus Rosenöl und Eigelb bestrichen hatte. Die ganze Nacht hindurch musste Ambroise die Schreie der Männer, die auf dem Schlachtfeld mit dem Tode rangen, mit anhören und hielt das für seine eigene verdammte Schuld. Bei Tagesanbruch fuhr ihm der Schrecken in die Glieder, als er erkannte, dass er in der Nacht die Schreie jener Soldaten vernommen hatte, die er mit kochendem Öl behandelt hatte, nicht die Schreie der anderen Verwundeten. Ambroise Paré sollte zur Wundversorgung nie wieder heißes Öl verwenden, er wurde ein großer Chirurg. Der erste Schritt zur modernen Chirurgie war getan.
Die Chirurgie muss irgendwann wie etwas ganz Selbstverständliches entstanden sein. Seit es den Menschen gibt, hatte er Leiden, die »mit der Hand« geheilt werden mussten. Dafür brauchte man einen Chirurgen, wörtlich: einen »Handwerker«. Kämpfen, jagen, umherziehen, nach Wurzeln graben, vom Baum fallen, gejagt werden: Das harte Leben unserer Vorfahren barg viele Risiken. Die Versorgung einer Wunde ist daher nicht nur die elementarste chirurgische Handlung, sondern wohl auch die erste. Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass eine schmutzige Wunde mit Wasser ausgespült, eine blutige Wunde abgedrückt und eine offene Wunde abgedeckt werden muss. Stellt man anschließend fest, dass die Wunde verheilt, wird man es beim nächsten Mal wieder genauso machen. Im Mittelalter wurde dieser gesunde Menschenverstand jedoch durch überlieferte Weisheiten getrübt. Man sah nicht auf das Ergebnis, sondern darauf, was ein bedeutender Vorfahr in einem alten Buch dazu geschrieben hatte. Das führte dazu, dass Wunden nicht gesäubert, sondern mit Brenneisen oder kochendem Öl versengt und mit schmutzigen Lappen verbunden wurden. Niemand fragte sich, ob denn gebratenes Fleisch überhaupt noch zu heilen vermochte. Erst nach dieser dunklen Zeit gewann in dieser schlaflosen Nacht von Turin der gesunde Menschenverstand wieder die Oberhand, und es entstand eine Form der auf Erfahrung basierenden Chirurgie.
Zurück zum Anfang. Wann wird dem Menschen wohl die Eingebung gekommen sein, eine Infektion, bei der sich Eiter gebildet hat, eine eitrige Wunde etwa, eine Pustel, ein Geschwür oder einen Abszess aufzuschneiden? Das ist das zweite Basisverfahren in der Chirurgie: das Abfließenlassen von Eiter. Dieser Vorgang wird drainieren genannt. Man braucht dazu nur etwas Scharfes, zum Beispiel einen Akaziendorn, die Spitze eines Feuersteins, einen bronzenen Dolch oder ein Skalpell aus Stahl. So kam das Messer in die Chirurgie. Und deshalb hängt bei uns Chirurgen die alte lateinische Weisheit Ubi pus, ibi evacua (Wo Eiter ist, muss drainiert werden) noch immer über dem Bett.
Die Versorgung von Knochenbrüchen ist das dritte Basisverfahren der Chirurgen. Vor Wölfen flüchten, ein Mammut jagen, stolpern, auf Raubzug gehen, von einer Keule niedergestreckt werden: Das prähistorische Leben bot wahrlich genügend Möglichkeiten, um sich die Knochen zu brechen. Ob wohl damals schon jemand so klug gewesen ist, einen gebrochenen Knochen zu richten, wie schmerzhaft das auch gewesen sein mag? Es war sicherlich nicht jedermanns Sache, denn man musste sich das erst einmal trauen, und – viel wichtiger – der Patient musste es auch zulassen. Nur wer Mut und Autorität mitbrachte und zudem noch über genügend Wissen und Erfahrung verfügte, konnte dieses Vertrauen gewinnen. Außerdem musste man geschickt sein, bestenfalls der Geschickteste in der Gruppe. Dann wurde man zu diesem Handwerk ausersehen, konnte zu einem cheirourgos (griechisch von cheiros für Hand und ergon für Werk, Arbeit) werden, zu einem Chirurgen.
Die Versorgung von Notfallpatienten ist ein Teil der Chirurgie geblieben. Der Umgang mit erheblichen Blutverlusten, Verletzungen und Wunden, das Sicherstellen der Atmung und die Stabilisierung eines Patienten in akuter Lebensgefahr gehören noch immer vornehmlich zu den Aufgaben eines Chirurgen in der Notaufnahme eines Krankenhauses.
Die Grundlagen der Chirurgie sind also so übersichtlich wie handfest. Wer Wunden, Abszesse und Brüche behandelt und Menschen in Not versorgt, kann mit der Dankbarkeit seiner Patienten rechnen oder, falls etwas schiefgeht, zumindest mit dem Verständnis der Angehörigen. Der nächste Schritt, der Schritt zu einer echten Operation, ist da schon ein ganz anderes Wagnis. Man versorgt keine Wunde, man führt sie herbei. Als kluger Chirurg (und als kluger Patient) wägt man das Risiko dabei ab. Bin ich dazu in der Lage? Geht es meistens gut aus oder eher schlecht? Gibt es Alternativen? Was wird aus dem Patienten, wenn ich nichts unternehme? Was wird aus mir, wenn es schiefgeht? Es geht immer darum, eine Balance zwischen den beiden Zielen zu finden: sein Bestes zu geben und Schaden zu vermeiden. Leichter gesagt als getan … Der römische Konsul Marius ließ sich von einem Chirurgen die Krampfadern entfernen. Der Patient überlebte und regierte noch jahrelang. Der Chirurg Ranby hielt es für vernünftig, mit seinem Messer in den Nabelbruch der englischen Königin Caroline zu stechen, was zur Folge hatte, dass seine Patientin einen elenden Tod starb. Trotzdem wurde der römische Kollege vom Konsul getadelt (und durfte dessen zweites Bein nicht operieren) und John Ranby für seine dem Hof erwiesenen Dienste geadelt. Die Chirurgie ist ein launisches Fach.
Wunden, Knochenbrüche, Eiterinfektionen und Operationen hinterlassen Narben, während Krankheiten wie Erkältungen, Durchfall und Migräne vorübergehen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Für diese unterschiedlichen Möglichkeiten, alles wieder »in Ordnung zu bringen«, gibt es im Niederländischen zwei verschiedene Ausdrücke: Von »helen« (heilen) spricht man bei Operationen und der Behandlung von Wunden, Schwellungen und Brüchen, von »genezen« (kurieren) bei der Behandlung von Krankheiten. Ein Chirurg heilt, und ein Doktor kuriert. Daher kommt die niederländische Bezeichnung »heelmeester« für Chirurg, im Gegensatz zum »geneesheer«, dem Arzt, der sich um die Genesung des Patienten bemüht. Chirurgen sind übrigens schon lange beides, kundige Ärzte und handwerklich arbeitende Chirurgen. Sie beschränken sich allerdings auf die Behandlung typischer chirurgischer Erkrankungen, die nur eine Minderheit aller Erkrankungen darstellen. Für die Behandlung der meisten Krankheiten, die einen Menschen heimsuchen können, sind nämlich weder Chirurgen noch Operationen erforderlich. Die Dienste, die ein Wundarzt im 16. Jahrhundert in Amsterdam zu bieten hatte, waren sogar so simpel und beschränkt, dass er seine Arbeit als einfacher Gewerbetreibender in einem Ladengeschäft verrichten konnte. Außerdem war die lokale Berufsgruppe der Amsterdamer Handwerkschirurgen noch so unbedeutend, dass sie mit drei anderen belanglosen Handwerken in einer Gilde zusammengefasst wurde: den Schlittschuhmachern, den Holzschuhmachern und den Haarschneidern.
Bis ins 18. Jahrhundert hinein machten Wunden, Eiter und Brüche in der kurzen Reihe der chirurgischen Erkrankungen, die Chirurgen behandelten, den größten Teil aus. Diese knappe Liste ließe sich noch durch das Herausschneiden und Versengen ungeklärter Wucherungen und Geschwüre und natürlich den Aderlass ergänzen, die populärste aller chirurgischen Handlungen, die allerdings mehr mit Aberglauben als mit der eigentlichen Krankheit zu tun hatte. Stellt man das alles in Rechnung, war Chirurgie eigentlich nicht mehr als ein langweiliges und simples Fach. Wäre ich damals Chirurg gewesen, hätte es mir ganz sicher weniger Spaß gemacht als heute.
Mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung und der Erfahrung in der Chirurgie nahm auch die Anzahl der Erkrankungen zu, die sich chirurgisch behandeln ließen. Ein bedeutsamer Grund für viele typische chirurgische Erkrankungen liegt in der einfachen Tatsache, dass der Mensch aufrecht geht. Dieser erste Schritt im aufrechten Gang vor circa vier Millionen Jahren brachte gleich eine Reihe von Problemen mit sich, die bis heute für einen Großteil des chirurgischen Behandlungsspektrums verantwortlich sind: Krampfadern, Leistenbrüche, Hämorrhoidenleiden, die Schaufensterkrankheit, Verschleiß der Hüfte, Hernien, Sodbrennen, Meniskusrisse – sie alle haben damit zu tun, dass wir auf zwei Beinen gehen.
Zwei chirurgische Erkrankungen, die heute einen bedeutsamen Teil der Chirurgie ausmachen, plagen den Menschen in diesem Maße jedoch noch nicht allzu lange: die relativen Newcomer Krebs und Arterienverkalkung. Sie haben sich in den letzten Jahrhunderten unter dem Einfluss eines neuen, von einem Übermaß an Kalorienzufuhr und Tabakgenuss geprägten Lebensstils eingeschlichen. Außerdem treten diese beiden Krankheiten meistens erst in fortgeschrittenem Alter auf, und früher starben die Menschen nun einmal, bevor sie überhaupt an Krebs erkranken oder sich die Arterien verschließen konnten.
Vom 19. Jahrhundert an wurden die Menschen älter. Die Ursache dafür liegt in einer bemerkenswerten Entwicklung, die in dieser Periode in der westlichen Welt einsetzte und die für die moderne Chirurgie mehr Bedeutung haben sollte als jede große Entdeckung oder jeder berühmte Chirurg: Der Mensch wurde reinlicher. Die Chirurgie hat sich dadurch sogar so radikal verändert, dass es fast erstaunlich ist, dass der Name des Fachs der gleiche geblieben ist.
Es lässt sich schwer erklären, warum es so lange gedauert hat, bis Hygiene und Chirurgie eine Verbindung miteinander eingingen. In einem Operationssaal des 18. Jahrhunderts würden wir uns zu Tode erschrecken. Das Geschrei muss markerschütternd gewesen sein, das Blut spritzte nur so in alle Richtungen, und der Gestank der versengten Amputationsstümpfe war wahrlich dazu angetan, Brechreiz zu erregen – wie in einem gruseligen Horrorfilm. Bei einer modernen Operation riecht es frisch nach Desinfektionsmittel, das bisschen Blut, das der Patient verliert, wird sauber abgesaugt, man kann sich in normaler Lautstärke verständigen, und im Hintergrund sind nur der Herzschlag des betäubten Patienten auf dem Monitor und das eingeschaltete Radio zu hören. Der eigentliche große Unterschied zwischen der damaligen und der heutigen Situation ist allerdings viel subtiler und für einen Außenstehenden nicht einmal sofort erkennbar. Er liegt in den leisen Regeln der Sterilität; sie bilden das Fundament der modernen Chirurgie.
Unter »steril« versteht man in der Chirurgie »völlig frei von Bakterien«. Unsere Operationskittel, Handschuhe, chirurgischen Instrumente und Materialien werden allesamt sterilisiert, das heißt vollkommen von Bakterien und anderen Krankheitserregern befreit. Dazu werden sie stundenlang in einem Autoklav, einer Art Schnellkochtopf, unter hohem Druck mit Dampf behandelt oder mit Gammastrahlen bestrahlt. Während einer Operation lassen wir eine panische Präzision walten. Um die Operationswunde legen wir eine sterile Zone an, aus der heraus nichts und niemand mit etwas oder jemandem außerhalb dieser Zone in Berührung kommen darf. Gehört man zum Team, dann »bleibt man steril«, das bedeutet, man trägt Operationskleidung und Handschuhe, die absolut frei von Bakterien sind. Um diesen Zustand gewährleisten zu können, muss eine strikte Choreografie beim Anziehen der Jacke und der Handschuhe sowie beim Herumgehen um den Patienten eingehalten werden: Man hält seine Hände immer oberhalb des Gürtels, schaut sich gegenseitig an, wenn man aneinander vorbeigeht, dreht sich ganz um, wenn man seine Jacke zuknöpft, und kehrt dem Patienten nie den Rücken zu. Um die Bakterienmenge in einem Operationsaal weiter einzudämmen, trägt jeder eine OP-Haube und einen Mundschutz, beschränkt man die Zahl der Anwesenden und hält die Tür möglichst geschlossen.
All diese Maßnahmen haben zu einem klar erkennbaren Resultat geführt. Früher war es ganz normal, dass spätestens drei Tage nach einer Operation Eiter aus der Wunde floss. Ein dummer Chirurg, der das nicht wusste. Daher musste man die Operationswunde offen halten, damit der Eiter leicht abfließen konnte. Erst unter sterilen Bedingungen wurde es möglich, die übliche Wundinfektion zu vermeiden; nun konnten die Operationswunden am Ende eines Eingriffs zum ersten Mal geschlossen werden. Nicht nur die Hygiene ist also neu in der Chirurgie, auch das Verschließen von Wunden ist eine ziemlich moderne Entwicklung.
Was für Menschen sind Chirurgen eigentlich? Wie kommt man dazu, anderen Menschen den Leib aufzuschneiden, selbst wenn sie es nicht spüren können? Wie kann man ruhig schlafen, wenn ein Patient nach der Operation um sein Leben ringt? Wie nimmt man den Faden wieder auf, wenn ein Patient unter dem Messer gestorben ist, auch wenn man selbst keinen Fehler gemacht hat? Sind Chirurgen durchgeknallt, brillant, gewissenlos? Sind sie Helden oder Aufschneider? Das Fach liegt in einem Spannungsfeld. Operieren ist schön, aber die Verantwortung wiegt bleischwer.
Ein Chirurg wird buchstäblich Teil der Behandlung seines Patienten. Seine Hände und seine Geschicklichkeit sind schließlich die Instrumente, mit denen er den Patienten behandelt. Gerade wenn sich Probleme ergeben, sollte er sich daher seiner Sache sicher sein. Denn dann stellt sich ihm die Frage: War mein Anteil an der Behandlung ausschlaggebend, oder habe ich richtig gehandelt und es lag an etwas anderem? Der Verlauf einer Krankheit ist niemals gewiss, wie gut die Behandlung auch sein mag. Denn auch im Krankheitsverlauf selbst können noch Probleme entstehen. Gleichwohl muss man als Chirurg den Verlauf vor sich selbst rechtfertigen können, viel stärker als die Ärzte, die nicht mit ihren eigenen Händen eingreifen. »Habe ich mein Bestes gegeben, habe ich es richtig gemacht?«, ist eine ständige selbstkritische Frage, die die meisten Chirurgen hinter einer selbstsicheren Ausstrahlung verbergen. Diese Haltung hat das Bild des Chirurgen zu allen Zeiten geprägt: omnipotent und unantastbar. Doch auch bei dem selbstsichersten Chirurgen ist dieses Äußere nur Fassade, eine Möglichkeit, die Verantwortung zu tragen und das ständig lauernde Schuldgefühl auf Distanz zu halten. Einfach weitermachen lautet das Motto.
Jeder Chirurg hat, auch wenn er keinen Fehler begangen hat, Patienten durch sein Messer verloren. Darüber muss ein Chirurg hinwegkommen können, denn nicht einmal fünf Minuten später kann schon der nächste Patient vor ihm stehen. Die Situation lässt sich vielleicht mit der eines Lokführers vergleichen, der jemanden überfährt, ohne etwas dagegen tun zu können. Trotzdem muss er weiter Züge fahren. Das sind dramatische Ereignisse, die sich je nach den Umständen und dem Anlass der Operation mehr oder weniger leicht verarbeiten lassen. Hatte der Patient Krebs oder handelte es sich um einen Unfall, dann hatte man keine andere Wahl, als zu operieren. Handelte es um eine elektive Operation, einen Eingriff, für den es eine nichtchirurgische Alternative gab, oder um eine Operation bei einem Kind, kann man den Verlust vor sich selbst viel schwerer rechtfertigen.
Die eigene Erfahrung spielt natürlich auch eine Rolle. Hat man einen Eingriff erst fünf- oder schon fünfhundertmal durchgeführt? Jedes Operationsverfahren hat eine sogenannte Lernkurve, das heißt, bei den ersten Operationen besteht noch ein höheres Komplikationsrisiko, das erst mit zunehmender Erfahrung des Operateurs abnimmt. Doch jeder Chirurg muss seine eigene Lernkurve durchlaufen, das lässt sich nicht vermeiden. War das meinen ersten Patienten klar, als ich als Chirurg angefangen habe? Der Chirurg Charles-François Félix de Tassy war sicher nicht der Geringste seiner Zunft, doch eine Fistel am After hatte er noch nie operiert, als ihn Ludwig XIV. deswegen konsultierte. Er erbat sich vom König ein halbes Jahr Zeit, in der er den Eingriff zunächst bei 75 nicht näher bezeichneten Patienten durchführte, bevor er sich an die Fistel Ludwigs heranwagte. Wie seine Lernkurve wohl ausgesehen hat?
Auch physisch muss man als Chirurg einiges aushalten. Man arbeitet stundenlang unter Stress und Zeitdruck, meistens im Stehen und ohne festgelegte Pausen, schiebt Nachtdienste und arbeitet morgens einfach weiter, schreibt Entlassungsbriefe, bildet angehende Chirurgen aus, hat eine leitende Funktion, sollte freundlich bleiben, muss schlechte Nachrichten überbringen, Hoffnungen machen, immer alles aufschreiben, was man sagt und tut, alles ausführlich genug erklären – und darf doch den nächsten Patienten nicht zu lange im Wartezimmer warten lassen.
Clogs, Haube und Mundschutz
Ein moderner Chirurg zieht sich regelmäßig um. Im Krankenhaus trägt er einen weißen Arztkittel. Im OP-Trakt zieht er eine saubere blaue oder grüne Operationskleidung an, trägt weiße Clogs und eine Operationshaube. Im Operationssaal selbst trägt er außerdem einen Mundschutz. Und beim Operieren hat er über der Operationskleidung einen sterilen Operationskittel und sterile Gummihandschuhe an. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte man, dass Krankheitserreger auch über winzige Speicheltropfen in der Luft verbreitet werden können. Chirurg Johann von Mikulicz aus Breslau beschloss daraufhin, nicht nur während der Operation möglichst wenig zu reden, sondern auch einen Schutz vor dem Mund zu tragen. Das Tuch, das man sich damals vorband, diente wohl vor allem dazu, den Bart der Chirurgen zu bedecken. Auf jeden Fall hatte man sich laut Mikulicz schnell daran gewöhnt, und das Atmen durch den Mundschutz fiel leichter als gedacht. Er schrieb darüber 1897 im Centralblatt für Chirurgie: »Wir atmen dadurch ebenso leicht wie eine Dame, die auf der Straße einen Schleier trägt.« Die Aidsepidemie hat dazu beigetragen, dass heute viele Chirurgen während ihrer Operationen auch eine Schutzbrille tragen. Sie lässt sich manchmal schwer mit dem Mundschutz kombinieren. Eine Brille beschlägt nämlich beim Atmen, wenn der Mundschutz an den Wangen oder der Nase nicht gut anliegt. Für Präzisionsoperationen werden Lupenbrillen verwendet, manchmal mit einer Stirnlampe. Das lästigste Kleidungsstück ist die Bleiweste, die unter der Operationsjacke getragen werden muss, wenn während der Operation Röntgenstrahlen zum Einsatz kommen. Das Ding ist eben bleischwer, und darunter wird einem glühend heiß.
Zum Glück werden die Misserfolge von der Dankbarkeit der Patienten oder Angehörigen aufgewogen. Zudem steht der harten Arbeit das große Vergnügen des Operierens gegenüber. Die Durchführung einer Operation ist eine komplexe Angelegenheit, doch sie macht auch Freude. Die meisten Handlungen eines Operateurs sind ziemlich elementar und werden uns schon im Kindergarten beigebracht: schneiden, kleben und immer schön innerhalb der vorgegebenen Linien bleiben. Wenn ich als Kind nicht mit Legosteinen gespielt oder nicht gern gebastelt hätte, hätte ich wohl zum Chirurgen nicht getaugt.
Neben der Dankbarkeit der Patienten und der Freude am Operieren gibt es noch etwas anderes, was die Chirurgie so spannend macht: die Suche danach, was dem Patienten fehlt. Das Aufspüren des zugrundeliegenden Problems und die Diskussion mit den Kollegen über die beste Lösung bieten eine willkommene Ablenkung von den Sorgen um den Patienten.
Wahrscheinlich wirkt das alles für Menschen, die nichts mit Chirurgie zu tun haben, wie etwas Magisches: die Verantwortung, die Geschicklichkeit, die Energie und das Wissen eines Arztes, der mit seinen eigenen Händen einen anderen Menschen retten kann. Daher wird über die Geschichte der Chirurgie meistens mit Ehrfurcht vor den Chirurgen geschrieben – als ob jeder Einzelne von ihnen ein Held gewesen wäre, der allen Widrigkeiten und ungünstigen Arbeitsbedingungen zum Trotz seinen Mitmenschen mit dem Messer zu helfen versuchte. Oft ist dieses Bild falsch. Chirurgen waren nicht selten gleichgültig, naiv, fies, grob oder auf Geld oder Ruhm erpicht. Schließlich sind sie auch nur Menschen wie alle anderen. Aber nicht selten waren die Chirurgen, die Geschichte geschrieben haben, respektabel, erfindungsreich, energisch, mitfühlend und einfach geschickt.
In diesem Buch versuche ich, als Chirurg kritisch und ohne magische Verklärung die Geschichte meines Fachs anhand berühmter Patienten, berühmter Chirurgen und erstaunlicher Operationen zu erzählen. Das ist nicht einfach, denn die Chirurgie ist nicht nur ein interessantes und spannendes, sondern vor allem auch ein sehr technisches Fach. Sie befasst sich mit den komplexen Details von Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers, und dazu gehört ein Jargon, der für Außenstehende nahezu unverständlich ist. Leser, die keine Chirurgen sind, werden zum Beispiel keine Vorstellung davon haben, was unter einem »akuten Aneurysma der Aorta abdominalis«, einer »Sigmoidperforation« oder einer »B-II-Resektion« zu verstehen ist. Nicht von jedem kann man erwarten zu wissen, was ein »perkutaner Zugang«, ein »Laryngoskop« oder ein »subphrenischer Abszess«, ein »Stadium T1N0M0 malignes Melanom« oder eine »Hartmann-Resektion« ist. Solche chirurgischen Begriffe müssen daher so erklärt werden, dass jeder den Clou der jeweiligen Geschichte verstehen kann. Und so sind es Geschichten geworden, die nicht allein von der Historie der Chirurgie handeln, sondern auch davon, wie unser Körper aufgebaut ist und was ein Chirurg mit ihm anstellen kann.
Einige chirurgische Begriffe lassen sich nicht einfach übersetzen und bedürfen daher einer Erklärung. Das lateinische Wort Inzision bedeutet Schnitt, wörtlich: Ein-schnitt, und Resektion bedeutet Entfernung. Ein Trauma ist eine von außen zugefügte Verletzung oder Wunde (ein Trauma kann auch psychisch sein, etwa wenn jemand nach einem schrecklichen Erlebnis ein Trauma zurückbehält, aber das ist in der Chirurgie nicht gemeint). Traumatisch heißt, etwas wird zerstört. Das Wort Indikation bedeutet in der Chirurgie »der Grund für eine Operation«, und eine Komplikation ist eine ungewollte Verwicklung oder Schwierigkeit.
Die verschiedenen Kapitel bieten keine komplette Übersicht über die Entstehungsgeschichte der Chirurgie, aber sie können einen Eindruck davon vermitteln, worum es in der Chirurgie ging und heute noch geht. Was ist Chirurgie? Welche Bedeutung hatte sie früher? Wie funktioniert eine Operation? Wen oder was braucht man dazu? Wie reagiert ein Körper auf das Eindringen eines Messers, einer Bakterie, einer Krebszelle oder einer Kugel? Was passiert bei einem Schock und was bei einer Krebserkrankung, einer Wund- oder Knochenheilung? Was lässt sich durch eine Operation reparieren und was nicht? Wie geht man bei der Rettung eines Menschenlebens genau vor? Woher stammen die gängigsten Operationen, und wer hat sie erfunden?
In den meisten Kapiteln geht es um Operationen berühmter Persönlichkeiten und überraschende Fakten. Wussten Sie zum Beispiel, dass Albert Einstein viel länger gelebt hat, als man es eigentlich für möglich gehalten hatte? Dass Houdini seine letzte Vorstellung mit einer akuten Blinddarmentzündung gegeben hat? Dass englische Könige am liebsten in ihrem eigenen Schloss operiert wurden, dass Kaiserin Sissi mit sechzig Jahren niedergestochen wurde oder dass John F. Kennedy und Lee Harvey Oswald von demselben Chirurgen operiert wurden? Wussten Sie, dass man Sie unter Strom setzt, wenn Sie operiert werden, und dass sich Chirurgen erst seit 150 Jahren vor Operationen ihre Hände waschen?
Einige der Geschichten liegen mir besonders am Herzen. Die von Jan de Doot, dem Amsterdamer mit dem Blasenstein, weil ich selbst auch in Amsterdam lebe, gar nicht mal so weit von dem Ort entfernt, an dem er sich den Stein selbst aus der Blase geschnitten hat; die Geschichte von den fresssüchtigen Päpsten, weil Operationen gegen gravierendes Übergewicht zu meinem Spezialgebiet gehören; die Geschichte des Schahs von Persien, weil seine charmante Witwe einmal kurz meine Patientin war; die Geschichte von Pieter Stuyvesant, weil ich einige Jahre als Chirurg auf der schönen Insel Sint Maarten gearbeitet habe, und auch die Geschichte zur Bauchspiegelung, weil ich damals als Assistenzarzt mit dabei war, als mein Chef zum ersten Mal in der Geschichte die Telechirurgie einsetzte. Und schließlich hat es vor langer Zeit einen anderen Chirurgen in Amsterdam gegeben, der auch ein Buch über verschiedene Beobachtungen aus der chirurgischen Praxis geschrieben hat. Das war Nicolaes Tulp, jener Mann, der von Rembrandt in dem Gemälde »Die Anatomie des Doktor Tulp« verewigt worden ist. Er hat seine Observationes Medicae mit einem Kapitel über einen Schimpansen abgeschlossen. Und gleichsam in der Nachfolge dieses großen Amsterdamer Kollegen des Goldenen Zeitalters handelt auch mein letztes Kapitel von einem besonderen Tier.
Tulp hat sein Buch seinem Sohn gewidmet. Ich widme mein Buch meinen Kindern Viktor und Kim, die ich so oft abends oder am Wochenende allein lassen muss, um im Krankenhaus wieder einmal jemanden zu operieren.
Arnold van de Laar,
Chirurg in Amsterdam 2014
1. LITHOTOMIE
Der Stein von Jan de Doot: ein Schmied in Amsterdam
Jan Jansz. de Doot mit seinem Blasenstein und seinem Messer, auf dem Gemälde von Carol von Savoyen (mit Dank an das Anatomische Museum des Medizinischen Zentrums der Universität Leiden).
»Aeger sibi calculum praecidens«, wörtlich übersetzt »ein Kranker, sich selbst einen Stein von vorn schneidend«. So merkwürdig lautet ein Kapitel im Buch des Nicolaes Tulp, Meisterchirurg und Bürgermeister von Amsterdam im 17. Jahrhundert. Tulp beschreibt in seinem Werk die verschiedenartigsten Anomalien und Kuriositäten, die ihm in seiner Praxis als Amsterdamer Chirurg begegnet sind: einen »Schluckauf, der zwölf Tage währte«, »das Absterben eines Daumens nach einem Aderlass«, »eine seltsame Ursache für beschwerliche Atmung«, »eine schwangere Frau, die 1400 Salzheringe aß«, »das Durchbohren eines Hodensacks«, »tägliches Urinieren von Würmern«, »Schmerzen am Anus vier Stunden nach dem Stuhlgang«, »Filzläuse« und schauerlicherweise auch »eine mittels Eisen herausgebrannte Hüfte«. Sein in lateinischer Sprache verfasstes Buch Observationes Medicae richtete sich speziell an Kollegen, an Wundärzte und Mediziner. Doch Tulps Beobachtungen wurden ohne sein Zutun ins Niederländische übertragen und unter medizinischen Laien überraschenderweise zu einem Bestseller. Von all den Merkwürdigkeiten schätzte man seine Schilderung des Schmiedes Jan de Doot, der sich einen Blasenstein selbst herausgeschnitten hatte, wohl am meisten, denn der Schmied ist nach vollbrachter Aktion auf der Titelseite abgebildet.
Dem großen Tulp muss der Bericht seines Mitbürgers allerdings die Schamesröte ins Gesicht getrieben haben. Hatte der Schmied doch all sein Vertrauen in Tulps Berufsstand verloren und das Heft selbst in die Hand genommen. Unerträglich lange hatte de Doot unter den Qualen eines Blasensteins gelitten. Zweimal bereits hatte er dem Tod ins Auge gesehen, als er einen Chirurgen seinen Stein hatte schneiden lassen, denn beide Male war der Eingriff misslungen. Die Operation heißt Lithotomie, was Steinschnitt bedeutet. Die Mortalität dieses Eingriffs – das heißt: die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen der Operation zu sterben – betrug in jenen Tagen vierzig Prozent. Das wichtigste Attribut einer erfolgreichen Steinschneiderpraxis war daher ein gutes Pferd, um schnell das Weite suchen zu können, bevor man von den Angehörigen des Patienten zur Rechenschaft gezogen wurde. Es verstand sich von selbst, dass das Fach des Steinschneidens, ebenso wie das des Zahnziehers und Starstechers, zu den reisenden Berufsständen gehörte. Das Gute war, dass sich auch im nächsten Dorf gewiss ein paar arme Tröpfe fanden, die solche Qualen litten, dass sie das Risiko einzugehen bereit waren und sogar dafür zahlten.
Zweimal hatte sich de Doot der vierzig Prozent hohen Wahrscheinlichkeit zu sterben gestellt, statistisch gesehen also sogar eine 64-prozentige Sterbewahrscheinlichkeit überlebt! Dass Jan de Doot noch lebte, war also entweder pures Glück oder aber der hellen Panik geschuldet, die ihn dazu veranlasst hatte, sich jeweils mitten in der Operation dem Griff der Assistenten zu entwinden und den Steinschneidern zu entfliehen, bevor diese ihr Werk vollenden konnten.
Die Beschwerden waren stark, die Schmerzen heftig und die Nächte schlaflos. Blasensteine hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Sie sind schon in alten Mumien entdeckt worden, und der Steinschnitt wird bereits in der Antike erwähnt. Blasensteinschmerzen gehörten wie Krätze und Durchfall zu den gängigen Leiden und waren so allgegenwärtig, dass man sie mit heutigen Alltagsbeschwerden wie Kopfweh, Rückenschmerzen oder Darmkrämpfen vergleichen kann.
Blasensteine entstehen durch Bakterien, sie hatten damals also unmittelbar mit einem Mangel an Hygiene zu tun. Es ist ein Irrtum anzunehmen, Urin sei von Natur aus schmutzig. Unter normalen Umständen ist die gelbe Flüssigkeit von ihrem Ursprung in den Nieren bis zum Abfluss über die Harnröhre vollkommen frei von Krankheitserregern. Normalerweise sind im Urin keine Bakterien. Doch sind sie einmal in die Blase gelangt, können sie eine Entzündung hervorrufen, durch die sich ein Konkrement oder Blasengrieß entwickeln kann, was anfangs, solange die Partikel noch so klein sind, dass sie ausgeschieden werden, nicht spürbar ist. Mehrere aufeinanderfolgende Blaseninfektionen können den Blasengrieß jedoch so vergrößern, dass er nicht mehr mit dem Urin ausgeschwemmt werden kann. So wächst er zu einem echten Stein heran. Und hat sich in der Blase ein Stein gebildet, der nicht mehr ausgeschieden werden kann, wird er seinerseits zur Ursache weiterer Blaseninfektionen. Hatte man also erst einmal einen Stein, wurde man ihn nie wieder los. Blasensteine vergrößern sich bei jeder Blaseninfektion, sie bestehen daher typischerweise aus mehreren Schichten, wie eine Zwiebel.
Warum aber bildete sich bei den Menschen im Goldenen Zeitalter der Niederlande so oft ein Blasenstein? Und warum geschieht es heutzutage nur noch selten? Amsterdamer Häuser waren kalt, zugig und feucht. Der Wind blies durch die Ritzen der Fensterrahmen, die Backsteinmauern waren wegen der aufsteigenden Feuchtigkeit immer klamm, und der Schnee drang unter der Haustür hindurch in die Innenräume. Dagegen ließ sich auch mit Heizen kaum etwas ausrichten. Unsere Vorfahren trugen daher Tag und Nacht immer dicke Kleidung. Die Porträts von Rembrandt van Rijn zeigen Menschen mit Pelzjacken und Mützen. Im 17. Jahrhundert lebten die Niederländer wie die Eskimos, allerdings mit dem großen Unterschied, dass sie nicht täglich in sauberem Wasser baden konnten. In den Grachten trieben tote Ratten und menschliche Fäkalien, und Gerber, Bierbrauer und Färber kippten ihre giftigen Abfälle hinein. Die Grachten des Jordaan-Viertels waren die Verlängerung vieler kleiner schlammiger Kanäle, durch die der Kuhmist aus den Weiden der Umgebung langsam zur Amstel hinfloss. Hier konnte man weder ein anständiges Bad nehmen noch seine Unterhosen waschen. Und Toilettenpapier gab es leider auch noch nicht.
So waren die Leisten, Gesäßspalten und Geschlechtsteile der dick bekleideten Menschen immer schmutzig. Die Harnröhre stellte für die Bakterien beim Eindringen in die Blase nur ein geringes Hindernis dar. Das beste Mittel gegen diesen äußeren Angriff wäre es gewesen, sehr viel Wasser zu lassen, um die Harnwege und die Blase zu spülen. Dazu muss man viel trinken. Doch auch diese Möglichkeit gab es nicht. Das Wasser aus der Pumpe eignete sich nicht ohne weiteres. Die sicherste Methode bestand wohl darin, aus dem Wasser eine Suppe zu kochen. Nicht verderblich waren nur Wein, Essig und Bier. Schätzungen zufolge trank ein Niederländer um 1600 täglich durchschnittlich mehr als einen Liter Bier. Doch das galt natürlich nicht für Kinder. Blaseninfektionen entstanden folglich schon im Kindesalter, und so hatten die Steine ein Leben lang Zeit zu wachsen.
Eine Blasenentzündung bringt an sich schon drei üble Beschwerden mit sich: Pollakisurie, häufiges Wasserlassen, Algurie, Schmerzen beim Urinieren, und Urge, ständigen Harndrang. Da Tulp die Tat von Jan de Doot als ein unerhörtes Husarenstück beschrieben hat, muss jenem die Blase schon entsetzlich zugesetzt haben, bevor er die Courage aufbrachte, sich selbst aufzuschneiden. Welche über eine normale Blasenentzündung hinausgehenden Schmerzen, die den Schmied in den Wahnsinn trieben, verursachte ihm der Stein?
Am Ausgang der Blase, unten in der Nähe der Harnröhre, liegt eine Art Drucksensor. Wird dieser Bereich durch eine volle Blase gereizt, entsteht normalerweise das Gefühl, Wasser lassen zu müssen. Doch auch ein Stein, der auf dem Blasenboden liegt, kommt mit dieser Region in Kontakt, so dass man einen ständigen Harndrang verspürt, ob die Blase nun voll ist oder nicht. Und will man sich dann erleichtern, verschließt der Stein durch das Pressen den Blasenausgang, so dass fast kein Urin herauskommt. Zudem verstärkt sich der Druck des Steins und verursacht einen noch intensiveren Reiz und stärkeren Harndrang. Man presst noch mehr, noch weniger tröpfelt heraus, der Reiz nimmt zu und der Drang verstärkt sich – es ist zum Verrücktwerden. Von Kaiser Tiberius wird berichtet, er habe das Abbinden des Penis, das natürlich ähnliche Leiden hervorruft, als Foltermethode angewandt. Wenn jemand Tag und Nacht, bei voller wie bei leerer Blase, solche Schmerzen erleiden musste, was kümmerte ihn dann eine vierzigprozentige Mortalität?
Hippokrates und die Steinschneider
Im Eid des Hippokrates rufen junge Ärzte die Götter an und versprechen ihnen einiges. Dabei geht es im Wesentlichen um vier Grundprinzipien ihres Fachs: die Bemühensverpflichtung (immer sein Bestes für alle Kranken tun), das Berufsethos (Respekt und Kollegialität), das Berufsgeheimnis (Privatsphäre und Diskretion) und den allumfassenden Grundsatz primum non nocere (vor allem nicht schaden). Hippokrates’ Auffassung nach erfüllten die Steinschneider diese Bedingungen nicht. Eindringlich beschwor er den Arzt in seinem Eid, das Steinschneiden anderen zu überlassen. Heute wird diese spezifische Passage als eine Aufforderung zur Spezialisierung interpretiert (überweise deine Patienten an einen Spezialisten, wenn du das Verfahren nicht selbst beherrschst), aber das ist eigentlich Unsinn. Hippokrates hat durchaus gemeint, was er geschrieben hat. Mit seiner Mahnung verbannte er die Steinschneider aus der Medizin, rechnete sie also zur Meute der Zahnzieher, Wahrsager, Giftmischer und anderer Scharlatane. Das war zu seiner Zeit sicherlich berechtigt. Denn auch wenn ein Blasenstein einem Menschen das Leben sehr vergällen konnte, war er an sich doch nicht tödlich, während das Risiko, an einem Steinschnitt zu sterben, vermutlich größer war als die Chance, nach Entfernen des Steins mit dem Leben davonzukommen. Mittlerweile haben sich die Operationsrisiken gewiss um ein Hundertfaches verringert. Daher ist die Furcht vor einer chirurgischen Lösung selbst bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen nicht mehr gerechtfertigt. Von sicheren chirurgischen Eingriffen, die nicht nur dazu dienen, Leben zu retten, sondern auch die Lebensqualität erhöhen, konnte Hippokrates aber nur träumen.
So wie Blasensteine schon in der Antike vorkamen, gab es auch früh Menschen, die sich mit dem Herausschneiden von Steinen befassten. Bereits im fünften vorchristlichen Jahrhundert erwähnt der Grieche Hippokrates in seinem Eid das Metier des Steinschneiders. Dieser Eid erwähnt all das, was ein guter Arzt leisten soll. Den Steinschneider führt Hippokrates als Beispiel dafür an, was einem Arzt gerade nicht erlaubt sei, denn er dürfe keinesfalls gegen das Grundprinzip der Medizin verstoßen: durch sein Handeln das Leiden wenigstens nicht zu verschlimmern. Dass der Urvater der Medizin diesen Verstoß gegen die Regel so explizit benennt, macht deutlich, welch grauenhafte Verwüstungen die Steinschneider schon bei den alten Griechen hinterlassen haben mussten.
Wer noch nie einen Blasenstein hatte, wird sich nur schwer vorstellen können, wo man das Messer ansetzen muss, um ihn herauszuschneiden. Weil ein Stein, der den Blasenausgang blockiert, durch das Pressen nach unten gedrückt wird, wird ein Leidender wie Jan de Doot allerdings haargenau gespürt haben, dass man ihn am ehesten von unten, zwischen Anus und Skrotum, zu fassen bekam. Diese Region wird Perineum genannt. Wer mit der Anatomie des menschlichen Körpers vertraut ist, würde den Schnitt niemals dort unten ansetzen, da Blutgefäße und Schließmuskeln zu dicht daneben liegen. Einfacher wäre es wohl, von oben an die Blase heranzukommen, doch hier liegt der Bauch mit den Gedärmen wiederum gefährlich nahe. Weil die Steinschneider aber keine Anatomen waren, sondern geschickte Kerle mit wenig Sachverstand, schnitten sie von unten direkt auf den Stein zu, ohne besondere Rücksicht darauf zu nehmen, welchen Schaden sie möglicherweise der Blase zufügten. Die meisten Opfer, die den Eingriff eines Steinschneiders überlebten, wurden inkontinent.
Zu Jan de Doots Zeiten kannte man zwei Arten des Steinschnitts. Die »kleine« Operation mit dem apparatus minor, der kleinen Gerätschaft, und die »große« Operation mit dem apparatus major, der großen Gerätschaft. Die kleine Operation wurde im ersten nachchristlichen Jahrhundert von dem römischen Enzyklopädisten Aulus Cornelius Celsus zum ersten Mal beschrieben, nachdem sie zuvor schon jahrhundertelang praktiziert worden war. Das Prinzip dieser kleinen Operation ist einfach. Zunächst legt sich der Patient auf den Rücken und hebt beide Beine an. Eine Haltung, die auch heute noch als Steinschnittlage oder Lithotomie-Position bezeichnet wird. Dann steckt der Steinschneider seinen linken Zeigefinger in den Anus des Patienten. So kann er an der Vorderseite des Enddarms den Stein in der Blase ertasten. Er zieht ihn mit dem Finger zu sich heran, also in Richtung des Perineums, bittet den Patienten – oder eine andere Person –, den Hodensack hochzuhalten, und schneidet dann mit einem Messer zwischen Hodensack und Anus quer bis zum Stein. Anschließend lässt er den Patienten den Stein herauspressen. Der Steinschneider kann ihn dabei unterstützen, indem er ihm auf den Bauch drückt oder mit einem Haken nach dem Stein angelt. Ist bis dahin alles gelungen, muss er den Patienten nur noch vor dem Tod durch Verbluten retten, indem er die Wunde möglichst lange fest abdrückt.
Dieser Eingriff ließ sich nur bei Männern bis zu einem Alter von etwa vierzig Jahren durchführen. Denn ungefähr in diesem Alter schwillt eine Drüse an, die den Steinschneidern im Wege stand. Da sie, was die Lage des Steins anbetrifft, »davor steht«, lateinisch wörtlich pro-status, wird sie Vorsteherdrüse oder Prostata genannt.
1522 beschrieb Marianus Sanctus Barolitanus die »große« Operation, eine von seinem Meister Giovanni Romani aus Cremona neu entwickelte Methode. Statt den Stein zum Instrument hinzudrängen, brachte man bei diesem Eingriff die Instrumente zum Stein. Für die nach ihm benannte »Marianische Methode« brauchte man eine Vielzahl von Instrumenten, daher ist sie auch mit dem Begriff apparatus major verknüpft. Der Anblick der vielfältigen metallenen Werkzeuge war für die Patienten häufig schon Ursache genug, in Ohnmacht zu fallen – oder es sich doch noch anders zu überlegen. Auch die große Operation wurde in Steinschnittlage ausgeführt, der Hodensack konnte dabei aber normal herunterhängen. Man führte ein gebogenes Stäbchen durch den Penis bis in die Blase ein. Dann schnitt man mit einem Messer vertikal auf der Mittellinie des Perineums, zwischen Penis und Skrotum auf das Stäbchen zu. Durch die Wunde brachte man bis in die Blase das »Gorgeret« ein, ein rinnenförmiges Instrument, durch das hindurch man den Stein mit Spreizern, Zangen und Haken in Bruchstücken entfernen konnte. Der Vorteil dieser großen Operation bestand gerade darin, dass die Wunde kleiner war und das Risiko der Inkontinenz geringer.
De Doot standen all diese komplizierten Instrumente nicht zur Verfügung, daher hielt er seinen Eingriff notgedrungen einfach. Er gebrauchte nur ein Messer und führte die »kleine« Operation mit einer großen, quer geführten Inzision aus. Das Messer hatte der Schmied heimlich selbst angefertigt. Bevor er zur Tat schritt, hatte er – was sicherlich kein Fehler gewesen war – seine (»völlig arglose«) Frau mit einer Ausrede zum Fischmarkt geschickt. Der Einzige, der bei seinem Eingriff am 5. April 1651 zugegen war, war sein Lehrjunge, der de Doots Skrotum hochhielt. Tulp schreibt, dass der Stein während der Prozedur mit der linken Hand festgehalten wurde, »scroto suspenso a fratre (der Hodensack wurde vom Bruder hochgezogen), uti calculo fermato a sua sinistra (so dass der Stein mit seiner Linken fixiert wurde)«. Aus diesem Küchenlatein lässt sich nicht entnehmen, wer von beiden den linken Zeigefinger in Jans Enddarm hatte. Wahrscheinlich versuchte Jan, alles selbst zu machen, während sein Assistent die »Operation« lediglich mit wachsendem Erstaunen verfolgte. Jan schnitt drei Mal, dennoch war die Wunde nicht breit genug. Daher steckte er beide Zeigefinger (also auch den linken) in die Wunde und riss sie weiter auf. Er wird vermutlich kaum Schmerzen und Blutverlust erlitten haben, weil er durch die alten Narben der Operationen aus den vorangegangenen Jahren schnitt. Durch heftiges Pressen gelang es ihm schließlich mit viel Ach und Krach – nach Doktor Tulps Ansicht mit mehr Glück als Verstand –, den Stein herauszudrücken. Dieser fiel zu Boden, war größer als ein Hühnerei und vier Unzen schwer. Der Stein ist mit Jans Messer in Tulps Buch auf einem Stich verewigt worden. Die Abbildung lässt auf dem eiförmigen Gebilde deutlich eine Einkerbung in Längsrichtung erkennen, die wahrscheinlich von dem Messer herrührt.
Die Wunde war riesig. Sie musste schließlich doch von einem Wundarzt versorgt werden und eiterte und fistelte noch lange. Auf dem Porträt, dass Carol von Savoyen vier Jahre nach Jans Heldentat von ihm gemalt hatte, sieht man ihn stehend (nicht sitzend) mit einem säuerlichen Lächeln um den Mund und mit dem Stein und dem Messer in der Hand.
Der primitive Steinschnitt durch die Mitte des Perineums wurde kurz nach Jans Verzweiflungstat von anderen Methoden abgelöst, die jedoch immer noch mit großer Lebensgefahr verbunden waren. Im selben Jahr, in dem sich de Doot den Stein aus der Blase geschnitten hatte, war in Frankreich ein gewisser Jacques Beaulieu geboren worden. Quer durch Europa reisend, führte er unter dem Name Frère Jacques die »große« Operation von der Seite her aus. Mit diesem Verfahren machte er Anfang des 18. Jahrhunderts in Amsterdam Karriere. Sterblichkeit und Komplikationen verringerten sich, der Schnitt konnte noch etwas kleiner und die Extraktion des Steins präziser werden. 1719 führte John Douglas die erste sectio alta aus, einen »hohen Schnitt« durch den Unterbauch. Dieser Zugang war aufgrund einer Warnung des Hippokrates, dass eine Verletzung auf der Oberseite der Blase immer tödlich sein würde, tabu gewesen. Er hatte unrecht. Im 19. Jahrhundert wurde der Steinschnitt fast gänzlich durch die transurethrale Lithotripsie verdrängt, ein komplizierter Begriff für das Zertrümmern (Tripsie) des Steines (Litho) durch (trans) die Harnröhre (Urethra). Mit schmalen, ausklappbaren Zangen und Raspeln, die durch den Penis in die Blase geschoben wurden, wurde der Stein blind, ganz nach Gefühl, gepackt, in Stücke gezwackt und zerkleinert. 1879 wurde in Wien das Zystoskop erfunden, ein optisches Instrument, das durch die Harnröhre direkte Sicht in die Blase bot und das Ausräumen und Entfernen der Blasensteine sehr vereinfachte. Als wirkungsvollste Behandlungsmaßnahme erwies sich allerdings die Prävention. Die moderne Gewohnheit, sich täglich eine saubere Unterhose anzuziehen, hat mehr gegen diese Geißel der Menschheit ausgerichtet als jede neue Operationstechnik. Ein richtiger Steinschnitt wird heute daher nur noch selten durchgeführt, und durch das Perineum schneidet man eigentlich gar nicht mehr. Außerdem gehört die Operation heutzutage nicht in den Bereich der Chirurgie, sondern in das Spezialgebiet der Urologie.
Für jene, die dennoch nachempfinden wollen, wie sich eine Lithotomie zwischen den Beinen wohl angefühlt hat, hat der französische Komponist Marais 1725 die »große« Operation, der er sich selbst unterzogen hatte, von Anfang bis Ende musikalisch umgesetzt. Das Stück für Viola da Gamba in e-Moll heißt Tableau de l’opération de la taille. Es dauert drei Minuten und beschreibt in vierzehn Schritten die Operation aus der Perspektive des Patienten: den Anblick der Instrumente, das Erzittern, den zuversichtlichen Gang zum Operationstisch, das Besteigen desselben, das Absenken des Stuhls, das erneute Erwägen, das Sich-festbinden-Lassen auf dem Tisch, den Schnitt, das Einführen der Zange, das Ziehen des Steins, den Beinaheverlust der Stimme, das Fließen des Blutes, das Losgebunden- und das Zu-Bett-gebracht-Werden.
Jan de Doot hat landesweite Berühmtheit erlangt. Wahrscheinlich hielten ihn viele für verrückt. Schon einen Monat nach seiner Tat, am 31. Mai 1651, ließ er sie vom Notar Pieter de Bary in Amsterdam beglaubigen. Dieser notierte, dass »Jan de Doot, wohnhaft im Engelsche Steeg, Alter etwa 30 Jahre …«, auch ein Gedicht darüber verfasst habe, »mit seiner eigenen Hand geschrieben, gedichtet oder komponiert«.
Der stolze Schmied hatte geschrieben:
»Was staunet man im ganzen Land
über diese glücklich’ Hand?
Es ist zwar eines Menschen Tat,
geführet doch durch Gottes Rat,
der selbst noch in des Sterbens Not
das Leben wieder gab de Doot.«
Was hat de Doots Frau wohl gedacht, als sie mit ihren Einkäufen vom Markt zurückkam?
2. ASPHYXIE
Die Tracheotomie des Jahrhunderts: Präsident Kennedy
Beweisstück JFK F-58 in der Untersuchung zum Mord an Präsident Kennedy. Medizinische Zeichnung von Ida Dox mit Ein- und Ausschusswunde im Schädel, Tracheotomie an der Vorderseite und schematischer Darstellung der Luftröhre dahinter.
An einem Freitagmittag wird in der Notaufnahme eines Krankenhauses ein fünfundvierzigjähriger Mann mit einer klaffenden Schusswunde am Kopf eingeliefert. Blut und Gehirnmasse tropfen heraus. Schnell werden die anderen Patienten aus der Abteilung hinausbugsiert. Ein Pulk Menschen drängt aufgeregt mit dem Opfer in die Ambulanz, Journalisten müssen draußen bleiben. Die Ehefrau läuft neben der Trage her. Ihr Gesicht ist voller Blutspritzer. Sobald der Verletzte im Behandlungsraum ist, schließt sich die Tür. Der Patient ist nun allein mit einem Arzt und einer Krankenschwester, während seine Frau draußen auf dem Gang wartet.
Bei dem betreffenden Arzt handelt es sich um den diensthabenden Arzt Charles Carrico, 28 Jahre alt, Assistenzarzt der Chirurgie im zweiten Jahr. Er erkennt den Patienten sofort. Vor ihm liegt Präsident Kennedy, blutüberströmt, mit einem großen Loch im Kopf. Er ist bewusstlos und atmet kaum noch. Sein Körper macht langsame, einziehende Bewegungen. Er bekommt keine Luft! Carrico führt sofort einen Beatmungsschlauch durch den Mund ein. Mit einem Laryngoskop, einem hakenförmigen Instrument mit einer kleinen Leuchte, fährt er bis ganz nach hinten in die Mundhöhle, schiebt die Zunge zur Seite und öffnet dabei den Rachen so weit wie möglich, bis der Kehldeckel sichtbar wird. Mit etwas Glück sind darunter die Stimmbänder zu sehen, zwischen denen er den Plastikschlauch hindurchschiebt. Die Lungen brauchen dringend Luft, erst dann kann er sich um die anderen Verletzungen kümmern. Aus einer kleinen Wunde in der Mitte des Halses sickert langsam Blut. Die Tür öffnet sich, vom Gang her ist Lärm zu hören. Doktor Perry, der diensthabende Chirurg, betritt den Raum.
Bekanntermaßen überlebte der Patient nicht und starb noch in der Notaufnahme. Noch am selben Abend obduzierte Doktor Humes, Militärarzt und Pathologe, im weit entfernten Bethesda Naval Hospital in Washington, D.C., den eilig eingeflogenen Leichnam. Es war die Leichenschau des Jahrhunderts, dessen war er sich bewusst. Fehler durfte er sich nicht erlauben, zumal genug Leute dabei waren, die ihm auf die Finger schauten, Männer in dunklen Anzügen, von denen niemand so genau zu wissen schien, wer sie eigentlich waren. Vor ihm lag nicht irgendein toter Körper. Dieser Leichnam war zugleich das wichtigste Beweisstück für den genauen Tathergang, und der war staatlicherseits von höchstem Interesse. Sollte Humes nämlich nur aus einer Richtung kommende Schusswunden finden, konnte der Anschlag von einer Einzelperson, im besten Fall von einem verrückten Einzeltäter, verübt worden sein. Fand er aber Schusswunden aus unterschiedlichen Richtungen, musste es sich wohl um ein koordiniertes Attentat mehrerer Schützen gehandelt haben, schlimmstenfalls um einen Putschversuch.
Aber Humes hatte von Anfang an ein Problem. Auf den Röntgenfotos der Leiche waren keine im Körper verbliebenen Projektile zu erkennen. Alle Projektile mussten also den Körper mit einer Einschuss- und Ausschusswunde durchdrungen haben. Er fand aber keine gerade, sondern nur eine ungerade Anzahl von Schusswunden. Nämlich drei. Zwei von ihnen lagen eindeutig in gerader Linie zueinander, ein kleines Loch im Hinterkopf befand sich unmittelbar gegenüber einem großen Loch an der rechten Kopfseite. Das dritte Loch, eine kleine Schusswunde auf dem Rücken, saß rechts unterhalb des Nackens. Wegen seiner geringen Größe konnte es sich hierbei nur um eine Einschusswunde handeln, da Einschusswunden immer kleiner als Ausschusswunden sind. Doch auch die Ausschusswunde eines Hochgeschwindigkeitsgeschosses konnte eine solch geringe Größe haben. In beiden Fällen blieb jedoch die Frage nach der korrespondierenden Ausschuss- bzw. Einschusswunde offen. Sie war nirgends zu entdecken.
Vizepräsident Johnson war Kennedys Amtsnachfolger. Er wurde noch am gleichen Tag in demselben Flugzeug, in dem der gestorbene Kennedy von Dallas nach Washington zurückgeflogen worden war, als Präsident vereidigt. In einer ersten Amtshandlung, genau eine Woche nach Kennedys Tod, beauftragte er eine Kommission unter Leitung des obersten US-Bundesrichters Earl Warren mit der Untersuchung des Attentats. Vor der Warren-Kommission mussten auch die beteiligten Ärzte aussagen. Der Abschlussbericht der Kommission ist öffentlich zugänglich, und die Transkriptionen der Aussagen der Ärzte findet man heute im Internet. Daraus lässt sich Folgendes schließen:
John F. Kennedy ist, acht Minuten nachdem er in Dallas niedergeschossen worden war, im Schockraum Nr.1 der Notaufnahme des Parkland Memorial Hospital von der Krankenschwester Margaret Henchcliffe und dem chirurgischen Assistenzarzt Charles James Carrico in Empfang genommen worden. Letzterer führte ihm sofort einen Beatmungsschlauch ein und schloss ihn an das Beatmungsgerät an. In diesem Moment betrat der vierunddreißigjährige Malcolm Oliver Perry den Behandlungsraum. Er erkannte, genau wie Carrico, dass Kennedy im Begriff war zu ersticken. Perry sah sich die kleine Wunde am Hals an, aus der langsam Blut sickerte. Für eine Entscheidung blieben ihm wohl nur Sekundenbruchteile. Was war hier los?
Der Präsident war bewusstlos, doch sein Brustkorb hob und senkte sich noch langsam. Doch trotz des Beatmungsschlauchs waren es keine normalen Atembewegungen. Entweder saß der Schlauch nicht richtig, oder etwas anderes stimmte nicht. Litt der Präsident unter einem Pneumothorax – also einem Lungenkollaps – oder einem Hämatothorax, einer Blutansammlung in der Brusthöhle? Und was bedeutete diese Halswunde? Eine Verletzung der Luftröhre? Wenn Carricos Tubus richtig saß, warum entwichen dann keine Luftblasen durch die kleine Wunde? Und wenn der Schlauch nun doch nicht in der Luftröhre, sondern aus Versehen in der Speiseröhre steckte? Dann musste sofort gehandelt werden.
Perry nahm ein Messer und führte eine Tracheotomie durch – wörtlich einen »Luftröhrenschnitt«, einen Schnitt (tomie) durch den Hals bis in die Luftröhre (trachea), um den Lungen Luft zuzuführen. Durch den Schnitt kann eine Trachealkanüle, ein besonderer Beatmungsschlauch, nach unten in die Luftröhre geschoben werden. Dort jedoch, wo der Schnitt für die Tracheotomie gesetzt werden musste, in der Mitte des Halses unterhalb des Adamsapfels, direkt vor der Luftröhre, saß die kleine Schusswunde. Perry nutzte daher dieses Loch für seine Tracheotomie und verlängerte die Wunde mit seinem Messer horizontal nach beiden Seiten. So verschwand das Einschussloch, nach dem Humes später vergeblich suchte.
Nach Perry drängten bald zahlreiche andere Ärzte in den Schockraum Nr. 1. Die ersten beiden Chirurgen, die ihm folgten, Dr. Baxter und Dr. McClelland, halfen ihm sofort bei der Tracheotomie. Während sie die Trachealkanüle in die Luftröhre schoben, wurde an jeder Seite eine Thoraxdrainage gelegt, eine links und eine rechts. Bei einer Thoraxdrainage wird ein Plastikschlauch zwischen den Rippen, also quer durch die Brustwand, in die Brusthöhle eingebracht, um Luft oder Blut abzusaugen, je nachdem ob man es mit einer kollabierten Lunge oder einem Brustkorb voller Blut zu tun hat. Ein Anästhesist kümmerte sich um das Beatmungsgerät, die Herzaktivität wurde mit Hilfe eines EKG kontrolliert, und an den Armen wurden venöse Zugänge für Blut- und Flüssigkeitsinfusionen gelegt. Der Patient erhielt eine Blutinfusion der Blutgruppe O-negativ und Ringer-Laktat, eine Lösung aus Wasser und bestimmten Mineralien.
Am Kopfende inspizierte ein Neurochirurg, Dr. Kemp Clark, die Hirnverletzung. Weil er zufällig dort stand, wurde er gebeten, den Beatmungsschlauch aus dem Mund zu ziehen, damit Perry stattdessen die Trachealkanüle in die Luftröhre einführen konnte. Clark entdeckte dabei Blut im Rachen des Verletzten. Man schloss auch noch eine Magensonde an, einen Schlauch, der durch die Speiseröhre in den Magen führt. Trotz aller Anstrengungen, die Atemwege zu sichern, wurde die Atmung nicht besser. Der Präsident hatte mittlerweile aus der Kopfwunde Unmengen an Blut verloren. Eine Krankenschwester versuchte, die Wunde mit Gaze zuzudrücken. Die Ärzte sahen Blut und Hirnmasse auf dem Boden und auf der Liege. Dann setzte der Herzschlag aus. Clark und Perry begannen sofort mit der Herzmassage, aber dadurch strömte noch mehr Blut aus der Kopfwunde. Dr. Clark hatte schließlich den Mut, die Reanimation abzubrechen und um ein Uhr mittags, 22 Minuten nachdem der Präsident in das Krankenhaus eingeliefert worden war, seinen Tod festzustellen.
Kurz darauf gab es Unstimmigkeiten darüber, was nun mit dem Leichnam des Präsidenten geschehen sollte. Der Secret Service reklamierte ihn für sich und ließ ihn ins Militärkrankenhaus nach Washington bringen. Zwischen den Ärzten in Dallas und den Militärärzten fand keine Übergabe statt. So konnte eine Kontroverse über die Schusswunden entstehen und zum Anlass für hartnäckige Verschwörungstheorien werden. Perry und die zehn anderen Ärzte im Schockraum Nr. 1 in Dallas waren nämlich nicht mehr dazu gekommen, ihren Patienten umzudrehen und seine Rückseite zu untersuchen. Daher haben sie die kleine Wunde am Rücken nicht zu Gesicht bekommen. Direkt nach den schrecklichen Geschehnissen wurde Perry auf einer improvisierten Pressekonferenz von Journalisten überrumpelt. Er bezeichnete die Wunde am Hals als Einschusswunde, die von einer von vorne eindringenden Kugel verursacht worden sei. Deshalb ging die Presse in den ersten Stunden und Tagen nach dem Attentat von einem oder mehreren Schüssen von vorne aus, was natürlich mit der Verhaftung von Lee Harvey Oswald überhaupt nicht in Einklang zu bringen war. Der junge Mann war keine anderthalb Stunden nach dem Anschlag festgenommen und sofort zum Einzeltäter erklärt worden, obwohl er aus einer Position geschossen haben musste, die hinter Kennedy lag.
Das ABC der Notfallmedizin
Das Alphabet bietet sich im Englischen als medizinische Eselsbrücke in Notfallsituationen an. Es gibt an, was in welcher Reihenfolge bei einem akut gefährdeten Patienten untersucht und stabilisiert werden muss. A steht für airway: Die Atemwege müssen frei sein, sonst erstickt der Patient innerhalb weniger Minuten. Meistens muss dafür ein Beatmungsschlauch durch den Mund und zwischen den Stimmbändern hindurch in die Luftröhre eingeführt werden. Das nennt man Intubation. Wenn die Intubation aus irgendeinem Grund nicht gelingt, muss an der Vorderseite des Halses sofort die Luftröhre aufgeschnitten werden. Das nennt man Tracheotomie. Dabei darf man nicht zögern, denn jede Sekunde zählt: »When you think of tracheotomy, perform it!« (»Nicht drüber nachdenken – tun!«) So dringend und lebensrettend kann sie sein. B steht für breathing: Sorge für eine ausreichende Atmung, das heißt dafür, dass die Lungen Kohlendioxid abgeben und Sauerstoff aufnehmen können, zum Beispiel mit Hilfe eines Beatmungsgeräts. Der unzureichende Gasaustausch zwischen dem Blut und der Außenwelt verursacht zwei Probleme. Das Gehirn, das Herz und alle andere Organe leiden unter einem Sauerstoffmangel und drohen ihre Funktion einzustellen. Diesen Zustand nennt man Ischämie. Die Muskeln können sechs Stunden ohne Sauerstoff auskommen, das Gehirn jedoch noch keine vier Minuten. Außerdem sinkt der pH-Wert des Blutes, wenn das Kohlendioxid nicht ausgeatmet wird. Das saure Blut greift die Organe noch stärker an und beeinträchtigt den Blutkreislauf. Erst nach A und B kommt C für circulation: Stabilisiere den Kreislauf, lasse den Patienten nicht verbluten und kontrolliere Herz und Blutdruck. Und dann gibt es auch noch D und E.
Von Anfang an stand die Berichterstattung über das Attentat also im Widerspruch zum Autopsiebericht, und sofort entstand der Eindruck, dass etwas vertuscht werden sollte. Der Pathologe Humes erfuhr erst am nächsten Morgen, als Perry ihn in einem Telefonat darüber informierte, von der Schusswunde in der Luftröhre. Mit dieser Information war für ihn die Sache klar: Die Schusswunde im Rücken, eine Verletzung des oberen rechten Lungenflügels, die er in der Brusthöhle entdeckt hatte, und das Loch, durch das Perry die Tracheotomie geführt hatte, lagen genau auf einer Linie und passten zu einem Schuss von hinten, ebenso wie der Schuss durch den Kopf. Es waren also zwei Schüsse von hinten, das denkbar wünschenswerteste Ergebnis, es gab nur einen Täter, keinen Putschversuch, und damit hatte es sich. Dennoch hielten viele den spontanen Bericht des heldenhaften jungen Chirurgen, der die Wunden des noch lebenden Präsidenten mit eigenen Augen gesehen hatte, für glaubwürdiger als das Protokoll der angeordneten Autopsie, die mitten in der Nacht, und dann auch noch in einem Militärkrankenhaus, durchgeführt worden war.
Wie sich Kennedys Schusswunden erklären lassen, ist auf dem Amateurfilm von Herrn Zapruder zu sehen, einem Mann, der unter Höhenangst litt und mit Unterstützung seiner Sekretärin, Frau Sitzman, den Autokorso und damit zufällig auch das Attentat auf den Präsidenten haargenau festgehalten hat. Um besser sehen zu können, musste er sich auf ein Mäuerchen stellen. Während er filmte, hielt ihn seine Sekretärin an den Beinen fest. Die Aufnahme, die erst fünfzehn Jahre nach dem Attentat freigegeben wurde, zeigt jene Bilder, die inzwischen jeder kennt: die herumfliegenden Schädelteile des Präsidenten und seine verzweifelte Frau Jackie, als sie auf die Heckklappe des fahrenden Autos klettert. Weniger bekannt ist jedoch, was der Film fünf Sekunden vor dem Kopfschuss zeigt. Es fällt kaum auf. Plötzlich verkrampft sich Kennedys Gesicht. Er greift mit beiden Händen nach seinem Hals, niemand scheint etwas bemerkt zu haben. Während alle fröhlich lachen und winken, wirkt der Präsident, als wäre er im Begriff zu ersticken.
Das Folgende spielte sich ab. Die schreckliche Kopfwunde wurde von einem dritten Schuss verursacht. Der zweite Schuss traf Kennedy in den Rücken und ging unterhalb seiner Stimmbänder quer durch seine Luftröhre. Daher konnte er weder rufen noch schreien, und deshalb bemerkte auch niemand, dass er dabei war zu ersticken. Die Kugel trat an der Vorderseite seines Halses wieder aus und traf John Conally, den Gouverneur von Texas, der vor ihm im Wagen saß, in den Brustkorb, am rechten Handgelenk und am linken Oberschenkel. Diese Kugel sollte wegen ihrer vermeintlich bizarren Flugbahn als the magic bullet alias Warren Commission Exhibit Number 399 bekannt werden.
Eine Rekonstruktion, die auf der Grundlage von Zapruders Film vorgenommen worden war, zeigt jedoch, dass die Bahn der Kugel gar nicht so bizarr war wie zunächst angenommen. Vor diesem zweiten Schuss war nämlich ein erster Schuss abgefeuert worden, der sein Ziel verpasst und James Tague, einen Zuschauer, an der rechten Wange verletzt hatte. Wegen des Knalls drehte sich Conally im Wagen um und packte seinen Cowboyhut. Diese Bewegung führte dazu, dass alle Wunden, die der zweite Schuss bei Kennedy und Conally verursachte, in einer Linie lagen. Diese Linie konnte sogar nach hinten bis zum offenen Fenster im sechsten Stockwerk des Schulbuchlagers der Texas School verlängert werden. Ob Lee Harvey Oswald hinter diesem Fenster stand oder ein anderer Schütze, bleibt ungewiss, denn Oswald stritt die Tat ab und wurde zwei Tage später selbst erschossen.
Was war bei dem Attentat nun aus chirurgischer Sicht passiert? Das Leben des Präsidenten war durch die beiden Schusswunden in dreifacher Hinsicht in Gefahr geraten. Der Schuss in seinen Kopf zerfetzte einen großen Teil seiner rechten Hirnhälfte.
Wie viel und welcher Teil seines Gehirns genau zerstört wurde, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. John F. Kennedys Gehirn gibt es nicht mehr. Wie schrecklich eine Hirnverletzung auch sein mag – sie ist nicht immer tödlich. Eine Verletzung der rechten Hirnhälfte verursacht eine linksseitige Lähmung (Hemiplegie), eine linksseitige Empfindungslosigkeit (Hemihypästhesie), den Verlust der Fähigkeit, die linke Hälfte der Umgebung zu sehen (Hemianopsie) sowie den Verlust des Interesses für diese Hälfte (Hemineglect). Auch der Charakter verändert sich (Frontalhirnsyndrom), man kann nicht mehr rechnen (Akalkulie), die Auffassungsgabe für Musik kann verloren gehen (Amusie), und das Gedächtnis wird beeinträchtigt (Amnesie). Das Sprachzentrum hingegen befindet sich meist in der linken Hirnhälfte, die wichtigen Steuerungszentren für die Atmung und das Bewusstsein liegen noch weiter von der verletzten Stelle entfernt, im Hirnstamm. Von Kennedy als Mensch wäre also nicht mehr viel übrig geblieben, doch sein Körper hätte möglicherweise noch weiterleben können.
Auch der gravierende Blutverlust aus der Kopfwunde hätte nicht unbedingt tödlich sein müssen. Solange das Herz den Blutdruck stabil hält, lässt sich ein starker Blutverlust durch Flüssigkeitszufuhr und Bluttransfusionen ausgleichen. Kennedy muss bei seiner Einlieferung in die Notaufnahme einen ausreichend hohen Blutdruck gehabt haben, da sein Puls noch zu spüren war und er sich noch bewegen konnte. Auch bei der Autopsie fand man keine weiteren unerwarteten inneren Blutungen. Ob allerdings die Blutung aus der klaffenden Kopfwunde noch zu stillen gewesen wäre, lässt sich im Nachhinein natürlich schwer beurteilen.
Eine viel größere und unmittelbare Gefahr war die Verletzung der Atemwege. In den acht Minuten, die zwischen dem Schuss durch die Luftröhre und Carricos Intubation lagen, hatte Kennedy nicht atmen können. Diesen Zustand des Erstickens, bei dem das Blut zu lange mit zu wenig Sauerstoff versorgt wird, bezeichnet man in der Medizin als Asphyxie. Er verursacht sehr schnell Schäden im Gehirn und im Hirnstamm, denn von allen Körperteilen können sie die geringste Zeit ohne Sauerstoff auskommen. Zunächst ist die Schädigung noch reversibel, das Opfer verliert das Bewusstsein und fällt in Ohnmacht. Doch dann wird die Schädigung irreversibel, das Opfer atmet zwar noch selbst, kommt aber nicht mehr zu Bewusstsein. Diesen Zustand nennt man Koma. Zum Schluss, wenn die lebenserhaltenden Systeme, die Steuerzentren des Bewusstseins, der Atmung und des Blutdrucks im Hirnstamm, vollkommen ausfallen, wird der Schaden fatal. Die Schädigung des Atemzentrums im Hirnstamm war die Ursache für die seltsam ziehenden Atembewegungen des erstickenden Präsidenten. Bei der Autopsie wurde kein Lungenkollaps und auch keine größere Ansammlung von Blut in Lungen oder Brustraum gefunden. Das Einführen eines Beatmungsschlauchs oder eine Tracheotomie hätten sein Leben also womöglich noch retten können, wenn diese Maßnahmen früher erfolgt wären. Heutzutage transportiert man ein bewusstloses Opfer nicht mehr ohne Beatmungsschlauch. Er muss sofort, an Ort und Stelle, von den Rettungskräften eingeführt werden, denn jede Sekunde zählt.
So starb der fünfunddreißigste Präsident der Vereinigten Staaten also infolge eines Blutverlusts, der so stark war, dass ein ganzer Raum voller Ärzte nichts dagegen tun konnte, sowie durch Ersticken, gegen das eine zu spät durchgeführte Tracheotomie nichts mehr auszurichten vermochte. Seltsamerweise war der erste amerikanische Präsident auf ganz ähnliche Weise ums Leben gekommen. Bei George Washington waren es allerdings gerade seine Ärzte, die den Blutverlust verursachten und ihn zudem noch ersticken ließen, da sie es ablehnten, eine Tracheotomie durchzuführen.
George Washingtons letzte Stunden sind von einem Augenzeugen, Oberst Tobias Lear, seinem Privatsekretär, genau beschrieben worden. Am Freitag, dem 13. Dezember 1799,