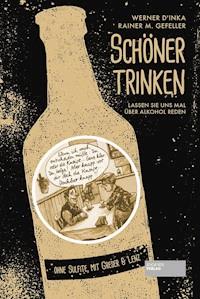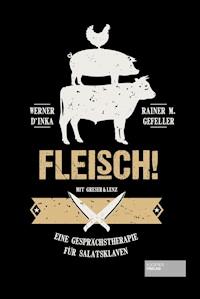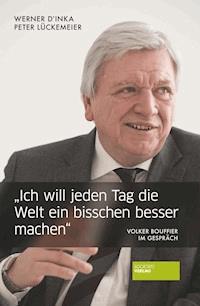Wir trinken gern.Na und?
Zwei Männer treffen sich in Harry’s New York Bar in Frankfurt. Sie trinken, sie reden. Ein Kellner kennt den Weg durch das Labyrinth der Getränkekarte.
Die Trinkstätte im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen empfängt ihre Gäste im Dämmerlicht. Dunkles Holz, Messing, schweres Sitzmobiliar, mit grünem Leder aufgepolstert. Ein Barpianist tupft leicht verdauliche Kost in die Tasten. Über allem ein sachter Geruch von Zigarrenrauch. Auf dem Beistelltischchen bringen wir ein Tonband in Stellung, damit nichts von diesem Abend verlorengeht. Hinter dem langen Tresen macht sich ein Herr im weißen Bar-Jackett auf den Weg zu uns, in leicht wiegenden Bewegungen, als würde er herbeiskaten. Sein sorgsam hochgezwirbeltes Bärtchen passt gut zu seinem magyarischen Namen: Nagy. Schon steht Herr Nagy an unserem Tisch, blitzende Augen, referiert kurz seine Familiengeschichte („ein Viertel der Namen im Budapester Telefonbuch ist Nagy“), aber dann:
Gefeller: „Können wir mal zur Sache kommen?“
D’Inka: „Genau…“
Auf dem Tisch steht eine „Springtime-Karte“, die eine Ansammlung von Phantasie-Drinks anpreist wie „Servir Tres Frais“, „Michi’s Cherry Blossom“, „Razzberry Mojito“.
G: „Können Sie Menschen wie uns irgendwas von dieser Karte empfehlen?“
Herr Nagy: „Nun, ich will mal so sagen: Ich habe Sie beide ja eher als Menschen kennengelernt, die dem Schnaps zugeneigt sind…“
Verständnisvolles Nicken von D und G.
Herr Nagy: „Klar heraus – ich würde Ihnen das nicht unbedingt empfehlen.“
D: „Mehr was für Mädchen, wie?“
Herr Nagy: „Nicht unbedingt, das könnte ich durchaus kräftiger gestalten.“
G: „Dann mal lieber nicht. Ich hätte gern zum Start etwas Fruchtiges, aber nicht zu süß, bitte.“
Herr Nagy: „Sehr gut. Mit Rum? Oder Gin?“
G: „Zuvor eine Gegenfrage. Wenn man unterschiedliche Getränke ausprobiert – ist da nicht auch die Reihenfolge von Belang? Womit soll man starten? Was kommt zum Schluss?“
Herr Nagy: „Dazu kann ich ganz klar sagen: Ich würde immer mit einer klaren Spirituose beginnen. Wodka, Gin…“
D: „Können wir doch einfach so machen.“
Herr Nagy: „Einfach ist nichts. Wir haben eine riesige Gin-Auswahl. (Er breitet die Arme aus, als wolle er uns eine gewaltige Destillerie zu Füßen legen.) Damit kann man vieles anstellen. Zum Beispiel den Negroni, Gin mit rotem Wermut und etwas Campari. Oder ganz klassisch Gin Fizz. Oder Tom Collins auf Gin-Basis.“
Unser Kellner – nein: Getränkeberater –, Herr Nagy, redet sich jetzt in Fahrt. Uns wird schwindlig.
Herr Nagy: „Wir haben da jetzt auch eine ganz neue Kreation von einem Kollegen in London, ‚The Forbidden Fruit‘, mit einem hausgemachten Beeren-Chutney aus Waldbeeren, etwas frisch gepresster Limette, ganz, ganz bisschen Zucker, shaken das ganze zusammen mit Gin und geben oben drauf eine Limonade…“
G: „Das nehme ich jetzt, fertig, aus!“
D: „Und ich den Negroni.“
Herr Nagy: „Dann mache ich den so, wie ich ihn für mich auch machen würde.“
D: „Unbedingt. Was Ihnen schmeckt, kann nicht schlecht sein.“
Wir lachen und schauen uns an. So geht das also los. Wir sitzen hier um herauszufinden, ob wir ein Buch über das Trinken schreiben wollen. Die einfache Idee: Wir nehmen an unterschiedlichen Orten Getränke zu uns und unterhalten uns darüber. Heute Abend soll, in Gegenwart von Herrn Nagy, die Entscheidung fallen. Der Tag ist denkbar schlecht gewählt: D fastet gerade und hat eigens für dieses Arbeitstreffen die Phase seines Alkoholverzichts unterbrochen. Darüber muss dringend gesprochen werden.
G: „Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man nichts trinkt?“
D: „Weniger schlimm, als du vielleicht annimmst. Es gibt zweifellos auch ein Leben ohne Alkohol.“
G: „Für einen gesunden Menschen, der dem Alkohol gänzlich entsagt, kann es aus meiner Sicht ja nur zwei Gründe geben: Entweder er ist religiös – oder er hat’s nötig.“
D: „Dass es noch andere Motivlagen gibt, hältst du natürlich für ausgeschlossen.“
G: „Man muss doch mal irgendwie ins Gespräch kommen!“
D: „Ich faste nicht aus religiösen Gründen, obwohl mir das nicht fremd wäre, und auch nicht, weil ich’s nötig hätte. Ist übrigens auch eine Charakterfrage, falls du verstehst, was ich meine.“
G: „Klär mich auf.“
D: „Ich glaube einfach, dass es gut und richtig ist, einmal im Jahr Verzicht zu üben, etwas Gewohntes oder Liebgewonnenes einfach mal sein zu lassen. Man fühlt sich gut, wenn man es schafft. Abgesehen davon verliere ich auch immer ein Kilo oder zwei.“
G: „Was natürlich nicht Not täte!“
D: „Ach!“
Wir sprechen über das Nichttrinken vielleicht auch in einer Art Verzweiflung. Herr Nagy hat noch nicht geliefert. Das Gespräch mäandert dahin wie ein Fluss, dem niemand seinen Lauf vorgegeben hat.
G: „Hören wir mal auf mit dem Fastenthema. Meine Tochter steckt gerade im Abitur. Die Schulleitung hat die Eltern ein Schriftstück abzeichnen lassen, wonach alkoholische Exzesse nach vollbrachter Prüfung gefälligst zu unterbleiben haben, jedenfalls auf dem Schulhof. Ist das nicht grotesk?“
Abiturienten trinken nun mal nach vollbrachter Tat, in Frankfurt am liebsten im Grüneburgpark. Na und?
D: „Beruhige dich, lass uns mal einen Augenblick reden wie alte Männer. Ich finde, so gesoffen wie die jungen Menschen heute haben wir früher nicht. Wir waren keine Kinder von Traurigkeit, aber dass die Schulleitung derart einschreiten musste …“
G: „Einspruch, Euer Ehren. Wir hatten früher natürlich keine Shots, nicht dieses süße Zeug, das heute gern konsumiert wird. Aber haben wir nicht auch Cola-Rum gezischt?“
D: „Apfelkorn!“
G: „Am liebsten selbstgemischt, weil’s dann günstiger kam. Wenn ich mich an die scheußlichen Zwei-Liter-Lambrusco-Flaschen erinnere, mit Plastikbast umwickelt…“
D: „Und nach der Leerung stellte man eine Kerze rein, für die Gemütlichkeit.“
G: „Ich glaube nicht, dass früher weniger getrunken wurde als heute. Auch vor uns nicht, wie wir von unseren Eltern wissen. In der Nachkriegszeit gab es eine solche Sucht nach Ausgelassenheit und Unbeschwertheit – immer begleitet von Alkohol.“
D: „Ja, doch. Du hast Recht, wir haben auch ganz schön einen abgebissen. Muss uns als verantwortungsbewusste Staatsbürger sowas nicht besorgt stimmen? Sind wir ein Land von Trinkern?“
G: „Ach, man ahnt manchmal gar nicht, wie viele Nicht-Trinker unter uns leben. Allerdings vernehme ich gelegentlich, dass sich unsere ostgotischen Landsleute etwas darauf einbilden, dass sie trinkfähiger seien als die Wessis. Vielleicht stimmt das, vielleicht waren die Verhältnisse einfach nur im Suff zu ertragen?“
D: „Wer die reale Flucht nicht geschafft hatte, konnte mit Hilfe von Gotano & Co wenigstens in eine Phantasiewelt flüchten. Denn natürlich gibt es auch das Trinken aus Verzweiflung.“
G: „Ich glaube, dass wir beide eine solche Verzweiflung noch nicht kennengelernt haben. In der DDR war dem Alkoholkonsum natürlich auch förderlich, dass er sehr billig war – auch in der Kneipe. Dort begab man sich nicht alleine auf die Flucht: es war ein gemeinschaftlicher, geselliger Vorgang.“
„Verzweiflung. Geselligkeit. Durst. Gibt’s noch weitere Trinkgründe?“
Inzwischen sind die Getränke da. D nippt („Prost. Mmmh. Echt raffiniert“), dann kehrt er sogleich zum Gespräch zurück:
D: „Zwei Gründe haben wir also identifiziert fürs Trinken: Verzweiflung und Geselligkeit.“
G: „Und Durst! Wenn man nach einem harten Arbeitstag von einem großen Durst geplagt wird…“
D: „Da kannst du ja wohl nicht mitreden.“
G: „Man macht aber so seine Beobachtungen!“
D: „Könntest du dir übrigens vorstellen, alleine zu trinken?“
G: „Hab’ ich auch schon gemacht. Macht keinen Spaß.“
D: „Verzweiflung. Geselligkeit. Durst. Gibt’s noch weitere Trink-gründe?“
G: „Weil’s schmeckt. Und was ich auch noch bedeutsam finde: Belohnung. Es wäre für mich zum Beispiel völlig undenkbar, dass ich wandern ginge, ohne ein Ziel vor Augen zu haben – ein Ziel mit Getränkeausschank. Zudem sollten wir nicht vergessen, dass Alkohol gern auch bei gewissen amourösen Gelegenheiten zum Einsatz kommt. Er entkrampft. Man spricht auch flüssiger.“
D: „Vielleicht sind auch gewisse Schranken dann nicht mehr so hoch. Der Mann wird mutiger, die Frau auch.“
G: „Um es knapp zu sagen – ohne Alkohol würden viele Amouren nicht zustande kommen.“
D: „Was noch?“
G: „In früheren Jahren diente der Alkohol in unserem Beruf manchen Kollegen zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit. Vor dem ersten Glas waren die Gehirnzellen quasi ausgetrocknet. Und Bier und Wein und sogar Schnaps waren immer präsent – im Büro und bei den Journalisten-Treffs nach Feierabend.“
D: „Ja, ohne Alkohol keine Kreativität. Bei mir ist das nicht so, allenfalls in minimalen Dosen. Ich ermatte eher. Wann verschwand eigentlich der Alkohol aus unserem Arbeitsleben?“
G: „Vor allem mit der Einführung der Computer-Technologie in den Redaktionen. Die Arbeit verdichtete sich, die Kollegen verschwanden hinter den Bildschirmen und damit war es auch mit der Geselligkeit vorbei.“
D: „Außerdem verzeiht es die Tastatur im Unterschied zur Schreibmaschine nicht, wenn man ein Glas Cola-Cognac darüber schüttet. Wir haben übrigens einen wichtigen Aspekt bislang nicht erwähnt: Trinken, weil es gesund ist. Rotwein zum Beispiel wird, jedenfalls in Maßen, von Medizinern gutgeheißen. Franzosen gelten ja gerade deswegen als weniger anfällig für den Herzinfarkt.“
Bevor wir uns in einer endgültigen Glorifizierung des Trinkens verlieren können, hat sich Herr Nagy wieder herbeibegeben und offeriert Zigarren zum Getränk.
G: „Mich beschäftigt die Frage, wie es der Geistes-Heroe Johann Wolfgang von Goethe geschafft hat, jeden Tag unfallfrei zwei Flaschen Wein zu konsumieren – und dabei auch noch rechtschaffen coole Schriften zu verfassen.“
D: „War ja ein durchaus begabter Autor!“
G: „Die F.A.Z. hätte ihn vermutlich nicht beschäftigt. Schrieb selbst für eure Zwecke zu weitschweifig.“
D: „Bismarck soll jeden Mittag eine Flasche Champagner geleert haben und war immer noch regierungsfähig. Man fragt sich: Wie haben die das geschafft? Die hatten ja im Zweifel eher weniger Bewegung als wir.“
G: „Es gab ja noch kein Gym und keine Muckibude und gejoggt wurde auch nicht. Rüstiges Ausschreiten war das Höchste des Sporttreibens. Wie ist es denn um deinen Konsum bestellt?“
D: „Ich trinke vorwiegend Wein, ich stamme ja aus dem Markgräflerland, einer Weingegend. Abends trinke ich eigentlich regelmäßig ein Viertel.“
Der unvermeidbare Herr Nagy fragt nach weiteren Wünschen. Ein Bier zur Currywurst? Was Härteres? Wir bestellen erstmal ein Wasser. Herr Nagy ist professionell genug, uns seine Verachtung nicht spüren zu lassen.
D: „Wo waren wir stehengeblieben?“
G: „Wird man eigentlich durchs Trinken vergesslicher?“
Gutmütiges Lachen. Auf dem Tonband ist zu hören, dass der Barmusiker jetzt ziemlich schmissig wird. Wir lassen uns nicht stören.
G: „Man darf nicht übersehen, dass die Alkoholgewohnheiten sehr unterschiedlich übers Land verteilt sind. In München, wo ja bereits der Balkan beginnt, wird die mindestens zweistündige Siesta ja auch gern genutzt, sich ein Weißbier oder gleich eine Maß einzuhelfen. Als ich in München gearbeitet habe, war ich doppelt so breit wie heute – ich meine: körperlich – weil ich die Usancen der dortigen Eingeborenen übernommen habe. Das würde ich heute gewiss nicht mehr schaffen. In einem auf Tüchtigkeit der Bevölkerung fußenden Landstrich wie der Rhein-Main-Region würde das zudem gesellschaftlich geächtet.“
D: „In der Frankfurter Partnerstadt Lyon ist es normal, dass die Berufstätigen sich bis halb vier Uhr am Nachmittag dem körperlichen Wohl widmen. Niemand kann sagen, dass diese Gegend weniger erfolgreich sei als andere in Frankreich – und niemand kann behaupten, dass München weniger erfolgreich sei als etwa das sauertöpfische Hamburg.“
Herr Nagy ist wieder da. Wir werden mit Zigarren versorgt und er empfiehlt uns, wir sollten die Würzigkeit des Rauchwerks mit etwas Süßerem kontrastieren. Herr Nagy gestikuliert und redet stakkatoartig auf uns herunter.
Herr Nagy: „Sie haben ja die leichtere Zigarre, da würde ich einen Single Malt Whisky mit einem Finish von zwei Sherrysorten empfehlen. Und bei Ihnen sollte es ein Botucal sein, eine Rum Reserva aus Venezuela, die den Charakter eines flüssigen Desserts hat, mit einer schönen tiefen Schokoladennote.“
G: „Darf ich Ihnen mal eine Fachfrage stellen?“
Herr Nagy: „Bitte!“
G: „Schmecken Sie das alles, was Sie hier so glühend beschreiben?“
Herr Nagy: „Aber ja! Das liegt an der Sensorik, das kommt mit der Zeit.“
D: „So alt sind Sie doch noch gar nicht.“
Herr Nagy: „Ich kann Ihnen versichern: Alles, was wir hier stehen haben, und jeden Drink, den wir anbieten, habe ich wenigstens schon einmal getrunken.“
Wir starren halb fassungslos, halb anerkennend auf das gewaltige Flaschenregal hinter dem Tresen.
G: „Nehmen Sie das eigentlich als Arbeitsgetränk mit nach Hause?“
Herr Nagy: „Nein! Ich habe zu Hause eine recht große Auswahl an Spirituosen. Allerdings trinke ich privat kaum Alkohol.“
Spricht es und skatet davon, um den Getränkenachschub zu sichern.
G: „Kannst Du Dich eigentlich an Deinen ersten Drink erinnern?“
D: „Ja. Das war ganz harmlos, ein Gläschen Wein am Mittag. Da war ich 14. Ich weiß nicht, ob das in deinen Augen früh oder spät war.“
G: „Da bist du eher ein Spätberufener.“
D: „Das war bei Bekannten im Nachbarort, bei einem Schlachtfest. Da hat mein Vater befunden, jetzt sei es so weit, jetzt könnte ich mal ein Glas Wein probieren. Und bei dir?“
G: „Ich wurde von einer Freundin meiner Mutter (in deren Abwesenheit) genötigt. Die Frau war des Glückes voll, weil ihr verschwundener Hund wieder aufgetaucht war, und sie war durstig. ‚Du trinkst jetzt mit‘, verfügte sie. Sie hatte Erdbeer-Wein dabei. Ich war elf. Mein Körper hat rebelliert, die Mutter musste die Spuren dieser Rebellion aufwischen. Die Freundschaft zwischen ihr und dieser Frau war danach über längere Zeit erkaltet.“
Später, beim Abhören des Tonbands, werden wir bemerken, dass es jetzt zu längeren Gesprächspausen kommt. Der Alkohol beflügelt offenkundig auch das gemeinsame Schweigen.
„Osteuropa und die Tradition der Trinksprüche“
G: „Du bist ja oft in Osteuropa unterwegs. Stimmt eigentlich der Mythos, dass dort ausgiebiger und härter getrunken wird als bei uns?“
D: Der Mythos kommt nicht von ungefähr. In Russland und in der Ukraine wird mächtig gesoffen, vor allem auf dem Lande und unter älteren Männern. Dort sind die Trinktraditionen natürlich auch gänzlich anders. Wein ist, außer in der Schwarzmeer-Region, so gut wie unbekannt. Wodka wird hingegen so getrunken wie bei uns Bier oder Wein, auch zum Essen. Bei meinem ersten Besuch in St. Petersburg sah ich fassungslos, wie zwei Männer zum Mittagsmahl eine Flasche Wodka leerten. Das waren keine Alkoholiker! Was mich allerdings besonders berührt, ist die sehr schöne Tradition der Trinksprüche, die bei guten Zusammenkünften vor jedem Wodka ausgebracht werden müssen. Sie folgen immer einer festen Reihenfolge und festen Ritualen. Der zweite Trinkspruch geht zum Beispiel auf die Gastgeber, der dritte auf die Frauen, der fünfte auf den Weltfrieden…Wenn man als Westeuropäer da mithalten kann, ist man sofort der King. In Moskau wurde ich einmal gebeten, den dritten Spruch, die Huldigung an die Frauen, darzubieten. Dazu stehen die Männer auf, die Damen bleiben sitzen. Als ich fertiggesprochen hatte, waren die Russen restlos begeistert und riefen: „Er ist einer von uns!“ Die Trinksprüche sind eine Herausforderung an die Schlagfertigkeit und den Intellekt. Gibt es bei uns leider nicht.“
Das Gespräch wendet sich wieder den heimischen Trinkgebräuchen zu. Schnell nähern wir uns einer existentiellen Frage: Sind wir eigentlich imstande, uns qualifiziert selbst zu versorgen?
G: „Ich trinke gern einen guten Wein, ohne dass ich für mich in Anspruch nehmen könnte, ein Spitzenweinkenner zu sein. Gewiss hat sich der Geschmack seit den finsteren Lambrusco-Zeiten verfeinert, aber mir ist keine solche Finesse zu eigen, dass ich eine 250-Euro-Flasche recht zu würdigen wüsste.“
D: „Man kann sicher eine Gülle von einem anständigen Wein unterscheiden. Auch ahnt man, dass eine Flasche Rotwein für drei Euro fünfzig nicht unseren Ansprüchen genügen könnte.“
G: „Außerdem gucke ich beim Einkauf auch aufs Etikett…“
D: „Fällst du auch drauf rein?! Ich auch. Irgendwie geht man davon aus: Wer ein geschmackvolles Etikett entworfen hat, kann beim Wein auch keine grundlegenden Fehler begangen haben.“
G: „Was natürlich Quatsch ist.“
D: „Natürlich. An sich kaufe ich inzwischen fast ausschließlich, was ich schon gekostet habe. Gern direkt beim Winzer. Es gibt so großartige junge Winzer – in Rheinhessen, in der Pfalz. Ein gutes Angebot haben zum Beispiel auch die Bischöflichen Weingüter in Trier – großartige Rieslinge.“
G: „Die Katholiken haben’s einfach drauf.“
D: „Die haben’s echt drauf.“
G: „Es ist ja eine meiner Lieblingsideen, dass man mal die Landkarte der leiblichen Genüsse (Weinanbau, Bier-Region, gutes Essen) und die Karte der konfessionellen Verbreitung in Deutschland übereinanderlegen sollte. Da werden wir den Beweis finden für die Übermacht der katholischen Lebensart: Überall dort, wo die Katholiken zu Hause sind, gibt es den besseren Wein, das bessere Bier, das bessere Essen.“
D: „Da bin sicher. Den Protestanten ist die Lebensfreude nicht so gegeben. Da gibt es eher Tee zum Essen.“
Die Bar füllt sich. Herr Nagy macht sich rar, der Lärmpegel steigt. Aber wir haben ein Stadium der Unbeirrtheit erreicht.
D: „Kannst du dich an deinen ersten richtigen Rausch erinnern?“
G: „Hab ich vergessen.“
D: „Geht mir auch so.“
G: „Aber um die Wahrheit zu sagen: In der schludrigen Jugendzeit haben wir allerlei gezecht. Die Kumpane, alle fühlten sich irgendwie links, diskutierten über Marx und die Psychoanalyse und hörten Schallplatten von Franz Josef Degenhardt. Wenn Frauen dabei waren, auch mal Leonhard Cohen.“
D: „Von Degenhardt gibt es ja diesen wunderbaren Song ‚Ich möchte Weintrinker sein‘“.
Ein dokumentarischer Einschub: Degenhardt, erste Strophe:
Ich möchte Weintrinker sein
Mit Kumpanen abends vor der Sonne sitzen
Und von Dingen reden, die wir gleich verstehn
Harmlos und ganz einfach meinen Tag ausschwitzen
Und nach Mädchen gucken, die vorübergehn
G: „Zur Gymnasialzeit gab es ja auch die Bottleparties. Jeder brachte irgendeine Flasche mit, was unweigerlich dazu führte, dass allerlei durcheinander getrunken wurde. Wir saßen im Kreis. Die geleerten Flaschen wurden in der Mitte gedreht. Derjenige, auf den der Flaschenhals zeigte, musste ein Kleidungsstück ablegen. Mit dem Ergebnis, dass bald alle Jungens in der Unterhose dasaßen. Die Mädchen hatten vorgesorgt und 15 Kleidungsstücke übereinandergezogen.“
D: „Da wir so schön drüber reden, will ich eingestehen: Du hast Recht. Wir haben früher nicht weniger getrunken. Heute sind vielleicht alle aufmerksamer. Und früher gab es keine Selfies, die immer gleich alles enthüllen.“
G: „Damals war das Trinken irgendwie unschuldiger. Heute sind die jungen Leute von Ernährungsberatern und Suchtbeauftragten umzingelt. Da bleibt nichts unbeobachtet und nichts analysefrei“.
D: „Wir, die Medien, haben uns ja auch schuldig gemacht. Alles wird gleich skandalisiert.“
G: „Natürlich sind unsere Labore inzwischen so raffiniert, dass sie in unseren Getränken Schadstoffe finden, die früher gar niemand kannte. Glyphosat im Bier zum Beispiel…“
D: „Unser Freund Otto Völker, der Binding-Chef, hat darauf hingewiesen, dass man eintausend Liter Bier auf einen Rutsch konsumieren müsste, um sich an den schädlichen Grenzwert heranzuzechen. Wie Gustave Flaubert sagt: ‚Es ist merkwürdig, je schärfer die Teleskope werden, desto mehr Sterne gibt es.‘ Aber jetzt was anderes: Hast du mal gekifft?“
G: „Gekifft wurde früher allerlei in meinem Freundeskreis, ich hab natürlich mitgemacht. Bei den Konzerten in der Festhalle, zum Beispiel bei den Rolling Stones, musste man sich nur dorthin stellen, wo die Amis waren. Über denen stand immer eine Haschisch-Wolke, und die haben gern geteilt. Gebracht hat es mir allerdings kaum was, weil ich immer schon Nichtraucher war. Das Kiffen wirkte nur zusammen mit Alkohol. Aber den Schwarzen Afghanen gab es damals fast an jeder Straßenecke, selbst hier bei uns in der Zeitungs-Mettage wurde gedealt.“
Das Gespräch nimmt jetzt wirklich einen seltsamen Verlauf, als müssten wir auch sämtliche orientalischen Genussverirrungen in Betracht ziehen. D beschließt eine brutale Notbremsung:
D: „Kennst du eigentlich Alkoholiker?“
G: „Ja. Auch in unserem Beruf, aber natürlich nicht nur dort, habe ich schon einige hinübergehen sehen. Zwei-, dreimal habe ich alkoholkranke Männer in den Entzug begleitet. Das ist grauenhaft; vor allem die Veränderung der Persönlichkeit ist schwer erträglich. Und das Ausmaß, wie Familie und Freunde von der Alkoholkrankheit in Geiselhaft genommen werden – weil alle sich irgendwie auf den kranken Trinker fixieren müssen. Trinker benehmen sich kein bisschen anders als Junkies. Sie lügen, sie wickeln dich ein, sie schwören bei sämtlichen Göttern, sie klauen – nur um an ihren Stoff zu kommen. Ich hatte einen Freund, ein großes Vorbild, der an den Folgen seiner Exzesse auf grausame Weise gestorben ist. Er war ein gläubiger Katholik, er erzählte: Selbst auf den Wallfahrten kannst du diesem Teufel nicht entgehen. Denn wenn die letzten Choräle gesungen sind, abends in irgendwelchen Unterkünften, dann geht es immer nur um das eine: ums Saufen…“
„Biergärten in München! Weinstände im Rheingau! Heroische Trinkstätten überall!“
Das Gespräch ist jetzt beinahe unmerklich – jedenfalls von den Gesprächsteilnehmern unbemerkt – in eine nostalgisch verklärende Phase übergegangen. Die Herren tauschen Erinnerungen aus, in denen nahe und ferne Gaststätten als Gnadenstätten gewürdigt werden. Die Biergärten in München! Die Weinstände im Rheingau! Die Kölsch-Paläste in Köln! Die Paris-Bar in Berlin! Die Guinness-Kathedralen in Dublin! Heroische Trinkstätten überall! Herr Nagy schleicht herbei und unverrichteter Dinge wieder fort. Wir knöpfen uns ein heikles Frankfurt-Thema vor.
D: „Trinkst du eigentlich auch Apfelwein?“
G: „Selten. Obwohl er mir manchmal sogar schmeckt, aber eben nur manchmal.“
D: „Geht mir auch so. Dabei zählen die Apfelwein-Gaststätten zweifellos zum Besten, was diese Stadt zu bieten hat.“
G: „Und die Kellner sind ähnlich unverfroren, dreist und großartig wie die berüchtigten Köbesse in Köln. Vor vielen Jahren bin ich einmal nach durchzechter Nacht in einer Apfelwein-Schänke an der Textorstraße eingekehrt und bat den Kellner, auf mich achtzugeben, auf dass ich nicht zu viel trinke. Nach dem achten Ebbelwei tippte er mir auf die Schulter und meinte: ‚He, Meister, so langsam tät’ ich mal zum Gespritzte übergehn…‘“
D: „Jetzt aber mal zum Unterschied der Geschlechter. Trinken Frauen anders als Männer?“
G: „Meistens nicht so viel – und wenn doch, dann werden sie eher mal gesellschaftlich geächtet. Wenn Männer sich so weit alkoholisch zurichten, dass ihnen auch mal ein Schrittfehler unterläuft, dann wird darüber eher gutmütig hinweggesehen als bei Frauen.“
D: „Wir sind so erzogen. Man möchte nicht erleben, dass Frauen die Contenance verlieren, Gleichberechtigung hin oder her.“
G: „Wenn eine Frau sich aber als trinkfest erweist, trinkfester sogar als die mit ihr zechenden Männer, dann ist einem das irgendwie unheimlich.“
D: „Das ist wahr. Wir sehen ja beide eine konkrete Dame vor uns, wir haben das ja beide schon erlebt. Aber ihren Namen wollen wir hier nicht nennen.“
G: „Auf keinen Fall…ihr Nachfolger trinkt ja nichts.“
Der Gesprächsfluss ist unterdessen erkennbar über die Ufer getreten. Über Bohnenkaffee wird doziert, über Liköre. D fragt, ob man zum Fußballspiel Champagner trinken darf und antwortet gleich selbst: „Niemals!“ D will auch wissen, ob es Getränke gibt, die man nie und nimmer trinken würde. G besteht darauf, dass ideologische Vorurteile beim Trinken nichts zu suchen haben: Erst einmal siegt die Neugierde, erstmal wird probiert.
D: „Ich habe bislang einen einzigen Eierlikör probiert und beschlossen: Sowas kommt mir nicht mehr über die Lippen!“