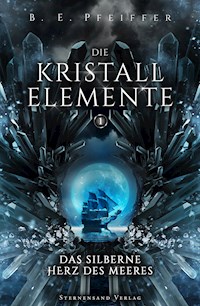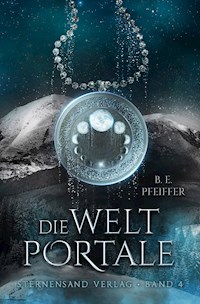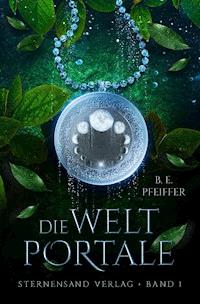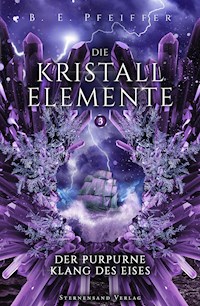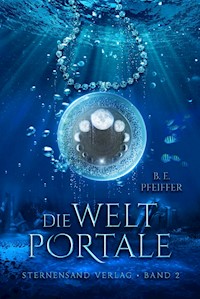4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Magische Romantasy und einem epischen Kampf zwischen Mondhexen und Sonnenkriegern Ich heiße Lyra. Bis vor Kurzem war mein Leben noch perfekt: Ich habe gern studiert und hatte mit Kegan den wunderbarsten Freund, den man sich wünschen kann. Doch alles hat sich verändert, als ich einen sonderbaren Traumfänger berührt habe. Ein Kerl ist aus dem Nichts aufgetaucht und hat behauptet, ich wäre eine Mondhexe. Er hat mich mit in eine Welt genommen, die ich nicht kenne und in der Kegan und ich auf einmal Feinde sind. Jetzt steht mein Leben Kopf. In mir erwacht eine uralte Magie und ohne Kegan fühle ich mich einsamer als jemals zuvor. Daran vermögen auch die Drachen, die man hier als Haustiere hält, nichts zu ändern. Als das Orakel der Mondhexen mir helfen will, Kegan zu treffen, lasse ich mich natürlich auf den Vorschlag ein. Obwohl wir Feinde sind. Denn ich kann Kegan trotzdem vertrauen. Oder? Magischer Auftakt einer Reihe voller Zauber, Drachen und dem Kampf um die wahre Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Schöpferin der Mondmagie
SONNENGEKÜSST
SCHÖPFERIN DER MONDMAGIE
BUCH EINS
B.E. PFEIFFER
Copyright © 2022 by B.E. Pfeiffer
c/o WirFinden.Es
Naß und Hellie GbR
Kirchgasse 19
65817 Eppstein
www.bepfeiffer.com
Umschlaggestaltung: Makita Hirt
Lektorat: Fam Marie Schaper
Korrektorat: Julie Roth
Satz: Bettina Pfeiffer
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form sind vorbehalten. Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für alle, die ihren Platz in der Welt noch suchen. Die Magie wird euch finden ...
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
So geht es weiter …
Es gibt noch ein Geheimnis zu lüften!
Danksagung
Über den Autor
Bücher von B.E. Pfeiffer
Prolog
ZWANZIG JAHRE ZUVOR
Du hast es gleich geschafft«, sagte er und biss die Zähne zusammen, als sie seine Hand mit ihrer beinahe zerquetschte.
Sie atmete stoßweise und presste ihre Lippen, so fest es ging, aufeinander, um einen Schrei zu unterdrücken. Ihr Gesicht lief rot an und sie drückte seine Hand noch fester.
»Ich kann das nicht«, keuchte sie, als die Wehe abklang, und stützte sich auf ihn.
»Du kannst und du wirst«, brummte die Alte, die auf einem Schemel saß und dem Mann und der Frau zusah.
Ihre Finger glitten über die Fäden des Traumfängers in ihren Händen, als würde sie ein Saiteninstrument spielen. Doch statt Musik erschuf sie ein Netz aus Magie, das der Gebärenden helfen sollte, die Strapazen besser zu überstehen.
»Es dauert schon so lange«, warf er ein. »Sarnai ist am Ende ihrer Kräfte.«
»Deswegen bin ich ja hier, Cullen«, erwiderte die Alte. »Um ihr mit meiner Magie beizustehen.«
»Wir haben keine Zeit mehr«, sagte Sarnai und grub ihre Fingernägel in Cullens Hand. »Die Fallen werden die Sonnenkrieger nicht ewig aufhalten. Ich kann ihre Macht spüren.«
Sie biss sich auf die Unterlippe, bis Blut hervorquoll, und rang dann um Atem.
»Kinder kommen, wenn die Zeit reif ist«, erklärte die Alte ruhig und stand auf. »Nicht wenn wir ihnen befehlen, in unser Leben zu treten.«
Sie schlug die Fäden des Traumfängers langsamer an. Das Zelt, in dem sie sich befanden, kühlte ab, das Feuer brannte nieder. Sarnai atmete ruhiger.
»Wir werden sie nicht aufwachsen sehen«, meinte Sarnai und kämpfte die Tränen zurück.
»Ihr bringt sie in Sicherheit«, entgegnete die Alte mitfühlend. »Und wenn sie alt genug ist, wird sie zu euch zurückkehren.« Sie legte den Kopf schief. »Du musst ihr erlauben, dich zu verlassen, Sarnai. Sonst riskierst du euer beider Leben.«
»Ich kann nicht«, schluchzte sie. »Ich will sie nicht verlieren. Vor dem Schleier wird sie nur ein Mensch sein. Schutzlos und ohne Eltern.«
»Wir bringen sie zu Jason«, redete Cullen ruhig auf seine Frau ein. »Du kennst ihn. Er war mein Freund, als ich unter den Menschen lebte. Sie wird bei ihm aufwachsen, als wäre sie seine Tochter.«
»Das ist nicht dasselbe«, presste Sarnai zwischen ihren Zähnen hervor, als die nächste Wehe ihren Bauch steinhart werden ließ.
»Ich will sie auch nicht gehen lassen«, raunte Cullen ihr ins Ohr. »Mir wäre es lieber, sie wäre bei mir, ich könnte sie beschützen und aufwachsen sehen. Aber sie soll leben. Hier ist sie ständig in Gefahr. Das verstehst du doch, oder, Liebste?«
Sie schluchzte und nickte. Dann drückte sie seine Hand so fest, dass die Knochen knackten.
Die Alte schritt um die beiden herum und die feinen Fäden ihrer Magie woben ein Netz aus grünem Licht.
Sarnai sammelte all ihre Kraft und nahm die Magie in sich auf. Ihr Körper fühlte sich mit einem Mal schwerelos an und sie erblickte das Licht des Mondes, das ihr trotz der Schmerzen Trost spendete.
»Gleich ist es geschafft«, drang die Stimme der Alten durch den Nebel der Magie, die sie bei der Geburt unterstützte.
»Du machst das großartig«, sagte Cullen.
Sarnai lächelte ihn an. Ihr Herz schlug schneller, als sie in seine unendlich tiefen grünen Augen blickte. Sie wünschte sich, dass ihre Tochter seine Augen bekommen würde.
Der Schrei eines Neugeborenen riss sie aus dem Zustand, in den die Magie sie versetzt hatte. Er brachte sie zurück in die Welt, die zu gefährlich war, um ihr Kind dort großzuziehen. Cullen zog sie an sich und stützte sie, damit sie aufrecht sitzen konnte.
»Ein gesundes Mädchen«, verkündete die Alte.
Aber das hatte Sarnai längst gewusst. Ihre Magie hatte sie und ihre Tochter schon vom ersten Moment, als das zweite Herz in ihr zu schlagen begonnen hatte, verbunden.
Leere nahm jetzt den Platz ein, der gerade noch voller Leben gewesen war. Tränen liefen Sarnai über die Wangen. Sie hatte ihren kostbarsten Schatz gerade erst bekommen und sie würde ihn doch fortschicken müssen.
»Darf ich sie halten?«, bat Sarnai. »Nur ein einziges Mal …«
Cullen schluckte und nickte der Alten zu. Zögerlich legte sie Sarnai das kleine Bündel in die Arme.
Sarnai schob die Decke zur Seite und betrachtete das Gesicht des Mädchens, das sie jetzt schon mehr liebte als irgendetwas anderes in beiden Welten.
»Sie hat deine Augen«, wisperte sie und sah zu Cullen auf, der die Wange seiner Tochter behutsam mit der Fingerspitze liebkoste.
»Und deinen starken Willen«, fügte er mit einem traurigen Lächeln hinzu. »Sie wird zu uns zurückkehren.«
»Aber werden wir dann noch hier sein?«, fragte Sarnai heiser.
Cullen setzte zu einer Antwort an, doch ein lauter Knall unterbrach ihn. Der Boden bebte unter ihnen und Sarnai presste den weinenden Säugling an sich.
»Wir müssen hier weg«, brüllte die Alte gegen den Lärm an. »Cullen, bring das Kind in Sicherheit. Ich kümmere mich um Sarnai.«
»Nein, noch nicht«, flehte Sarnai. »Nimm sie mir noch nicht weg.«
Cullen half seiner Frau, aufzustehen, zog sie an sich und hauchte einen Kuss auf ihre Stirn. »Welchen Namen soll sie tragen?«, fragte er, während er sie aus dem Zelt führte.
»Lyra«, antwortete Sarnai.
Aus den anderen Zelten rannten Leute und schrien Befehle. Aber sie blendete all das aus, blickte in das Gesicht ihrer Tochter und zeichnete mit dem Daumen eine Mondsichel auf die Stirn des Kindes.
»Du bist geboren unter dem Mond der Mystik und Lebenskraft«, murmelte sie. »Kehr zu mir zurück, mein Mondschein. Ich werde auf dich warten.«
Sie küsste das Neugeborene und drückte es noch einmal an sich. Dann sah sie Cullen in die Augen, die zu glänzen begonnen hatten.
»Ich komme bald zu dir zurück, meine Liebste«, versprach er. »Unsere Tochter wird gut versorgt sein. Hab keine Angst.«
»Mögen die Götter des Mondes euch beide sicher zu mir zurückbringen«, sagte Sarnai, als Cullen sich von ihr löste.
Er rannte zwischen den Leuten hindurch auf eine Felswand zu. Mit einer Hand drückte er seine Tochter gegen seine Brust, die andere zog einen Traumfänger aus seiner Tasche und berührte die Fäden. Dunkelblaue Funken stoben um ihn auf und öffneten einen Spalt in der Wand, durch den Sarnai einen Blick auf Häuser und grüne Hecken werfen konnte.
Lyra war in der Menschenwelt sicher. Daran musste Sarnai glauben. Nur so konnte sie die nächsten Jahre überleben. Bis sie ihre Tochter wieder in die Arme schließen durfte.
KapitelEins
HEUTE - EDINBURGH
Jemand legt seine Hände vor meine Augen und ich hebe den Kopf.
»Wer bin ich?«, fragt er mit verstellter Stimme.
»Hmmmm«, mache ich, obwohl ich ihn selbst dann erkennen würde, wenn er einen Stimmverzerrer benutzen würde. »Das Sumpfmonster von Edinburgh?«, schlage ich trotzdem vor und kichere, als er die Hände zurückzieht.
»Fast«, meint Kegan und lässt sich neben mich auf die Bank fallen.
Sein blondes Haar glänzt in der kühlen Wintersonne und seine türkisfarbenen Augen erinnern mich an das ruhige Meer. Ich beuge mich ihm entgegen und die Grübchen an seinen Wangen vertiefen sich.
Doch statt mich zu küssen, greift er nach dem Buch, das auf meinem Schoß liegt, und dreht es um.
»Sieh an, lernst du für englische Literatur?«, will er wissen und sein Lächeln wird breiter.
Das Flattern in meinem Bauch, das ich ohnehin ständig in seiner Nähe fühle, gleicht jetzt einem Orkan. Obwohl ich trotz des dicken Wintermantels und der Handschuhe die Kälte gespürt habe, dringt jetzt Wärme in meinen Körper. Wegen Kegan.
»Nein, ich mag nur zufällig Shakespeare-Sonette«, erwidere ich. »Würde dir aber auch nicht schaden, sie zu lesen.«
»Hey, ich kenne zumindest die großen Werke von Shakespeare. Zeig mir einen anderen Rugbyspieler, der dir mehr als zwei Titel nennen kann.«
Er zwinkert und endlich beugt er sich nach vorn und küsst mich. Seine Lippen sind weich und schmecken nach Honig.
Ich seufze und schmiege mich an ihn. Kegan legt einen Arm um meine Schulter und zieht mich näher zu sich.
»Man muss sich ja nicht an den Schlechteren orientieren«, werfe ich ein.
»Nein, aber an dich kommt auch niemand heran, Lyra«, erwidert er. »Ist schon ungerecht.«
»Was genau?«, hake ich nach, stütze mich an seiner Brust ab und sehe ihm ins Gesicht.
Kegan schmunzelt und ein weicher Ausdruck huscht über sein Gesicht. »Na, dass du klug und atemberaubend schön bist. Als wären dir sämtliche Göttinnen gewogen.«
Ich schnalze mit der Zunge, ahne allerdings, dass meine Wangen sich gerade rot färben. »Und du bist sicher, dass du keine Sonette liest und dir daraus irgendwas zusammenspinnst?«
Seine Finger streichen zärtlich über meine Wangen und mein gesamter Körper geht in Flammen auf. »Bezaubernd und bescheiden«, sagt er und senkt sein Gesicht, bis seine Lippen direkt über meinen schweben. »Vermutlich habe ich mich deswegen auf den ersten Blick in dich verliebt. Du strahlst diese Anziehung aus, der man sich einfach nicht entziehen kann.«
»Wenn wir nicht schon ein Paar wären, würde ich denken, du willst mich abschleppen«, sage ich, aber es klingt nicht so neckisch, wie ich es mir wünschen würde. Vielmehr bin ich atemlos, weil alles in mir wegen seinen Worten kribbelt.
Kegan hebt seine Mundwinkel. »Ich habe heute Nachmittag frei. Wir könnten also …«
Ich schlage ihm mit dem Buch gegen den Oberarm und er lacht. »Ich muss heute im Laden aushelfen«, verkünde ich.
»Schon wieder?« Kegan atmet geräuschvoll aus. »Macht dein Dad das, weil er nicht will, dass wir Zeit zusammen verbringen?«
»Ich denke, er will nur vermeiden, dass du mir das Herz brichst, wenn du in einem halben Jahr verschwindest«, antworte ich. Der Stich in meiner Brust erinnert mich daran, dass Kegan im Sommer wieder nach Irland zurückkehren wird, weil sein Auslandsjahr zu Ende ist.
»Darüber haben wir doch schon geredet«, meint er mit einem Mal ernst. »Du könntest mit mir kommen, wenn du möchtest.«
»Und bei dir wohnen?«, hake ich nach und schüttle den Kopf. »Nicht mal wenn Dad deine Eltern vorher kennenlernen würde, wäre er einverstanden. Und ich kann nicht wegziehen, weil wir das Geld nicht haben. Das weißt du.«
»Ich könnte dir helfen«, versucht er, mich zu überzeugen. »Überleg es dir. Ich möchte nicht, dass unsere Beziehung endet, wenn ich nach Hause zurückgehe.«
Er lehnt seine Stirn an meine und Wärme breitet sich auf meiner Haut aus. Kegan fühlt sich immer an, als wäre er gerade aus dem Warmen gekommen, selbst wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Aber wenn ich in seiner Nähe bin, erfüllt mich nicht nur Wärme, sondern auch Liebe. Ich bin mir sicher, wenn seine Finger nicht mit meinen verschlungen wären und er mich nicht festhielte, würde ich fortschweben.
»Ich habe noch nie so viel für jemanden gefühlt wie für dich, Lyra«, raunt er. »Versprich mir, dass du es dir zumindest überlegst, bis ich gehen muss.«
»Kannst du nicht einfach hierbleiben?«, spreche ich die Frage aus, die ich schon so oft gestellt habe.
»Nein, du weißt, dass ich das Familiengeschäft übernehmen muss«, erwidert Kegan wie immer.
Seine Familie besitzt eine Brauerei, die wohl ziemlich gut läuft. Kegan und seine drei Brüder sollen nämlich alle in das Geschäft einsteigen.
»Ich weiß.« Mit einem Seufzen hebe ich meinen Kopf. »Lass uns jetzt nicht darüber nachdenken. Wir haben noch ein paar Monate.«
Ich versuche, nicht so bedrückt zu klingen, wie ich mich fühle. Jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, wird mir schwer ums Herz. Kegan wirkt ebenfalls niedergeschlagen.
»Hey«, sage ich und lächle ihn an. »Wie wäre es, wenn ich mich nach dem Abendessen rausstehle und wir uns unter der alten Eiche treffen?«
»Wirklich, unter der Eiche?«, fragt er und hebt seine Augenbrauen. »Da ist es ziemlich kalt. Kommst du denn danach mit mir ins Wohnheim?« Er lehnt sich nach vorn und seine Lippen streifen meine Schläfen, während er weiterspricht. »Wir beide wissen doch, dass ich dich anschließend aufwärmen sollte, wenn wir uns bei der Eiche treffen.«
»Ach, und du denkst, ich komme einfach so mit?«, frage ich neckisch und drücke das Buch gegen seine Brust, als er nach mir greifen will.
»Etwa nicht?«, hakt er nach und springt auf, nachdem ich mich erhoben habe.
»Hm, vielleicht sollte ich heute nicht zur alten Eiche gehen«, murmle ich vor mich hin und schultere dabei meine Tasche.
»Das würdest du mir nicht antun«, sagt Kegan mit aufgerissenen Augen und greift sich theatralisch an die Brust.
»Na, du bist dir deiner Sache in letzter Zeit zu sicher«, entgegne ich.
Kegan läuft an mir vorbei und baut sich vor mir auf. Sein Blick ist ungewöhnlich ernst, als ich zu ihm aufschaue. Er ist mindestens einen Kopf größer als ich und seine Schultern sind breit. In der gefütterten Lederjacke wirkt er reifer und verflucht sexy. Ein bisschen wie Captain America, nur noch attraktiver. Für Rugby ist er definitiv geeignet und es wundert mich nicht, dass er der Kapitän der College-Mannschaft geworden ist, obwohl er nur ein Jahr hierbleibt.
»Ich ziehe dich doch nur auf«, erklärt er und legt seine Hände auf meine Oberarme. »Mir reicht es schon, wenn ich neben dir sitzen und dir zuhören darf, wie du über Sonette sprichst.«
Mein Herz beginnt zu flattern und ich lächle. »Wirklich?«
»Wirklich.« Er nickt. »Solange du bei mir bist, ist sogar dieser langweilige Kram aufregend.«
Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und seufze, als meine Lippen auf seine treffen. Kegan lässt seine Hände über meine Arme streichen. Bevor ich meine Finger in seinem Nacken verschränken kann, löst er sich von mir.
»Kommst du heute Abend zur Eiche?«, fragt er und sieht mich an wie ein Welpe, der um ein Leckerchen bettelt.
»Halb zehn«, erwidere ich und stehle mir noch einen Kuss. »Lass mich nicht warten.«
»Niemals«, verspricht er und lässt mich los. »Bis später.«
Ich weiß, dass er immer noch hinter mir steht, vermutlich seine Hände in die Hosentaschen schiebt und mir nachsieht. Das macht er immer. Also gehe ich betont langsam über das Unigelände, halte erst am gusseisernen Tor an und drehe mich um. Kegan hebt seine Hand und ich winke ihm zurück. Dann trete ich hinaus.
Der Campus mit den vielen Lehrgebäuden und dem idyllischen Park, in dem ich gerade noch gelesen habe, liegt mitten in der Stadt Edinburgh. Alte Häuser aus braunen Steinen säumen die Straße, die mich zum Laden meines Vaters führt. Es sind zwar einige Autos unterwegs, trotzdem ist es ziemlich ruhig, was bestimmt an der Tageszeit liegt. Mittag ist vorbei, die Rushhour am Abend hat noch nicht begonnen.
Ich biege von der Hauptstraße in eine Seitengasse und bleibe vor dem großen Schaufenster eines windschiefen Hauses aus Backstein stehen. Der Rahmen um das Glas war mal leuchtend rot, jetzt sieht er eher bräunlich aus und die Farbe ist abgeblättert. Auch das Schild aus Zinn ist verrostet und nur noch schwer lesbar. Aber irgendwie passt es zu dem Laden, in dem mein Dad Antiquitäten verkauft.
Die Glocke über der Tür, die sicher so alt ist wie Edinburgh selbst, klingelt, als ich eintrete. »Dad, ich bin zurück vom College!«, rufe ich, weil der Laden, von dem Bimmeln abgesehen, vollkommen still ist.
Mein Blick schweift über die unzähligen Stücke, die hier stehen und auf einen Käufer warten. Alte Bücher mit Ledereinband, ein Globus, der mich an Spionagefilme erinnert, weil eine Minibar in ihm Platz hat, Statuen, Schilde und Möbelstücke aus der viktorianischen Zeit, sowie die Vitrine mit den Schmuckstücken. Dazwischen entdecke ich einige Kartons und ich ahne, warum mein Vater meine Hilfe benötigt.
»Dad?«, rufe ich noch mal.
Dann atme ich tief ein. Der Laden schenkt mir eine seltsame Ruhe. Was vermutlich daran liegt, dass ich hier aufgewachsen bin. Meine Mum starb kurz nach meiner Geburt und Dad hat mich alleine großgezogen. An dem Verkaufstresen, der eigentlich ein Esstisch ist, habe ich laufen gelernt. In dem Schrank, der angeblich der letzten schottischen Königin – Maria Stuart – gehörte, habe ich mich immer versteckt. Ich habe gehofft, dass dahinter eine verborgene Welt liegt, die man durch die Schranktüren betreten kann.
Als Kind habe ich wohl zu oft ›Die Chroniken von Narnia‹ gelesen. Heute weiß ich, dass dort bestenfalls Wollmäuse ihr Dasein fristen. Kein magisches Reich, in dem es Hexen, Faune und andere mystische Wesen gibt.
Trotzdem wirkt dieser Laden manchmal ein wenig verzaubert. Wenn die Sonnenstrahlen wie jetzt durch das Fenster fallen, leuchten die winzigen Staubpartikel wie Gold auf und hüllen alles in ein magisches Licht.
Meine Finger kribbeln bei dem Gedanken und es knistert, als würden Feuerfunken auf trockenes Holz treffen. Eine seltsame Kraft durchströmt meinen Körper und ich hebe wie in Trance die Hand in Richtung des Schranks an …
»Oh, Lyra«, sagt mein Vater und die Kraft, die ich gerade gefühlt habe, verschwindet. »Ich habe dich gar nicht gehört.«
»Ich habe gerufen«, erwidere ich und blinzle.
Meine Schläfen pochen wie immer, wenn ich in diesen komischen Zustand gerate. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, von etwas in Besitz genommen worden zu sein. Ich traue mich nur nicht, darüber zu reden. Von Kegan abgesehen halten mich die meisten meiner Mitstudenten ohnehin schon für seltsam. Und Dad will ich damit nicht belasten.
»Entschuldige, ich war kurz oben, um etwas zu essen. Möchtest du ein Sandwich?«, fragt Dad.
Seine rötlichen Haare sind wieder etwas zu lang geworden, weil er nicht zum Friseur geht, obwohl ich ihn mehrmals daran erinnert habe. Rund um die blauen Augen hat er ziemlich tiefe Falten für sein Alter und seine Haut wirkt blass. Aber er lächelt, wie immer. Ich habe ihn noch nie traurig gesehen.
»Ich habe mein Lunchpaket erst vor einer Stunde gegessen«, erwidere ich und deute auf die sieben Kartons. »Überraschungspakete?«
Dad dreht sich in die Richtung und das Lächeln vertieft sich. »Ja, waren Schnäppchen bei einer Online-Auktion. Ich habe extra auf dich gewartet.« Er tastet auf seiner Brusttasche herum. »Wo habe ich denn jetzt die verflixte Brille gelassen?«
»Auf deiner Stirn, Dad«, sage ich mit einem Schmunzeln.
Er greift an seinen Haaransatz und lacht. »Was täte ich nur ohne dich, Schatz?«
Bei seinen Worten bekomme ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mehr als einmal darüber nachgedacht habe, mit Kegan zu gehen. Es stimmt, dass ich nicht an einem anderen Ort studiere, weil ich meinen Dad nicht finanziell belasten will. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich hätte kein gutes Gefühl, ihn alleine zu lassen.
»Wieso schaust du denn so traurig?«, fragt Dad und ich blinzle.
»Tue ich doch gar nicht«, erwidere ich mit verkrampftem Lächeln. »Ich überlege nur, welche Kiste ich als Erstes nehme.«
»Hm«, brummt Dad. »Dann such dir eine aus, Schatz.«
Er reicht mir ein Teppichmesser und wartet, bis ich einen Karton gewählt habe. Dann nimmt er ebenfalls einen und wir suchen uns einen Platz, um sie auszupacken. Ich trenne das Klebepapier auf und hole Handschuhe aus einer Schublade. Seit ich einmal eine halb verweste Ratte aus einer Auktionskiste gezogen habe, bin ich vorsichtig. Immer wieder liegen Dinge in diesen Kisten, die man nicht berühren will. Ich habe schon die Überreste einer Tarantel gefunden oder Scherben und andere Dinge, an denen man sich verletzen kann. Zwar habe ich eine Tetanusimpfung, aber ich möchte trotzdem nicht wieder in die Notaufnahme, um mich nähen zu lassen. Die Handschuhe verhindern zumindest die gröbsten Verletzungen. Und den Kontakt mit toten Insekten und Tieren.
»Viel Glück!«, sagt Dad und kümmert sich um seinen Karton.
»Dir auch«, entgegne ich.
Ab jetzt reden wir nicht mehr. Wir beide versinken in diesen Schatzkisten, die immer eine Überraschung bereithalten.
Ich öffne den Deckel und der Geruch nach Staub und Dachboden dringt heraus. Ganz oben liegt eine zerbrochene Figur, die einmal ein Reiter auf einem Pferd war. Die ist wohl hinüber. Darunter ist eine vergilbte Zeitung ausgebreitet, als hätte jemand die Dinge verstecken wollen. Ich nehme sie heraus und betrachte das Chaos in dem Karton.
Ein Teddybär, der alt und verstaubt aussieht, liegt mit dem Gesicht nach oben darin. Ihm fehlt ein Auge, aber er hat eine Marke im Ohr. Also könnte er, wenn man ihm etwas Liebe und Zuwendung zukommen lässt, vielleicht sogar wertvoll sein. Ich lege ihn auf eine Seite, wo die Dinge hinkommen, die wir behalten werden. Danach finde ich eine Tasse mit Goldrand, die – wie durch ein Wunder – unversehrt ist. Auch sie kommt zum Teddy.
Das Holzkästchen mit den Schnitzereien braucht auf jeden Fall eine neue Lasur. Ich öffne es und betrachte den blinden Spiegel, in dem ich nicht einmal verschwommen mein Gesicht sehen kann. Trotzdem weiß ich, dass meine Augen waldgrün schimmern und meine Haare im Sonnenlicht einen leichten Rotstich haben, obwohl die Locken sonst dunkelbraun sind.
Auch wenn das Kästchen ein wenig Arbeit machen wird, lege ich es auf den Behalten-Stapel. Was nicht dort landet, ist der Schmuck, den ich überall verstreut in der Kiste finde. Der ist so angelaufen und ganz offensichtlich kein echtes Silber, sodass ihn wohl niemand haben will. Auch die zwei kaputten Teller, die ich heraushole, werde ich wegwerfen.
Dann fällt mein Blick auf einen Traumfänger. Er sieht neu aus und liegt zwischen vergilbten Zeitungsblättern und Bruchstücken eines Porzellantellers, der wohl im neunzehnten Jahrhundert gefertigt wurde.
»Was machst du denn hier?«, frage ich, als könnte er mir das beantworten.
Behutsam lege ich meine Finger an den schwarzen Rahmen. Aus was der wohl besteht? Er fühlt sich kalt wie Metall und gleichzeitig weich wie Leder an. Die Fäden, die dieses Netz, das wie eine Blüte geformt ist, bilden, sehen so hauchdünn aus, als bestünden sie aus Spinnweben. Sie sind allerdings erstaunlich fest.
»Ich habe schon wieder einen Traumfänger gefunden«, rufe ich meinem Dad zu.
»Du ziehst die Dinger ja in letzter Zeit magisch an«, erwidert er nuschelnd.
»Ja, seltsam, oder?«
Dad antwortet nicht mehr. Wir haben schon mal darüber gescherzt, dass in den letzten drei Wochen mindestens fünf Traumfänger in Überraschungskisten drinnen waren, die ich geöffnet habe. Sie waren alle unterschiedlich groß und besaßen andere Farben. Alle waren schön, aber dieser hier … der ist besonders.
In der Mitte sitzt ein Stein, der ein Herz sein könnte. Aber die Form lässt sich nicht eindeutig zuordnen. Die Oberfläche des Steins schimmert, je nachdem, wie ich den Traumfänger drehe, in einer anderen Farbe. Einmal sieht es grünlich aus, dann blau, dann wieder grau …
Ich kann nicht aufhören, den Traumfänger anzusehen. Jetzt, da ich ihn ins Licht halte, erkenne ich, dass der Rahmen nicht schwarz ist, sondern dunkelblau. Und auf den Fäden funkeln winzige silberne Lichter, als würde sich der Morgentau darauf sammeln.
Etwas verleitet mich, die Fäden noch einmal zu berühren. Ich will dieses Silber in mir aufnehmen, so verrückt es auch klingt. Ich hebe meine Hand an und meine Fingerspitzen schweben über dem Netz. Einen Atemzug zögere ich, dann fasse ich einen der winzigen silbernen Punkte an.
Ein Klang wie aus zehn Dudelsäcken explodiert in meinen Ohren und ich werde von den Füßen gefegt. Ächzend lande ich auf dem Rücken. Alle Luft wird aus meinen Lungen gepresst und ich kann mich nicht rühren. Nur hochblicken.
Über mir schwebt Wasser. Es ist, als würde ich auf einen ruhigen See blicken. Nur dass ich unter ihm liege und meinem Spiegelbild über mir in die aufgerissenen Augen sehe. Bin ich gerade gestorben? Ist das eine Nahtoderfahrung?
Hinter meinem Spiegelbild geht der Mond auf. Erst silbern, dann färbt er sich so dunkelblau wie der Traumfänger, den ich immer noch festhalte, und schließlich golden. Geschwungene Linien aus silbernem und goldenem Licht zeichnen etwas auf die Mondoberfläche, die wieder dunkelblau geworden ist. Es dauert eine Weile, bis ich einen Baum erkenne. Im selben Moment beginnt die Wasseroberfläche trüb zu werden.
Tropfen fallen auf mich herab, aber sie fühlen sich nicht nass oder kalt an. Sie sickern in meine Kleidung und meine Haut. Wärme flutet meinen Körper und als der letzte Tropfen gefallen ist, kann ich mich wieder bewegen.
Gierig atme ich ein und huste dann. Mein Kopf dröhnt, trotzdem setze ich mich auf.
»Dad?«, krächze ich und lehne mich zurück, als ich seine Hände auf meinen Oberarmen fühle. »Ich glaube, ich brauche einen Arzt.«
»Du brauchst einen Soldaten«, antwortet eine Stimme, die ich nicht kenne.
KapitelZwei
Keuchend fahre ich herum und blicke in ein sonnengegerbtes Gesicht. Der Mann hat dunkelbraune Haare und Augen und lässt die Hände sinken, die mich gerade noch berührt haben. Er wirkt älter als ich, ist vermutlich so alt wie Dad, nur sieht er weniger verbraucht aus. Wo ist er auf einmal hergekommen?
»Wer sind Sie?«, frage ich und rücke von dem Fremden ab, bis mir ein Tisch den Weg versperrt. Er ist groß, größer als Kegan. Allerdings sind seine Schultern ziemlich schmal, aber das bedeutet nicht, dass keine Gefahr von ihm ausgeht.
»Im Moment dein Leibwächter«, erwidert er. Unsere Blicke treffen sich. »Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Endlich sind deine Kräfte erwacht.«
»Kräfte?«, stammle ich und schlucke gegen die Trockenheit in meiner Kehle an. Was ist hier los?
Ich betrachte den Kerl noch genauer. Er sieht aus, als wäre er gerade von einem Mittelalterfest gekommen. Seine Kleidung erinnert mich an Söldner aus Computerspielen. Er hat einen Brustharnisch aus braunem Leder mit Nieten und zusätzlichem Schutz an den Schultern und Unterarmen an. Über der Stoffhose trägt er Stiefel. Sie sind so unförmig, als hätte man das Material einfach um seine Füße gelegt und an den Schienbeinen mit Schnüren festgebunden. Ein Schwert baumelt an seiner Hüfte. Ein verdammt langes Schwert.
»Wo ist mein Vater?«, frage ich heiser und lehne mich zur Seite, um an dem Möchtegern-Ritter vorbei zu sehen. Da entdecke ich Dad und keuche. »Was haben Sie mit ihm gemacht?«
Sein Körper ist erstarrt, als hätte man ihn mitten in der Bewegung eingefroren. Erst da bemerke ich, dass der ganze Raum verändert wirkt. Nichts bewegt sich mehr, noch nicht einmal das Pendel der alten Standuhr. Dad sieht in meine Richtung und ich erkenne die Sorge in seinem Blick. Er muss mitbekommen haben, dass etwas mit mir nicht stimmt.
»Ich habe die Zeit für ihn angehalten«, erklärt der Mann vor mir und klingt ein klein wenig stolz. »Er wusste, dass das eines Tages geschehen und dass es gefährlich sein würde, dir in dem Moment, in dem deine Kräfte erwachen, nahe zu kommen. Aber er wollte zu dir, weil du ihm wirklich viel bedeutest.«
»Er ist mein Vater«, fahre ich den Kerl an. Der atmet geräuschvoll aus, aber ich lasse ihn nicht zu Wort kommen. »Was auch immer Sie ihm angetan haben, machen Sie es rückgängig.«
Er hebt eine Augenbraue. »Sonst was?«
Ich packe den ersten Gegenstand, den ich erreiche, und mache mich wurfbereit. »Sonst zeige ich Ihnen, warum ich beim Softball gefürchtet war.«
Der Kerl muss nicht wissen, dass ich deswegen gefürchtet bin, weil ich mich selbst mit meinem Wurf ausgeknockt habe und meine Querschläger echt gefährlich waren. Hoffentlich sehe ich entschlossen genug aus.
Erst betrachtet der Typ mich nur finster, dann kräuseln sich seine Lippen und er lacht. »Sarnai wird so stolz auf dich sein, wenn sie dich sieht«, bringt er hervor und räuspert sich, als wolle er das Lachen so unterdrücken.
»Wer?«, hake ich nach, bekomme aber keine Antwort.
Der Mann bewegt seine Hand Richtung Schwertgriff und ich atme scharf ein. Doch statt die Klinge zu ziehen, wandert die Hand höher und er holt etwas aus einer Tasche im Brustpanzer. Mein Herz schlägt wie wild, als ich einen feuerroten Traumfänger sehe. So einen habe ich erst vor einigen Tagen aus einer Kiste geholt.
Ohne mich aus den Augen zu lassen, berührt der Mann das Netz und die Luft um uns vibriert. Ich kann spüren, wie etwas durch den Raum fegt und die Starre löst. Dad macht mit einem Mal einen Schritt nach vorn, stolpert und fällt dem Mann mit dem Traumfänger in die Arme.
»Reuel«, keucht mein Vater, als er zu dem Kerl aufsieht.
»Lange nicht gesehen, Jason«, sagt dieser Reuel mit einem warmen Lächeln.
Dad erwidert es nicht. Zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, verfinstert sich seine Miene und er macht einen Schritt von Reuel fort, kaum dass er wieder auf eigenen Beinen steht.
»Was willst du hier?«, fragt mein Vater frostig, kommt zu mir und zieht mich in seine Arme.
Ich lasse Reuel nicht aus den Augen, der uns seinerseits viel zu intensiv mustert.
»Das weißt du genau«, antwortet er schließlich. »Ihre Kräfte sind erwacht. Sie ist hier nicht mehr sicher.«
»Sie ist noch nicht zwanzig Jahre alt«, erwidert Dad heftig. »Ihr habt gesagt, es könnte auch einundzwanzig oder mehr Jahre dauern, aber nie unter zwanzig. Es ist zu früh.«
»Du wusstest, dass der Tag kommt«, entgegnet Reuel ruhig. »Der Traumfänger hat auf sie reagiert.«
»Sie hat so lange nicht auf diese Dinger angesprochen, keine Anzeichen gezeigt«, fährt Dad ihn an. »Nur deswegen habe ich zugelassen, dass ihr sie weiterhin in ihre Nähe bringt. Weil ich sicher war, es wäre zu früh.«
Reuel hebt eine Augenbraue. »Hätte es etwas geändert, wenn es in drei Monaten geschehen wäre? Oder in vier?«
Dad beißt sich auf die Unterlippe und schweigt.
Meine Hände schwitzen und ich starre auf den Traumfänger zwischen meinen Fingern. Am liebsten würde ich ihn fortschleudern, aber ich kann nicht. Als würde mir das Ding seinen Willen aufzwingen. Absolut bescheuert.
»Ich bin ohnmächtig, oder?«, bringe ich heraus. »Das hier passiert nicht wirklich. Ich träume das alles.«
»Nein«, antwortet Reuel und seine Stimme hat einen harten Klang angenommen. »Du bist wach und die Magie, die du gewirkt hast, wird bald die Sonnenkrieger auf deine Fährte locken. Wenn ich dich nicht in Sicherheit bringe, bekommen sie dich und dann …«
»Hör auf, ihr Angst zu machen«, unterbricht Dad ihn und zieht mich enger an sich. »Sie weiß von all dem nichts. Ihr wolltet, dass sie als Mensch aufwächst, also hat sie keine Ahnung, wovon du sprichst. Du machst ihr nur Angst!«
Meine Brust fühlt sich eng an und ich bekomme kaum noch Luft. »Wovon redest du?«, bringe ich atemlos heraus. »Was meinst du mit als Mensch aufwächst? Als was sollte ich sonst aufwachsen?«
Reuel betrachtet mich, dann hebt er den roten Traumfänger in seiner Hand an und zupft an den Fäden, als würde er Gitarre spielen. Wieder vibriert die Luft und diesmal legt sich ein silberner Glanz über den Raum und alle Möbelstücke darin. Sämtliche Farbe entweicht, nur Dad, Reuel und ich sehen unverändert aus, während der Rest mich an eine Schwarz-Weiß-Fotografie erinnert.
»Der Schutzzauber wird uns ein wenig Zeit verschaffen«, erklärt Reuel, zieht einen Stuhl heran und wirft sich darauf.
Das Holz des antiken Möbelstücks knarrt laut, hält die Bohnenstange von einem Mann aber aus. Reuel stützt seinen Ellbogen auf dem Oberschenkel ab und legt sein Kinn auf die Hand. Er mustert uns und stößt dann den Atem aus.
»Willst du es ihr sagen oder soll ich?«, fragt Reuel.
Ich sehe von ihm zu Dad und mein Herz stolpert, weil seine Miene so ernst ist. Dad presst die Lippen fest aufeinander und kneift die Augen zusammen. Wenn Blicke töten könnten, würde Reuel wohl jeden Moment blutüberströmt zusammensacken.
»Dad?« Meine Stimme zittert und ist so leise, dass ich nicht sicher bin, ob mein Vater mich gehört hat.
Aber er atmet geräuschvoll aus und sieht dann mich an. Immer noch hält er mich fest, und auch wenn ich weiß, dass er mir etwas verheimlicht, will ich ihn nicht loslassen. Ich vertraue meinen Beinen im Moment nicht.
»Können wir in die Wohnung gehen?«, fragt er an Reuel gewandt.
»Sicher, das ganze Haus steht unter dem Schutzzauber«, erwidert dieser und erhebt sich. »Aber ob du es ihr hier sagst oder oben, wird keinen Unterschied machen.«
Dad ignoriert den Einwurf. Er lässt seinen Arm um meine Schultern geschlungen und führt mich die Stufen hoch in die Wohnung über dem Laden. Wir treten durch die Tür am Ende der Treppe. Auch in der Wohnung sieht alles aus, als wären wir in einer alten Fotografie ohne Farbe gefangen.
»Setz dich«, murmelt Dad und lässt sich neben mir auf dem Sofa nieder.
Er greift nach meiner Hand und ich bin nicht sicher, ob ich so zittere oder er. Reuel sinkt auf den Sessel, in dem Dad sonst immer Fußball schaut. Ich wünschte, er würde einfach verschwinden.
Bei dem Gedanken surrt der Traumfänger, den ich immer noch halte, heftig und Reuel starrt das Ding mit hochgezogenen Augenbrauen an. Dann richtet er sich auf und hebt seine Hand.
»Soll jetzt ich oder …«
»Lyra«, unterbricht Dad ihn.
»Ja?«, hauche ich und schlucke gegen den Kloß in meinem Hals an.
Dads Lippen beben und seine Augen glänzen. Er wirft Reuel einen Blick zu, bevor er wieder mich ansieht.