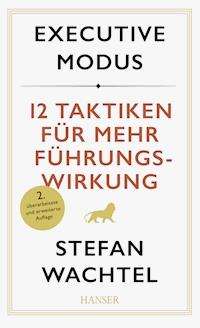Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Praktischer Journalismus
- Sprache: Deutsch
Ein gutes Radio- oder Fernsehmanuskript erleichtert Sprechen und Hörverstehen gleichermaßen: Denn wie geschrieben wird, so wird auch (vor)gelesen. Stefan Wachtel leitet aus dem Vergleich von Mündlichkeit und Schriftlichkeit Regeln zum Schreiben ab und erläutert Methoden kreativen und hörverständlichen Formulierens. Freies Sprechen kann durch professionelle Stichwortkonzepte erlernt werden. Exemplarische Sendetexte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ermöglichen ein gezieltes Schreib- und Sprechtraining. Die 5. Auflage wurde überarbeitet und aktualisiert. »Stefan Wachtel macht uns nützliche Vorschläge, die Melodie eines Satzes so zu komponieren, dass die Betonung auf dem Kern der Botschaft liegt.« Wolf von Lojewski, ZDF
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[1][2]
(Foto: H.-M. Asch)
Stefan Wachtel, Dr. phil., ist Senior Coach bei ExpertExecutive in Frankfurt am Main und berät Spitzenmanager für öffentliche Auftritte. Er war zuvor 1990 bis 1996 TV-Sprecher und Trainer bei ARD und ZDF. Wachtel schreibt regelmäßig fürs Handelsblatt und den Harvard Business Manager und ist Autor u. a. von »Achtung Aufnahme!« (hrsg. mit Nina Ruge, 1997), »Überzeugen vor Mikrofon und Kamera« (1999), »Rhetorik und Public Relations« (2003), »Sprechen und Moderieren in Hörfunk und Fernsehen« (6. Aufl. 2009) und »Texten für TV« (mit Martin Ordolff, 4. Aufl. 2013).
Kontakt: [email protected].
[3]Stefan Wachtel
Schreiben fürs Hören
Trainingstexte, Regeln und Methoden
5., überarbeitete Auflage
UVK Verlagsgesellschaft Konstanz · München
[4]Praktischer Journalismus
Band 29
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISSN 1617-3570
ISBN 978-3-86496-342-1
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Dieses eBook ist zitierfähig. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenangaben der Druckausgabe des Titels in den Text integriert wurden. Sie finden diese in eckigen Klammern dort, wo die jeweilige Druckseite beginnt. Die Position kann in Einzelfällen inmitten eines Wortes liegen, wenn der Seitenumbruch in der gedruckten Ausgabe ebenfalls genau an dieser Stelle liegt. Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler.
1. Auflage 1997
2. Auflage 2000
3. Auflage 2003
4. Auflage 2009
5. Auflage 2013
© UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und München 2013
Einbandgestaltung: Susanne Fuellhaas, Konstanz
Titelfoto: Istockphoto Inc.
Satz: Klose Textmanagement, Berlin
UVK Verlagsgesellschaft mbH
Schützenstr. 24 · 78462 Konstanz . Deutschland
Tel.: 07531-9053-0 · Fax: 07531-9053-98
www.uvk.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
[5]Inhalt
Vorwort zur 5. Auflage
Einführung: »Informationen« fürs Ohr
Erster Teil: Geschriebene Spreche – gesprochene Schreibe
1 Schreiben
2 Formen des Schreibens
3 Vorformulierte Texte?
4 Verheimlichte Schriftlichkeit
5 Schreiben und Sprechen
6 Grammatik und Rhetorik
Zweiter Teil: Regeln und Empfehlungen
1 Fürs Sprechen schreiben
1.1 Mündlich!
1.2 Die Fakten umkleiden und anbinden
1.3 Wieder und wieder!
2 Das Vorlesen im Blick haben
2.1 Vorlesen ist Überschauen und Sprechdenken
2.2 Klare Betonungen ermöglichen
2.3 Stolpersteine
2.4 Ein Kern pro Satz
2.5 Untiefen im Satz
3 Das Zuhören erleichtern
3.1 Auf Anhieb verstehen helfen
3.2 Wir hören Bilder
3.3 Klarer Textverlauf
[6]3.4 Das Innere von Sätzen
3.5 Hören läuft auf das Satzende zu
Dritter Teil: Bauformen
1 Den Stoff sammeln
2 Die Rede gliedern
3 Anfangen
4 An- und Abtexten
5 Sinn und Unsinn des Leadsatz-Prinzips
6 Manuskripte und Textgrafiken
7 Schreiben fürs Sprechen vor der Kamera
8 Hör-Texte kürzen und redigieren
Vierter Teil: Schreiben mit Methode
1 Training
2 Kritik und Kriterien
2.1 Gespräche über Hör-Texte
2.2 Denkstil – Sprachstil – Sprechstil
3 Texte planen
3.1 »Free Writing«
3.2 Assoziieren mit Methode: Mind Maps
3.3 Rhetorisch Anordnen
4 Wege zu hörverständlichen Sätzen
4.1 Schreiben in Sinnschritten
4.2 Der »Umweg« über Stichwörter
4.3 Um-Schreiben fürs Hören
[7]Fünfter Teil: Trainingstexte
1 Texte zum Sprechtraining
1.1 Fähigkeiten ermitteln
1.2 Sinngliederung
1.3 Betonungen auswählen
1.4 Sprechausdruck
1.5 Aussprache
2 Texte zum Um-Schreiben fürs Hören
2.1 Pressemitteilungen
2.2 Agenturmeldungen
2.3 Moderationen
3 Texte zum Übertragen in Stichwörter
4 Texte für Castings
Schluss: »Bewusstlosigkeiten« in Funktexten
Literatur
Index
[8]Vorwort zur 5. Auflage
»Ganz gut, aber sprachlich?«, »Nicht richtig lebendig«, »Zu langweilig«, »Was soll mir das sagen?«, oder auch: »Alles verstanden!«, »Hat mich gut mitgenommen.« So oder ähnlich wird über gesprochene Texte geurteilt. Es gibt intuitive Kriterien für Hör-Texte in Radio und Fernsehen. Also muss es auch Empfehlungen für das Texten zum Hören geben. Und gibt es sie, dann lassen sie sich auch begründen.
Der Sprachstil der Zeitung verfehlt das Ohr. Wer zum Hören ungeeignete Texte vorliest, muss damit rechnen, dass er schlicht nicht verstanden wird. Wer Unsprechbares schreibt, wird falsch betonen. Attraktive, verständliche und überzeugende Funktexte brauchen deshalb handwerkliche Grundlagen. Wer das erlernen will, ist zumeist auf Hinweise von Kollegen angewiesen oder versucht, so zu schreiben wie diese. Solche Tipps sind aber selten systematisch, nicht selten verallgemeinern sie sehr subjektive Erfahrung, manchmal sind sie falsch. An der Regel fehlt es nicht, wohl aber an seiner einsichtigen Begründung.
Neu zu formulieren sind inzwischen einige Regeln, die sich nicht aus der oft blinden Praxis herleiten lassen. Deshalb habe ich sprechwissenschaftliche und wahrnehmungspsychologische Erkenntnisse angewandt und daraus schließlich Empfehlungen für das Schreiben von Hör-Texten abgeleitet. Das Buch teilt also nicht nur mit, wie in den Sendern allenthalben geschrieben wird, sondern es macht auch das Regelwerk verständlich. Vor allem schlägt es Methoden vor, die man in der gängigen Stilistik nirgendwo vorfindet.
Der Aufbau setzt die Begründungen vor die Ratschläge: Die ersten drei Teile entwickeln das Verhältnis von Information, Schreiben, Sprechen, Vorlesen und Hören, um daraus Empfehlungen abzuleiten. Der vierte Teil beschreibt die Methoden. Der fünfte Teil enthält deutschsprachige Originaltexte aus Hörfunk und Fernsehen als Vorschläge zum Schreib- und Sprechtraining und für Demos.
»Schreiben fürs Hören« ist während meiner früheren Arbeit in der Aus- und Fortbildung von Hörfunk- und Fernsehjournalisten entstanden. Dieses Buch ist zugleich das Pendant zu dem Klassiker »Sprechen und Moderieren in Hörfunk und Fernsehen«, der im selben Verlag erschienen ist. Für diese fünfte Auflage habe ich kleinere Textkorrekturen vorgenommen, einige Trainingstexte ausgewechselt und die Literaturhinweise aktualisiert.
Ich danke allen, die mit mir ihre Texte diskutiert haben, namentlich denen, die mir Hinweise gaben oder mehrere Texte zur Verfügung stellten: Stephan Becker (Fundamentals Production Frankfurt/M.), Susanne Becker (ZDF), Silvia Braun [9](ORF), Carola Ferstl (n-tv), Joachim Filliés (WDR, ZDF), Karen Fuhrmann (HR), Knut Galden (SWR), Hellmut K. Geißner (Lausanne), Norbert Gutenberg (SR, Universität Saarbrücken), Jutta Odile Heß (ZDF), Bernd Liesert (Pro Sieben), Wolf von Lojewski (ZDF), Frank Lorenz (Leipzig), Martin Ordolff (ZDF), Kirsten Ripper (Euronews), Jost Samson (SAT.1), Hanns Martin Schäfer † (Schweizer Fernsehen DRS), Jürgen Schmidt (SWR), Wolf Schneider (Starnberg), Angela Schöneberg (ZDF), Christoph Seydel (ExpertExecutive, Frankfurt a. M.), Edith Slembek (Universität Lausanne), Silke Tschorn (Bloomberg TV), Bettina Warken (ZDF). Tobias Gebhardt-Seele, Dorothea Schuler und Günter Wirth danke ich für Korrekturvorschläge und Pit Kalla für die Grafiken. Für Kritik danke ich meiner Frau Sabina.
Frankfurt am Main, im Juni 2013
Stefan Wachtel
[10][11]Einführung: »Informationen« fürs Ohr
»Allgemein aber gilt:
Das Geschriebene muss sich leicht vorlesen lassen.«
(Aristoteles, Rhetorik, 1407b)
»Wir informieren uns zu Tode«. Neil Postman überzeichnet einen Umstand, der nun schon seit langem gefeiert wird: Eine nie da gewesene Menge an Informationen. Und sogleich auch fallen einem »Informationsflut« oder »Informationsdichte« ein. Und wirklich, viele dieser Informationen sind oft nicht zu gebrauchen und viel weniger hörend zu »verarbeiten« – zu verarbeiten allenfalls noch im Computer, dann aber auch wieder nur zu bloßen »Informationen«. Wer mit Radio und Fernsehen informieren will, braucht sprachliche Formen speziell für das Ohr. Informieren aus Lautsprechern findet seine Grenze am Hörverstehen.
Warum sind vorgelesene Texte oft so schwer zu verstehen? Wo liegen die Probleme im Einzelnen, die »Schreiben fürs Hören« als Handwerk nötig machen? Ich sehe drei Hauptprobleme in Texten für Hörfunk und Fernsehen: die fehlende Situierung von Informationen, die Verdichtung und die Unpersönlichkeit. Diese Probleme sind zunächst darin begründet, dass in Hörfunk und Fernsehen meist mehr Informationen vorliegen als sinnvoll vermittelt werden können. Zudem sind die Informationen oft zu wenig am Hörer orientiert (vgl. Geißner 2000).
Fehlende Situierung
Journalistische Texte werden leider oft für Chef und Abnahme geschrieben und weniger für die Zuhörer und Zuschauer. In der Regel fallen dann die altbekannten Sprachmuster nicht mehr auf. Was oft gelesen und gehört wurde, wird bereitwillig akzeptiert und immer wieder gern genommen. Oft verlangt noch die Abnahme alle »Infos«, was nicht immer der Verständlichkeit dient. Vielfach ufert Gesprochenes in Hörfunk und Fernsehen auch in Geschwätz aus. (In einem Training sagte einmal eine Cutterin, der gesprochene Text komme ihr wie eine Art Atmo vor). Die gesprochene Information aus Funktexten rauscht vorbei, wird oft nicht als natürlich und damit schwerlich als glaubwürdig empfunden – sie besteht nicht selten aus [12]unverbundenen, stereotyp vorgelesenen »Infos«. In vielen Texten wird den Hörern nicht rhetorisch vermittelt, warum sie das anhören sollen. Aber nur das Schriftliche, nicht das Mündliche, vermittelt Wissen pur und von Situationen tendenziell entbunden (vgl. Ong 1987, 47 ff.). So mancher Funk-Journalismus erspart sich eine situierende Anbindung an die Zuhörer mit Methode; immer mehr Formate verlangen nicht selten sogar eine »abgehackte Sprechweise«, »ganz kurze Sätze« oder auch: »keine Verben«. Kein Warum und Wozu, am Ende nur noch Substantive und Schlagzeilen, was nicht zu einem Sprechstil führt, in dem wir gern sprechen hören oder den wir verstehen. Leider sind auch dafür allzu schnell »praktische« Tipps zu haben, zum Beispiel: Nur noch »facts«.
Das mag kulturell folgerichtig sein. Was etwa in den US-amerikanischen Medien schon seit Jahrzehnten zu beobachten ist, scheint nun mit der üblichen Verzögerung auch hier zu gelten: Wir hören eine fragmentarische Funksprache, die aus »Informationen« besteht, die sich selbst als ihr eigener Kontext genug sind, und nicht selten scheint es, als sei sie nicht eigentlich an jemanden gerichtet. Das Verständnis von Information als kontextlose Auflistung ist inzwischen zu einem festen Muster des journalistischen Schreibens für Hörfunk und Fernsehen geworden. Diese Sprache dient einer eigentümlichen Informiertheit, der es nicht anders ergeht als Formen losgelösten Wissens, deren Anwendung das Lösen von Kreuzworträtseln ist.
Radio- und Fernsehkonsumenten hören nicht selten altkluge Sätze von der folgenden Art (Auszug aus einer ZDF-Nachrichtensendung, nicht eines Kulturmagazins!): »… Und es sieht ganz so aus, dass der neue starke Mann im Kreml Wladimir Putin sein wird, der Mann aus dem Dunkel der Geheimdienste, Kriegsherr, künftiger Präsident eines schwer angeschlagenen Landes. Demokratie oder Autokratie – wohin wird diese Wahl Russland führen?« Eine solche Metaphorik würde kein Mensch frei reden, sie geht auch schlecht ins Ohr. Hinzu kommt, dass dieser Text in einen Teleprompter geschrieben wurde – obwohl er die »freie« Antwort auf eine Frage in einem Schaltgespräch war. Hier wird aufgeblähte Bildung vorgeführt, wo einfach nur Menschen zueinander reden sollten.
Die »informierte« Geschwätzigkeit der elektronischen Medien hat ihr Gegenstück in der Sprachlosigkeit der Zuhörenden. Diese ist sicher nicht von Redakteuren und Autoren gewollt. Sie wird jedoch von nicht wenigen Sendern und deren »Philosophien« zumindest gefördert – meist mit dem Wunsch, viele Informationen zu bieten. Nur, mehr und »informativer« zu reden, das vermag die Sprachlosigkeit der Zuhörer und Zuschauer leider nicht aufzulösen, entgegen den Wünschen gut meinender Medienpädagogen. Der »gut informierte« Journalist und der verständnislose Zuhörer, beide gehören zusammen, wo und so lange es wenig kümmert, ob die Informationen wirklich verstanden werden.
[13]Verdichtung
An Quantität fehlt es also nicht – wohl aber am Verstehen. Sind es am Ende die partout nicht digitalisierbaren Prozeduren selbst, die noch immer Probleme machen, weil Menschen beteiligt sind: Schreiben, Vorlesen, Sprechen, Hören? Dabei scheint das Hören am schwersten betroffen zu sein: Wer liest, kann auswählen, beiseite legen. Wer hört, ist dagegen unmittelbar ausgesetzt, bekommt oft genug nur Information pur. Ein »Zurückhören« ist nicht möglich, und auch das nachträgliche »Zurechthören« mühsam, besonders mit unverbundenen und dichten Informationen. »Alle Infos sind drin!« heißt es in Kritikgesprächen geradezu beschwörend – nur, kommen sie auch wieder raus? Fürs Hören schreiben als Methode der sprachlichen Informationsverdichtung?
Immerhin haben die Produktionsbedingungen gegen die Informationsfülle den Mangel an Sendezeit parat, der der Quantität des Textes Grenzen setzt. Begriffen ist darum längst, dass Techniken her müssen, diese Fülle zu bändigen. So wird schließlich sprachlich nur noch erwähnt und »angesprochen«, vielleicht abgelesen am Modell des Computers, der Informationen lediglich aufnimmt und verarbeitet. Das wird weniger verwunderlich, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir uns als Anwender oft wie unsere Computer verhalten, die ja Informationen nur sammeln: Immer bedeutender scheint es allemal zu sein, eine Sache aufgenommen, von einer Sache gehört zu haben, als sie zu verstehen. Insofern kommt die kontextlose Sprache der elektronischen Medien der herrschenden Kommunikationspraxis entgegen. Ein Sammelsurium nicht situierter Informationen schließlich geht immer weniger in Handeln ein. Die Funksprache ist Ergebnis derselben Kultur, die auf das Gespräch nicht mehr viel gibt. Nur wenige »kommunikative« Anteile enthalten die Texte. Radio und Fernsehen sind Orte einer neuen Mündlichkeit geworden, die weder wie die ursprüngliche mündliche Kultur dialogisch ist noch durchgehend die Tiefe des Schriftlichen erreicht.
Wenn das Schreiben fürs Hören auf das lebendige Sprechdenken mithilfe des Textes zielt, dann kann es sich nicht an quasi-mathematisch gewonnenen Verständlichkeitsforderungen orientieren: Text schreiben wie Text lesen wie frei sprechen heißt nicht allein Fakten vermitteln oder transportieren. Hörverstehen ist auch nicht bloße Informationsverarbeitung. Das bedeutet, dass sich die Informationen des Textes nicht ungestraft verdichten lassen. Ein krasses Beispiel: Eine Ursache kann begrifflich nur gegeben sein, wenn eine Folge vorliegt, da sie ihrem Wesen nach erst mit der Folge entsteht. Mittelbare Folgen sind Folgen unmittelbarer Folgen. Demzufolge kann eine mittelbare Ursächlichkeit nur bestehen, wenn eine unmittelbare Folge der Ursachen zu weiteren Folgen geführt hat. Unter mittelbarer Ursächlichkeit ist also das Hervorrufen von Folgen eines unmittelbaren Ereignisses oder Zustandes zu verstehen.
[14]Das Beispiel mag plausibel machen, dass äußerste, hier sogar präzise Verknappung kaum mehr verständlich, ganz sicher aber nicht hörverständlich ist. Hörverstehen benötigt auch auflockernde Elemente, eine Redundanz etwa, die keine neuen Sinnangebote macht, sondern vorher Gesagtes erneut aufnimmt.
Aber nicht nur Verdichtung, auch Verkünstlichung erschwert Hörverstehen. Nicht selten werden Bilder und Wortspiele kreiert, die ihre spätere Übersetzung ins Mündliche scheinbar vergessen machen wollen. »Zuhören wird zur Kunst, wenn Friedrich Küppersbusch wortgewandt und rasant loslegt«, klapperte stolz der Klappentext einer Moderationen-Sammlung. Was wohl bewundert, aber oft nur schwer hörverstanden werden kann, bietet sich später an, es »in aller Ruhe zu genießen und nachzulesen« (vgl. Küppersbusch 1995).
Vor allem Texter aus Kunst und Kultur, deren »Sendung« oft unverhohlen literarisch ist, schreiben selten hörverständlich. Legitim mag das insoweit sein, als, wer Kunst und Kultur hören/sehen will, auch ästhetische Sprache verträgt oder erwartet. Riskant und absurd aber wird der ziselierte Stil des Feuilletons, wenn er auf Kosten der Sprechbarkeit und Anhörbarkeit geht (vgl. Ordolff/Wachtel 2013). Auf manchen hergebrachten Plätzen in Hörfunk und Fernsehen lebt dieser literarische Stil noch fort; andere neuere Medien können sich das nicht gestatten. Eine Entwicklung zur einfacheren, verständlicheren Form ist schon jetzt am Erfolg von Produkten zu beobachten, die sich stärker am Markt orientieren. Gerade dort, in Video- und CD-ROM-Produktionen oder für das Internet etwa, wird spätestens bei der Sprachaufnahme aussortiert und umgeschrieben, was als Text nicht verständlich vorliegt.
Verdichten wie Verkünstlichen geht sehr gut mit geschriebenen Texten; sie lassen sich lesend kontrollieren und sie versprechen überdies die Gewähr für »gute Sprache«. Scheinbar lässt sich über den Weg des Textverfassens auch mehr, mit einem Begriff der Branche: »unterbringen«. Wirkt sich das Vorformulieren von Texten positiv auf den Inhalt aus? Da scheint das Beispiel des auswendig lernenden Kunstmoderators die positive Ausnahme zu sein. In den allermeisten Fällen scheint im Gegenteil »Schriftlichkeit keine Gewähr für Inhalt zu bieten, wie den z.T. schriftlich vorformulierten Moderationen der Hörfunk-›Fließwellen‹ unschwer anzumerken ist« (Gutenberg 1989, 116).
Auch belehrende Ideologie kommt uns aus Rundfunktexten entgegen. Dem Journalismus der »besseren« TV-Magazine zeichnet etwas bis heute ganz besonders aus, von »Monitor« bis »Spiegel-TV«: Es ist die väterliche Belehrung aus dem Bildschirm, das Abgewogene, Moralische der Anführer einer Gemeinde, die vom allwissenden Moderator geleitet wird. Heraus kommt »der Moderator mit dem Bednarz-Blick des guten Menschen von unten und dem strengen Blick des journalistischen Profis von oben, mit stets reinem Gewissen. Der Blick bereitet den Zuschauer vor, das Magazin nimmt ihn auf als Teil einer Gemeinde, die vom Moderator selbst [15]angeführt wird. Es ist immer derselbe Bednarz-Blick, gleich welcher Moderator durch die Sendung führt. Die Moderation, Blick, Haltung und Satzmelodie – sie erzeugen eine Stimmung bei dem, der vor seinem Bildschirm sitzt« (Kohn 1996, 114). Diese Moderationspredigt wird nie von der Lesehilfe Teleprompter lassen, sie könnte ohne ihn den Menschen ja nicht länger vor der Rolle verstecken. Freies und dennoch vorbereitetes Reden würde da nur stören.
Nicht nur vom Teleprompter können die allermeisten Fernsehbeamten nicht lassen. Sie können es auch nicht lassen, schon in der Moderation, die ja lediglich für das Thema interessieren soll, zu sagen, was man vom Folgenden zu halten hat. Journalismus ist auf Wahrheit, Objektivität und Aufklärung aus.
Aber selbst der Informationsjournalismus des Rundfunks ist vor allem in den Politmagazinen eminent rhetorisch. Er leistet Überzeugungsarbeit und liefert die Appelle gleich mit – oft noch bevor sich der Rezipient ein Bild machen kann (Müller-Ullrich 1996, 13 f.). Zwei Anfangssätze von Bednarz-Moderationen:
Auch unser nächster Bericht ist, wenn sie so wollen, ein Aufruf zur Abrüstung
…
Auch unser nächster Bericht klingt unglaublich, ist aber wahr.
Unpersönlichkeit
Auch einer möglichen »Ideologie der Sachlichkeit und Nichtpersönlichkeit« (Gutenberg 1989, 117) kommt das Textverlesen zupass. Reibungslosere Produktion, kein Ärger, alles fließt besser, und wer mit Textsicherheit (vor-) produziert, erreicht alle Mal, sich nicht zu versprechen. Und wer schreibt, dem bieten sich auch schon die journalistischen Sprachmuster an, die in vielen Medien ähnlich sind. Zum Einerlei des Dudelfunks scheint auch das Einerlei der Sprache zu gehören.
Eine solche sprachliche Gleichförmigkeit kommt freilich nicht nur daher, dass Texte abgelesen werden; vorformulierte Texte zu sprechen macht die sprachliche Standardisierung allerdings leichter. Zudem macht das vorherige Textverfassen die Schere im Kopf schärfer, die nichts Verfängliches zulassen soll – die Texte werden ja »abgenommen«. Was aber, wenn der Hörer Verfängliches braucht, damit er überhaupt »reinhört«? Schließlich kann das spätere Text-Vorlesen fast bewusstlos geschehen: Was bereits formuliert ist, muss beim Vorlesen nicht mehr gedacht werden. Dann ist es nicht mehr verwunderlich, wenn auch der Sprechstil flach wird. »Zum einen Ohr rein, zum anderen wieder heraus«.
Beim Textvorlesen wie schon beim Schreiben wird versucht, »Neutralität« zu wahren, vor allem dort, wo angebliches bloßes Informieren Meinung verhindern soll. An den Nachrichten der ARD lässt sich das beobachten. Die Präsentation [16]ist steif und starr wie eh. Hinter dieser leblosen Teilnahmslosigkeit steht nicht nur das Unverständnis der Sprecher im Moment des Vorlesens, ebenso oft redliches Bemühen um Objektivität, der Versuch, noch in der letzten Minute des Textpräsentierens Sagen von Meinen und Meinung von Meinungsmache zu trennen. Kein leichtes Unterfangen, denn selbst in Nachrichten steht Meinung von der ersten Planungsminute an Pate. Dass uns seit Jahren die Programmmanager von ARD und ZDF als O-Töne in den Hauptnachrichten präsentiert werden, als seien sie Weltgeschehen (meistens mit einer Rechtfertigung der Rundfunkgebühren), ist ein Beleg hierfür.
Selbst die bloße Anordnung von Informationen wertet. Überhaupt ist zu fragen, ob es »sprachliche« Objektivität geben kann und soll, wo sie schon inhaltlich nicht zu haben ist. Sprecherische Neutralität gibt es nicht; wird sie versucht, ist sie gelogen.
Sprachliche und technische Qualität
»Bitte entschuldigen Sie die schlechte technische Qualität«, musste früher manchmal ein »Frollein« vor einem Beitrag mit rauschendem Ton oder flimmerndem Bild ansagen. Heute müsste man vor so manchem Beitrag angeben: »Bitte entschuldigen Sie die schlechte Sprachqualität«! Wer gute oder wenigstens ursprüngliche und echte Sprache sucht, der wird im Rundfunkjournalismus selten fündig. Oft genug kann ein Training nur dazu dienen, die eigene Sprache des Moderators wiederherzustellen bzw. überhaupt erst aufzufinden. Originalität ist leider nicht lehrbar, aus einem Buch schlicht gar nicht, im Training allenfalls durch topische oder kreative Schreibtechniken. Originalität ist allerdings ein Nebenprodukt sicherer Methodenkenntnis. Sie ist der zweite oder dritte Schritt: Nur wer das Handwerk beherrscht, hat die Hände frei für charakteristische Form und Stilsicherheit.
Zu recht sollen Texte auch ansprechend in der Form sein. Oft genug rangiert aber die Form vor dem Inhalt. Die Form sollte doch im seriösen Sinne immer nur dem Inhalt dienende Funktionen haben: Neugierig machen, Zuhörer und Zuschauer binden und Verständlichkeit fördern. Auf immer mehr Sendeplätzen siegt dagegen die Abwechslung in der Form über Relevanz und Verknüpfung der Inhalte. Als Konsequenz des Primats der Form ist auch längst das Infotainment ausgerufen. Nun ist der Gedanke keineswegs neu, dass man Zuhörer besser erreichen kann, wenn die Sprache auch attraktiv ist – schon die Antike begriff Rhetorik zu einem Teil als Ästhetik des (gesprochenen) Wortes. Allerdings dominierten Form und Unterhaltung kaum so sehr die Inhalte wie in den heutigen Medien. Mit diesen Gedanken ist nichts gegen Unterhaltung aus Lautsprechern gesagt. Problematisch ist aber die Tendenz, jedes Thema als Unterhaltung anzubieten (Postman 1988, 110). Fatal, dass das gerade die Fernsehnachrichten trifft. Oder soll man mit Doelker (1991, 99) [17]meinen, dass Unterhaltung ohnehin schon etwa den Fernsehnachrichten anhängt? »Gerade wenn sie gut gemacht sind, haben sie einen höheren Unterhaltungswert, und Gott sei Dank funktioniert nachher die Psychohygiene des Zuschauers, indem er (fast) alles wieder vergisst.«
Alles oder fast alles vergessen – auch hieran ist nicht ganz unschuldig, was mittlerweile Schwerpunkt der Qualitätsanstrengungen ist: die Technik. Natürlich erleichtert die Technik die Produktion alle Mal. Zu sehen ist aber jetzt schon die Gefahr, dass ihre Faszination als Selbstzweck natürlichem Schreiben und Sprechen im Wege stehen könnte. Digitalisierung verspricht das »Übermitteln« noch leichter zu machen und die Informationen perfekter zu drängen; kein überflüssiger Laut, kein Atmen, gleich lange Pausen, und was einmal lebendig gesprochen war, wird zum sterilen Produkt. Die Produktionspraxis ist unschwer vorstellbar: Der Redakteur-Techniker, der kurz hineinhört und in einem gestalteten Beitrag herumschneidet. Mögliche Kriterien der digitalen Bearbeitung müssen so nicht mehr die des Zuhören-Könnens sein. Mit diesen Folgen der erleichternden Technik ist aber nicht einmal bei den Produzenten das Verstehen nötig, das immerhin am Ende den Zuhörern zugemutet wird. So können neue »Informations«-Systeme vergessen machen, was Menschen trotz aller Technik noch immer leisten müssen, nämlich hören und verstehen. Hören und Zuhören werden mit der Technisierung des Schreibens auch dadurch schwerer, dass die Texte weitgehend nur am Computerbildschirm entstehen. So kommt das Hören beim Schreiben noch nicht in den Blick. Dann wird mit den Augen statt mit den Ohren gearbeitet, und auch das Produkt geht statt ins Ohr ins Auge (vgl. Slembek 1991) – nicht nur im Fernsehen.
Was mit immer geläufigerer Technik entstehen kann, ist eine in der Tat brillante technische Sauberkeit. Verstehen und Überzeugungskraft ursprünglich natürlichen Sprechens aber werden durch immer bessere technische Möglichkeiten nicht automatisch leichter. So kann man Informationen unterbringen, am Ende ist aber immer weniger ursprüngliches natürliches Reden hörbar. Technisch hergestellte Sauberkeit und Ordnung können unversehens zur Unordnung im Kopf werden, wenn allein nach technischen Gesichtspunkten gar ganze Textteile gestrichen oder vertauscht werden. Die einmal geschehene rhetorische Bearbeitung würde erst zunichte, schließlich aus der Sicht der Technik schlicht unnötig. Gesendet werden könnten dann aus journalistisch Bearbeitetem nur noch die »Infos«. Und wieder stehen Informationen bezuglos und pur da. Oft genug weiß man nicht, wie die Informationen einzuordnen sind und was man damit soll.
Da ist es nicht mehr weit bis nach Waco, Texas, wo im Januar 1993 der US-amerikanische TV-Kanal CNN mit seinen Berichten über das Ende einer Sekte vorgemacht hat, was schlüssiger Endpunkt unreflektierter »Präsentation« solcher Informationen ist: Aus der Not der Nichtinformation wird die Tugend des Authentischen. Ein brennendes Haus mit vielleicht schon brennenden Menschen [18]und ein Reporter, der präzise so viel weiß und sieht wie der Zuschauer – lediglich ein »Übermittler«, der schließlich auch auf den letzten Rest Sprache verzichten könnte. Machte das Schule, und es sieht sehr danach aus, dann gäbe es immer mehr solchen Informierens ohne eigene Informiertheit. Das geht bis hin zu Kommentaren ohne eigene Meinung: Da wird einerseits zu bedenken gegeben, andererseits aber auch darauf hingewiesen, und am Ende bleibt immer etwas abzuwarten.
Diese Überlegungen sind hoffnungslos altmodisch. Sie plädieren für Tugenden, die inzwischen schwerlich an öffentlichen Plätzen zu finden sind, kaum mehr im Radio, schon gar nicht im Fernsehen. Es gab Zeiten, da hatte zumindest das Radio einmal Raum für Aufklärung und kritisches Zuhören, auch für rationalen Diskurs und dialogisches Erwidern (vgl. Geißner 2000). Kritik und Diskurs brauchen vor allem Zeit. Die aber haben diese Medien gerade nicht. Der Funk ist inzwischen immer seltener ein Ort des Denkens, des Abwägens und Vertiefens. Sprache fürs Hören soll freilich zuallererst das Verstehen fördern, sollte man meinen. Vielleicht aber, so sieht es seit längerem aus, rechnet man damit an den Entscheidungsstellen heimlich schon längst nicht mehr. Mehrmals habe ich gehört, Verstehen sei der Attraktivität gegenüber zweitrangig. Diese Entwicklung ist wohl nicht aufzuhalten: Wer sie aber durch hausgemachte Hörunverständlichkeit fortschreibt, macht schlechtes Radio oder schlechtes Fernsehen.
Mündlichkeit ist gefragt
Da muss erst ein Fußballspieler kommen und zeigen, dass man sich mündlich klar ausdrücken kann. »Es sind diese kurzen Sätze«, schrieben die Zeitungen als Günter Netzer Ende der Neunzigerjahre begann, im Fernsehen Klartext zu reden. Den professionellen Akteuren im Rundfunkjournalismus war das vorher offenbar nicht möglich. Die professionellen journalistischen Sprachmuster stehen dem klaren Ausdruck im Wege.