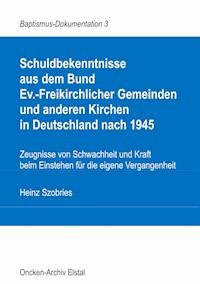
Schuldbekenntnisse aus dem Bund Ev.-Freikirchlicher Gemeinden und anderen Kirchen in Deutschland nach 1945 E-Book
Heinz Szobries
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Baptismus-Dokumentation
- Sprache: Deutsch
Wie haben Baptisten in Deutschland ihr Verhalten in der Zeit des Nationalsozialismus beurteilt? Der Autor beschreibt und dokumentiert die Diskussionen nach dem Krieg über Schuld sowie die Entwicklungen bis zum offiziellen Schuldbekenntnis des BEFG. Die 50 veröffentlichten Textdokumente, eingeschlossen sind Vergleichstexte aus anderen Kirchen und Freikirchen, machen diesen Band zu einem wichtigen Nachschlagewerk und regen zugleich an, die gesellschaftliche Verantwortung von Christen heute zu reflektieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Zum Autor und zur Dokumentation
Geleitwort
Erinnern und Gedenken gehören zum Leben (Wolfgang Lorenz)
Einführung
Auf der Suche nach Schuldbewusstsein und Schuldbekenntnissen
Dokumentation
Teil 1 Dokumente aus dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG)
1.01 Bundesbrief für die Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden im Westen Deutschlands, 25. Juni 1945
1.02 Bundesleitung des BEFG, Brüderliche Verlautbarung an die Gemeinden, 25./26. Juli 1945
1.03 Friedrich Rockschies, Aufzeichnungen, 1945
1.04 Stuart W. Herman, Notes on the Baptist Church in Germany, 17. und 20. Oktober 1945
1.05 Friedrich Wilhelm von Viebahn, Schuldbekenntnis, 28. Februar 1946
1.06 Hans Rockel, Der Weg durch die Schuld, 14. April 1946
1.07 Paul Schmidt, Unser Weg als BEFG in den Jahren 1941-1946, Bericht an den Bundesrat, 24.-26. Mai 1946 (Auszug)
1.08 Jacob Köbberling, Gegenschrift zu „Unser Weg […]“, 1946 (Auszug)
1.09 Emil Janssen, Bericht zur Theologischen Woche, 25.-27. August 1946 (Auszug)
1.10 Paul Schmidt, Ein Blick durchs deutsche Bundesfenster, 23. Juli 1947 (Auszug)
1.11 Jakob Meister, Hans Rockel, Erklärungen auf dem BWA-Kongress in Kopenhagen, Juli 1947
1.12 Johannes Schneider, Entwurf eines Schuldbekenntnisses, 1947
1.13 Hans Fehr, Vortrag in einem kirchengeschichtlichen Seminar in Hamburg, 1958
1.14 Adolf Pohl, Wort zum Unterrichtsbeginn im Predigerseminar Buckow, 1961
1.15 Hans Luckey, Interview: Wir sind widerlegt worden, September 1971
1.16 Manfred Sult, Bericht des Präsidenten an den Bundesrat des BEFG in der DDR, 1984
1.17 BEFG in Deutschland, „Hamburger Schuldbekenntnis“, EBF-Kongress Hamburg, 2. August 1984
1.18 Ausländische EBF-Kongress-Teilnehmer, Antwort auf die Erklärung zur NS-Zeit, 4. August 1984
1.19 Bundesleitung des BEFG in der DDR, Wort an die Gemeinden zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, 3. April 1985
1.20 Bundesleitung des BEFG in Deutschland, Wort zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht, 5. November 1988
1.21 Bundesleitung des BEFG in der DDR, Wort zu den Ereignissen und Reformen im Land, Dezember 1989
1.22 Präambel des Vereinigungsvertrages zwischen dem BEFG in Deutschland und dem BEFG in der DDR, 10. Mai 1991
1.23 Bundesleitung des BEFG, Unser Dank für 50 Jahre Frieden, März 1995
1.24 Walter Zeschky, Wolfgang Lorenz, Präsidentenbericht an den Bundesrat des BEFG, 1995
1.25 Bruderrat der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, Zur Haltung der Brüdergemeinden während der Zeit des Nationalsozialismus und nach dem Zusammenbruch, April 1995
1.26 Heinz Szobries, Litanei der Betroffenheit, 1996
1.27 Bundesleitung des BEFG, Zum Verhältnis von Juden und Christen – eine Handreichung für die Gemeinden des BEFG, 1997 (Auszug)
1.28 Vorstand des Diakoniewerkes TABEA, Erklärung anlässlich der 100-Jahrfeier in Hamburg, 1999
Teil 2 Vergleichstexte aus anderen Kirchen und Freikirchen
2.01 Methodistenkirche in Deutschland, Beschluss der Prediger der Mittel- und Nordostdeutschen Jährlichen Konferenz, September 1945
2.02 Konferenz der katholischen Bischöfe Deutschlands, Hirtenbrief, 23. August 1945
2.03 Walther Baudert, Rundschreiben an die Gemeinen der Deutschen Brüder-Unität, Herrnhut, 19. September 1945
2.04 EKD, Stuttgarter Erklärung, 18./19. Oktober 1945
2.05 Vereinigung Evangelischer Freikirchen in Berlin, Die Freikirchen in Deutschland und die Wiederherstellung des Lebens des deutschen Volkes, 28. Oktober 1945
2.06 Methodistenkirche in Deutschland, Erklärung über die Stellung unserer Kirche zur gegenwärtigen Lage, 5./6. Dezember 1945
2.07 Sam Baudert, Bischof der Deutschen Brüder-Unität, Briefe an die leitenden Brüder im Ausland, Bad Boll, 31. Dezember 1945 und 2. Mai 1946
2.08 The Free Church Federal Council of England and Wales, Brief, April 1946
2.09 Vereinigung Evangelischer Freikirchen in Deutschland, Antwortbrief, 29. Juli 1946
2.10 Deutsche Evangelische Allianz, Wort zum 100-jährigen Jubiläum, September 1946
2.11 Rat der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, Entschließung, 10./11. Dezember 1946
2.12 Bruderrat der EKD, Darmstädter Wort, 8. August 1947
2.13 Bischof I.W. Ernst Sommer, Bericht an die Konferenz der methodistischen Bischöfe der Welt in Boston/USA, 23. April 1948
2.14 Vereinigung Evangelischer Freikirchen, Erklärung, 30. September 1949
2.15 EKD-Synode Berlin-Weißensee, Wort zur Judenfrage, 23./27. April 1950
2.16 Freikirchenrat der VEF in der DDR, Stellungnahme zur Situation in der DDR, 18. Oktober 1989
2.17 Mühlheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden, Erklärung zur Stellung des MV während der Zeit des Nationalsozialismus, April 1991
2.18 Peter Strauch, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden, 50 Jahre danach, 7. Mai 1995
2.19 Reinhold Ulonska, Präses des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Fünfzig Jahre danach, Mai 1995
2.20 Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland (AMG), 50 Jahre nach Kriegsende, 10. Juni 1995
2.21 Jörg Zink, Wir haben geschlafen. Ein christliches Schuldbekenntnis, 1995
2.22 Siebenten-Tags-Adventisten, Erklärung zum 60. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, 7. Mai 2005
Nachwort
Vergangenheitsbewältigung – eine Last für den BEFG, seine Gemeinden und deren Mitglieder?
Anhang
Freikirchliche Tagungen zur Thematik
Die Freikirchen von der Weimarer Republik zum Dritten Reich (1977)
Baptisten und Zeitgeist (1986)
Erinnerung schafft Zukunft (1989/1990)
Widerstand und (V)Ergebung (1993)
Leben in Widerstand und Anpassung (1998)
Wider das Vergessen (2000)
Verein für Freikirchenforschung
Gemeinden
Auswahl freikirchlicher Veröffentlichungen und unveröffentlichter Arbeiten zur Thematik
(chronologisch)
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
Der Autor Heinz Szobries wurde am 2. Dezember 1930 in Berlin geboren. Nach Abitur, Lehrerausbildung und Schuldienst in Berlin studierte er Evangelische Theologie in Berlin, Münster sowie am Theologischen Seminar in Hamburg. Seit 1958 diente er als Pastor des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) in den Gemeinden Varel/Oldb., seit 1962 in Bremen, Ziethenstraße und seit 1969 in Berlin-Tempelhof. 1974 bis 1979 folgte Heinz Szobries einer Berufung als freikirchlicher Referent in die Ökumenische Centrale in Frankfurt am Main. Weitere Gemeindedienste in Duisburg, Juliusstraße ab 1979, in Barsinghausen/Goltern ab 1984 und in Wuppertal-Elberfeld ab 1990 schlossen sich an, unterbrochen durch eine Freistellung für die Organisation des Europäischen Baptistischen Kongresses 1983 bis 1984. Seit 1990 lebt er im Ruhestand, zunächst in Hagen, seit 2006 im Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach.
Von den zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten seien erwähnt: Mitarbeit im Ökumenischen Rat Berlin, in verschiedenen Landesverbänden des BEFG, Protokollführer und Verhandlungsleiter im Bundesrat des BEFG, Mitwirkung in diversen Bereichen des Bundes, wie z.B. im Arbeitskreis Gemeinde und Weltverantwortung, in der Osteuropahilfe, als langjähriger Delegierter für die Konferenz Europäischer Kirchen, in der Verfassungskommission, im Arbeitskreis Rechtsordnungen des BEFG.
Heinz Szobries ist seit 1953 verheiratet mit Hildegard geb. Lange, sie haben vier Kinder.
Der vorliegende dritte Band der Schriftenreihe Baptismus-Dokumentation hat eine längere Vorgeschichte. Bereits 1995 wurde auf dem BEFG-Bundesrat eine Dokumentation der vorliegenden Schuldbekenntnisse angeregt, aber erst im Jahr 2000 bei Heinz Szobries in Auftrag gegeben.1 Auf einer Tagung des Vereins für Freikirchenforschung 2004 zur gleichen Thematik trug Heinz Szobries ein Zwischenergebnis seiner Recherchen zum BEFG vor. Dieses Referat wurde 2005/06 im Jahrbuch des Vereins veröffentlicht2 und liegt dem II. Kapitel (Einführung) dieser Dokumentation zugrunde. Ein zweites Referat dieser Tagung von Karl Heinz Voigt zu weiteren Freikirchen und zur Evangelischen Allianz erschien bereits im Jahrbuch 20043 und wurde 2005 in erweiterter Form veröffentlicht4. Die vorliegende Dokumentation kann an diese wertvolle Arbeit anknüpfen, übernimmt einzelne Texte, korrigiert und ergänzt andere und fügt neue hinzu. Nach vielen weiteren Jahren kann sie hiermit nun für den BEFG präsentiert werden.
Den Hauptteil dieses Bandes bildet die Textsammlung in Kapitel III. Heinz Szobries hat im Teil 1 neben den offiziellen Stellungnahmen des BEFG auch eine Reihe weiterer Äußerungen und Veröffentlichungen von Verantwortlichen des BEFG aufgenommen. Ergänzt werden diese in Teil 2 durch die Dokumentation von ausgewählten Vergleichstexten aus anderen Kirchen, wobei der Auswahlschwerpunkt bei Bekenntnissen aus Freikirchen liegt. Außerdem sind einzelne Erklärungen zur DDR-Zeit aufgenommen worden. Einige kurze Hinweise auf Fachtagungen und weitere Literatur zur Thematik finden sich im Anhang.
Die dokumentierten Texte im III. Kapitel sind in der Regel in vollständiger Form aufgenommen worden. Kürzungen erfolgten bei Überlänge sowie für das Thema irrelevanten Passagen. Offensichtlich orthografische Fehler wurden korrigiert und die neue Rechtschreibung zugrunde gelegt.
Reinhard Assmann Ines Pieper
Vorwort zur 2. Auflage 2017:
Neben einzelnen Korrekturen wurden ergänzende Hinweise in den Anmerkungen zu den Texten 1.09 und 2.18 aufgenommen. Das Literaturverzeichnis enthält einige neue Titel.
Am 12. April 1990 tagte die Volkskammer der DDR nach ihrer Konstituierung als erstes frei gewähltes Parlament und verabschiedete in einem ersten Beschluss eine gemeinsame Erklärung aller Fraktionen – ein bemerkenswertes Schuldbekenntnis, das die Bekenntnisse der Kirchen in diesem Band ergänzt. In ihr heißt es:
„Durch Deutsche ist während der Zeit des Nationalsozialismus den Völkern der Welt unermessliches Leid zugefügt worden. Nationalismus und Rassenwahn führten zum Völkermord, insbesondere an den Juden aus allen europäischen Ländern, an den Völkern der Sowjetunion, am polnischen Volk und am Volk der Sinti und Roma. Diese Schuld darf niemals vergessen werden. Aus ihr wollen wir unsere Verantwortung für die Zukunft ableiten. […]“4a
1 Siehe Kapitel II Einführung.
2 Freikirchenforschung 15 (2005/06), S. 272-323.
3 Freikirchenforschung 14 (2004), S. 229-261.
4 Karl Heinz Voigt, Schuld und Versagen der Freikirchen im „Dritten Reich“. Aufarbeitungsprozesse seit 1945, Frankfurt am Main 2005.
4a Neues Deutschland vom 14./15.4.1990; zu den Mitinitiatoren gehörte der Parlamentarier Klaus Tschalamoff aus der BEFG-Gemeinde Schönebeck, Oncken-Archiv Elstal Bestand A14 „Briefe“ B 07.
I. Geleitwort
Erinnern und Gedenken gehören zum Leben
Dank für 50 Jahre Frieden – so hatte die Bundesleitung zum 8. Mai 1995 ihren Beitrag zu den vielen Gedenkveranstaltungen benannt. Schon damals wurde die Bitte geäußert, dass dieser Beitrag mit anderen Stellungnahmen und Verlautbarungen, die sich mit der Bewältigung des nationalistischen Erbes beschäftigen, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Es ist meinen Kollegen Heinz Szobries, Reinhard Assmann und Ines Pieper vom Oncken-Archiv zu danken, dass jetzt eine umfangreiche Dokumentation von Texten aus dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) und anderen Kirchen und Freikirchen, wie sie im Oncken-Archiv in Elstal vorliegen, für den Druck erstellt wurde. Meinem Geleitwort liegen Gedanken zugrunde, die ich 1995 zu Papier gebracht habe.
In der Erinnerung liegt das Geheimnis der Erlösung – so hat es der chassidische Weise Baal Schem Tow gesagt und so hat es der ehemalige Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Rede am 8. Mai 1985 zitiert. Geheimnis der Erlösung – kommt dieser Gedanke zu schnell, wenn wir bedenken, dass zur Erinnerung des jüdischen Volkes unauslöschlich die Erfahrung des millionenfachen Mordes gehört?
Wie sollte sich uns das Geheimnis der Erlösung erschließen, solange wir die Erinnerung des Unrechts verharmlosen? Je mehr wir erfahren und wissen wollen über das, was dem jüdischen Volk, aber auch Sinti und Roma, Polen und Russen, Sozialisten, Kommunisten, Menschen mit Behinderungen, Homosexuellen, Frauen und Kindern angetan wurde, desto schmerzlicher wird ein aufrichtiges und umfassendes Erinnern.
Es gibt keinen besseren Weg zur Sensibilisierung als das Studium jener Zeit, des Lebens auch nur eines Kindes, der Tränen auch nur einer Mutter, so hat es Elie Wiesel einmal gesagt. Selbst nach so vielen Jahren erscheint das Erinnern für die Nachfahren von Tätern und Opfern noch schwierig genug. So wird schon im Vorfeld über die Bedeutung dieses Datums 8. Mai 1995 gestritten. Ist dieses Datum Unglück, Verrat, Katastrophe, Zusammenbruch, Kapitulation, Vertreibung oder in jedem Falle Befreiung: Befreiung zur Umkehr, zum Neuanfang, zur Versöhnung, zum Lernprozess aller Überlebenden?
Christen in Deutschland haben Erklärungen abgegeben, die als Schuldbekenntnisse gewertet wurden. Von vielen wurden sie begrüßt, aber auch von vielen Menschen abgelehnt. So ist das Erinnern und das öffentliche wie persönliche Gedenken der Überlebenden eine Aufgabe, die in jeder Generation neu angefasst werden muss.
Die damals Umgekommenen dürfen nicht dem Vergessen anheimfallen. Sie sollen in den Folgegenerationen durch Erinnern und Gedenken Wohnrecht unter uns und im Gedächtnis der Menschheit behalten, damit ihr Geschick und ihre Leiden nicht ohne Sinn und Wirkung bleiben. Dazu gehört, dass wir ihre Stimmen hören aus Briefen, Aufzeichnungen und Berichten, aber auch zur Kenntnis nehmen, wie Beteiligte und die Nachkriegsgeneration zu ihrem eigenen Verhalten stehen.
Im Buch des Propheten Jesaja lesen wir: Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche: Du bist mein Volk! (Jes.51,16)
In Verbannung und Gefangenschaft erfährt das Volk Israel die Gegenwart Gottes – als Wort auf ihrer Zunge und als Raum zum Atmen, der sie durch alle Ängste trägt. Gott sagt durch den Propheten: Es gibt keinen besseren Grund, an die neue Erde und den neuen Himmel zu glauben, als diese Erfahrung. So klein wird ER – und so nahe kommt ER dabei seinem Volk.
Uns Christen stellt diese prophetische Erinnerung vor die Frage: Welches Wort tragen wir auf unserer Zunge, mit dem wir die Situation unserer Erde zutreffend beschreiben und zugleich die Hoffnung auf ihre Erneuerung bezeugen? Wo finden wir Raum zum Atmen in der Atemlosigkeit der Aktionen und Reaktionen unserer Zeit? Wir haben darauf keine andere Antwort als die, um Jesu willen – trotz Schuld und Versagen – die Erinnerung wach zu halten und daraus zu lernen.
Wir haben Grund zur Hoffnung, dass alle Erinnerungen und alles Eingestehen des Versagens zum Leben für heute und morgen verhelfen; denn, so sagt es George Santayana: Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen.
Pastor i.R. Dr. Wolfgang Lorenz
II. Einführung5
Auf der Suche nach Schuldbewusstsein und Schuldbekenntnissen
„Es ist nicht gut, vor Wirklichkeiten zu tun, als ob sie nicht wären, sonst rächen sie sich.“ Romano Guardini
1. Der Anlass für die Suche
Die öffentliche Erklärung des BEFG vor den in- und ausländischen Delegierten des Jubiläumskongresses der Europäischen Baptistischen Föderation (EBF) 1984 in Hamburg ist von allen Beteiligten tief bewegt aufgenommen und seitens der ausländischen Anwesenden mit großem Respekt und einer geschwisterlichen Geste der Versöhnung beantwortet worden.
Elf Jahre später, auf dem Bundesrat in Bochum 1995, wurde bedrückend erkennbar, dass dieses sogenannte Schuldbekenntnis wie auch ein ähnliches der Bundesleitung des BEFG in der DDR überhaupt nicht im Gedächtnis eines großen Teils der Abgeordneten war. Es hatte offenbar keinen Versuch gegeben, die Erklärung in den Gemeinden zu rezipieren bzw. dazu anzuregen. Dieser erschreckenden Unwissenheit versprach der damalige Vizepräsident des BEFG, Wolfgang Lorenz, entgegenzuwirken und regte die Veröffentlichung von entsprechenden Texten aus den ehemaligen Bünden in Ost und West an.6
Aber erst wiederum fünf Jahre später gab eine Rückfrage nach dieser Veröffentlichung den Anstoß zur Arbeit an einer Dokumentation. Auf Umwegen bin ich gebeten worden, die vorhandenen Texte zu sammeln und zu ordnen. Meinerseits habe ich diese Suche erweitert auf die anderen Freikirchen in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF). Turbulenzen im BEFG und daraus resultierende dringlichere Aufgaben haben meine Arbeit am Thema zum Stillstand gebracht, so dass 2004 nur ein Zwischenergebnis vorgetragen werden konnte.
2. Das zugrundeliegende Material
Zusammengetragen und ausgewertet werden hier nahezu ausschließlich die Quellen aus dem Leitungsbereich des BEFG, d.h. Protokolle von Bundesleitungssitzungen, Rundschreiben an die Gemeinden und andere bundesoffizielle Äußerungen. Die Quellen werden jeweils in den Fußnoten angegeben. Berücksichtigt sind ferner grundlegende Arbeiten, die sich mit der Geschichte des BEFG und speziell mit der Haltung des Bundes in der NS-Zeit beschäftigt haben. Sie sind im Anhang ersichtlich.
Dankenswerterweise haben mir verschiedene Freikirchen der VEF einige Texte zur Sache aus ihrem Bereich zur Verfügung gestellt. Dabei ging es mir nicht um eine komplette Darstellung freikirchlichen Denkens und Handelns zum Thema, sondern um die Frage, ob andere Ansätze und Handlungsweisen in den vergleichbaren Freikirchen erkennbar sind. Sofern die Texte zitiert werden, sind sie im Teil 2 vollständig oder auszugsweise abgedruckt und mit Quellenangaben versehen. Schließlich habe ich zur Kenntnis genommen, dass die frühere Studentenarbeit des BEFG in ihrer Zeitschrift „SZ“ sowie die Initiative Schalom und der Arbeitskreis des BEFG „Gemeinde und Weltverantwortung“ in Tagungen an das Thema herangegangen sind. Auch dies wird hier in den Übersichten im Anhang verzeichnet.
Auf ein Defizit dieser Arbeit weise ich ausdrücklich hin: Schon Erich Geldbach hat 1992 angemahnt, dass es an der Zeit wäre, „wenn es nicht schon viel zu spät ist, die Quellen der Ortsgemeinden zu sammeln und wissenschaftlich zu sichten“.7 Dies ist m.W. bis jetzt nicht geschehen, auch wenn Festschriften von Gemeinden auf dieses dunkle Kapitel hin untersucht wurden.8 Die Zahl der Festschriften, die über diese Zeit hinweggehen, ist aus meiner, allerdings begrenzten Sicht, wahrscheinlich sehr viel größer.
3. Grundsätzliche Überlegungen
Ein Schuldbekenntnis kann sich nur aus einem Schuldbewusstsein ergeben. Individuelle Schuld wird an gewohnten oder eingeübten, nachprüfbaren Maßstäben festgemacht. Solche Maßstäbe sind vorgegeben in der Tradition eines Volkes (Selbstbewusstsein, Über- oder Unterlegenheitsbewusstsein), in den Sozialisierungsbereichen der Familie (Gewohnheiten, Erziehungsideale und -fehler, Durchsetzungsvermögen) und in der religiösen Unterweisung (Bibelverständnis, Gemeindestruktur, Frömmigkeits- und Konfessionsmerkmale) sowie natürlich in den jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
Hier geht es aber nicht um individuelle Handlungsweisen, sondern um gemeinschaftliches Handeln und die Ausrichtung eines Gemeindebundes. Aus den spärlichen Texten geht hervor, dass die Verantwortung der Bundesorgane, speziell der Bundesleitung, sehr wohl in schwierigen Zeiten erkannt worden ist. Wie sich diese Verantwortung im speziellen Fall ausgewirkt hat, zeigen die Dokumente. Doch im Nachhinein kann von einem Schuldbewusstsein nur in Ansätzen ausgegangen werden. Dafür spricht vornehmlich die Tatsache, dass die wichtigen Aussagen – sowohl im BEFG als auch von den Brüdergemeinden wie schon die Stuttgarter Erklärung der EKD-Vertreter von 1945 – selbst nicht von einem Schuldbekenntnis sprechen, sondern sich als „Erklärungen“ deklarieren. Weithin ist die Schuldfrage ausgeklammert worden, weil es an Schuldbewusstsein fehlte oder das Thema wegargumentiert wurde. Ein wesentlicher Grund dafür war ein konservatives Schriftverständnis und daraus sich ergebende Haltungen, speziell zum Staat. Sie sind festgehalten, verteidigt und gesichert worden. Diese Verweise auf die Schrift und die Bindung an das überlieferte Verständnis spielen in den späteren Verteidigungsversuchen eine ebenso wichtige Rolle wie die einseitige Interpretation des Missionsbefehls.
Paul Schmidt, damaliger Bundesdirektor und Reichstagsabgeordneter vor 1930, hat die Nachkriegsdiskussion um die Schuld zwar als „eine offene Frage für den Raum der Gemeinde Jesu“ hingestellt, jedoch Schuldzuweisungen für sich selbst sowie gegen die Bundesleitung oder die Gemeinden bzw. den Bund als Ganzes als unzutreffend abgewiesen. Seine Art der Fragestellung in der Verteidigungsschrift „Unser Weg […]“ signalisiert ziemlich eindeutig die von ihm eingenommene Position:
„Die Schuldfrage wird aber auch unter uns gestellt. Dabei entsteht natürlich zunächst die Frage, hat die Gemeinde Jesu das Wächteramt in ihrem Volk, wie etwa die Propheten es in Israel hatten? Hat die Gemeinde Jesu einen Auftrag für das ganze Volk in dem Sinne, dass es die Verantwortung für den Geist und die Sittlichkeit des Volkes trägt? Kann die Gemeinde schuldig werden im Ganzen, wenn sie nicht gegen besondere Sünden der Staatsführung öffentlich Protest erhebt? Kann die Gemeinde Jesu durch ihr glaubensstarkes Verhalten in Verkündigung und Leben den Verfall eines Volkes aufhalten und kann sie als mitschuldig angesprochen werden, wenn ein so starker Verfall der sittlichen Kräfte und ein so tiefer Sturz des Volkes erfolgt, wie es jetzt der Fall ist? Nach unserer bisherigen Erkenntnis war es so, dass die Gemeinde Jesu die Heilsbotschaft zu verkündigen und zu verkörpern hat, dass sie aber nicht den Auftrag und die Kraft hat, ein ganzes Volk zu bewahren und zu behüten. Schuldbekenntnisse können aber auch nur dann abgegeben werden, wenn jemand vor Gott steht und sich vor Gott in Schuld weiß, nicht aber um dadurch irgendeiner Gruppe von Christen irgendwo zu gefallen oder irgendwo und irgendwann schneller einen neuen Lebensanschluss zu finden oder sich irgendwie einzugliedern.“9
Dem hat als einer der wenigen10 Dr. Jacob Köbberling, Holzminden, in einer umfangreichen Streitschrift widersprochen: „Es ist ein weltfremder Idealismus, wenn sie [die Gemeinde] glaubt, an dem sittlichen Verfall und dem Sturz eines Volkes unbeteiligt zu sein, während ihr Auftrag, die Verkündigung des Evangeliums, irgendwie nebenher läuft.“11 Köbberling setzt sich sowohl mit dem Schriftverständnis als auch mit den Zusammenhängen des Bundesschlusses zwischen Baptisten und Brüdern im Jahre 1941 auseinander und zieht eine negative Bilanz, und zwar hinsichtlich eines mangelhaften, unzureichenden Glaubensbekenntnisses. Er bemängelt ferner eine zwiespältige und unglaubwürdige Haltung zum Staat ebenso wie die Isolierung von der übrigen Christenheit in Deutschland. Am meisten stört ihn, dass versucht wird, den Bund und die leitenden Brüder „von aller Schuld freizusprechen, indem er [Paul Schmidt] den Weg 1941-1946 als gottgewollten, wohlbehüteten Weg darstellt.“ Ein vereinbartes Gespräch mit ihm in der Bundesleitung wegen der Veröffentlichung seines Textes ist nicht zustande gekommen. Das Protokoll vom 5./6.Juni 1947 hält fest: „Paul Schmidt geht hierbei auch auf die von Br. Köbberling bemängelte Stellung zum Staat und auf das Glaubensbekenntnis ein. Br. Schmidt hatte inzwischen eine Unterredung mit Br. Köbberling, der auch zur heutigen Sitzung eingeladen war, aber nicht erscheinen konnte. Er hat den Eindruck, dass das Ergebnis dieser Besprechung höchstwahrscheinlich der freiwillige Verzicht Dr. Köbberlings auf die Veröffentlichung sein wird. – Die Bundesleitung würde die Veröffentlichung der Schrift für verhängnisvoll halten und lehnt eine weitere schriftliche Auseinandersetzung ab.“12 Vielleicht spielt für die offensichtliche Abweisung eine Rolle, dass Köbberling bereits 1937 eine heftige Auseinandersetzung hatte wegen der Haltung gegenüber der Bekennenden Kirche und vor allem hinsichtlich der öffentlichen, verharmlosenden Äußerungen Paul Schmidts (und des methodistischen Bischofs Dr. Melle – beide als Vertreter der Freikirchen Deutschlands auf einer internationalen Kirchenkonferenz in Oxford) zur Religionsfreiheit in Deutschland.13
Bei Durchsicht der frühen Stellungnahmen aus den Reihen des deutschen Bundes fällt auf, dass sie keine offizielle Autorisierung besitzen und auch nicht aus eigenem Antrieb abgegeben wurden. Sie sind gewissermaßen zwangsläufige, noch dazu persönliche Aussagen zur Vergangenheit vornehmlich gegenüber ausländischen Vertretern bzw. auf Konferenzen im Ausland. Hier gleichen sich im Ansatz die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mit ihrer Stuttgarter Erklärung im Herbst 1945 und die (wenigen) Sätze von Jakob Meister und Hans Rockel auf der 7. Weltkonferenz der Baptisten in Stockholm 1947. Hinzu kommt, dass beide Kirchen, der Rat der Evangelischen Kirche in Stuttgart wie auch die deutschen Baptisten noch 1984 in Hamburg, ihre Aussagen zur Verflochtenheit in die deutsche NS-Geschichte lediglich als Erklärungen ausgewiesen haben. Insbesondere die Bundesleitung hat sich 1984 strikt dagegen gewandt, ein Schuldbekenntnis zu formulieren bzw. abzugeben.14 Dennoch hat die Geschichte das bewusst Vermiedene längst überholt: Die sogenannten Erklärungen von Stuttgart bzw. Hamburg laufen längst nur noch unter der Bezeichnung „Schuldbekenntnis“ und die Reaktionen der ausländischen Empfänger dieser Botschaften haben genau dem entsprochen, was ein Bekenntnis von Versagen und Schuld nach sich ziehen sollte: Vergebung von Schuld und Erneuerung des Glaubens.
Anders als Paul Schmidt in seinem Bericht „Unser Weg […]“ von 1946 gibt Hans Fehr 1958 erstmals, allerdings in einem nichtöffentlichen Kreis, Einblick in die Gedanken leitender Mitarbeiter des Bundes. Als einziger unter den noch lebenden leitenden Männern aus der NS-Zeit hat der frühere Vorsteher des Albertinen-Diakonissenhauses und spätere Bundesvorsitzende einen sehr persönlichen, bewegenden Bericht (z.T. unter Tränen!) vor Hamburger Studenten gegeben. Darin kommt die enge Bindung an ein bestimmtes Prinzip der Schriftauslegung und an das übliche Missionskonzept zur Sprache mit der Konsequenz, man habe – fälschlicherweise – vor Gott guten Gewissens gehandelt:
„Das Leben des Bundes in diesem totalen Staat war einfach nicht leicht. Das klare Wort von Röm. 13 war da – so waren wir erzogen. Wie oft haben wir gesagt, der Staat ist ein Diakon Gottes; das können wir nicht gut umbiegen – nur war die Haltung der Gemeinden unseres Bundes im totalen Staat wieder sehr schwer. Wir hatten uns so vereinbart, wir wollen so weit gehen, dass wir immer noch das Evangelium sagen können. Erst wenn das uns verboten wird, ist die Zeit des offenen Kampfes da. Manche Prediger haben da erst recht Texte des Alten Testaments gepredigt, bis die Gemeinde es leid war, aber aus Opposition. Der Gewinn aus dieser Verpflichtung, das Evangelium auf alle Fälle zu verkündigen, ist gewiss das Gute und war größer als der etwaige Gewinn eines früh herbeigeführten Verbotes. Der Zeugnisdienst war nicht leicht. Die bündische Jugend wurde aufgelöst, unser Schrifttum kam 1941 zum Erliegen, im Juni 1941 wurde die christliche Presse verboten (offiziell wegen des Krieges). In dieser Zeit haben wir die Ostmission aufgezogen, hinter der siegenden Wehrmacht her. Die unterdrückten Menschen haben wir gesammelt, besonders in der Ukraine, Bibeln und Gaben versandt. Für die Durchführung dieses Dienstes war es weise genug, die Bundesleitung davor zu bewahren, allzu früh den Bestand des Bundes aufs Spiel zu setzen. [...] Wir haben eine Haltung (?) durchsetzen können, nicht immer frohen Gewissens, aber schließlich vor Gott doch guten Gewissens.“15
Er nennt aber auch einen ganz anderen Gesichtspunkt, der in der Diskussion oftmals vergessen wird. Es ging – in seinem engeren Bereich – um die Existenz der Diakonissenhäuser und ihres Auftrages. (Ähnliche Gedanken über die Bemühungen, vor allem das Werk des Bundes zu erhalten, sind auch in den Äußerungen von Paul Schmidt enthalten.) Hans Fehr weist in dem Zusammenhang den Vorwurf weit von sich (und den anderen Brüdern), dem Nationalsozialismus verfallen gewesen zu sein:
„Hat der Nazismus uns irgendwie innerlich geschadet? Blut- und Boden-Theorie usw. haben uns nicht angefochten. Wir waren im Evangelium genug befestigt, um hier Widerstand leisten zu können. Nicht die Umwelt in ihrer Weltanschauung spielte zu uns hinein, sondern die Not der Menschen. Es ist schwer zu sagen, was hier hineinspielt. Die Taufziffer ist keine absolute Ziffer. Hier spielen zu viele Dinge hinein. Rückgang in der Zeltmission. In Hamburg waren wir16 uns einig: Wir treten niemals in die Partei ein. Das haben wir eine Zeitlang gehalten. Diakonie [fordert]: es ist Zeit, in die Partei einzutreten; wir haben miteinander geredet und gebetet; schließlich haben wir es getan, um die Häuser zu schützen. Wir haben dann in der Bundesleitung Buße tun müssen, mussten ein Jahr zurücktreten.“17
Zumindest in den ersten Nachkriegsjahren ist die Parteizugehörigkeit führender Mitarbeiter des Bundes zur NSDAP als ein Flecken auf der sonst anscheinend weißen Weste des Bundes angesehen worden. In der „Verteidigungsschrift“ von Paul Schmidt gegenüber den deutschsprachigen kanadischen Baptisten und in seinem Denken hatte ein Schuldbewusstsein keinen Platz. Das gilt allerdings auch, abgesehen von wenigen anderen Stimmen, in der Breite der sonst vielfältigen Meinungen im Bund.
„Wenn wir kein öffentliches Schuldbekenntnis abgelegt haben und wenn wir im Blick auf die Vergangenheit wohl auf einen starken missionarischen und evangelistischen Einsatz und auf eine gesegnete Führung Gottes durch die schweren Jahre zurückschauen können, aber nicht zu irgendeiner heute anerkannten oder nicht anerkannten Widerstandsbewegung gehörten, so möchten wir doch sagen, dass wir das als unseren Gottesweg ansahen und heute noch ansehen, um den viel gebetet, viel geglaubt, und innerlich viel gerungen wurde. Vielleicht können wir auch sagen, dass das Zeugnis unserer Gemeinden und unserer dienenden Brüder auch in der dunkelsten Zeit in der vollen Kraft und in der ganzen Fülle des Evangeliums abgelegt wurde. Wir stehen mit im Schatten unseres Volkes, wir tragen Leid um vieles, das sich begeben hat, und wir stehen mit unter den harten Folgen, die sich für unser Land und für andere Länder daraus ergeben haben.“18
Mit diesen negativen Befunden der schuld-ablehnenden Argumentation darf allerdings das Thema Schuldbewusstsein nicht beiseitegelegt werden. Es fehlen noch detaillierte Untersuchungen zu den Gründen, die konkret zum Ausblenden eines Schuldbewusstseins geführt haben; dies könnte nicht nur historische, sondern auch aktuelle Bedeutung haben.
4. Reaktionen in der Nachkriegszeit
Das erste Informationsschreiben des BEFG nach dem Zweiten Weltkrieg vom 25. Juni 1945 benennt zwar „die Auflösung eines vom Herrn abgewandten Führertums, die Aufdeckung wie Beseitigung unglaubwürdiger Brutalitäten der Gewalthaber und das Gericht, in dem wir mit unserem Volke noch stehen“, vermeidet aber jeglichen Hinweis noch Einsicht auf eine mitzutragende Verantwortung. „Quälende Fragen und ernste Gebete steigen zu Gott empor“ wird festgestellt, aber eine Selbstkritik findet nicht statt: „Als Gemeinden möchten wir nach wie vor einzig Botschafter sein an Christi Statt: ‚Lasset Euch versöhnen mit Gott!’ Der Herr hat uns in diese Stunde geführt.“19
Eine erste Verlautbarung der Bundesleitung an die Gemeinden nach Kriegsende blendet die bittere Vergangenheit und die furchtbaren Gräueltaten des Nazi-Regimes völlig aus; sie kennt nur die offensichtliche Not der Nachkriegszeit und die Dankbarkeit, dem Inferno des Krieges entronnen zu sein. Die in Wiedenest zum ersten Mal seit Kriegsende versammelten Brüder der Bundesleitung wenden sich mit einer Verlautbarung an die Gemeinden des Bundes:
„Wir stehen erschüttert am Grab der politischen Größe Deutschlands und beugen uns unter das furchtbare Gericht, das Gott über unser geschlagenes Volk verhängt hat.





























