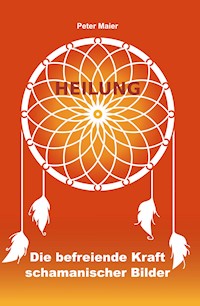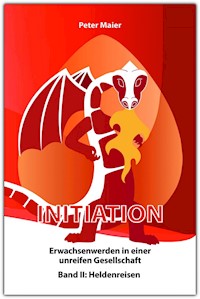Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Schule macht krank!" So klagen immer mehr Eltern und Schüler. Tatsächlich hat im Bildungssektor seit dem sogenannten Pisa-Schock 2001 eine wahre Reformflut eingesetzt – veranlasst von den Kultusbehörden und auf Druck von Wirtschaftskreisen. Diese Reformen gehen häufig über die Köpfe von Lehrern und Schülern hinweg. Schulen sind aber keine beliebigen Versuchslabore, Kinder und Jugendliche keine digitalisierbaren Lernmaschinen. Gerade in der Pubertät brauchen Schüler im Lehrer einen verständnisvollen Menschen, der ihnen nahe steht, sie ermutigt und unterstützt, ihnen notwendige Grenzen setzt und ihnen zugleich genügend Raum lässt für Kreativität, Selbstreflexion und für die Ausbildung sozialer Kompetenzen. Dieser Ansatz erhält in Zeiten von Corona-Krise und Homeschooling eine ungeahnte Aktualität. Der erfahrene Pädagoge Peter Maier entwickelt an Hand des Modells des Lebensrades seine "Pädagogik des Herzens", die neben der Wissensvermittlung die Bedürfnisse der Schüler, ihre Persönlichkeitsentwicklung, ihre Charakterbildung und ihre Werteerziehung im Blick hat. Er zeigt auf, dass eine integrative Pädagogik nötig und eine Schule mit menschlichem Antlitz auch in Zeiten des beständigen Reformdrucks bezüglich Schulstruktur, Bildung und Unterricht möglich ist. In drei fundamentalen Prinzipien erläutert er – basierend auf vielen (auch witzigen) Beispielen aus der Unterrichtspraxis –, was eine "Pädagogik des Herzens" ausmacht. Das konkrete Klassenzimmer ist auch im dritten Jahrtausend der Ort, an dem Bildung, Erziehung und Schule stattfinden. Der Lehrer spielt hierbei eine entscheidende Rolle. An ihm liegt es, eine wärmende Atmosphäre und ein menschliches Arbeitsklima zu schaffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schule – quo vadis?
Plädoyer für eine Pädagogik des Herzens
Peter Maier
Fachbuch
Die Gleichwertigkeit weiblicher und männlicher Lehrender und Lernender ist für den Autor selbstverständlich. Deshalb möchte er sie nicht ständig betonen und verzichtet daher auf eine unnötige Textaufblähung – auch, um nicht vom eigentlichen Inhalt des Buches abzulenken. Die jeweils explizite Erwähnung beider Geschlechter hätte das Buch ohne einen größeren Erkenntnisgewinn um mehrere Seiten anschwellen lassen.
Schule - quo vadis?
Plädoyer für eine Pädagogik des Herzens
Texte: © Copyright Peter Maier 2020
Verlag: Peter Maier
Impressum: Peter Maier, Hochfellnweg 2, 8210 Olching
Druck: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
ISBN:
Danksagung
Mein Dank gilt vor allem meiner „Compagna“ Valeria Groten, die mich in meinem Vorhaben bestärkt hat und mir bei der Entstehung des Buches vielfältig mit ihrem Rat beigestanden ist.
Mein Dank geht an David Sedlbauer für Entwurf und Gestaltung des Buchcovers, sowie der Grafiken im Text.
Dank gebührt auch Ludwig Aeckerle, der mir bei der Durchsicht des Manuskripts sehr behilflich war und wesentliche Korrekturarbeiten übernommen hat.
Dank sagen möchte ich den Kolleginnen und Kollegen, die mir sehr authentische Unterrichtssituationen erzählt und einer Veröffentlichung dieser ausdrücklich zugestimmt haben.
Ich danke epubli Berlin für die Möglichkeit, dieses Buch zu veröffentlichen.
Vorwort
Seit dem Pisa-Schock 2001 ist die Schullandschaft in Deutschland sehr in Bewegung geraten, besonders die gymnasiale. Es gibt viele kritische Stimmen, die dem alten G-9-Gymnasium nachtrauern und den gefühlten oder tatsächlichen Verlust der damit einhergehenden humanistischen Allgemeinbildung beklagen. Viele Eltern jammern zudem darüber, dass ihrer Erfahrung nach im neuen G-8-Turbo-Gymnasium, das in vielen Bundesländern nun die Regel ist, die Freizeit ihrer Kinder viel zu kurz komme. Sie meinen, dass eine fundierte Persönlichkeitsentwicklung während der Pubertät aufgrund der höheren Wochenstundenzahl entweder ganz blockiert oder zumindest merklich behindert würde. In solchen Argumenten mag ein Kern von Wahrheit stecken. Auf jeden Fall kommt die Bildungsdiskussion, die in der Bundesrepublik immer noch Ländersache ist, seither nicht mehr zur Ruhe.
Eine mögliche Kritik an der gegenwärtigen Bildungspolitik im Allgemeinen und an der „richtigen“ Form des Gymnasiums im Besonderen möchte ich bewusst anderen überlassen: etwa den Landeselternverbänden, die in vielen Bundesländern gegenwärtig mit den Kultusministerien um das „passende“ Gymnasium ringen; oder aber Kulturkritikern wie dem österreichischen Philosophen Konrad Paul Liessmann, der in seinem Buch „Geisterstunde – Die Praxis der Unbildung“ leidenschaftlich beißende Kritik an den gegenwärtigen Bildungsreformen übt und den Finger in die Wunde der Bildungspolitik überhaupt legt.1 Für eine gesellschaftliche Diskussion sind solche Stimmen wie die von Herrn Liessmann sicher nötig, um neue Ideen anzustoßen oder auf Fehlentwicklung hinzuweisen, auch wenn die Kritik da und dort überzogen erscheinen mag.
Bildung und Schulpolitik sind zu einem gesellschaftlichen Megathema geworden, an dem sich viele Gruppen, Verbände und Behörden beteiligen: Bildungspolitiker aller Parteien, Kultusbehörden, Bildungsinstitute, Elternverbände, Kulturkritiker und Soziologen. Fast nie aber kommen die eigentlich Betroffenen selbst zu Wort – die Schüler, um die es doch in erster Linie gehen sollte, und die Lehrer. Diese sind hauptsächlich damit beschäftigt, immer neue Vorgaben von oben in immer kürzeren Zeitabständen umzusetzen, die vielfältigen Erwartungen der Eltern nach erfolgreicher Wissensvermittlung und vor allem nach Erziehung zu erfüllen und sich im Schulalltag mit teilweise großen „Pubertätsklassen“ und bisweilen „wilden Kinderbanden“ zu behaupten und durchzusetzen. Daher meine ich, dass mein Buch einen wichtigen Beitrag zur gegenwärtigen Bildungsdiskussion leisten und eine Lücke schließen kann. Ich möchte endlich einmal Erfahrungen auch aus der Lehrerperspektive einbringen und Impulse und Anregungen aus Sicht eines praktizierenden Pädagogen geben, die vor allem auf die Schüler, ihre Situation und ihre Probleme ausgerichtet sein wollen.
Um über den Tellerrand des Schulalltags hinausschauen zu können, musste ich immer wieder die gängigen Pfade der Pädagogik verlassen. Ich wollte nicht als Fachidiot versauern oder gar in die Gefahr geraten, in ein Burn-out hineinzuschlittern. Zudem verspürte ich große Lust, auch andere Sichtweisen und neue Perspektiven kennenzulernen. Dazu musste ich zum Teil ganz individuelle, unkonventionelle und eigenwillige Wege beschreiten. Diese haben mich in meiner Tätigkeit als Pädagoge und als Autor sehr beflügelt und mit dazu beigetragen, nun ein Buch über die heutige Schule im Allgemeinen und über meine konkrete Arbeit als Lehrer im Besonderen zu schreiben.
Drei Zusatzausbildungen haben mir dazu verholfen, über Schule, Bildungssystem, Lehren und Lernen besser und vielleicht etwas kompetenter reflektieren zu können. Ich hoffe, dass Sie, lieber Leser, einige interessante Impulse, Anregungen und neue Sichtweisen über die „Schule von heute“ und über gegenwärtige Strömungen in der Bildungsdiskussion erhalten können. Wenn mir dies nur ansatzweise gelingen sollte, sind Sinn und Zweck dieses Buches bereits erfüllt.
Ich wurde bei der Abfassung meines Buches vor allem von zwei Überlegungen geleitet: Bei meiner Zusatzausbildung zum Initiations-Mentor, also zum Begleiter der Jugendlichen bei ihrem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung hin zum Erwachsenwerden, wurde mir bewusst, dass genau bezüglich dieser fundamental wichtigen Thematik ein gesellschaftliches und daher auch bildungspolitisches Defizit besteht. Im Bildungskanon der einzelnen Bundesländer habe ich die Initiation selbst, das Erwachsenwerden unserer Schüler, nirgends explizit thematisiert finden können. Zum anderen ist dieses Buch von der Sorge motiviert, dass in dem ganzen momentanen und beständigen Reformprozess vor allem an den Gymnasien die eigentliche Pädagogik und damit eine adäquate Betreuung und menschliche Begleitung unserer Schüler in ihrem Pubertätsprozess immer mehr auf der Strecke bleibt oder ganz unter die Räder kommt.
Dies darf nie passieren! Die Jugendlichen, ihre Persönlichkeitsentwicklung und ihr Wohlergehen müssen immer im Zentrum jeder Reform bei Bildung oder Schulstruktur stehen. Deshalb möchte schon der Titel des Buches „Schule – quo vadis?“ den Finger in genau diese Wunde legen. Und daher wurde auch mit Absicht der Untertitel „Plädoyer für eine Pädagogik des Herzens“ gewählt. Der Bildungskanon verfolgt immer zwei Ziele: die Wissensvermittlung und die Persönlichkeitsbildung. Über das erste Ziel gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen und Diskussionen von Fachleuten. Man glaubt, dieses Ziel steuern und kontrollieren zu können. Vielleicht.
Mein Buch hingegen möchte sich vor allem dem zweiten Ziel, der Persönlichkeitsentwicklung, Charakterbildung und Werteerziehung der Schüler, widmen, weil gerade dieses in der gegenwärtigen aufgeregten Bildungsdiskussion immer mehr ins Hintertreffen zu geraten scheint. Dieses zweite Bildungsziel, das sich mit der Realität von Jugendlichen in der Pubertät beschäftigen will, kann nicht so einfach „gemessen“, überprüft und gesteuert werden. Es ist aber deshalb nicht weniger wichtig als die eigentliche Wissensvermittlung. Und beide Ziele – Wissensvermittlung und Persönlichkeitsentwicklung – gehören untrennbar zusammen.
Die Slogans „Erziehung durch Beziehung“, „Initiation als Schlüssel der Pädagogik“ und „Auf den Lehrer kommt es an“ sind es wert, näher betrachtet und untersucht zu werden. Das vorliegende Buch stellt sich die Aufgabe, zumindest punktuell einzufangen, worin denn eine „Pädagogik des Herzens“ bestehen könnte, nach der alle Sehnsucht haben, die aber eben nicht künstlich erzeugt oder autoritativ von oben her verordnet werden kann und die wohl in der Praxis von Schule und Unterricht so oft nicht gelebt und erlebt wird. Vielleicht bin ich ein unverbesserlicher Idealist, der auch nach 34 Jahren als Lehrer am Gymnasium noch immer an die Möglichkeit und an die tägliche Realisierung einer solchen „Pädagogik des Herzens“ glaubt – zumindest im Klassenzimmer.
Nach einer Einleitung soll in Kapitel 1 zunächst auf einige Aspekte der aktuellen Bildungsdiskussion eingegangen werden. In Kapitel 2, das autobiographisch ausgerichtet ist, möchte ich meinen persönlichen Werdegang als Lehrer schildern und anhand einiger exemplarisch ausgewählter Situationen verdeutlichen, worauf es im Unterricht wirklich ankommt.
In Kapitel 3 wird schließlich der Initiations-Gedanke, also der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler von der Pubertät bis hin zum Erwachsensein, ins Zentrum der Überlegungen gerückt. Denn neben der eigentlichen Wissensvermittlung muss gerade dieses Ziel stets in den Blick genommen werden. Unsere Kinder und Jugendlichen sind keine Lernmaschinen! Die Initiation kann dabei zurecht als „Matrix der Persönlichkeitsentfaltung“ gelten.
In Kapitel 4 wird das sogenannte „Lebensrad“ vorgestellt, das als Grundlage und Modell einer modernen, integrativen Pädagogik dienen kann. In Kapitel 5 wird dieses Modell des Lebensrades dann zuerst auf die Situation der Schüler angewandt. In Kapitel 6 dient es dazu, die Ausbildung der Lehrerpersönlichkeit zu untersuchen und näher zu entfalten. Im letzten Kapitel 7 schließlich habe ich einige Prinzipien dargelegt, die für mich unabdingbar für eine „Pädagogik des Herzens“ sind, um die es in der Schule immer gehen sollte.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass die sieben Kapitel eine systematische Ordnung aufweisen. Im Zentrum des Buches steht Kapitel 4, in dem mit Hilfe des Lebensrades eine integrative Pädagogik entworfen wird. Die drei Kapitel davor korrespondieren dann mit je einem Kapitel danach. Während in Kapitel 1 die reale, gegenwärtige Situation von Schule und Bildungspolitik im Fokus steht, soll in Kapitel 7 gleichsam als Antwort darauf die Vision einer „Pädagogik des Herzens“ entworfen werden. Kapitel 2, in dem es um meinen persönlichen Werdegang als Pädagoge geht, korrespondiert mit Kapitel 6, in dem die Archetypen der Lehrerpersönlichkeit ganz allgemein entfaltet werden. Kapitel 3 schließlich widmet sich ganz grundsätzlich der Initiation – der Persönlichkeitsentfaltung und dem Erwachsenwerden der Schüler. Darauf nimmt dann wiederum Kapitel 5 Bezug, in dem mit dem exemplarisch vorgestellten und auch für Schulen geeigneten Initiations-Ritual des WalkAway eine reale Möglichkeit beschrieben wird, wie dieser Prozess des Erwachsenwerdens heute ganz konkret und im Rahmen der Schule gestaltet werden kann.
Mir ist bewusst, dass ich in diesem Buch nur einige Anregungen und Impulse geben kann. Diesen Anspruch möchte ich jedoch als mittlerweile „alter Hase der Pädagogik“ durchaus erheben – unverkrampft und bisweilen mit einem Augenzwinkern nach dem Motto: „Leute, nehmt die Bildungspolitik und vor allem unsere Schüler ganz ernst, aber vergesst dabei die Freude nicht! Schule kann doch auch im dritten Jahrtausend Spaß machen!“
Olching, im Herbst 2015
Peter Maier
Die Corona-Krise verhinderte 2020 wochenlang das Unterrichten der Kinder und Jugendlichen in der Schule. Durch die Digitalisierung war Home-Schooling jedoch möglich. Dabei zeigte sich aber, wie enorm wichtig der persönliche Kontakt zwischen den Schülern untereinander und zwischen Schülern und Lehrern für den Lernerfolg ist. Viele Kinder und Jugendliche vermissten ihre Lehrer schmerzlich. Für die Persönlichkeitsentwicklung, die Charakterbildung und die Werteerziehung ist der Lehrer-Schüler-Kontakt auch im dritten Jahrtausend unverzichtbar, da Jugendliche gerade in der Pubertät eben keine digiatlisierten Lernroboter sind. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erhalten die in diesem Buch vorgebrachten „Grundprinzipien einer Herzenspädagogik“ daher eine ganz neue, unerwartete Aktualität.
Olching im Frühjahr 2020
Peter Maier
Einleitung
Wenn ich das Referendariat mit einbeziehe, dann bin ich jetzt, da ich dieses Buch schreibe, seit 34 Jahren ohne Unterbrechung als Lehrer an staatlichen Gymnasien in Bayern tätig. Und wenn man will, könnte man dies so ausdrücken: Seit 34 Jahren bin ich „an der pädagogischen Front“ im Einsatz. Im Rückblick auf diese lange Zeit kann ich sagen: Ich bin noch immer gerne Lehrer und habe die meiste Zeit auch gerne unterrichtet. Das pädagogische Feuer, das man unbedingt braucht, um heute vor großen Klassen bestehen zu können und nicht frustriert zu werden, lodert noch immer in mir.
In Deutschland sind die weiterführenden staatlichen Schulen „Mainstream-Schulen“, da die meisten Eltern ihre Kinder in genau diese Schularten schicken. Ich persönlich halte unser gegenwärtiges Schulsystem trotz der sehr aufgeregten bildungspolitischen und gesellschaftlichen Dauer-Diskussion auch im internationalen Vergleich grundsätzlich für geeignet, den Kindern und Jugendlichen das Wissen zu vermitteln, das sie für die Erfordernisse unserer heutigen Bildungsgesellschaft in einer globalisierten Welt benötigen.
Ich selbst würde mich einerseits als „konservativen Lehrer“ in einem wörtlichen Sinne bezeichnen, der das, was sich beim jahrzehntelangen Unterrichten bewährt hat, erhalten und weitergeben will. Ich bin etwas skeptisch, wenn in immer kürzerer Taktung wieder eine „neue pädagogische Sau“ durchs „Schul-Dorf“ getrieben wird, von der es heißt, sie würde alle Schulprobleme schnell beseitigen oder „die“ Lösung für einen exzellenten Unterricht bringen. Im Rückblick betrachtet gab es aber drei entscheidende Entwicklungen, die mich zwangen, meinen Standpunkt als Lehrer in seinen Grundlagen neu zu überdenken. So gesehen halte ich mich persönlich auch für einen fortschrittlichen, suchenden und „progressiven Pädagogen“.
Die erste dieser Entwicklungen wurde in mir zu einer Zeit ausgelöst, in der am Gymnasium bildungspolitisch gesehen noch relative Ruhe herrschte. Denn vor 20 Jahren wurde mir in einer Lehrerkonferenz schlagartig bewusst, dass ich motivationslos und krank werden könnte, wenn ich nicht sofort etwas für mich selbst unternehmen und meine Lehrerpersönlichkeit entscheidend weiterentwickeln würde. Und so begann ich 1995 mit der ersten meiner drei Zusatzausbildungen, die sich dann über 15 Jahre hinweg erstreckt haben:
zum Lehrer für Gruppendynamik nach der Methode der „Themenzentrierten Interaktion“ (TZI) nach Ruth Cohn;
zum Supervisor an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München, einem Institut, das nach dem Standard der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSV) ausbildet;
und zum Initiations-Mentor in der Tradition der nordamerikanischen „School of Lost Borders“.
2
Diese drei Weiterbildungen haben mich ziemlich verändert – als Mensch und als Lehrerpersönlichkeit. Ja, sie haben mir erst die Augen dafür geöffnet, was in der Schule und beim Unterrichten möglich und für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler nötig ist. Dafür bin ich auch aus heutiger Sicht noch sehr dankbar. Denn dadurch wurde mein Unterricht viel lebendiger, meine Beziehung zu den Schülern intensiver und, davon bin ich überzeugt, meine Effektivität als Lehrer größer.
Und dann platzte 2001 mit dem sogenannten Pisa-Schock eine bildungspolitische Bombe in das herkömmliche, etwas behagliche und betuliche deutsche Schulsystem, die alles veränderte. Danach war nichts mehr, wie es einmal war. Dies war die zweite wesentliche Entwicklung, die ich als Lehrer erlebte und die diesmal von außen kam. Dazu hieß es unter der Überschrift „Der heilsame Schock“ in ZEIT ONLINE vom 2. Dezember 2011:
„Vor zehn Jahren, am 4. Dezember 2001, schockte die erste Pisa-Studie die deutsche Öffentlichkeit. Denn die Leistungen unserer Schüler im Lesen, in der Mathematik und den Naturwissenschaften erwiesen sich im internationalen Vergleich als unterdurchschnittlich. Noch schlimmer: Jeder vierte 15-Jährige konnte nicht richtig lesen und schreiben.“3
Die Folge dieser Pisa-Studie, die das deutsche Bildungssystem im Allgemeinen und das Gymnasium im Besonderen eher schlecht wegkommen ließ, war, dass mehrere westliche Bundesländer bald darauf und überstürzt das verkürzte, achtjährige Gymnasium einführten, das in den ostdeutschen Ländern bereits die Regel war. Ein entscheidendes Argument zur Verkürzung der Schulzeit bei einer gleichzeitigen Beibehaltung des Abiturniveaus war auch der Druck aus der Wirtschaft. Deutsche Uni-Absolventen sollten in Zukunft, so wie in vielen Vergleichsländern, schon früher, das heißt schon Anfang zwanzig, für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können.
Infolge dieser Reformen wurden in den einzelnen Bundesländern zudem moderne Unterrichtsmethoden eingeführt, eine neue, vergleichende Aufgabenkultur entwickelt und neue Leitungs- und Führungsmodelle erprobt, so wie sie in Unternehmen üblich sind. Diese gymnasialen Reformen wurden aufgrund des Pisa-Schocks in vielen Bundesländern in der Regel von oben her, das heißt von den zuständigen Kultusministerien, durchgesetzt. Deutschland sollte als Bildungsland, als Land der Ingenieure, der Hochleistungstechnologie und einer modernen Dienstleistungsgesellschaft, fit gemacht werden für eine globalisierte Welt im dritten Jahrtausend. So wurde etwa in Bayern 2003 von der damaligen Landesregierung ganz unerwartet und überstürzt das verkürzte G-8-Gymnasium beschlossen und das bisherige Kurssystem mit Grund- und Leistungskursen aufgelöst.
Diese schnellen Reformen von oben vor allem in den westlichen Bundesländern brachten natürlich große Unruhe bei Lehrern und Schülern, sowie bei großen Teilen der Elternschaft mit sich. Im Stadtstaat Hamburg zerbrach an der Gymnasial-Reform die Landesregierung einer Koalition aus CDU und Alternativer Liste, in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen wurde das alte G-9-Gymnasium wahlweise wieder eingeführt. Auch das Bayerische Kultusministerium kommt seither nicht mehr ganz zur Ruhe und ringt noch immer um geeignete Nachbesserungen im G-8-Gymnasium.
Die dritte Entwicklung, mit der ich mich als Lehrer auseinandersetzen musste und muss, würde ich als die „digitale Revolution“ bezeichnen, die natürlich auch vor den Schulen nicht halt machen kann und darf. Sie verändert den Schulalltag im Allgemeinen und die Mediennutzung und die damit zusammenhängenden Unterrichtsmethoden im Besonderen permanent mit hoher Geschwindigkeit. Diese Revolution setzte fast zeitgleich mit dem Pisa-Schock ein. Als Beispiele können dazu unter anderem der vermehrte Internet-Einsatz im Unterricht oder die Möglichkeit eines „Internet-Portals“ für die Lehrerkommunikation angeführt werden. Natürlich müssen sich auch wir „alten“ Lehrer diesen digitalen und medialen Herausforderungen stellen. Als ein sehr deutliches Symbol für diese fundamentalen Veränderungen könnten die interaktiven Tafeln, „Whiteboards“ genannt, gelten, die die bisherigen, seit Jahrhunderten bewährten Kreidetafeln ein für alle Mal ablösen.
Dennoch scheint mir in dem ganzen „Hype“ aus gesellschaftlicher Dauerdiskussion um die richtige Struktur des Gymnasiums, neuer technokratischer Schulverwaltungs-Reformen, sowie der durch die digitale Revolution verursachte permanente Veränderungsprozess in den Kommunikationsmitteln, Medien und Unterrichtsmethoden das Entscheidende von Schule und Unterricht immer mehr in den Hintergrund zu geraten: eine Pädagogik des Herzens, die diesen Namen auch verdient.
Ich trauere dem „alten Gymnasium“, das bis zum Hereinbrechen des Pisa-Schocks 2001 in westlichen Bundesländern existierte, nicht nach. Ich selbst habe mich ja schon zu einer Zeit, als noch alles beim Alten zu bleiben schien, durch meine langjährigen Fortbildungen auf den Weg zur Entwicklung meiner eigenen Lehrerpersönlichkeit gemacht. Dennoch beschleicht mich jetzt immer mehr der Verdacht, dass oftmals von oben her verordnete Strukturreformen und eine permanente technisch-digitale Veränderung schon als „die“ eigentliche Schulentwicklung selbst angesehen wird – eine große Illusion, wie ich meine!
Ja, man kann für viel Geld immer neue Informatikräume einrichten und diese mit der jeweils modernsten Generation von Computern bestücken, man kann DVDs auf interaktiven Tafeln abspielen oder You-Tube-Filme sofort ins Klassenzimmer holen. Dies ist toll und dies ist sofort messbar. Auch eine veränderte Schulleitungs-Struktur – ob notwendig und sinnvoll oder nicht –, ist sofort „sichtbar“. Aber ist dies alles wirklich „das“ entscheidende Moment für einen lebendigen und substanziellen Unterricht? Und werden die Ansprüche an eine moderne Pädagogik schon dadurch erfüllt, dass vor jedem Schüler ein Computer steht und sich in jedem Klassenzimmer nun ein interaktives Whiteboard befindet?
Ich glaube vielmehr, dass die eigentliche Pädagogik, die natürlich nicht so leicht sichtbar und messbar gemacht werden kann, immer mehr in den Hintergrund gerät. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie überflüssig geworden wäre. Denn Jugendliche können in der Regel nur dann gut arbeiten und ordentliche Leistungen erzielen, wenn sie in einer fruchtbaren und lebendigen Beziehung zum jeweiligen Lehrer stehen. Der Slogan „Erziehung durch Beziehung“ hat seine Gültigkeit keineswegs verloren. Im Gegenteil, er ist aktueller denn je. Wenn dieser Grundsatz im großen Getöse der neuesten Medienentwicklung und im von Kritikern so bezeichneten „Schulreformwahn“, den der Pisa-Schock ausgelöst hat, übersehen wird, läuft etwas total schief an der Schule – vor allem am Gymnasium. Hier liegt im Moment viel im Argen und hier muss gegengesteuert werden.
Besonders das Gymnasium, in das Schüler als Kinder eintreten und das sie acht oder neun Jahre später als bereits Volljährige wieder verlassen, muss immer zwei grundlegende Hauptziele im Auge haben: die fachliche Bildung und die Persönlichkeitsentwicklung, die Hochschulreife und die Charakterbildung, die geistige, wissenschaftliche Herausforderung und die Vermittlung von emotionalen und sozialen Kompetenzen gleichermaßen. Gerade diese zweite Ebene von Persönlichkeitsentwicklung zur Selbständigkeit und Selbstverantwortung, von Charakterbildung und Impulsen zum Erwachsenwerden ist angesichts des digitalen und technokratischen Reformdrucks, sowie der gesellschaftlichen Dauerdiskussion um die richtige Schulstruktur vollkommen in den Hintergrund geraten. Ich möchte diese heute kaum mehr beachtete Ebene mit dem Begriff „Pädagogik des Herzens“ umschreiben.
Eine Herzens-Pädagogik lässt sich aber auch mit einer Schar von externen Evaluatoren, die ein Gymnasium auf Herz und Nieren prüfen wollen, nur ansatzweise oder gar nicht erfassen. Auch vom grünen Tisch einer Kultusbehörde aus kann diese Ebene, zu der vor allem die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern gehört, schwerlich erreicht werden. Meine drei Zusatzausbildungen, die alle die pädagogische Praxis im Klassenzimmer selbst im Blick hatten, haben mir aber genau für diese zweite, eher nicht messbare Ebene den Blick geschärft. Wenn diese im Alltag von Unterricht und Schule jedoch fehlt, geht das Herz der pädagogischen Arbeit verloren. Folgenden Fragen möchte ich daher in diesem Buch besonders nachgehen:
Was brauchen Jugendliche, besonders Jungen, wirklich, um ihre Persönlichkeit gut entfalten und zugleich ordentliche Lernerfolge erzielen zu können?
Wie können unsere Schüler von uns Lehrern in der bisweilen schwierigen Zeit ihrer Pubertät adäquat begleitet und zum Erwachsenwerden hingeführt werden? Denn wenn sie mit dem Abitur die Schule verlassen, sind sie volljährig und damit rechtlich gesehen Erwachsene.
Wie kann eine Schulart wie das Gymnasium den Spagat bewältigen, sich den immer neuesten medialen und strukturellen Entwicklungen zu öffnen, um die geforderte Wissensvermittlung zu bewerkstelligen, und zugleich dem Anspruch gerecht werden, weiterhin ein Ort der Menschlichkeit, sowie der Persönlichkeits-, Charakter- und Wertebildung für die Schüler zu bleiben?
Wie kann ich mich als einzelner Lehrer in der ganzen Umbruchssituation und in dem heutigen „Hochgeschwindigkeits-Schulalltag“ behaupten und zugleich meinen Schülern Orientierung geben und ihnen Vorbild sein? Wie kann ich also in meinem Unterricht eine gelassene Atmosphäre schaffen und eine „Pädagogik des Herzens“ verwirklichen?
Diese Fragen sollen in den nachfolgenden Kapiteln näher entfaltet, diskutiert und schließlich beantwortet werden. Es sollen zudem neue und konstruktive Wege gleichsam als notwendiges Korrektiv zur gegenwärtigen aufgeregten Bildungs- und Schulentwicklung aufgezeigt werden. Damit dies möglich wird, sollen im ersten Kapitel zunächst plakativ und griffig einige wesentliche Phänomene beschrieben werden, mit denen sich Schule, Schüler, Lehrer und Schulleitungen gegenwärtig auseinandersetzen müssen.
Kapitel 1: Schulreformen – geplatzte Illusionen?
Wie in Vorwort und Einleitung bereits erwähnt, löste der Pisa-Schock 2001 bei den Bildungsverantwortlichen zuerst Entsetzen und dann eine große und bisweilen überstürzte Reformtätigkeit aus, die fast ausschließlich von oben verordnet wurde. Eine gute und fundierte Reform braucht aber in der Regel Zeit, alle Betroffenen müssten zu Wort kommen dürfen und in ihren Ansprüchen, Bedürfnissen und Erfahrungen ernst genommen werden: die Schüler, ihre Eltern, die Lehrer, die Schulleiter, die Sachaufwandsträger. Kein Wunder, dass Kritik von Elternverbänden danach nicht ausblieb und sogar Landtagswahlen nicht zuletzt aufgrund der Bildungspolitik gewonnen oder verloren wurden.
Der Einfluss von Wirtschaftsverbänden hat bei der Einführung des verkürzten G-8-Gymnasiums in vielen westlichen Bundesländern sicher eine wichtige Rolle gespielt. Schließlich sollte Deutschland im internationalen Vergleich auch zukünftig bestehen können. Ich denke, Reformen im Schulbereich waren und sind unbedingt nötig. Wenn der Wirtschafts- und Bildungsstandort Deutschland weiterhin im internationalen Vergleich konkurrenzfähig bleiben soll, dann dürfen wesentliche Reformen natürlich auch nicht vor den Schulen halt machen.
Mein Eindruck als Betroffener dieser notwendigen Entwicklung ist jedoch, dass hier ein fundamentaler Irrtum begangen wurde und immer noch wird. Ich möchte dies einmal bewusst provozierend und plakativ so ausdrücken: Schüler sind keine Roboter oder Lernmaschinen, sie sind Menschen in der Pubertät – also genau in der Phase, die zu einem eigenständigen und selbstverantwortlichen Leben führen soll. In der Schule darf es daher nicht nur um bloße Wissens- und Kompetenzvermittlung gehen, obwohl diese äußerst wichtig sind. Gerade in der Pubertät sind die Jugendlichen in einer fundamentalen Entwicklungs- und Umbruchssituation, sie sollen zudem soziale Fähigkeiten einüben und ein eigenes Wertesystem ausbilden können. Dazu braucht es aber Zeit und Muße.
Wenn Jugendliche durch eine hohe Wochenstundenzahl wie am G-8-Gymnasium und durch eine hohe Frequenz von Prüfungen zu sehr unter Druck gesetzt werden, haben sie zu wenig Zeit, sich zu entfalten, nachzudenken und ihren sonstigen Neigungen nachzugehen. Schüler brauchen genügend Freizeit, damit sie den Stoff verdauen können und sich das Gelernte in ihnen setzen kann. Außerdem müssen sie Anregungen für ihre Persönlichkeitsentwicklung aufnehmen und integrieren können. Daher ist es kein Wunder, dass sich nach fast 15 Jahren Reformtätigkeit der Kultusbehörden immer mehr Gegenstimmen erheben, die den tatsächlichen oder nur vermeintlichen Untergang des herkömmlichen Gymnasiums beklagen und auch nicht mit beißender Kritik sparen. Der Nachteil an diesen Stimmen ist jedoch, dass sie meist von außerhalb des Schulsystems kommen. Was ist mit den Betroffenen selbst – mit den Schülern und den Lehrern? Gerade die Erfahrungen der Lehrer sind jetzt in der öffentlichen Debatte gefragt.
Dieses Buch möchte genau hier ansetzen: Ich möchte Impulse und Anregungen zu Schule und Unterricht aus der Sicht eines erfahrenen Pädagogen geben, die ich in der momentanen, heiß gelaufenen Bildungsdiskussion ziemlich vermisse. Um dies bewerkstelligen zu können, wird in diesem ersten Kapitel zunächst auf wesentliche Punkte der gegenwärtigen Bildungsdiskussion eingegangen und es sollen einige ernst zu nehmende Kritiker zu Wort kommen.
(1) Bildungsreformen: Schule – quo vadis?
Der österreichische Philosoph und Kulturkritiker Konrad Paul Liessmann hat mit seinem Buch „Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift“4 viel Aufsehen erregt. Er wendet sich leidenschaftlich und in sehr plakativer und zum Teil sarkastischer Weise gegen den durch den Pisa-Schock ausgelösten und von ihm so betrachteten „Bildungsreform-Wahn“. Schon der Text auf dem Bucheinband lässt erahnen, wohin seine Kritik zielt: „Niemand weiß mehr, was Bildung bedeutet, aber alle fordern ihre Reform. Ein regelrechter Markt hat sich etabliert, auf dem Bildungsforscher und -experten, Agenturen, Testinstitute, Lobbys und nicht zuletzt Bildungspolitiker aller Fraktionen ihr Wesen und Unwesen treiben.“5
Kritische Thesen zur Bildungsreform
Nachfolgend sollen einige seiner Gedanken in Form von zehn kritischen Thesen an der gegenwärtigen Bildungspolitik wiedergegeben werden:6
1. These
Öffentliche Schulen sind heute zu Laboratorien von Bildungsforschern und Erziehungswissenschaftlern mutiert. Sie entwerfen eine „schöne neue Schulwelt“ über die Köpfe von Lehrern und Schülern hinweg. Zusätzlich werden viele ungelöste gesellschaftliche und soziale Probleme auf die Schulen abgewälzt, was zu deren völligen Überforderung führt. (vgl. S. 23).
„Der Gedanke, dass Schulen auch Schutzräume darstellen können, die sich bewusst auf wesentliche Fragen konzentrieren und sich gegenüber den Zumutungen einer hysterisierenden Öffentlichkeit auch abschotten können, ist uns sehr, sehr fremd geworden.“ (S. 24).
2. These
Der vergleichende Pisa-Test, der ja vorgibt, den Bildungsstand eines Landes „objektiv“ ermitteln zu können, wird von immer mehr Experten als zu fehlerhaft kritisiert. Dennoch halten bisher alle Länder und die Verantwortlichen in den Kultusbehörden daran fest wie an einem Evangelium. „Pisa misst also in erster Linie den Glauben von Bildungspolitikern und Bildungsjournalisten an fragwürdige Statistiken. Pisa ist längst zu einer säkularen Religion geworden, die nur mehr Rechtgläubige und Ketzer kennt.“ (S. 13).
Die angeblichen „Bildungskatastrophen“, von denen in den Medien immer wieder reißerisch berichtet wird, werden durch Pisa erst künstlich erzeugt, um danach die Notwendigkeit von Reformen fordern zu können. Dahinter stecken aber Interessen, die mit der eigentlichen Bildung gar nichts zu tun haben: nur wettbewerbsorientierte Wirtschaftskreise; die empirische Bildungsforschung, die ja gerade durch permanente Reformen erst an Bedeutung gewinnt; die Sehnsucht von Bildungspolitikern nach Ranglisten im Bildungsvergleich, in denen sie dann nach Spitzenplätzen gieren können (vgl. S. 17).
3. These
Eine wesentliche Schuld an der überall empfundenen „Bildungspanik“ hat die empirische Bildungsforschung selbst. Denn an ihren angeblichen Fähigkeiten, objektive und substanzielle Aussagen über den Bildungsstand eines Landes machen zu können, wird bereitwillig und naiv geglaubt. Auf deren Testergebnisse wird dann mit hektischen Aktivitäten von Seiten der Bildungspolitik reagiert – etwa dass die Fachlehrpläne zum x-ten Male „entrümpelt“ werden. „In Summe ergibt sich das Bild eines haltlosen Aktivismus, der eine überbordende, kontrollierende, evaluierende, steuernde und anlassbezogene Bürokratie schafft, die Bildungsprozesse in der Regel eher sabotieren denn befördern.“ (S. 19).
Der Bildungsbereich ist zu einem internationalen Kampfplatz mutiert. Dabei gibt die OECD7 den Takt an, nach dem sich dann die Bildungspolitiker der Länder bereitwillig richten: „Hier geht es um wirtschaftsnahe Ausbildung, um Schulung zur Anpassungsfähigkeit, um internationale Vergleichbarkeit, um ein effizientes Verhältnis zwischen Ausgaben und Ergebnissen, und es geht immer noch um die leidige Akademikerquote...“ (S. 19 f.)
Bei den Pisa-Vergleichstests handelt es sich nur um ein großangelegtes Täuschungsmanöver, das für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft nicht viel bringt, sondern höchstens die diffuse Sehnsucht befriedigen kann, in einer OECD-Statistik ein paar Plätze gut gemacht zu haben. (vgl. S. 21).
4. These
Bei dem heutigen pädagogischen Ansatz ist nicht mehr das Wissen als solches, sondern nur noch die Anwendungskompetenz von Wissen wichtig. Dies ist aber ein fundamentaler Irrtum: „Pisa verstärkt dabei jene verhängnisvollen Tendenzen in der Didaktik, die zwischen Fähigkeiten und Kenntnissen nicht mehr unterscheiden und am Ende eines Lernprozesses immer eine Kompetenz zur Lösung einer lebensweltlich orientierten Aufgabe sehen wollen.“ (S. 14 f.).
Das „… zu glauben, dass diese Problemlösungskompetenzen unabhängig von Wissen erworben werden können, ist aber ebenso ein Irrtum wie die Annahme, dass auf ein Wissen, das nicht zu einer unmittelbaren Handlungsorientierung führt, immer und überall verzichtet werden könne.“ (S. 15).
5. These
Die Schlagworte aktueller Bildungspolitik wie etwa „Kompetenzorientierung“ oder „Wettbewerbsvorteil“ signalisieren einen gravierenden Bruch mit den Idealen klassischer Bildungskonzeptionen, die das Wissen selbst noch hochschätzten. Die Atmosphäre und der Geist an den Stätten der Bildung haben sich entscheidend verändert. (S. 28).
Bildung wird heute nur noch unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Verwertbarkeit gesehen. Eine Hingabe an die Bildung als Wert an sich geht immer mehr verloren. „Kein Wunder, dass sich gerade im Bereich der Bildung die Entrümpler, Kürzer, Entsorger, Ballastabwerfer nur so tummeln. In der Katastrophen-, Test- und Dauerreformrhetorik zeigt sich die Praxis der Unbildung in ihrer hysterisierten Gestalt.“ (S. 28).
Bildungseinrichtungen wie Schulen brauchen daher weniger statt immer mehr Reformen, sie benötigen „... Entschleunigung, nicht Hektik, Besonnenheit, nicht Tempo, Stabilität, nicht permanenten Wandel, Sicherheit, nicht medialen und politischen Dauerbeschuss.“ (S. 29).
6. These
„Kompetenzorientierung“ lautet heute das Zauberwort in der Bildungspolitik, das alles Bisherige hinfällig werden lässt. An Stelle von totem Wissen sollen nun nur noch brauchbare Fähigkeiten erworben und nichts Unnützes mehr gelernt werden. So soll der kompetent gewordene Mensch der Zukunft entstehen, der sich in jeder Situation die wichtigsten Informationen beschaffen und angemessene Entscheidungen treffen kann. „Der Nimbus internationaler Tests wie Pisa rührt auch daher, dass damit Kompetenzen angeblich genau vermessen und deshalb auch verglichen werden können.“ (vgl. S. 45 und S. 46).
Das derzeit überall gerühmte „Kompetenzkonzept“ wurde ursprünglich in der Wirtschaft entwickelt und dann auf die Pädagogik übertragen. Man spricht etwa von Selbstkompetenz, Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz und Systemkompetenz. (vgl. S. 46).
Der Kompetenzbegriff hat sich mittlerweile zu „dem“ Universalbegriff in der Bildungspolitik schlechthin entwickelt, der alles andere – auch Schlüsselqualifikationen und Sachkenntnis – in sich aufnimmt. Wohin diese Entwicklung gehen kann, zeigt zum Beispiel der umstrittene Entwurf „Lehrplan 21“ in der Schweiz, der 4000 (!) Kompetenzen aufweisen kann. (vgl. S. 49).
7. These
Diese Umstellung von Bildung und Fachwissen auf nur noch Kompetenzen ist „eine Praxis der Unbildung, die vor gar nichts mehr zurückschreckt.“ (S. 51). Denn dieses Kompetenz-Konzept erwies sich in der Praxis als verheerend, nachdem es „... in die Hände von Fachdidaktikern, empirischen Bildungsforschern, Schulreformern und ministeriellen Bürokraten gelangt...“ war. (S. 47).
Mit der ausschließlichen Kompetenzorientierung wurden nämlich gleich zwei Gesichtspunkte mit festgelegt: Alle Kompetenzen müssen ausschließlich dem Lösen von Problemen dienen; und alles Problemlösen muss erfolgreich umgesetzt, genützt und auf konkrete Situationen angewandt werden können. Die Folge: Alles, was in der Schule in Zukunft gelernt wird, muss anwendungsorientiert und mit dem Nachweis der Nützlichkeit versehen sein. (vgl. S. 47 f.).
Wir sind heute zu feige geworden, in geistigen Inhalten einen Wert an sich zu sehen – jenseits aller aktuellen Bedürfnisse. Das eigentliche Wissen wird aus den Lehrplänen geworfen. Dafür vermitteln und testen wird dann (inhalts)leere Kompetenzen, die wir für besonders praxis- und lebensnah halten – die Praxis der Unbildung in ihrer hypertrophen Gestalt. Der reinen Kompetenz-Ideologie wird alles andere geopfert. (vgl. S. 56 f. und S. 59).
8. These
Die Entwicklung ist schon so weit gediehen, dass konstatiert werden muss: „Uns fehlt mittlerweile jede Vorstellung davon, dass es geistige Inhalte geben könnte, die Wert und Interesse in und für sich selber haben und deshalb der entscheidende Stoff, die entscheidende Nahrung für die Entwicklung eines jungen Menschen sein müssen. Wissen heute ist ergebnisorientiert und anlassbezogen, es soll sich entweder an den Bedürfnissen der jungen Menschen, an den Wünschen der Arbeitgeber oder an den Herausforderungen der Zukunft, die niemand kennt, orientieren.“ (S. 56)
Dagegen muss gefordert werden, dass wieder offen über den Bildungskanon debattiert wird. Es sollte eine Lust auch an einer zweckfreien Betätigung des Geistes geben, denn nur so kann wieder Wissen entstehen, das zugleich notwendig und befreiend ist. Die Bildungsplaner sollten doch darauf vertrauen, dass all die Kompetenzen auch dann erreicht werden können, wenn die ganze Bildung nicht schon von vorneherein nur noch zweckgebunden ist. (vgl. S. 59 f).
9. These
Durch die Kompetenzorientierung werden nun die operationalisierbaren Fähigkeiten und nicht mehr fachspezifische Kenntnisse als zentrale Ziele von Lernprozessen proklamiert. Die Fächer und Disziplinen, die es immer gegeben hat in der Schule und an der Universität, unterliegen nicht zuletzt deshalb „... aktuell einem rasanten Prozess der Verflüchtigung, der nicht nur altgewohnte und liebgewordene Vorstellungen zerstört, sondern auch die Frage nach den Ordnungen des Wissens völlig neu stellt.“ (S. 61).
Dabei ist es doch so, dass sich die Neugierde der Schüler immer auf etwas, auf einen Gegenstand, also auf ein Fach richtet, nie jedoch auf eine Kompetenz. Eine bloße Kompetenz kann keine Begeisterung vermitteln – weder bei Schülern noch bei Lehrern. (vgl. S. 76 f.).
Um dies an einem Beispiel klar zu machen: Ein Text selbst sollte doch Inhalt und Ziel des Unterrichts sein, aber dies „... ist der kompetenzorientierten Bildungskonzeption fremd geworden. In der Fächerdämmerung, die sich über unsere Schulen … senkt, verschwindet so ein essentielles Moment europäischer Bildung: der Hunger nach Erkenntnis, der Wille zur Welt, die Konzentration auf eine Sache, die Neugier auf alles Mögliche und nicht nur auf das, was heute oder morgen nützen kann. Die neue Disziplinlosigkeit führt zu einer Verwahrlosung des Denkens und einer Abwertung des Wissens, die nur im Interesse jener sein kann, die kein Interesse an gebildeten Menschen haben, da die Dummheit zu den Fundamenten ihres Geschäftsmodells zählt.“ (S. 76).
10. These
Nur wenn die Fächer als solche erhalten bleiben, bleibt auch echte Bildung erhalten, die diesen Namen noch verdient. Fachwissen durch Kompetenzen zu ersetzen bedeutet somit einen gravierenden Verlust von Bildung. (vgl. S. 77).
Bildungssysteme, die rein ökonomisch und kompetenzorientiert ausgerichtet sind, werden eine heftige geistige Krise erleben. Denn die Konsequenzen sind mittelfristig das Verschwinden der „Humanities“ – der geisteswissenschaftlichen und musischen Fächer. Es geht nur noch um die einseitige Orientierung von Schule und Studium an den Zielen wirtschaftlicher Verwertbarkeit, um ein Konzept von Bildung also, das eine berufsorientierte Ausbildung mit dem Schwerpunkt in den naturwissenschaftlichen Fächern und in Wirtschaft hat. (vgl. S. 168 f.).
„Das Handeln und Denken der Gegenwart orientiert sich an einem einzigen Parameter: dem Wirtschaftswachstum. Daran wird nicht nur der Erfolg von Gesellschaften gemessen, danach richten sich auch die Investitionen im Bildungsbereich … Das Wirtschaftswachstum beschreibt allerdings nur einen Aspekt der gesellschaftlichen Entwicklung. Andere Dimensionen werden davon weder erfasst noch folgen sie gleichsam naturwüchsig aus der ökonomischen Prosperität: Gesundheit, Glücksfähigkeit, Gerechtigkeitschancen, Ausweitung demokratischer Rechte, Möglichkeiten der Partizipation und Verantwortung, Gleichberechtigung von Individuen ...“ (S. 169). Dies ist dann die „allgegenwärtige Praxis der Unbildung“. (vgl. S. 181).
Anmerkungen aus Sicht eines praktizierenden Pädagogen
Soweit in knappen Thesen die wichtigsten Aussagen von Herrn Liessmann über die gegenwärtigen Reformen im Bildungsbereich. Wie wirken diese Ansätze aus Sicht eines altgedienten Pädagogen? Nachfolgend ebenfalls zehn Anmerkungen:
1.
Die Stimme von Herrn Liessmann war in der Bildungsdiskussion notwendig und für mich persönlich ist sie erfrischend. Sie will aufrütteln und anregen. Sehr zutreffend finde ich die Erkenntnis, dass Schulen immer mehr Gefahr laufen, zu Versuchslaboratorien von gesellschaftlichen Gruppierungen gemacht zu werden, die gar nichts mit der Schule zu tun haben. Die Bildungsexperimente werden tatsächlich und oftmals unnötig auf dem Rücken von Schülern und Lehrern ausgetragen.
2.
Es ist fatal, wenn (Fach)Wissen immer mehr durch bloße Kompetenzfähigkeiten ersetzt wird. Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Beides ist gleichermaßen notwendig: fundierte Fachkenntnisse und ihre Anwendungskompetenzen. Beide Prinzipien dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wenn man sich etwa mit der fast ausschließlichen Orientierung an Kompetenzen nur noch auf ein Prinzip versteift, ist dies wie bei einer Monokultur. Irgendwann ist der (Bildungs)Boden ausgelaugt und leer. Mit reinen Kompetenzen als Ziel von schulischer Bildung lügt man sich zudem selbst in die Tasche. Kein Wunder, dass von den Universitäten immer mehr Klagen über das mangelnde fachliche Wissen von Abiturienten kommen.
3.
Die Ausrichtung der Fachlehrpläne auf Kompetenzen, Nützlichkeit und wirtschaftliche Verwertbarkeit tut aus Lehrersicht richtig weh. Denn Jugendliche in ihrer Entwicklung sollten auch in Zukunft die Möglichkeit haben, an einem Ort der Bildung mit der Schönheit und dem Mysterium von Allgemeinwissen, mit geisteswissenschaftlichen, literarischen, musischen und ethischen Themen in Berührung zu kommen, ohne sofort die Nützlichkeit im Blick zu haben.
4.
Herr Liessmann ist Philosoph, kein Lehrer. Er kann es sich leisten, wie ein Adler hoch in den Lüften, das heißt über dem Alltag von Schule, Bildung, Lehren und Lernen zu schweben und mit scharfem Blick zu erkennen, dass in der heutigen Bildungspolitik etwas grundsätzlich schief läuft. Er kann also durchaus zum Nachdenken anregen.
5.
Herr Liessmann sagt aber nichts über den Schulalltag selbst und über die konkrete Situation von Schülern und Lehrern. Dazu kann er auch nicht viel sagen. Als Pädagoge interessieren mich jedoch noch andere Fragen als die von Herrn Liessmann, die in der Schule nicht minder wichtig sind: Wie kann Unterricht in unserer hektischen Zeit gelingen? Wie kann ich als Lehrer im Zeitalter von Medienkonsum und Digitalisierung Schüler für meine Fächer weiterhin begeistern? Wie kann ich in meinen Klassen eine gute Beziehung zu den Schülern herstellen? Wodurch entsteht eine gute Arbeitsatmosphäre, so dass die Schüler bereit sind, neues Wissen aufzunehmen?
6.
Schüler sind in erster Linie Menschen, nicht Lernmaschinen. Darum dürfen sie niemals zu bloßen (Nutz)Objekten der Bildungspolitik werden. Sie sind Menschen in ihrer Entwicklung in bisweilen fundamentalen Umbruchssituationen, die vor allem die Pubertät mit sich bringt. Dies im Blick zu haben, muss auch in Zeiten einer beschleunigten Bildungsreformtätigkeit immer höchste Priorität haben.
7.
Bei all den Reformen im Bildungsbereich müssen stets zwei Bildungsziele gleichzeitig im Mittelpunkt stehen: die Wissens- und Kompetenzvermittlung auf der einen und die Persönlichkeits-, Charakter- und Wertebildung auf der anderen Seite. Beide Ziele dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, keines der beiden darf zugunsten des anderen vernachlässigt werden. Und schon gar nicht dürfen diese Ziele auf dem „Altartisch“ forscher „Reformer“ geopfert werden, die etwa nur wirtschaftliche Interessen verfolgen.
8.
Das „Kerngeschäft“ des Lehrers – das Unterrichten von Klassen und die individuelle Förderung einzelner Schüler – muss immer im Zentrum von Schule und Unterricht bleiben. Daher sollten Lehrer für die wissenschaftlichen Erfordernisse der heutigen Zeit und für eine „Pädagogik des Herzens“ gleichermaßen ausgebildet werden. Die Lehrerbildung kann sich nicht in technischen Neuerungen, im Einüben und Anwenden immer neuer Kommunikationsmittel oder in der Umsetzung zu vieler bürokratischer Vorschriften erschöpfen.
9.
Für einen guten Unterricht sind Mitgefühl und Empathiefähigkeit des Lehrers ebenso wichtig wie seine Fach- und Methodenkenntnisse. Diese „weichen“ Qualitäten können aber schwerlich in Pisa-Statistiken erfasst oder in externen Evaluationen gemessen werden. Wie denn auch? Daher verbreitet sich in der ganzen Hysterie von Bildungsreformen heute immer mehr die irrige Meinung, dass nur noch Wissensbildung und Kompetenzvermittlung die vorherrschenden und entscheidenden Aufgaben des Lehrers seien.
10.
Zum Schluss ein persönliches Bekenntnis: Ich habe es mir – je länger ich unterrichte, desto mehr – auf die Fahnen geschrieben, mein Herz für die Bedürfnisse und die emotionale Situation der Schüler zu öffnen, deren Entwicklung bisweilen von schweren Umbrüchen geprägt ist und die davon hin- und hergeworfen werden können. Immer mehr Schüler kommen aus zerrissenen Familien und sind davon bisweilen schwer belastet. Das kann mir als Lehrer nicht gleichgültig sein.
Ich habe festgestellt, dass die Schüler zu fachlicher Höchstleistung bereit sind, wenn sie vom Lehrer wahr- und ernstgenommen und in ihrer Entwicklung auf dem Weg zu jungen Persönlichkeiten bestätigt und gewürdigt werden. Neugierde am Fach und Beziehung zum Lehrer gehören für die meisten Schüler untrennbar zusammen, zumindest in Unter- und Mittelstufenklassen.
Darum möchte sich dieses Buch genau mit diesem fundamental wichtigen emotionalen Aspekt des Unterrichts – mit der Beziehungsebene zwischen Schülern und Lehrer – beschäftigen, der heute völlig in den Hintergrund zu geraten droht. Das wäre aber fatal und Schüler wie Lehrer haben dies nicht verdient.
Der Mehrwert der schulischen Bildung
Bevor ich mich der veränderten Rolle des Lehrers in der heutigen Bildungsdiskussion zuwende, soll zunächst noch kurz der Politikwissenschaftler Christian Grünwald zu Wort kommen. In seinem Beitrag mit dem Titel „Total vermessen“ in der Süddeutschen Zeitung weist er auf die Grenzen einer völligen Ökonomisierung von immer mehr Bereichen unseres Lebens hin, die auch vor dem Bildungssektors nicht Halt macht: „... der Trend zur Ökonomisierung scheint unaufhaltsam zu sein. Märkte sind effizienzgeprägt, ihre Mittel sind Standardisierung und Normierung. Was bei Produktion und Handel zu Kostenreduktion und vergleichbarer Qualität führt, ist auch im Bildungssektor präsent: G-8-Gymnasien, Pisa, Bologna, vom Schulkind bis zum Postgraduate wird verglichen, harmonisiert, effizienter gemacht.“8
Im gesellschaftlichen Mainstream wird heute alles wirtschaftlichem Denken und ökonomischer Effizienz unterworfen, also auch die Bildung, wovon ja dieses erste Kapitel handeln soll. Der Glaube an ein permanentes Wirtschaftswachstum ist zu einer neuen weltumspannenden „kapitalistischen Religion“ geworden, an die viele blind und naiv glauben. Ihre Transportmittel sind die Globalisierung und die Digitalisierung.
Herrn Grünwald geht es bei seinen Überlegungen in erster Linie ganz grundsätzlich um den Wirtschaftsstandort Deutschland, der sich immer mehr von einem Industriestaat zu einem wissensbasierten Dienstleistungsland entwickelt hat, wenn er überraschend folgende Kernfrage stellt: „Ist Ökonomisierung noch gut für die Wirtschaft?“9 Denn Wissensgesellschaften sind vor allem auf den „Schlüsselrohstoff“ für Innovationen angewiesen: auf immer neue Ideen. Ideen aber verlangen Kreativität – in Forschung, Verwaltung, im Management und vor allem in der Bildung. Daher fordert er: „Statt kürzerer Bildungswege mit verschulten Abschlüssen sollte das freie Denken, das Sich-Ausprobieren an Schulen und Hochschulen wieder gefördert werden – anstelle eines Systems, das aller Individualisierung zum Trotz vermehrt Gleichförmigkeit produziert. Standardisierung fördert eindimensionales, lineares Denken und tötet Kreativität.“10
Es tut gut, im ganzen Orchester von aufgeregten Stimmen zur Bildungspolitik auch solch eine wie die von Herrn Grünwald zu hören, der weiterdenkt und aufzeigt, wohin eine Dominanz ökonomischen Denkens führen kann, vor allem wenn es auf externe Gebiete wie den Bildungsbereich ausgedehnt wird: auf eine geistige Verarmung. Doch nun zur Situation des Lehrers in der heutigen Bildungsdiskussion: Was hat sich geändert, was aber müssen auch in Zukunft bleibende und essentielle Aufgaben des Lehrers sein?
(2) Methodenreformen und Digitalisierung: Lehrer – quo vadis?
Der „Pisa-Schock“ von 2001 hat eine umfangreiche Reformtätigkeit im Bildungsbereich ausgelöst, deren Ende nicht abzusehen ist. Mir kommt es manchmal so vor, als ob damals der „Bildungs-Unbildungs-Geist“ aus der Flasche gelassen wurde. Dadurch kam auch das herkömmliche traditionelle Bild des Lehrers in Bewegung – besonders an den weiterführenden Schulen.
Kritik an den Lehrern
Es wurde vor allem der lehrerzentrierte Unterricht, plakativ bisweilen als „Frontalunterricht“ bezeichnet, heftig kritisiert. Hier glaubten einflussreiche gesellschaftliche Gruppen – Wirtschaftskreise, Bildungsforscher, selbsternannte oder tatsächliche Reformer – eine der Hauptursachen zu finden, warum Deutschland im Pisa-Vergleich 2001 der OECD nur mittelmäßig abgeschnitten hatte.
Was dann folgte, wurde von manchen Lehrern, die viele Jahre eine engagierte und verantwortliche pädagogische Arbeit geleistet hatten, als wahrer „Tsunami in der Bildungspolitik“ erlebt und als Methoden-, Digitalisierungs- und Strukturveränderungs-Wahn empfunden. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass dabei das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Da sich Bildung seit Pisa als Mega-Thema entwickelt hat, vergeht keine Woche mehr, in der nicht neue Vorschläge zur Verbesserung der Schule medial wirksam propagiert werden, die den Anspruch erheben, „die“ Lösung aller Schulprobleme zu beinhalten. Kein Wunder, dass gerade ältere Lehrer, die viel Erfahrung mit dem Unterrichten von Kindern und Jugendlichen in der Pubertät haben, zunehmend verunsichert werden.
Manche Pädagogen fühlen sich und ihre Arbeit auch herabgewürdigt. Sollte denn alles falsch gewesen sein, was sie bisher im Unterricht gemacht haben? Sollte ihr ehrliches Engagement umsonst gewesen sein? Das bisherige Lehrerbild und der Lehrerberuf insgesamt wurden durch diesen öffentlichen „Hype“ in der Bildungsdiskussion in den letzten Jahren immer mehr in die Defensive gedrängt. Gleichzeitig wurden in zunehmendem Maße ungelöste gesellschaftliche Fragen auf die Schulen abgeschoben und dann zu „Schulproblemen“ erklärt.
Den Lehrern an weiterführenden Schulen wie etwa an den Gymnasien wurde vermittelt, wie altmodisch, „hinterwäldrerisch“ und konservativ sie doch seien, weil sie noch immer einem längst vergangenen, altertümlichen Lehrerbild anhingen; daher hätten sie eine gehörige Portion Mitschuld am schlechten Abschneiden in der Pisa-Studie. Von tatsächlichen oder selbsternannten Bildungsexperten wurde den Gymnasialpädagogen vorgeworfen, dass sie methodisch und informationstechnisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit seien und dass der Bildungsstandort Deutschland mit solch einer Einstellung zu Schule, Unterricht und Bildung im entfesselten Bildungswettkampf einer globalisierten Welt schnell den Anschluss verlieren würde. Diese Warnung darf natürlich nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Die gleichen Leute sparten dann nicht mit Verbesserungsvorschlägen, mit deren Hilfe schnell und einfach alle Schulprobleme zu bewältigen seien. Hier einige dieser Forderungen, die meist von außen an die Schulen herangetragen wurden:
vollkommene Auflösung des Frontalunterrichts;
Verzicht auf möglichst jeden lehrerzentrierten Unterricht;
dafür nur noch neue Unterrichtsformen: Gruppenarbeit, Partnerarbeit, selbständiger Unterricht der Schüler;
ein Computer an jedem Schülertisch;
vollkommen digitalisierter Unterricht nur noch mit Whiteboards und Computern;
Verzicht auf gedruckte Bücher; dafür nur noch digitalisierte Bücher, die bei Bedarf heruntergeladen werden können;
Kommunikation Lehrer – Schüler zunehmend über Smartphone oder Mailkontakt;
Verzicht auf Noten und Hausaufgaben;
Lehrerraumprinzip: die Schüler haben keine Klassenzimmer mehr, sondern müssen zum Lehrer kommen;
nur noch Unterricht im Doppelstundentakt usw.
Natürlich hatten diese Vorschläge Konsequenzen für das Lehrerbild: der Lehrer als Bildungs-Manager, als Bildungs-Organisator und Bildungs-Initiatior, als Kompetenzvermittler, als bloßer Dienstleister bei der selbständigen Wissensorganisation der Schüler.
Es dauerte einige Zeit, bis sich die eine Gruppe der Hauptbetroffenen der Bildungsreformen – die Lehrer selbst – zu Wort meldete und sich gegen diese Fundamentalkritik an ihrer Tätigkeit und an den ihnen von außen her zugeschriebenen neuen Rollenbildern zu wehren begann: über ihre Berufsverbände, aber auch über Buchveröffentlichungen. Daher sollen im Folgenden einige solcher Stimmen exemplarisch für viele zur Sprache kommen: der Deutsche Philologenverband; Arne Ulbricht mit seinem Buch „Schule ohne Lehrer?“; und Michael Felten, Gymnasiallehrer für Mathematik und Kunst in Nordrhein-Westfalen. Er möchte mit seinem Buch „Auf die Lehrer kommt es an! Für eine Rückkehr der Pädagogik in die Schule“11 den Finger in die Wunden legen, die Schülern und Lehrern durch übereilte und naive Reformen im Bildungssektor immer mehr geschlagen werden.
Lehrer sind Helden des Schulalltags
Die Lehrer sind seit dem Pisa-Schock einem ständigen bildungspolitischen und vor allem medialen Veränderungsdruck ausgesetzt. Da jeder Bürger selbst einmal Schüler war, glaubt er, in Fragen der Bildung ein Experte zu sein. Meist erinnert man sich als Erwachsener jedoch nur noch an schlechte Lehrer, die es natürlich genauso gibt wie beispielsweise auch schlechte Ärzte oder Juristen. Lehrer zu loben, leistet sich die Gesellschaft viel seltener. Dies geht schon bei der Grundfrage los, wer denn ein guter Lehrer sei und was einen solchen ausmache. Die eigentlich Betroffenen, die Schüler, müssten dies am besten wissen. Die Vorschläge für den „Deutschen Lehrerpreis“, der jedes Jahr einmal vergeben wird, kommen daher teilweise von den Schülern selbst. In den Begründungen für die Preise kann man ihn finden – den guten Lehrer:
„Lehrer müssen zuhören können, sie müssen Vertrauen vermitteln; andererseits wird Verbindlichkeit geschätzt, kein Heute-so-und-morgen-so. Ein Klassenzimmer-Despot scheitert vor den Schülern ebenso wie ein Luftikus. Das Idealbild ist eine kuriose Mischung: der Lehrer auf Augenhöhe, zu dem man trotzdem aufblicken kann.“12 Soweit die ehrliche Vorstellung von Schülern.
Eine der größten Lehrervertretungen in Deutschland, der Deutsche Philologenverband, will aus verständlichen Gründen das Lehrerbild stärken – nach innen im Verband und nach außen in der öffentlichen Wahrnehmung. Einen guten Anlass dazu bot eben dieser „Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ 2014“, bei dem 15 Lehrkräfte und sechs innovative Unterrichtsprojekte ausgezeichnet wurden. Daher titelte die verbandseigene Zeitschrift „Profil“ in ihrer ersten Ausgabe 2015 „Deutschlands Pädagogen: Helden des Alltags“.13 Für 2014 wurden Initiativen gewürdigt, in denen fächerübergreifend unterrichtet und die Zusammenarbeit im Team in besonderem Maße gefördert wurde. In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ nominierten Schülerinnen und Schüler aus Abschlussjahrgängen an weiterführenden Schulen „... besonders engagierte Lehrer, die interessant unterrichten, eine hohe fachliche Kompetenz besitzen und die Jugendlichen motivieren und unterstützen.“14
Eine der Preisträgerinnen dieser Kategorie war Michaela Bauer von der Dr.-Karl-Grünewald-Realschule Bad Königshofen/Bayern, Lehrerin für Mathematik und Katholische Religionslehre. Sie wurde von ihren Schülern nominiert, „... weil sie sich durch ihre Herzlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit selbst auszeichnet. Sie motiviert und unterstützt die Jugendlichen. Selbst trotz einer 'manchmal strengeren Herangehensweise' verliert Michaela Bauer ihren Respekt vor den Schülern nicht und peppt 'den Unterricht durch den einen oder anderen Spaß auf.'“15 Es fällt auf, dass die Qualitäten, die sich Schüler vom Lehrer wünschen, nur wenig mit den vielfältigen Reformvorschlägen zu tun haben, die auf Schule und Lehrer im Wochentakt von außen her einprasseln. Darum tut es gut zu hören, was sich gerade Schüler unter einem guten Lehrer vorstellen.
Bei dem Festakt in Berlin, bei dem die Preise vergeben wurden, sprach der Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Oberstudiendirektor Heinz-Peter Meidinger, auch das Ziel des Deutschen Lehrerpreises an: „... dass Lehrkräfte in Deutschland zur kreativen Nachahmung angeregt werden, denn die ausgezeichneten Projekte seien keine, durch besondere Umstände ermöglichten Leuchturmprojekte, sondern 'Konzepte, die bei entsprechendem Engagement und bei Unterstützung durch die Schulleitung überall umsetzbar sind.'“16
Zu kurz gesprungen im digitalen Klassenzimmer
„Klick-Clique. Smartphone-Nutzer werden immer jünger, die Geräte prägen spätestens von der fünften Klasse an die Kindheit.“17 Mit dieser Überschrift kommentiert die Süddeutsche Zeitung das Ergebnis der sogenannten KIM-Studie 2014 zum Umgang von sechs- bis 13-jährigen Kindern mit Medien, die vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest Anfang 2015 veröffentlicht wurde. Das Ergebnis: Smartphones, also jene Handymodelle, die Apps und Internetzugang bieten, finden immer mehr Verbreitung bei Kindern. Laut dieser Studie hat unter den Zwölfjährigen heute fast jeder ein Handy, die Hälfte ein Smartphone.
Die Kommentatorin dieser Studie in der SZ, Juliane von Wedemeyer, sieht diese Entwicklung ambivalent: „Der Sprung zum Smartphone, der oft zeitlich mit dem Wechsel auf eine weiterführende Schule zusammenfällt, ist allerdings Segen und Fluch. Möglich wird dadurch nämlich nicht nur der brave Anruf bei den besorgten Eltern, sondern auch die besagte Whatsapp-Kommunikation und jeder Blödsinn, der im Internet vorhanden ist. Und davon gibt es eine ganze Menge.“18 Frau Wedemeyer empfiehlt im Folgenden den Eltern Gespräche über die Risiken dieser „Allerskönner“ Smartphone in den Hosentaschen ihrer Kinder – über die möglichen Inhalte, die auf ihre Kinder einströmen und über Fragen des Datenschutzes.19
Es ist kein Wunder, dass viele Lehrer an weiterführenden Schulen glauben, nur noch dann bei ihren Schülern bestehen und sie motivieren zu können, wenn sie in ihrem Unterricht auf dieser digitalen Welle mitsurfen und ihren Schülern in deren vertrauten „Lebenswelten“ von Facebook, Twitter, Whatsapp oder Instagram begegnen. Wasser auf diese „Digital-Mühlen“ kommt auch von aktuellen Studien wie einer, die im November 2014 veröffentlicht wurde. Sie bescheinigt Deutschlands Achtklässlern nur Mittelmaß im weltweiten Vergleich, wenn es um die Computer-Nutzung geht.20
Der Lehrer und Autor Arne Ulbricht nimmt in seinem Artikel „Im digitalen Klassenzimmer“ diese Studie jedoch zum Anlass, um die Entwicklung zur Digitalisierung des Unterrichts an vielen Schulen einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen: „Das volldigitalisierte Klassenzimmer wäre ein Horror.“21 Seiner Meinung nach sollte man nicht blind auf den weltweiten Digitalisierungs-Zug aufspringen, sondern differenzieren und Chancen und Risiken der Digitalisierungsmöglichkeiten im Unterricht mit Bedacht abwägen. Im Folgenden sollen einige seiner Gesichtspunkte genannt werden, die er in dem Artikel vorbringt und die auch die Rolle des Lehrers betreffen:
In Hamburg sollen bereits an mehreren Schulen Tafeln, Bücher und Hefte durch Smartphones, Tablets und Laptops ersetzt werden, um angeblich individuelles Lernen zu fördern. Zudem ist man der Ansicht, dass die Erlaubnis für Schüler motivierend wirke, auch privat genutzte Smartphones im Unterricht zu verwenden. Ist dies aber wirklich motivierender, nur weil diese Art zu „unterrichten“ die meisten Schüler anfangs „lustiger“ finden?
Der Unterricht sollte weitgehend ein smartphonefreier Raum sein, um eine klare Gegenwelt für die Schüler zu bieten, „... deren erste und letzte Aktion eines jeden Tages darin besteht, aufs Handy zu gucken...“
Abgesehen von bestimmten Lernphasen oder von Projektarbeit, bei denen natürlich das Internet genutzt wird, sollte der Unterricht auch in Zukunft ein „Mannschaftssport“ bleiben, wobei der Lehrer der Trainer und die Klasse die Mannschaft ist. „Die Mannschaft sollte zusammen ein Ziel erreichen. Deshalb sollte in Klassenverbänden nicht ständig individualisiert gelernt werden.“ Dies ist aber der Fall, wenn jeder – wie zu Hause – sogar im Klassenzimmer nur noch am eigenen Smartphone sitzt.
Ja, es gibt heute bereits weltweit Schulen, die das Lernen vollkommen digitalisiert haben, die im Unterricht konsequent mit iPads arbeiten und in denen der Lehrer nur noch eine Art Lernberater ist. In Holland war sogar geplant, Schüler ab vier(!) Jahren auch im Homeoffice lernen zu lassen. Herr Ulbricht fragt daher zurecht, wann die Existenz des herkömmlichen Lehrers infrage gestellt wird: „Wann wird das Kürzel SOL, das eigentlich für 'selbstorganisiertes Lernen' steht, für 'Schule ohne Lehrer' stehen?“
Am Beispiel des Mathematiklehrers macht der Autor deutlich: „Dennoch bedeutet der Mathelehrer für das Leben eines Heranwachsenden mehr als die beste Mathe-App. Der Lehrer ist ein Mensch aus Fleisch und Blut und kein iPad aus Aluminium und Glas.“ Im Gegensatz zum Smartphone, das stets emotional ungerührt bleibt, kann der Lehrer Schülern helfen, wenn sie mitten im Unterricht zu heulen beginnen, weil sie etwas nicht verstehen, Liebeskummer haben oder weil die Scheidung der Eltern bevorsteht und damit ihre persönliche Welt zusammenbricht.
Herr Ulbricht ist nicht gegen eine digitalisierte Schule, denn dann wäre er wirklich ein Lehrer aus einer anderen Zeit. Dies wäre heute schlichtweg unverantwortlich. Aber die Digitalisierung darf nicht die Vereinzelung der Schüler fördern, die im Klassenzimmer bewusst einüben sollten, wie man auch mit Menschen zusammenarbeiten kann, die keine Freunde sind.
Obwohl eine Projekt- und die damit verbundene Recherchearbeit im Laptopraum heute nicht mehr wegzudenken ist, sollte die Schule jedoch ganz bewusst Alternativen zum dauerhaften Internetkonsum aufzeigen. Aus zwei Gründen: Denn heute verbringen „... viel zu viele Schüler viel zu viel Zeit in sozialen Netzwerken...“ Außerdem wird das Wissen, das sich viele Schüler in wenigen Sekunden ergooglen, binnen weniger Sekunden wieder vergessen.
Das Fazit des Autors: „Die Schule sollte ein Raum sein, in dem man auch ohne digitale Hilfe lernen kann. Lehrer sollten Schüler motivieren, sie neugierig auf das Neue machen – auch mal in einem emotionalen Notfall für sie da sein. Auch die nächsten Generationen werden Lehrer brauchen, die Menschen und keine Maschinen sind.“
22
Herr Ulbricht spricht mir mit diesen Gedanken aus dem Herzen. In seinem Artikel wird bereits deutlich, wie sich die Rolle des Lehrers verändert hat und welche vielseitigen Erwartungen und Ansprüche an ihn heute gestellt werden. Diese hängen jedoch ganz davon ab, von wem sie kommen: von Eltern, Schülern, Bildungsforschern, selbsternannten Bildungsexperten, Soziologen, Bildungspolitikern, Kultusbehörden oder von Wirtschaftsverbänden, um nur einige zu nennen. Ich kann es immer weniger verstehen, warum bei pädagogischen Themen nicht die eigentlichen Fachleute für Bildung, Schule und Unterricht – also die Lehrer selbst – gefragt werden, die es doch am besten wissen müssten, was beim Unterrichten geht, was sinnvoll ist und was nicht, in welchen Situationen sich ihre Schüler heute befinden und wie Lernerfolge am besten erzielt werden können.
Warum hört die Öffentlichkeit viel lieber auf medial „aufgemotzte“ und aufgebauschte fragwürdige Studien und sich selbst inszenierende „Marktschreier“, die vorgeben, als Bildungsexperten „die“ Lösung aller heutigen Jugend- und Schulprobleme in der Tasche zu haben. Ich werde vor allem dann hellhörig und bisweilen auch wütend, wenn solche Stimmen von außerhalb des Schulbereichs kommen und Lehrer pauschal und billig populistisch in eine Ecke drängen nach dem Motto: Die Lehrer seien schuld, wenn Deutschland im Welt-Bildungsverleich nur mittelmäßig abschneidet.
In diese Richtung geht auch Thorsten Dirks, Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, der die Umsetzung der sogenannten „digitalen Agenda“ von Seiten der Bundesregierung lobt. Als wichtigstes Beispiel kann hier der zügige Ausbau des Breitbandnetzes angeführt werden. Dagegen mache den Firmen der Fachkräftemangel große Sorgen, „… wo nach Aussagen des Bitkom-Chefs zu wenig geschieht. Weil in Deutschland die Länder für die Schul- und Ausbildungspolitik zuständig seien, gebe es große Zuständigkeitsfragen. 'Hier klafft in der Digitalen Agenda an zentraler Stelle eine Lücke', sagt Dirks. Es falle zudem auf, dass die Gesellschaft für die Anforderungen der digitalen Transformation des Landes noch nicht bereit sei ...
Beim Thema Bildung müssten sich die Schulen und Berufsschulen schnell auf die Anforderungen der digitalen Welt einstellen, sagt Dirks. Das müsse sich zum einen an der Ausstattung der Schulen zeigen, aber auch an den Lehrplänen. So sei es beispielsweise aus Sicht seines Verbandes zwingend notwendig, Englisch schon ab der ersten Klasse anzubieten. Zudem müssten die Schüler kompetenter werden, was die Nutzung der neuen Medien angehe.“23
Soweit die klaren Forderungen eines Wirtschaftsverbandes, dessen Firmen sich im weltweiten extremen digitalen Wettkampf befinden. Natürlich muss diese Stimme ernst genommen werden. Hier kann man erahnen, welchem Spannungsfeld die Schulen und vor allem die Lehrer heute ausgesetzt sind, denen es neben der fachlichen Bildung ja vor allem um die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler gehen muss. Davon ist beim IT-Branchenverband Bitkom natürlich überhaupt nicht die Rede. Dieser möchte nur genügend Fachkräfte von den Schulen geliefert bekommen. Schule muss aber viel, viel mehr als bloßer Lieferant von zukünftigen Fachkräften in den MINT-Fächern sein.24 Es muss immer und vor allem um Pädagogik gehen.
Daher soll zum Schluss dieser Überlegungen ganz bewusst noch der Gymnasiallehrer und Kollege Michael Felten zu Wort kommen. In seinem Buch „Auf den Lehrer kommt es an! Für eine Rückkehr der Pädagogik in die Schule“ betrachtet er den ganzen momentanen „Bildungs-Hype“, zu dem auch die zunehmende Digitalisierung von Unterricht und Schule gehört, aus der Perspektive eines betroffenen Pädagogen. Wieder sollen in zehn Thesen einige seiner Gedanken vorgestellt werden.25
Der Lehrer ist wichtig
1. These
Die gegenwärtige Bildungsdiskussion wird von Bildungsjournalisten immer wieder durch ein „Strukturlamento“ angereichert: Manche sehen in Gesamtschulen, auch Gemeinschaftsschulen genannt, das anzustrebende Ziel, weil der Gedanke des Einheitlichen etwas Anheimelndes habe. „Dabei haben die PISA-Forscher selbst regelmäßig darauf hingewiesen, dass nicht die Strukturen über schulische Qualität entscheiden, sondern die Güte des Unterrichts.“ (S. 11). Es gibt kein „bestes Schulsystem“, sondern nur guten oder schlechten Unterricht. (vgl. S. 12).
2. These
Es ist Mode geworden, Schulen von Seiten der Kultusbehörden mehr Selbstverantwortung zu geben. Dieses „Selbständigkeitsgetue“ ist jedoch nur eine Mogelpackung, „... um administrative Kosten zu reduzieren, um Verantwortung für Schulexperimente von sich abzuschieben, um dem Unmut über zu große Klassen zu entgehen...“ (S. 12). Außerdem müssen die Lehrer viel Zeit an der Schule in Arbeitskreisen verbringen, um eigenständige Schulprogramme zu formulieren, die danach nicht umgesetzt werden oder aus Kostengründen gar nicht verwirklicht werden können. Dafür fehlt in diesem Fall die Zeit für eine gute Unterrichtsvorbereitung, sowie für Gespräche mit Eltern und Schülern. (vgl. S. 12).
3. These
Zur externen Evaluation: Es spricht etwas dafür, Bildungsprozesse von Zeit zu Zeit zu überprüfen und das Geschehen im Klassenzimmer nicht völlig dem Belieben des einzelnen Lehrers zu überlassen. Dennoch entspricht es einer naiven Gläubigkeit, wenn in Evaluationen eine geradezu sakrosankte Steuerungsform gesehen wird. Vor allem dann, wenn aufgrund eines Evaluationsberichtes nur noch solche Konsequenzen gezogen werden, die bezahlbar und politisch gewollt oder wirtschaftlich erwünscht sind; wenn nur noch genau das unterrichtet und gepaukt wird, was in regelmäßigen vergleichenden Lernstandsmessungen abgefragt wird; wenn banale schulinterne Befragungen als Scheinlegimitation für neue Schulversuche missbraucht werden. (vgl. S. 13).
4. These
In der Schulpolitik ist dringend eine „personale Wende“ nötig: Damit der „normale“ Lehrer seine bisweilen schwierigen Aufgaben erledigen kann – den jungen Leuten fachliche Kompetenzen vermitteln, ihr „Weltbewusstsein“ erweitern, Kinder auch aus bildungsfernen Schichten erreichen –, braucht er vor allem eines: „… nicht ständig neue Entwicklungsvereinbarungen oder endlose Strukturdebatten, sondern Ruhe und Unterstützung in seinem Unterrichtsalltag; im beständigen Ringen um Motivation und Nachhaltigkeit, bei der täglichen Gratwanderung zwischen Über- und Unterforderung seiner vielen individualisierten Schüler.“ (S. 14).
5. These