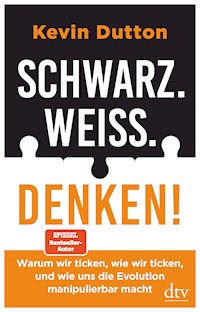
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum digitale Medien und Populismus unser Steinzeithirn triggern und wie wir dieser Falle entkommen können. Unsere Gehirne sind darauf geprägt, schwarz und weiß zu denken, zu sortieren und zu kategorisieren. Bedingt ist das evolutionär. Flucht oder Kampf, Leben oder Tod: Die meisten Entscheidungen unserer Urahnen waren binär geprägt. Entwicklungspychologisch ist das längst überholt. Doch in der Welt von Social Media hat binäres Denken Konjunktur: Daumen rauf und Daumen runter. Der Oxforder Forschungspsychologe Kevin Dutton legt die evolutionären und kognitionspsychologischen Grundlagen unseres Denkens dar und zeigt, wie wir den Grautönen wieder zu ihrem Recht verhelfen können. Dieses Buch ist ein Weckruf in Zeiten zunehmender Intoleranz und zeigt zugleich den Weg aus der Krise. Kevin Dutton ist sich sicher: Wir können unsere evolutionäre Programmierung überwinden, wenn wir uns unserer Anlagen bewusst werden und sie verstehen. Und dann können wir künftig auch weit nuanciertere und viel bessere Entscheidungen treffen. Smart Thinking, unterhaltsam dargeboten: mit zahlreichen Beispielen aus dem Alltag und Experimenten, anschaulich und appellativ, eine beeindruckende Synthese aus Kognitionswissenschaften, Evolutionswissenschaft und der Psychologie des Überzeugens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kevin Dutton
Schwarz. Weiß. Denken!
Warum wir ticken, wie wir ticken, und wie uns die Evolution manipulierbar macht
Aus dem Englischen von Ursula Pesch
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.
GENESIS 1,1–5
Einleitung
Er ist wie ein Mann mit einer Gabel in einer Suppenwelt.
NOEL GALLAGHER
Auf den einen Zettel hat jemand die Worte »wirkliches Leben« gekritzelt, auf den anderen »Fantasie«. Die Zettel sind mit Tesafilm auf Marmeladengläser geklebt, die neben der Kasse stehen, dazwischen ein Foto von Freddie MercuryMercury, Freddie. Beide Gläser sind zu zwei Dritteln voll mit Münzen und Scheinen. Und füllen sich, wie ich feststelle, ziemlich schnell. Als ich mit meiner Vorspeise fertig bin, sind sie bereits geleert und mit neuen Aufklebern versehen worden. Auf dem einen steht »Kätzchen«, auf dem anderen »Welpen«. Vielleicht nicht ganz so brillant wie der Text zu »Bohemian Rhapsody«, aber dennoch wirkungsvoll. Immer wieder ist das Klirren von Metall auf Glas zu hören.
Meine Neugier ist geweckt.
Ich sitze in einem Café in San Francisco, wo ich die letzten vierzehn Tage damit verbracht habe, mit drei der weltweit führenden Experten in puncto Schwarz-Weiß-Denken – den Untiefen des binärbinären Gehirns – zu sprechen. Da ich vor meinem Rückflug nach Oxford noch Zeit totschlagen muss, habe ich mich nach Haight-Ashbury hineingewagt, um über einiges nachzudenken. Ich bestelle ein paar Tacos und beschließe, die Kellnerin zu fragen, was es mit diesen Gläsern auf sich hat. Sie lächelt.
»Wir tauschen immer wieder die Aufkleber aus«, erzählt sie mir, »fünf-, sechsmal am Tag. Früher, als nur ein Glas dastand und die Leute keine Wahl hatten, gab es nur wenig Trinkgeld. Doch wenn man Gästen die Wahl gibt – Kätzchen oder Welpen –, sind sie viel großzügiger. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es ist einfach nur ein kleiner Spaß.«
Ich bin mir da nicht so sicher.
Bevor ich gehe, lungere ich in der Nähe der Kasse herum und warte darauf zuzuschlagen. Zwei Frauen Anfang zwanzig zögern, kichern und treffen dann ihre Wahl. Eine entscheidet sich für »Kätzchen«, die andere für »Welpen«.
»Warum?«, frage ich sie.
»Katzen brauchen dich nicht«, sagt eine der Frauen. »Welpen schon.«
Ihre Freundin schüttelt den Kopf. »Genau deswegen mag ich Katzen lieber! Eine Katze brauchst du nicht auszuführen. Aber mit einem Hund musst du das tun, das geht nicht anders. Und das macht keinen Spaß, wenn es kalt und dunkel ist und regnet …«
Die Welpen-Frau unterbricht sie. Das will sie so nicht stehen lassen. »Genau deswegen sind Hundebesitzer freundlicher«, protestiert sie. »Wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, triffst du andere, die mit ihren Hunden unterwegs sind, und man lernt sich kennen.«
Das Hin und Her geht noch eine Weile so weiter, bis sie, sich kabbelnd, das Café verlassen. Die Kellnerin kommt herüber und gibt eine weitere Bestellung ein.
»Sehen Sie? Ich habe es Ihnen gesagt«, meint sie. »Die Leute haben Spaß daran, eine Wahl treffen zu müssen. Und gehen dann zufrieden weg.«
Ich nicke. Aber ich frage mich unwillkürlich, wie wohl einige der anderen Optionen lauten, die sie erwähnt hat. Welche anderen Wahlmöglichkeiten wurden den Gästen gegeben, wenn sie kamen, um ihre Rechnungen zu begleichen?
Sie zuckt die Schultern. »Apple oder Microsoft«, sagt sie. »Frühling oder Herbst. Badewanne oder Dusche …«
Sie hält mitten in der Aufzählung inne und schwirrt zu einem anderen Tisch davon. Doch ich vermute, dass die Liste endlos ist. Weil es in der Tat jede Menge binärbinärer Möglichkeiten gibt, um Gruppen in zwei Lager zu spalten. Bei so vielen unterschiedlichen IdentitätIdentitäten ergeben sich auch jede Menge gegensätzlicher Vorlieben.
Mir fällt ein Artikel ein, den ich in der Lokalzeitung, dem Chronicle, gelesen habe. Offensichtlich hat FacebookFacebook derzeit rund 70 verschiedene KategorienKategorienSuperkategorien allein für Geschlechtsidentität. Und auf SpotifySpotify kommt man inzwischen auf fast 4000 verschiedene Musikgenres. In einer undurchsichtigen Welt voller unscharfer, verschwommener GrenzenGrenzen ergreifen wir die Chance, alles bedingungslos zu kategorisieren. Farbe zu bekennen. Vor allem wenn diese Farben rein und einfach sind und keine psychische Herausforderung darstellen.
Wie der Marmeladenglastest zeigt, sind wir sogar bereit, für dieses Privileg zu bezahlen.
Wir leben in einer gespaltenen Welt. Wohin wir auch schauen, gibt es GrenzenGrenzen. Allen voran haben Länder Grenzen. Auf der einen Seite sind »wir«, auf der anderen »sie«. Städte haben Bezirke und Stadtviertel. Auch im Alltagsleben ziehen wir unzählige Grenzen. Wir entscheiden auf der Grundlage von Geschlecht und Hautfarbe, wo wir Grenzen ziehen. Und in Großbritannien stellte sich sogar die Frage: In der EU bleiben oder nicht?
Unser Gehirn ist mit einer Formatierungspalette ausgestattet. Durch unsere lange und vielfältige evolutionEvolution, evolutionäräre Vergangenheit sind wir darauf programmiert, GrenzenGrenzen zu ziehen. Doch wie können wir uns sicher sein, dass die Grenzen, die wir ziehen, die richtigen sind? Und woher wissen wir, wo wir sie ziehen sollen? Die Antwort lautet ganz einfach: Wir können es nicht wissen. Wir können uns nicht sicher sein, dass die von uns gezogenen GrenzenGrenzen die richtigen sind. Und doch sind wir gezwungen, sie zu ziehen. Weil die Welt ein komplizierter Ort ist und weil Dinge durch das Ziehen von Grenzen einfach werden und sich bewältigen lassen, »machbar« werden. Und wir sehnen uns nach »Machbarkeit«.
Nehmen wir zum Beispiel die Grade Point Averages (GPAs, Notendurchschnitt) von Studenten. In der akademischen Welt Großbritanniens werden Abschlussnoten auf der Basis des Punktedurchschnitts vergeben, den ein Kandidat im Abschlussjahr im Rahmen eines vorgegebenen Notenspektrums erzielt. Einerseits ist das sehr vernünftig. Andererseits jedoch, statistisch betrachtet, eine Momentaufnahme. Ergibt es wirklich Sinn zu sagen, der eine Student sei »erstklassig«, der andere jedoch nicht, wenn Ersterer einen Durchschnitt von 70 und Letzterer einen Durchschnitt von 69 Prozent erzielt?
Diese Frage ist nicht nur philosophisch interessant, sie hat auch praktische Folgen. Studenten, die ihr Studium »mit Auszeichnung« oder »mit gutem Erfolg« bestanden haben, bieten sich ganz andere Möglichkeiten als Studenten mit einem schlechteren Notendurchschnitt. Ein Prozentpunkt mehr oder weniger kann den Unterschied zwischen einem weiterführenden Studium oder, akademisch betrachtet, dem Ende der Reise bedeuten. Träume können zunichtegemacht, Berufsperspektiven zerstört werden. Türen öffnen und schließen sich abhängig davon, wo wir unsere GrenzenGrenzen ziehen. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Als Teil der Strategie zur Eindämmung des CoronavirusCoronavirus hielt die britische Regierung im März 2020 alle über Siebzigjährigen dazu an, in ihren vier Wänden zu bleiben, um sich vor der Krankheit zu schützen. Über siebzig – und Türen öffnen sich, wenn es um Prüfungsdurchschnitte geht. Über siebzig – und Türen schließen sich, wenn es um das CoronavirusCoronavirus geht. Aber irgendwo müssen wir Grenzen ziehen. Und wir tun es. Stürme, DrogenDrogen, Gefängnisse, Terrordrohungen, Pandemien[1] … was auch immer, wir kategorisieren es. Wir benutzen Zahlen, Buchstaben, Farben, alles, was uns zur Verfügung steht. Weil eine gezogene Grenze bedeutet, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Und wir stehen im Leben ständig vor Entscheidungen.
Schwarz. Weiß. Denken! handelt also von Ordnung. Oder eher von der Illusion von Ordnung. Davon, wie sich die GrenzenGrenzen, die wir im Chaos der ungezähmten Wirklichkeit ziehen, wie kognitive Trugbilder verflüchtigen, je stärker wir unsere Aufmerksamkeit auf ihre trügerischen, vergänglichen Formen richten. In den Tagen unserer prähistorischen Vorfahren war unser Gehirn noch frisch und unverbraucht. Es funktionierte reibungslos, effizient und war ausnehmend zweckdienlich. Wenn unsere frühen Vorfahren unerwartet auf eine Schlange unter einem Gesteinsbrocken stießen, stellten sie sich nicht die Frage, ob sie gefährlich war oder nicht. Sie machten sich einfach aus dem Staub. Schnell. Dasselbe galt für Tiger im Gebüsch. Und Krokodile im Schilf. Okay, es konnte der Wind sein. Doch es war besser, aus sicherer, angemessener Entfernung darüber nachzudenken, außer Reichweite des Scharfen, Spitzen oder Giftigen.
Mit anderen Worten: Die überwältigende Mehrheit der Entscheidungen, die unsere frühesten Vorfahren in ihrem Alltagsleben trafen, war wahrscheinlich binärbinär. Schwarz und weiß. Entweder – oder. Und das aus gutem Grund. Bei den zu treffenden Entscheidungen ging es oft um Leben und Tod. Sturzfluten. Tornados. Blitzschläge. Erdrutsche. Lawinen. Umfallende Bäume. Solche Dinge kommen aus dem Nichts. Sie geschehen von einem Augenblick auf den anderen. Menschen, die lange nachdachten, bevor sie handelten, lebten normalerweise nicht allzu lange.
Heute hat sich das Überlebensspiel jedoch geändert. Die mentalen Shortcuts, die sicherstellten, dass unsere frühen Vorfahren der Evolutionskurve immer einen Schritt voraus waren, können sich – so wie die Schlangen und Tiger, denen aus dem Weg zu gehen wir dank der EvolutionEvolution, evolutionär gelernt haben – irgendwann rächen. Die Beweise sind allgegenwärtig. Fragen Sie nur die südafrikanische Mittelstreckenläuferin Caster SemenyaSemenya, Caster, die wegen ihrer natürlich erhöhten Testosteronwerte in die Schusslinie geraten ist. Oder die Amerikanerin Caitlyn JennerJenner, Caitlyn, die 1976 als William Bruce Jenner Olympiagold im Zehnkampf gewann. Der erbarmungslose Druck durch immer mehr GenderGender-UnterkategorienKategorien, durch eine soziale, psychische und informationelle KomplexitätKomplexitätKognitionkognitive Komplexität verlangt Karten einer grenzenlosen, nahtlosen Wirklichkeit mit einem größeren Maßstab, mit feineren Linien sowie weniger und unauffälligeren Faltkanten. Die groben Abgrenzungen vergangener Zeiten reichen einfach nicht mehr aus.
Um zu sehen, wie sich die Anforderungen an das Gehirn entwickelt haben, wollen wir uns dorthin zurückbegeben, wo alles begann, und die einzellige Amöbe betrachten. Ziel aller Lebewesen ist es, zu überleben und sich fortzupflanzen. In der seichten Unterwasserwelt, die das Universum dieses unentwickelten Organismus darstellt, sind Wärmeschwankungen, die Verfügbarkeit von Nahrung und die Umgebungshelligkeit – Hell und Dunkel, Schwarz und Weiß – tatsächlich die einzigen drei für das Überleben notwendigen KategorienKategorien. Derartige Veränderungen in der äußeren Umgebung der Amöbe werden gespiegelt durch Veränderungen innerhalb ihrer Zellmembran, die sie dazu befähigen, sich entweder auf nahe Nahrungsquellen (zum Beispiel Glukose) zu- oder von giftigen Stimuli fortzubewegen. Eine Amöbe würde sagen: »Kein Bedarf an einem Dimmer in diesem Teich, Kumpel. Romantische Soirées bei Kerzenlicht sind echt nicht unser Ding. Wenn es plötzlich dunkel wird, so heißt das, dass buchstäblich etwas in der Luft liegt, und wir machen uns aus dem Staub. Wir halten es lieber einfach.«
Eine edle, wenn auch spartanische Philosophie.
Doch Einfachheit ist nicht jedermanns Sache und im Zuge der natürlichen AusleseAuslese, natürliche entwickelten sich Unternehmen, Innovation und technologisches Know-how. Mit dem Auftauchen mehrzelliger Organismen hielten die ersten Nervensysteme der Welt in Form von primitiven Nervennetzen oder Ganglien ihren Einzug – Ansammlungen von Nervenzellkörpern. So wie bei ihren einzelligen PrototypPrototypen bestanden ihr Zweck und ihre Funktion darin, das Erkennen extrazellulärer Stimuli zu erleichtern. Diesmal, etwa eine Milliarde Jahre später, jedoch mit schnelleren, effizienteren Mitteln.
Heute, in der Gegenwart, ist unsere mühevolle psychophysische Entwicklung schließlich abgeschlossen. Wir Menschen sind nun mit mindestens sechs primären Sinnen, ja wahrscheinlich noch erheblich mehr, ausgestattet: Fünf von ihnen – Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken und Hören – dienen dazu, Vorgänge in der Außenwelt wahrzunehmen. Der sechste, die Propriozeption (Tiefensensibilität), hat den Zweck, ein stabiles inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, und zwar durch einen konstanten Strom koordinierter neuraler Informationen zu Körperbewegung und -lage.
Von diesen sechs grundlegenden Sinnen ist das Sehen – das für 70 Prozent all unseres sensorischen Inputs verantwortlich ist – der bei Weitem dominanteste. Und das aus gutem Grund. Im Lauf unserer EvolutionEvolution, evolutionärsgeschichte war eine genaue Vorstellung von der Größe, Form und Bewegung anderer Lebewesen entscheidend für unser Überleben – ebenso das Empfinden für Helligkeit und Kontraste, wie noch heute für die Amöbe. Für unsere prähistorischen Vorfahren führte das plötzliche Auftauchen eines Schattens an der Wand einer Höhle, auf der Oberfläche eines Gewässers oder auf einem dürren Streifen offener, sonnengebleichter Savanne zu zwei grundlegenden Überlegungen. Erstens: Handelt es sich um etwas, was ich zum Abendessen haben kann? Zweitens: Ist es etwas Großes, Starkes und Gefährliches, das mich zum Abendessen haben möchte?
Hell und Dunkel. Schwarz und Weiß. Dreieinhalb Milliarden Jahre. Bei genauerer Überlegung: nicht übermäßig viele Änderungen.
Dann aber änderte sich tatsächlich alles. Fast über Nacht, wenn wir den paläontologischen Zeitmaßstab heranziehen. Mit dem Auftauchen von Bewusstsein, von Sprache und Kultur kam Bewegung in die Sache. Plötzlich waren Schwarz und Weiß – Hell und Dunkel – Schnee von gestern. Und Grau war die Farbe, in der man dachte. Dimmer wurden unverzichtbar, ein wichtiges neurophysiologisches Werkzeug, das uns helfen sollte, in Schattierungen zu denken statt in binärbinärem Schwarz-Weiß.
Doch es gab ein Problem. Ein großes. Es gab keine Dimmer. Diese Dinger existierten einfach nicht. Sie hätten die nächste große Nummer sein können. Hätten das neue »Kampf oder Flucht« sein können. Doch der Markt hatte sich so blitzschnell verändert, dass es den Eierköpfen der natürlichen AusleseAuslese, natürliche nicht gelungen war, sie herzustellen. Sie waren nicht in Produktion gegangen und sind es noch immer nicht.
Wodurch wir in einer etwas misslichen Lage stecken. In einem grauen Flüsschen mit ganz primitiven Schwarz-Weiß-Paddeln. Wir klassifizierenKlassifikation, wir etikettEtikettieren und wir ordnen ein, nur um dann irrationale, suboptimale Entscheidungen zu treffen, weil unsere Gehirne zu schnell zu groß geworden sind. Weil sie zu schnell und zu früh zu clever geworden sind. Wir kategorisieren, statt abzustufen. Wir polarisierenpolarisieren, Polarisierung, statt zu integrieren. Und wir überspitzen und karikieren Unterschiede, statt ÄhnlichkeitÄhnlichkeiten zu betonen und hervorzuheben.
Nehmen Sie zum Beispiel Wein. Die meisten von uns wären bei einer Blindverkostung vermutlich in der Lage, einen Rot- von einem Weißwein zu unterscheiden. Und manche vielleicht einen Cabernet Sauvignon von einem Pinot Noir. Doch zwei exklusive, anspruchsvolle, komplexe Bordeauxsorten: sagen wir einen Château Lafite Rothschild En Primeur 1982 von einem Château Mouton Rothschild En Primeur 1995? Wohl eher nicht. Beunruhigender ist natürlich unsere Blindheit gegenüber Unterschieden zwischen Menschen. Einen Château Lafite Rothschild En Primeur 1982 als »rot« oder einen Jacques Prieur Montrachet Grand Cru als »weiß« zu kategorisieren, wird wohl kaum eine Apokalypse herbeiführen. Doch alle Muslime als den IslamIslamischen StaatIslamischer Staat (IS) (IS) unterstützende Radikale zu kategorisieren, möglicherweise schon.
Die tödliche darwinistische Ironie verstehen wir nicht, zu unserem eigenen Schaden. Die binärbinäre KognitionKognition, die für unser Überleben keinesfalls erforderlich ist, könnte eines Tages unser Schicksal besiegeln. Und zwar eher heute als morgen, wenn die Polarisierungpolarisieren, Polarisierungsstrategien von Terrororganisationen, wie dem zuvor erwähnten Islamischen StaatIslamischer Staat (IS), oder populistische Spielarten des politischen Fundamentalismus, wie der immer wieder von der TrumpTrump, Donald-Administration propagierte, weiterhin Einsicht und Vernunft den Rang ablaufen.
Aber sind wir nicht alle gleichermaßen schuld? Wohin wir auch schauen, unser Schachbrettdenken spaltet uns, was in besonderem Maße auf die flüchtige, oberflächliche Welt der sozialen MedienMedien zutrifft. Wenn jemand mit einer Behauptung oder einer ÜberzeugungÜberzeugung aufwartet, der wir nicht von ganzem Herzen zustimmen, wie sieht dann unsere erste Reaktion aus? Neigen wir normalerweise nicht dazu, das genaue Gegenteil zu behaupten? (Siehe Abbildung 0.1.)
Auf den folgenden Seiten werden wir also beginnen, die Bedeutung von KategorienKategorien und KategorisierungKategorisierung – das unendliche kognitive Lego-Set, mit dessen Hilfe wir die Realität zusammensetzen und konstruieren – im Alltagsleben zu betrachten, und über die Tatsache nachdenken, dass wir ohne dieses Set nicht in der Lage wären, auch nur die einfachsten Entscheidungen zu treffen. Im Laufe des Buches werden wir entdecken, dass wir bereits in einem sehr frühen Alter mit dem Ziehen von GrenzenGrenzen beginnen und dass unsere Fähigkeit zu kategorisieren so wie die Sprache und das Gehen ein Instinkt ist, eine tief in unser Gehirn eingebettete evolutionäre Anpassung, und nicht etwas, was wir von Grund auf neu erwerben. Und wir werden aufdecken, warum das kognitive Auferlegen dieser »falschen Klarheit« ein urzeitliches menschliches Bedürfnis nach Ordnung befriedigt. Nach der Einfachheit und »Machbarkeit«, nach der wir uns so sehr sehnen. Nach Unterscheidungen, Dichotomien und GrenzenGrenzen. Dass Unterscheidungen und Dichotomien jedoch schnell zu Spaltung, Diskriminierung und Zwietracht führen können, wenn wir die Grenzen zwischen Menschen statt zwischen Bildern ziehen.
Schwarz
Weiss
Grau
SPORT: Nur olympische Goldmedaillen sollten gefeiert werden. Silber und Bronze symbolisieren letztlich Versagen.
Alle olympischen Medaillen sollten gefeiert werden. Jeder Podiumsplatz ist ein Erfolg.
In manchen Situationen sind unbedeutendere Medaillen ein Grund zum Feiern. In anderen nicht. Ein eindeutiger Favorit, der aufgrund mangelnder Konzentration nur Silber schafft, könnte ein Beispiel für letzteren Fall sein, ein Außenseiter, der alle Erwartungen übertrifft, für ersteren.
BrexitPOST-BREXIT-IDENTITÄTSKRISE: Ich bin Brite.
Ich bin Europäer.
Man kann beides sein. Man muss nicht damit aufhören, sich als Brite zu fühlen, um sich als Europäer fühlen zu können. Und umgekehrt. IdentitätIdentität ist kontextabhängig. Wenn England ein Fußballländerspiel gegen ein anderes europäisches Land austrägt, wird sich ein Englandfan »englisch« fühlen. Befindet sich eben dieser Fan jedoch in einer abgelegenen Gegend eines anderen Kontinents, ist es gut möglich, dass er sich vor allem als »Europäer« fühlt.
POLITIK & NATIONALE SICHERHEIT: Terroristen sind geisteskrank.
Terroristen sind zurechnungsfähig.
Viele Terroristen verhalten sich vielleicht wie »Geisteskranke«, sind aber durchaus zurechnungsfähig. Zwei Menschen können dasselbe tun, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der Prozess der Radikalisierung kann ein völlig normales Individuum in einen Geisteskranken verwandeln und dazu führen, dass es aus einer rationalen Perspektive heraus Wahnsinnstaten begeht.
Abbildung 0.1: Drei Beispiele von Schwarz-Weiß-Argumenten, die vor Kurzem in den britischen MedienMedien zu finden waren (und ihre grauen Alternativen).
Nehmen Sie zum Beispiel Schwarz und Weiß im kulturellen Sinn. Stellen Sie sich vor, wir würden alle Farben der Menschheit in einer Linie aufreihen, vom schwärzesten Schwarz an einem Ende bis zum weißesten Weiß am anderen, und daran vorbeigehen. Während wir dies täten, wären wir an keinem bestimmten Punkt in der Lage zu erkennen, wo eine schwarze Person endet und eine braune beginnt. Oder wo eine braune Person endet und eine hellbraune beginnt. Oder wo Hellbraun endet und Weiß anfängt. Was die Hautfarbe angeht, wären diejenigen, die Schulter an Schulter stünden, so gut wie identisch. Wir wären mit einem KontinuumKontinuum von unbestimmten Zwischenfarben konfrontiert. Im rassischen oder ethnischen Sinne würden Schwarz und Weiß einfach aufhören zu existieren.[2]
Doch RasseRasse ist derzeit eines der brennendsten Themen.
Während wir die Betrachtung des unserem Gehirn angeborenen, allumfassenden KategorisierungKategorisierungsinstinkts fortsetzen, werden wir noch auf andere Gefahren stoßen. Wenn Freddie MercuryMercury, Freddie nicht gerade damit beschäftigt war, über die Unterschiede zwischen wirklichem Leben und Fantasie nachzudenken, versicherte er offensichtlich gern Folgendes: Wenn eine Sache es wert ist, getan zu werden, ist sie es auch wert, übertrieben zu werden. Es liegt mir fern, mit Freddie über das Für und Wider zu streiten, eine Show abzuziehen, doch wenn es darum geht, wie wir kategorisieren, hätte er nicht deutlicher danebenliegen können. Zu viele Optionen – und unser Gehirn weiß nicht, was es tun soll. Zu wenige – und wir gleiten ab ins Militante.
Ein Beispiel für ersteres Problem sind FilmkategorienKategorien. Netflix führt derzeit über 76000 sorgfältig kuratierte Film-Subgenres auf. Diese reichen von »Psycho-Biddy« (Filme über verfeindete Omis, die in ihren Geistervillen erbitterte Konkurrenzkämpfe miteinander austragen) über »Sport treibende Meerestiere« (Filme, in denen mutierende Meerestiere beim Betreiben diverser menschlicher Sportarten unterschiedliche Positionen einnehmen, einschließlich einer Riesenkrabbe in Koni Goalkeeper, die einen Fußballtorwart spielt, und einem Riesentintenfisch in Der Calamari-Wrestler, der, wie Sie bestimmt schon erraten haben, einen Wrestler mimt).
Ein Beispiel für letzteres Problem ist der IS. Die »Grauzone« ist ein Begriff, den diese Organisation gezielt geprägt hat, um eine Welt zu beschreiben, in der Muslime und Nichtmuslime miteinander leben. Sie ist eine Abscheulichkeit, die auf frevelhafte Weise die brutale binärbinäre Linie verwischt, die die Grenze zwischen zwei monolithischen MetakategorienKategorien darstellt. Zwischen ihr und den Ungläubigen. Den Gerechten und den Ungerechten. Den Einsen und den Nullen. Den Helden und den Pennern. Kein Wunder, dass ihre Flagge nur diese zwei Farben trägt: Schwarz und Weiß.[3] Das ist kein Zufall. Und kein Wunder, dass eine Stadt wie London, ja, jede Stadt, ihr verhasst ist. In Städten fließt alles zusammen; Hoffnungen und Träume, Leidenschaften und Schreckgespenster, Farben und Glaubensbekenntnisse treffen dort aufeinander und lassen das Wasser trübe werden. Der multireligiöse, panideologische Herzschlag einer modernen blühenden Metropole, sei es London, Paris, New York oder Beirut, versetzt dem IS – und anderen Organisationen wie ihm – einen Schock, weil er nahelegt, dass wir Menschen in der Lage sein könnten, es zusammen zu schaffen. Miteinander auszukommen. Muslime und Nichtmuslime. Dass wir auf denselben Märkten einkaufen, dieselben Filme sehen, in denselben Parks mit den Hunden spazieren gehen und auf denselben Spielplätzen mit den Kindern spielen könnten.
Doch FanatismusFanatismus duldet nichts dergleichen. Fanatismus verlangt die schnelle und vollständige AblehnungAblehnung auch nur des geringsten Anzeichens von AmbiguitätAmbiguität. Für den IS repräsentiert Transideologie – gleich welcher Art – Dekadenz, Verderbtheit und Gottlosigkeit von apokalyptischem Ausmaß. Es muss das eine oder das andere sein. Entweder – oder.
Die Lösung liegt natürlich irgendwo in der Mitte, und wir werden erkennen, dass es zwischen torhütenden Krabben und Calamari-Wrestlern auf der einen sowie Osama bin Ladenbin Laden, Osama und Abu Bakr al-Baghdadial-Baghdadi, Abu Bakr auf der anderen Seite einen optimalen KategorisierungKategorisierungsgrad gibt, der stark davon abhängt, was wir zu kategorisieren versuchen. Dieser gilt auch, wenn es darum geht, andere zu beeinflussen – das heißt, wenn es sich nicht darum handelt, wie wir KategorienKategoriengenerieren, um die Realität für uns selbst zu definieren, sondern darum, wie wir Kategorien nutzen, um die Realität für andere zu definieren. Und – Freddie möge mir verzeihen – weniger ist fast immer mehr.
Wenn wir in der EvolutionEvolution, evolutionärsgeschichte zurückgehen und uns auf die Suche nach den prähistorischen Ursprüngen des Schwarz-Weiß-Denkens machen, werden wir feststellen, dass drei die magische Zahl ist, wenn es darum geht, Meinungen zu prägen, Meinungen zu ändern und andere auf seine Seite zu ziehen. Tief im Nebel unserer dunklen, darwinistischen Vergangenheit decken wir eine geheime goldene Triade dyadischer SuperkategorienSuperkategorienKategorien auf, die bis heute einen so tief greifenden, mächtigen Einfluss auf unsere leicht beeinflussbaren Gehirne haben, dass Menschen, die uns von etwas überzeugen wollen, sie nur strategisch nutzen müssen, um uns auf ihre Seite zu ziehen: Kampf versus Flucht, wir versus sie und richtig versus falsch. In den Händen eines Bin Ladens oder eines Hitlers können derlei KategorienKategorien Millionen Menschenleben kosten. Doch wenn sie im Dienst des Gemeinwohls vernünftig angewendet werden, können sie Wunder bewirken.
Ein Beispiel: 62000 Menschen nahmen an der Generalprobe für die Eröffnungsfeier der 2012 in London stattfindenden Olympischen Spiele teil, doch nur eine Handvoll von ihnen ließ etwas über den Inhalt der Show in den sozialen MedienMedien durchsickern. Das ist wirklich erstaunlich – vor allem angesichts des Drucks, der Erwartungen und Verlockungen, die mit der heutigen Download-Kultur einhergehen. Es wird heftig darüber spekuliert, warum dies wohl der Fall war, und eine der Theorien ist besonders faszinierend. Sie besagt, dass Danny BoyleBoyle, Danny, der künstlerische Leiter der Spiele, am Abend des Spektakels das Wort an die glücklichen Teilnehmer richtete, die im Olympia Park in London vor ihm versammelt waren, und sie nicht darum bat, die Sache »geheim zu halten«, sondern »die Überraschung aufzusparen«. Ein unbedeutendes DetailDetail? Auf den ersten Blick: ja. Doch bei näherer Betrachtung handelt es sich hier – sofern es denn stimmt – um ein Beispiel von ÜberzeugungÜberzeugungskunst.
Und so funktioniert es, das versteckte evolutionäre Kleingedruckte unter den Überzeugungs-Headlines, das auf den drei SuperkategorienSuperkategorien basiert, die unsere Ahnen uns weitervererbt haben:
Kampf versus Flucht – Widerstehe der Versuchung, alles auszuplaudern! Ignoriere das Geflüster der menschlichen Natur. Jeder von uns teilt gern Geheimnisse, doch niemand möchte eine Überraschung verderben.
Wir versus sie – Lasst es uns bis zu dem großen Tag für uns behalten, ja? Wir sind privilegierte Insider. Wir wollen doch nicht zu früh Outsider in den Club reinlassen, oder?
Richtig versus falsch – Wie würdest du dich fühlen, wenn du wüsstest, dass etwas, was du gesagt hast, nicht nur den großen Tag ruiniert hat, sondern auch all die Mühe und harte Arbeit, die in ihn gesteckt wurde?
Nur diese kleine Änderung in der Formulierung – von »Geheimnis« zu »Überraschung« –, nur eine einfache Verschiebung der Kategorie – von »teilen« zu »verderben« – machte den Unterschied aus.
Tatsächlich ist die Sprache, wie wir herausfinden werden, mehr oder weniger der Schlüssel zur Aktivierung jeder Art von Kategorie, nicht nur dieser unwiderstehlichen, waffenfähigen evolutionEvolution, evolutionärären SuperkategorienSuperkategorien. Denn die Wahrheit ist: Wenn wir die Sprache nicht hätten, hätten wir nichts. Die Funktion von Sprache ist, wie wir erfahren werden, in der Tat extrem elementar, sie besteht im Grunde darin, »dieses« von »jenem« zu unterscheiden. Das Andere mit EtikettEtiketten zu versehen, sobald es als anders erkannt wurde.
Und wo die Sprache endet, übernimmt die BeeinflussungBeeinflussung das Zepter. Auch deren Funktion ist klar und eindeutig. Sie besteht ganz einfach darin, mein »dieses« zu ihrem »jenes« zu machen.
Meine »verdorbene Überraschung« zu ihrem »geteilten Geheimnis«.
Es ist ein Schachzug, den wir alle beherrschen müssen, wenn wir im Leben vorankommen wollen, und einer, der unmittelbar herrührt von der urzeitlichen Vorliebe unseres Gehirns, Dinge schwarz-weiß zu sehen. Doch es müssen Bedingungen erfüllt und Regeln befolgt werden. Wir müssen wissen, wie es funktioniert, warum es funktioniert und wann es funktioniert. Und, vielleicht am allerwichtigsten, wie wir auf der Hut sein können, wenn andere versuchen, diesen Schachzug bei uns anzuwenden.
Im weiteren Verlauf unserer Reise zum Kern der BeeinflussungBeeinflussung werden wir entdecken, dass das Gehirn, welches grobe, primitive Karten der Realität erstellt, selbst eine Karte ist. Eine antiquierte, überholte, vom Wetter gezeichnete Karte, die sich entlang dreier großer Linien falten lässt – Kampf versus Flucht, wir versus sie, richtig versus falsch. Und dass das Wissen von diesen Linien und von der Art und Weise, wie sich die Karte öffnen und falten lässt, es verdammt viel einfacher macht, die richtigen Schritte zu tun, als einer Karte zu folgen, die sich nur nach dem Zufallsprinzip öffnet.
Wir lernen, dass der Standardmodus des Gehirns – eine binärbinäre »Entweder-oder«-KategorisierungKategorisierung der Welt vorzunehmen – alle Aspekte unseres Lebens, alle Urteile, die wir fällen, und alle Entscheidungen, die wir treffen, beeinflusst und dass er das hervorragende kognitive Vermächtnis des wilden und heroischen Kampfes unserer Vorfahren zum Ausdruck bringt, dem Schicksal zu trotzen und die mörderischen Schlachtfelder der Vorzeit zu überleben. Schwarz. Weiß. Denken! stützt sich auf Erkenntnisse aus allen möglichen Bereichen – von der Forensik bis hin zur sozialen und kognitiven Neurowissenschaft und von der Intergruppendynamik bis hin zu den heiß umkämpften Grauzonen an den GrenzenGrenzen von Sprache, Aufmerksamkeit und Denken – und präsentiert eine einzigartige Synthese der kognitiven Wissenschaft, der Evolutionswissenschaft und der Kunst der Einflussnahme.
Kurz gesagt, es bietet eine brandneue Theorie des sozialen Einflusses. Eine Theorie dessen, was ich SupersuasionSupersuasion nenne (super und persuasion, engl. ÜberzeugungÜberzeugung). Eine Theorie, die in den letzten Jahren eine beträchtliche konzeptuelle Verfeinerung erfahren hat – in den kulturellen und politischen Hochöfen von vier der dominantesten globalen Nachrichtenthemen.
BrexitBrexit. TrumpTrump, Donald. CoronavirusCoronavirus. Und der Aufstieg des islamIslamischen Fundamentalismus.
Alles »dort draußen« existiert entlang eines KontinuumKontinuums. Notendurchschnitte. Hautfarbe. Trotz der binärbinären Wahl, die uns die Marmeladengläser lassen, und unserer Vorliebe für Katzen oder Hunde. Alles dort draußen ist grau. Doch um die Wirklichkeit zu verstehen, um herauszufinden, in welcher Beziehung ihre vielen unterschiedlichen Elemente stehen und wie sie miteinander interagieren, müssen wir in der Lage sein, das amorphe, unstrukturierte KontinuumKontinuum in kleinere, genauere, in sich geschlossene mundgerechte Abschnitte zu unterteilen. Wir müssen im grenzenlosen Grau der Welt GrenzenGrenzen ziehen, um eine illusionäre Schachbrettoberfläche zu schaffen, auf der wir uns wie rationale, denkende Schachfiguren auf ordentliche, vorhersagbare und regelbasierte Weise bewegen und fühlen und argumentieren können. Wir müssen einen »Trugschluss der unangebrachten Konkretisierung« erzeugen, wie der Mathematiker und Philosoph Alfred North Whitehead es einst formulierte.
Schach funktioniert, weil das Brett schwarz-weiß ist. Das Leben funktioniert, weil unser Gehirn schwarz-weiß ist. Aber Weisheit liegt im Wissen vom Grau, im tieferen Verständnis dessen, dass die Quadrate auf dem Brett, ja, sogar das Brett selbst, nicht existieren, obwohl wir als kognitive Großmeister dazu bestimmt sind, dieses Spiel zu spielen.
In Schwarz-Weiß gemeißelt ist die älteste, einfachste, machtvollste WahrheitWahrheit, die es gibt. Die Wahrheit, die Freddie nicht sah. Fantasie ist wahres Leben. Weil alles wirklich zählt. Weil für mich alles wirklich zählt.
1 | Der KategorisierungKategorisierungsinstinkt
Fortschritt ist die Fähigkeit des Menschen, Einfaches kompliziert zu machen.
THOR HEYERDAHL
Als Lynn KimseyKimsey, Lynn an einem milden Sommermorgen des Jahres 2003 zur Arbeit kam, hatte sie keine Ahnung, dass die Ereignisse des Tages die nächsten vier Jahre ihres Lebens in die unheimliche, verschlungene Nebenhandlung eines makabren Psychothrillers verwandeln würden. Am Abend fuhr sie vorbereitet, instruiert und im Dienste des Generalstaatsanwaltes als leibhaftig gewordene Version von Dr. Pilcher, dem schielenden Insektenspezialisten aus dem Film Das Schweigen der Lämmer, über die Autobahn nach Hause.
Früher im Jahr, am Morgen des 6. Juli, einem Sonntag, hatte eine Frau namens Joanie Harper zusammen mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter, Earnestine Harper, in Bakersfield, Kalifornien, einen Gemeindegottesdienst besucht. Es war ein großer Tag für die Familie: der erste Kirchenbesuch von Joanies jüngstem Kind, dem sechs Wochen alten Marshall. Nach dem Gottesdienst aß die Familie in einem einfachen Restaurant im Ort zu Mittag und fuhr dann nach Hause, um ein Nachmittagsschläfchen zu halten. Joanie und ihre Kinder schliefen im hinteren Schlafzimmer, ihre Mutter in einem Schlafzimmer am anderen Ende des Hauses. Anschließend wollten sie zum Abendgottesdienst zur Kirche zurückkehren.
Das war jedenfalls der Plan gewesen. Doch niemand sah die Harpers an jenem Abend beim Gottesdienst.
Am Dienstagmorgen beschloss Kelsey Spann, eine Freundin der Familie, nach Joanie, ihrer Mutter und den Kindern zu sehen. Sie waren weder am Sonntagabend in der Kirche erschienen, noch hatte irgendjemand sie seit Sonntag gesehen oder etwas von ihnen gehört. Und sie gingen nicht ans Telefon. Vielleicht stimmte etwas nicht.
Kelsey ging zu einer Seitentür, um mit einem Schlüssel, den Joanie ihr zur Aufbewahrung gegeben hatte, das Haus zu betreten. Doch die Tür gab nicht nach. Der Schlüssel drehte sich im Schloss, aber auf der anderen Seite schien sich etwas zu befinden, was die Tür daran hinderte, sich zu öffnen. Kelsey begab sich zur Rückseite des Hauses und versuchte, die Glasschiebetür zu öffnen – was ihr zu ihrer Überraschung gelang. Das war äußerst seltsam. Joanie vergewisserte sich immer, dass die Tür verschlossen war. Kelsey betrat das Haus und lief zu Joanies Schlafzimmer.
An jenem Dienstagmorgen ging um 7 Uhr morgens bei der Polizei in Bakersfield ein Notruf ein. Er kam von der 3rd Street 901. Joanies Adresse. Die Szene, die sie bei ihrer Ankunft erwartete, schockierte selbst die erfahrensten Polizeibeamten.
Joanie lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett. Sie war mit einer Pistole Kaliber .22 dreimal in den Kopf und zweimal in den Arm geschossen worden. Sie wies auch sieben Messerstiche auf.
Auch der vier Jahre alte Marques Harper lag auf dem Bett, die Augen weit geöffnet. Er hatte eine Schusswunde an der rechten Seite des Kopfes und die Fingerspitzen seiner rechten Hand waren bis auf die Knochen durchgebissen. Die Ermittler folgerten, dass hierfür eine Angstreaktion verantwortlich war. Marques musste den Mörder gesehen und instinktiv die Finger in den Mund gesteckt haben.
Die erst zweijährige Lyndsey Harper wurde am Fußende des Bettes gefunden. Sie trug noch ihr kleines blaues Kleid, das sie in der Kirche angehabt hatte. Sie war durch einen Schuss in den Rücken getötet worden.
Earnestine, Joanies Mutter, wurde im Hausflur gefunden, mit zwei klaffenden Einschusslöchern im Gesicht. Sie war aus nächster Nähe erschossen worden. Neben ihr lag eine Pistole. Wer immer der Eindringling gewesen sein mochte, Earnestine hatte eindeutig vorgehabt, sich nicht kampflos zu ergeben.
Schließlich wurde Marshall, Joanies sechs Wochen alter Sohn, den man anfänglich für verschwunden hielt, neben seiner Mutter, unter einem Kissen verborgen, gefunden. Wie seine Schwester Lindsey war auch er von einem Schuss in den Rücken getötet worden.
Die Mordermittlungen der Polizei nahmen schnell an Fahrt auf, und es dauerte nicht lange, bis sich ein Hauptverdächtiger herauskristallisierte. Der 41-jährige Vincent BrothersBrothers, Vincent, Joanie Harpers Noch-Ehemann, zählte zu den Säulen der Bakersfielder Gemeinde. Der Familienvater hatte an der Norfolk State University seinen Bachelor-Abschluss und an der California State University seinen Master in Erziehungswissenschaften gemacht. 1987 trat er eine Lehrerstelle an einer örtlichen Grundschule an, in der er sich im Lauf von acht Jahren zum Konrektor hocharbeitete.
Doch BrothersBrothers, Vincent hatte eine dunkle Seite. Obwohl Joanie ihn zweifellos geliebt und nach Kräften versucht hatte, dafür zu sorgen, dass die Beziehung zwischen ihnen harmonisch verlief, hatte das Paar sich immer wieder getrennt, so auch im Jahr 2000, kaum einen Monat nach der Hochzeit. Doch später im Jahr war Lindsey, das zweite Kind des Paares, zur Welt gekommen. So wie bei Marques, dem ersten Kind, das Joanie ein paar Jahre früher zur Welt gebracht hatte, war BrothersBrothers, Vincent bei der Geburt nicht dabei. 2001 wurde die Ehe annulliert. BrothersBrothers, Vincent hatte unüberbrückbare Differenzen angeführt, Joanie Betrug. Angeblich hatte sie zum Zeitpunkt der Eheschließung nichts von BrothersBrothers, Vincent’ vorherigen beiden Ehefrauen gewusst.
Dieses Wissen hätte ihr rückblickend das Leben retten können. 1988 war BrothersBrothers, Vincent wegen Misshandlung seiner ersten Frau zu sechs Tagen Gefängnis verurteilt und anschließend unter Bewährung gestellt worden. 1992 hatte er erneut geheiratet. Doch seine zweite Frau hatte schon im darauffolgenden Jahr die Scheidung eingereicht, weil BrothersBrothers, Vincent, wie sie behauptete, gewaltGewalt, häuslichetätig sei und gedroht habe, sie umzubringen. 1996 hatte BrothersBrothers, Vincent dann eine weibliche Angestellte der Schule, in der er im Jahr zuvor Konrektor geworden war, bei sich zu Hause sexuell belästigt. Laut Akten des Verwaltungsbezirks hatte die Frau behauptet, BrothersBrothers, Vincent habe sie in sein Schlafzimmer gezerrt, sie geschlagen und Fotos von ihr gemacht. Obwohl sie den Vorfall den örtlichen Behörden gemeldet hatte, riet die Polizei ihr davon ab, Strafanzeige zu erstatten, weil BrothersBrothers, Vincent als »Vorbild in der Gemeinde« gelte.
Im Januar 2003 hatten Joanie und BrothersBrothers, Vincent in Las Vegas zum zweiten Mal geheiratet. Doch im April war BrothersBrothers, Vincent wegen Spannungen zwischen ihm und Joanies Mutter erneut aus dem Haus ausgezogen. Im Mai kam dann Marshall zur Welt. Sechs Wochen später war er tot. Als der Prozess im Februar 2007 schließlich medienwirksam eröffnet wurde, argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass es sich hier um eine Beziehung handele, die nachweislich unstet gewesen sei, und um einen Mann, der nicht nur gewaltGewalt, häuslichetätig, sondern auch ein Ehebrecher sei. Tatsächlich bildete BrothersBrothers, Vincent’ angebliche Serie außerehelicher Beziehungen den Kern der Anklage der Staatsanwaltschaft. Das Hauptmotiv für die Morde, so hieß es, sei Habgier. BrothersBrothers, Vincent habe sich von der Last befreien wollen, seine wachsende Familie ernähren zu müssen.
BrothersBrothers, Vincent war im April 2004 festgenommen und des fünffachen vorsätzlichen Mordes angeklagt worden. Während des Prozesses erklärte er sich für nicht schuldig.
BrothersBrothers, Vincent’ Alibi gründete sich auf geografische FaktenFakten. Laut der Verteidigung hatte er zum Zeitpunkt der Morde Urlaub und befand sich rund 2000 Meilen entfernt in Columbus, Ohio, bei seinem Bruder Melvin, den er, nebenbei bemerkt, zehn Jahre lang nicht gesehen hatte. Als Beweis dienten ein Mietwagenvertrag – für einen Dodge Neon, der später von Kriminalbeamten beschlagnahmt wurde – und ein paar Kreditkartenquittungen für Artikel, die am Tag der Morde in einem Geschäft in North Carolina gekauft worden waren. Tatsächlich hatte die Polizei damals BrothersBrothers, Vincent’ Spur bis zum Haus seiner Mutter in North Carolina verfolgt, um ihm die Nachricht von den entsetzlichen Morden zu überbringen.
Doch nach und nach wurde Licht in die Sache gebracht. Eine genauere Untersuchung der Kreditkartenquittungen sowie die Analyse der Bilder der Überwachungskamera des Geschäfts zeigten, dass Melvin zum besagten Zeitpunkt die Einkäufe getätigt hatte, und zwar mit der Kreditkarte seines Bruders, dessen Unterschrift er gefälscht hatte.
Außerdem bestätigte eine nähere Untersuchung des Mietwagens, dass BrothersBrothers, Vincent den Dodge zwar tatsächlich in Ohio gemietet hatte, aber auch mehr als 5400 Meilen damit gefahren war. So unwahrscheinlich es unter normalen Umständen auch war, eine solche Strecke in drei Tagen zu bewältigen, konnte BrothersBrothers, Vincent angesichts dieser hohen Meilenzahl jedoch durchaus nach Bakersfield und wieder zurück gefahren sein, wie die Staatsanwaltschaft argumentierte.
Doch dieser Beweis, so zwingend er auch erscheinen mochte, war lediglich ein Indiz. BrothersBrothers, Vincent mochte zwar ein Ehebrecher sein, entgegnete die Verteidigung, aber das machte ihn nicht zum Mörder. Wenn dies der Fall sei, dann würde, statistisch gesehen, ein Drittel der Geschworenen vor Gericht gestellt werden. Zudem besagte die Tatsache, dass Melvin die Kreditkarte seines Bruders in einem Geschäft in North Carolina benutzt hatte, keineswegs, dass dieser Bruder sich währenddessen am anderen Ende des Landes befunden und seine Familie erschossen habe. Stattdessen hatte er vielleicht draußen auf dem Parkplatz gewartet. Und auch die 5400 Meilen, die BrothersBrothers, Vincent mit dem Dodge zurückgelegt hatte, beinhalteten nicht unbedingt, dass er nach Kalifornien gefahren war. Sie konnten sich in Wirklichkeit überall angesammelt haben. Und um das Argument ad absurdum zu führen: BrothersBrothers, Vincent konnte sie theoretisch gefahren sein, ohne auch nur die Staatsgrenze von Ohio überquert zu haben.
Nötig waren Tatsachen: keine Rückschlüsse oder Annahmen oder Spekulationen, sondern solide, unwiderlegbare Beweise.
Die Behörden kamen ein wenig voran, als ein Nachbar in Bakersfield angab, BrothersBrothers, Vincent zum Zeitpunkt der Morde in der Nähe des Hauses der Harpers gesehen zu haben. Doch er konnte sich natürlich auch geirrt haben. War es BrothersBrothers, Vincent gewesen oder nicht? Konnte er schwören, dass es sich um BrothersBrothers, Vincent gehandelt hatte? Der Fall war zum Verzweifeln. Alle Beweise deuteten übereinstimmend auf BrothersBrothers, Vincent hin, doch es gab keinen forensischen Volltreffer, um den Fall abschließen zu können.
Das Mietauto musste der Schlüssel sein. Jene Meilen. Es musste eine Möglichkeit geben, eine Verbindung zwischen BrothersBrothers, Vincent, den Morden und der Straße herzustellen.
Doch worin bestand die?
Verräterisches Insekt
Am 25. Juli 2003 schlenderten zwei FBI-Agenten und ein Polizeibeamter aus Bakersfield mit einem Autokühler ins Bohart Museum of Entomology an der University of California, Davis. Das Kühlergitter war voller Insekten, und sie wollten wissen, um welche es sich handelte. Nicht dass an den Insekten etwas ungewöhnlich war, zumindest nicht in Zentralkalifornien. Doch ob etwas ungewöhnlich ist oder nicht, hängt per definitionem völlig vom Kontext ab. Die Insekten waren vielleicht in Kalifornien nichts Ungewöhnliches. Aber wie sah es mit anderen Orten aus?, wollten die Beamten wissen. Ohio, zum Beispiel? Oder North Carolina?
Eine sehr schlanke, gelehrt wirkende Frau mit wachsamen, haselnussbraunen Augen und strengem Kurzhaarschnitt begrüßte das Trio. Lynn KimseyKimsey, Lynn, eine Mitvierzigerin, war Professorin für Entomologie an der UC Davis und die Museumskuratorin. Da ihr Interesse vor allem der Biogeografie von Insekten, insbesondere kalifornischen Insekten, galt, war niemand besser geeignet, die Fragen der Gesetzeshüter zu beantworten. Falls der Kühler, den sie mitgebracht hatten, irgendwo westlich der Rockies gewesen war, würde KimseyKimsey, Lynn dies sagen können, denn sie konnte diese Insekten wie ein ökologisches Röntgenbild lesen. Sie begutachtete den Kühler und nahm ihn mit zur Analyse.
Im vergangenen Jahr besuchte ich Professor KimseyKimsey, Lynn in Davis, um mich mit ihr über den Fall zu unterhalten. Fast zwei Jahrzehnte später war er ihr noch immer im Gedächtnis, als wäre es gestern gewesen. »Damals hatte ich keine Ahnung, dass ich an einer Mordermittlung teilnahm«, erzählte sie mir, während wir tief im Inneren des Museums in einem Linnäischen Labyrinth sorgfältig etikettierter Insektenbehälter umherwanderten. »Dieses DetailDetail haben sie ausgelassen, und wahrscheinlich aus gutem Grund. Viele wissenschaftliche Untersuchungen werden am besten blind durchgeführt, ohne dass die Forscher wissen, welches spezielle Puzzle sie zu lösen versuchen. Auf diese Weise vermeidet man das Risiko, dass man sich bei dem, was man zu tun versucht, selbst in die Quere kommt und die wissenschaftliche Methode mit den eigenen Erwartungen kontaminiert. Es geschieht fast unmerklich. Ohne dass man es erkennt. Und wenn man Sachverständiger in einem Mordprozess ist, kann dies schwerwiegende Folgen haben.«
Ich lasse den Blick an den flachen Ahornschubladen mit ihren exakt ausgerichteten weißen Schildchen entlangschweifen – Cornell-Schubladen, wie Lynn KimseyKimsey, Lynn erklärt. Lepidoptera: Schmetterlinge und Motten. Orthoptera: Grillen und Heuschrecken. Hymenoptera: Bienen, Ameisen und Wespen. Keine andere Kreatur auf dieser Welt wird nach ihrem Ableben so pedantisch konserviert wie das Insekt.
Wir bleiben vor einer Schublade mit dem EtikettEtikett»Xanthipus corallipes pantherinus« stehen. KimseyKimsey, Lynn öffnet sie.
»Wir haben dann dreißig verschiedene Insekten auf dem Kühler gefunden«, sagt sie. »Oder vielmehr Teile von Insekten: Flügel, Beine, ein Abdomen, Teile eines Abdomens, einen Kopf und Abdomen ohne Flügel oder Beine … Am Ende waren es jedoch sechs, die die Geschichte verrieten.
Zum einen waren da zwei Käfer, die nur im Osten der Vereinigten Staaten leben. Dann gab es zwei Wanzen. Neacoryphus rubicollis und Piesma brachiale oder ceramicum, die nur in Arizona, Utah und Südkalifornien vorkommen. Sie befanden sich auf dem Luftfilter. Es gab eine große goldene Feldwespe, Polistes aurifer, der ein paar Flügel und Beine fehlten – die findet man vor allem in Kalifornien, doch sie wurde auch weiter östlich in Kansas gesichtet. Und dann war da dieses kleine Kerlchen, Xanthippus corallipes pantherinus, auch als rotschenklige Heuschrecke bekannt. Oder das, was von ihr übrig war. Wir haben sie anhand eines ihrer Hinterbeine identifiziert. Die Innenseite der Schenkel ist leuchtend rot.« KimseyKimsey, Lynn nimmt den Behälter heraus und reicht ihn mir. Ich linse durch den Glasdeckel. Es erfordert keine allzu große Vorstellungskraft zu begreifen, wie man auf diesen Namen gekommen ist. Die Beine sind in der Tat leuchtend rot, wie Glut unterhalb der grau melierten Asche des Körpers. Ich lasse den Behälter zurück in die Schublade gleiten und schiebe sie zu. Unglaublich, sich vorzustellen, dass ein einfaches Insekt es vermochte, einen Menschen in die Todeszelle zu bringen.
»Und woher stammt Xanth … die rotschenklige Heuschrecke?«, frage ich, als wir zu den Lepidoptera, den Motten und Schmetterlingen, zurückgehen.
Lynn KimseyKimsey, Lynn lächelt, »Xanthippus corallipes pantherinus findet man nicht weiter östlich als Kansas und Zentraltexas«, erklärt sie. »Alles in allem kann man also sagen … ja, das Auto, zu dem dieser Kühler gehörte, war irgendwann einmal im Osten der USA gewesen. Doch es musste irgendwann auch durch Staaten westlich von Colorado gekommen sein, was mit der Hypothese übereinstimmte, dass BrothersBrothers, Vincent westlich von Ohio entweder auf der Interstate 70 oder 40 gefahren war.«
Die Gesetzeshüter waren mehr als zufrieden. Als sie rund eine Woche später wiederkamen, um den Kühler abzuholen und zu hören, was KimseyKimsey, Lynn mithilfe ihrer KategorisierungKategorisierungsfähigkeiten zutage gebracht hatte, war das, was sie ihnen zu berichten hatte, Musik in ihren Ohren. Kimseys entomologisches Navi war so gut wie das Original. Es war, als sei BrothersBrothers, Vincent’ gemieteter Dodge mit seinem eigenen mobilen Peilsender ausgestattet gewesen, der alle paar hundert Kilometer die Route aufgezeichnet hatte.
Damit war BrothersBrothers, Vincent’ Schicksal besiegelt. Lynn KimseyKimsey, Lynn sagte am 15. Mai 2007 ordnungsgemäß vor dem Kammergericht von Bakersfield aus und die Geschworenen befanden BrothersBrothers, Vincent des Mordes an seiner Frau, seinen drei Kindern und seiner Schwiegermutter für schuldig.
Wir bleiben bei einer anderen Schublade stehen. Auf dem EtikettEtikett steht Acherontia styx, Totenkopfschwärmer, der Schmetterling aus Das Schweigen der Lämmer. Lynn KimseyKimsey, Lynn öffnet die Schublade und reicht mir die Schale: »Der Richter lehnte die Möglichkeit einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung ab und verurteilte BrothersBrothers, Vincent zum Tod«, erklärt sie nüchtern. »Heute sitzt er im San Quentin und wartet auf seine Hinrichtung.«
Ein kurzer Schauer durchfährt mich.
»Was empfinden Sie bei diesem Gedanken?«, frage ich, während ich den Inhalt der Schublade studiere. »Es war Ihr Beweis, der ihn dorthin brachte.«
Sie zuckt die Schultern. »Ich empfinde nichts«, sagt sie. »Ich meine, er hat sich selbst dorthin gebracht mit seiner Tat. Ich habe nur meinen Job gemacht. Getan, was ich jeden Tag tue. Dinge in Schubladen einordnen.«
Die Welt in Schubladen einordnen
2005, im Jahr nach BrothersBrothers, Vincent’ Festnahme, führte die amerikanische Entwicklungspsychologin Lisa OakesOakes, Lisa an der University of Iowa eine Studie durch, die auf faszinierende Weise deutlich machte, wie wir alle Dinge in Schubladen einordnen, um es mit Kimseys Worten zu sagen. OakesOakes, Lisa wollte herausfinden, wie früh dieses In-Schubladen-Einordnen oder, wie ich gern sage, dieser »KategorisierungKategorisierungsinstinkt« einsetzt. War es etwas, was das Gehirn einfach tat, wie hören oder riechen oder weinen? Oder mussten wir es irgendwie lernen?
Um dies herauszufinden, wählte OakesOakes, Lisa eine Gruppe von vier Monate alten Babys aus und ließ auf den Bildschirmen zweier Computer, die nebeneinander in ihrem Labor standen, Bilder von Katzen aufblitzen. Die Katzen wurden gleichzeitig und paarweise präsentiert, eine auf dem linken und eine auf dem rechten Bildschirm. Während der 15 Sekunden, die jedes Paar auf dem Bildschirm erschien, hielt ein Beobachter fest, wie lange die Babys jede Katze anschauten, wobei die Ausrichtung der kindlichen Aufmerksamkeit auf einen Stimulus ein Richtmaß für dessen Neuheit darstellte.
Doch die Sache hatte einen Haken. Nachdem sich die Kinder sechs Katzenpaaren gewidmet hatten und langsam mit ihnen vertraut geworden waren – was die Abnahme der Betrachtungszeit im Verlauf der sechs Versuche zeigte –, schmuggelte Lisa OakesOakes, Lisa entweder eine neue Katze ein, die die Babys noch nicht gesehen hatten, oder einen Hund.
Der Grundgedanke war einfach. Falls die Babys den Hund länger anschauten als die neue Katze, würde dies nahelegen, dass der Hund sich für sie stärker von den vertrauten Katzen unterschied als die neue Katze. Mit anderen Worten: Es würde beweisen, dass ihr Gehirn Hunde auf andere Weise verarbeitete als Katzen und sie einer neuen Kategorie zuordnete. Nahm die Aufmerksamkeitsspanne der Babys hingegen nicht selektiv zu, wenn sie Bilder von Hunden sahen, dann bedeutete dies, dass ihr Gehirn Hunde und Katzen als ein und derselben Kategorie zugehörig behandelte. Der Kategorie »Tier«.
Das Ergebnis dieser Studie war außergewöhnlich. Trotz der Tatsache, dass die Kinder zuvor kaum mit Hunden oder Katzen in Berührung gekommen waren, trotz der Tatsache, dass sie sich im Alter von nur vier Monaten noch nicht die Worte »Hund« und »Katze« angeeignet hatten, und trotz der Tatsache, dass Hunde und Katzen sich tatsächlich ziemlich ähnlich sind – beide haben vier Beine, zwei Augen, Fell und einen Schwanz –, betrachteten die Kinder die Bilder der Hunde länger als die Bilder der neuen Katze. Schon mit vier Monaten ordnet das Gehirn die Außenwelt in Schubladen ein.
Nach dem Mittagessen mit Professor Kimsey im Bohart Museum of Entomology schlendere ich über den Campus zum UC Davis Center for Mind and Brain, wo Lisa OakesOakes, Lisa, die 2005 die University of Iowa verlassen hat, nun das Infant Cognition Lab der Psychologischen Abteilung leitet. Wir treffen uns beim Empfang und sie führt mich herum. Plüschtiere, kleine Plastiktiere, Bälle, Glocken und Bausteine finden sich dort neben Elektroden, Oszillografen, Blickregistrierungsgeräten und den neurophysiologischen Dreadlocks von EEG-Schädelhauben. Das Labor sieht aus wie das extrem unordentliche Schlafzimmer eines dreijährigen Supergeeks.
Während sie mich herumführt, erklärt OakesOakes, Lisa mir einiges von dem Krimskrams. Sie ist sehr herzlich, sodass ich mich sofort wohlfühle. Ich erzähle ihr von meinem Treffen mit Lynn KimseyKimsey, Lynn auf der anderen Seite des Campus und davon, dass es mithilfe der entomologischen TaxonomieTaxonomie gelungen war, einen Mehrfachmörder zu überführen. Sie ist beeindruckt. Denn derartige DetailDetails tauchen nie auf den Computerbildschirmen in ihrem Labor auf. Differenzierter als Katze und Hund wird’s nicht.
Die Welt ist ein komplizierter Ort, erklärt sie. Wenn wir auf die Welt kommen, erscheint sie uns als »blühende, schwirrende Verwirrung«, wie William JamesJames, William, der Vater der westlichen Psychologie, es einst formulierte. Dies ist ein Problem, das einer Lösung bedarf. Wie bei den meisten Problemen ist es leichter, damit umzugehen, sobald es »bereinigt« wurde. Und so beginnt unser Gehirn, den Blizzard eingehender Daten in einzelne, überschaubarere Haufen zu sortieren. Augen, Nasen und Münder werden Gesichter. Dinge, die bellen, wiehern oder muhen sowie vier Beine und einen Schwanz haben, werden Tiere.
»Stellen Sie sich vor, wie die Welt wäre, wenn unsere Gehirne keine KategorienKategorien bilden könnten«, sagt Lisa OakesOakes, Lisa. »Selbst die einfachsten Dinge, die wir tagtäglich als gegeben hinnehmen, wären eine große Herausforderung. Sie spazieren in den Garten Ihres Freundes und der hat eine neue Sprinkleranlage. Doch Ihnen fehlt die Kategorie ›Bewässerungsgerät‹. ›Was ist das für ein Ding da mitten auf dem Rasen?‹, fragen Sie sich. ›Ich kenne es nicht. Ist es gefährlich? Ist es etwas, was mich umbringen könnte?‹«
Wären wir nicht fähig zu kategorisieren, fährt sie fort, wäre es jeden Morgen beim Aufwachen so, als würden wir auf einem neuen Planeten aus dem Bett steigen. Föhn: Was ist das? Versucht er, mich anzugreifen? Fernseher: Wer sind die Leute da drin? Versuchen sie, mit mir zu sprechen? Waschmaschine: Hm … stecke ich den Kopf hinein?
KategorienKategorien versetzen uns in die Lage, uns auf vorhersehbare, geordnete Weise – Objekt für Objekt, Person für Person – durch die Welt zu bewegen, sodass unsere Reise durchs Leben nicht nur aus einer endlosen Reihe zufälliger, neuer und im Grunde bedeutungsloser Interaktionen besteht, sondern geplant, kontrolliert und zielgerichtet ist.
»In diesem Sinne könnte man Babys als den Forschungs- und Entwicklungszweig unserer Spezies betrachten, oder?«, schlage ich vor.
»Absolut«, sagt OakesOakes, Lisa. »Wenn wir klein sind, nehmen wir die Welt zunächst in umfassenden, allgemeinen KategorienKategorien wahr. Wie zum Beispiel ›Pflanzen‹ und ›Tiere‹. Wenn wir dann im Laufe der Zeit unsere KategorisierungKategorisierungsfähigkeit verbessern, werden diese Kategorien schärfer umrissen. Wir sehen Blumen und Bäume. Hunde und Katzen. Vögel und Fische. Große und kleine. Knuddelige und nicht so knuddelige. Und mit zunehmender Erfahrung und Entwicklung nehmen wir noch detailliertere Unterscheidungen vor. Wir differenzieren zwischen Chihuahuas und Labradoren. Perserkatzen und Siamkatzen. Laubbäumen und immergrünen Bäumen. Kleinen Roten Kardinalen und großen Rosaflamingos. Haien und Delfinen.«
Später, so sagt sie, werden wir dann noch pingeliger. Wir sehen Rot-Kiefern, Weymouth-Kiefern, Akazien und Orchideen, Steinadler, Graugänse, Rotkehlchen und Sperlinge, Rote Admirale, Große Schillerfalter, Aurorafalter und Kuhaugen. Wenn wir uns schließlich im Erwachsenenalter als Botaniker oder Biologen betätigen, werden unsere taxonomischen Systeme so fein abgestimmt, dass wir es zum großen Ärger der Freunde, mit denen wir einen Spaziergang unternehmen, nicht lassen können, in einen unverständlichen Jargon zu verfallen, wenn sie auf eine hübsche Blume deuten.
Ebenso werden wir es als Insektenforscher zum Ärger von Mehrfachmördern nicht lassen können, in unverständliches Latein zu verfallen, wenn die Polizei mit einem Kühler voller zerfetzter Wanzen und Motten auf der Matte steht.
Unabhängig von unseren Klassifizierungsfähigkeiten sind die Prinzipien stets identisch. Vorhersagbarkeit, Erwartung und die Minimierung von UnsicherheitUnsicherheit. Exakt die gleichen Prinzipien, die für vier Monate alte Babys auf den Idiotenhügeln der KategorisierungKategorisierung gelten, gelten auch für alpine Kategorisierer wie Lynn KimseyKimsey, Lynn hoch über der taxonomischen Schneegrenze. Beim Kategorisieren, so OakesOakes, Lisa, geht es um methodisches und effizientes Navigieren, egal wo oder wann es geschieht.
Was bei uns Übrigen eine fundamentale Frage aufwirft: Welcher Grad der KategorisierungKategorisierung ist in unserem Alltagsleben optimal, um größtmögliche Effizienz zu erzielen? Wenn sich unser Kategorisierungsinstinkt entwickelt hat, um KomplexitätKomplexitätKognitionkognitive Komplexität zu verringern, verfehlen wir dann nicht das Ziel, wenn wir das Gewöhnliche und Alltägliche – wie Hunde oder Häuser zum Beispiel – mit der taxonomischen Gier eines forensischen Entomologen kategorisieren?
Neuntausend Meilen westlich, jenseits eines kalten blauen Meers und auf der anderen Seite eines glühend heißen Kontinents, spreche ich mit Professor Mike AndersonAnderson, Mike, dem Dekan der Abteilung Psychologie und Bewegungswissenschaft der Murdoch University in Perth, Westaustralien.[4]AndersonAnderson, Mike, ein Schotte, ist einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der kategorialen Wahrnehmung. Vor allem, wie sie sich bei Kindern entwickelt.
Wir kategorisieren die Welt auf drei verschiedenen Ebenen, erklärt er: auf einer übergeordneten Ebene, einer Basisebene und einer untergeordneten Ebene. Wir können also, wenn wir etwas kategorisieren, so allgemein bleiben oder so spezifisch werden, wie wir möchten. »Es ist keine perfekte MetapherMetapher, aber stellen Sie sich das Ganze als Stammbaum vor mit den allgemeineren oder übergeordneten KlassifikationKlassifikationen ganz oben und den spezifischeren oder untergeordneten Klassifikationen ganz unten«, schlägt er vor. Die Klassifikationen auf der übergeordneten Ebene gleichen den Eltern, die auf der Basisebene den Kindern und die auf der untergeordneten Ebene den Enkeln und Urenkeln.
»Hier ein Beispiel«, fährt AndersonAnderson, Mike fort. »Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen den Weg beschreiben und sagen, dass Sie am Ende der Straße bei einem viereckigen Betonbau mit einer Tür, vier Fenstern und einer Auffahrt sowie einem Garten, in dem sich ein bellendes Säugetier mit vier Beinen, Fell und wedelndem Schwanz befindet, rechts abbiegen sollen. Sie würden mich für ein bisschen seltsam halten! Das ist eine sehr wortreiche Beschreibung. Warum habe ich Ihnen nicht einfach gesagt, dass Sie bei dem Haus mit dem Hund rechts abbiegen sollten? Denn sobald ich die Wörter ›Haus‹ und ›Hund‹ sage, ergänzt Ihr Gehirn automatisch die anderen DetailDetails.
Stellen Sie sich andererseits vor, ich würde sagen: ›Biegen Sie bei dem mit Schlangenlinien verzierten Kunsthandwerkerhaus mit dem Mansardendach und dem Bergamasker Hirtenhund vor dem Eingang rechts ab.‹ Wieder würden Sie mich für verrückt halten. Doch dieses Mal bin ich nicht übertrieben allgemein, sondern übertrieben spezifisch. Sofern Sie kein Architekt und nicht an seltenen HunderasseRassen interessiert sind, sind Sie kein bisschen schlauer und wissen immer noch nicht, wohin Sie gehen sollen. Und selbst wenn Sie Architekt und an seltenen Hunderassen interessiert wären, würde es ziemlich seltsam klingen.«
Und so entscheiden wir uns für den goldenen Mittelweg. In allgemeinen Unterhaltungen wählen wir, um Informationen weiterzugeben, zu erhalten und zu ordnen, die KategorienKategorien der Basisebene, weil diese uns am meisten Zeit und Energie sparen und uns befähigen, am effektivsten zu kommunizieren: der Grund, weshalb wir die Fähigkeit, zu kategorisieren, überhaupt entwickelt haben.
Im Großen und Ganzen, erklärt AndersonAnderson, Mike, sind die KategorienKategorien der Basisebene für das Alltagsleben am optimalsten. Und sie haben, wie er sagt, einen sogenannten »privilegierten« Status. Mit anderen Worten: Wenn es am grenzenlosen Kategorien-Firmament taxonomische Sterne gäbe, wären sie diejenigen, die man am ehesten mit bloßem Auge sehen könnte. Sie wären diejenigen, die heller leuchten würden als der Rest. Diejenigen, denen zu folgen ratsam wäre, wenn man seinen Kurs nach den Sternen ausrichten würde.
»Fragen Sie zum Beispiel einen Vierjährigen, ob ein Kälbchen auch dann noch muhen würde, wenn es in einer Schweinefamilie aufwüchse, und er würde mit Ja antworten«, sagt AndersonAnderson, Mike. »Selbst im Alter von vier Jahren erkennen Kinder schon, dass ein Tierbaby im Laufe der Zeit die Merkmale anderer Tiere seiner Kategorie aufweisen wird, egal, wo es aufwächst. Oder fragen Sie einen Fünfjährigen, ob ein Stachelschwein, das sich so verändert hat, dass es äußerlich nicht von einem Kaktus zu unterscheiden ist, nach wie vor ein Stachelschwein ist, und er würde Ja sagen. Egal, wie es von außen betrachtet aussieht, es ist immer noch ein Stachelschwein.«
Kinder ziehen also von einem sehr frühen Alter an BasiskategorienKategorien-Unterscheidungen – Kuh, Schwein, Stachelschwein – äußeren ÄhnlichkeitÄhnlichkeiten vor, wenn sie Schlüsse ziehen, welche Eigenschaften verschiedenen Tieren gemeinsam sein könnten. Und nicht nur das: Sie scheinen auch zu verstehen, dass die Mitgliedschaft in einer Kategorie der Basisebene bestehen bleibt; dass Kühe Kühe sind und auch dann noch muhen werden, wenn sie in einer Familie von Schweinen oder Lamas oder Gnus aufwachsen.
»Die Antwort auf Ihre Frage«, so AndersonAnderson, Mike, »lautet also, dass die Basisebene der KategorisierungKategorisierung im Alltag die nützlichste und natürlichste ist. Doch es hängt davon ab, was Sie unter Alltag verstehen. Alltag kann für viele verschiedene Menschen viele unterschiedliche Dinge bedeuten. Es gibt zum Beispiel jede Menge Forschungen, die Folgendes zeigen: Je mehr wir über etwas wissen, desto eher werden wir es mit einer größeren Detailgenauigkeit kategorisieren. Experten auf einem bestimmten Gebiet werden es bis zum Überdruss kategorisieren. Das heißt, dass das, was sie für optimal halten mögen, wenn sie miteinander reden, für Außenseiter vielleicht nicht optimal ist.«[5]
Nehmen wir zum Beispiel die Biologie. Dort gibt es sieben »taxonomische Stufen« genannte Ebenen der KategorisierungKategorisierung: Reich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art. Für Biologen ist die optimale Ebene die Gattung, das heißt die Ebene über derjenigen, die die meisten anderen wahrscheinlich am praktischsten finden: der Art.
»Um auf die Hunde zurückzukommen«, fährt AndersonAnderson, Mike fort, »das Wort ›Hund‹ ist genau genommen ein Deskriptor auf der Ebene der Art – Canis familiaris –, der auf ein Mitglied der Gattung Canis verweist. Andere Mitglieder auf der Ebene der Art sind zum Beispiel Canis lupus, der Wolf, oder Canis latrans, der Kojote. Wir müssen also ein bisschen Vorsicht walten lassen, wenn wir über eine optimale Ebene der KategorisierungKategorisierung sprechen. Es hängt wirklich vom Kontext ab: vom GesamtbildGesamtbild, der jeweiligen Situation und dem, was kategorisiert wird.«
Weshalb das FBI an einem lauen Sommermorgen des Jahres 2003 ins Bohart Museum of Entomology in Davis kam und der Taxonomin Lynn KimseyKimsey, Lynn den ramponierten Kühler eines beschlagnahmten Ford Dodge reichte. Außergewöhnliche Umstände erforderten außergewöhnliche Fähigkeiten der KategorisierungKategorisierung. Und der merkwürdige Fall der einbeinigen rotschenkligen Heuschrecke hätte selbst Sherlock Holmes alles abverlangt.
2 | Eine Menge Probleme
Das Kontinuum ist das unbegrenzt Teilbare.
ARISTOTELESAristoteles
Im Oktober 2004 fühlte Paul Sinton-HewittSinton-Hewitt, Paul sich ziemlich mies. Er hatte gerade einen gut bezahlten Marketing-Job verloren und sich beim Laufen durch die Straßen seines Wohnviertels im Westen Londons eine Verletzung zugezogen, gerade zu der Zeit, als er sich auf den London-Marathon vorbereitete. Er war beim Physiotherapeuten gewesen, doch dieser hatte den Kopf geschüttelt. Knie kommen nicht von heute auf morgen wieder in Ordnung. Womöglich verschlimmern sich die Beschwerden noch. Wie immer im Leben hätte das Timing nicht schlechter sein können. Paul zog seine Teilnahme am Marathon zurück, ging ins Pub und grübelte über seine Situation nach. Keinen Job mehr und nun auch keinen Marathon mehr – er fühlte sich niedergeschmettert. Wie ein zerfetztes Insekt im Kühlergitter des Lebens.
Fünfzehn Jahre später sitzen Paul und ich in eben diesem Pub. Es befindet sich ganz in der Nähe des Laufvereins in Richmond, in dem wir beide Mitglieder sind. Ich komme mit Drinks von der Bar zurück. Wir trinken ein paar Schlucke und schauen uns um.
»Ich hatte die Wahl«, erzählt Paul mir nüchtern. Er ist herzlich, drahtig, grauhaarig und spricht mit leiser, ruhiger Stimme. »Zu Hause Trübsal zu blasen, mich selbst zu bemitleiden und ein Opfer zu sein. Oder den Arsch hoch zu kriegen und die Gelegenheit zu nutzen, etwas zu tun. Etwas zurückzugeben. Für einen Unterschied im Leben anderer Menschen zu sorgen, während ich herauszufinden versuchte, was ich mit meinem eigenen Leben anstellen sollte.«
Es ist ihm hoch anzurechnen – und ein unermessliches Glück für Millionen anderer Läufer überall auf der Welt –, dass er sich für Letzteres entschied. Und so kamen am 2. Oktober 2004, einem kühlen Samstagmorgen, dreizehn in Lycra gehüllte Pioniere, ahnungslose Revolutionäre, um Punkt 8.45 Uhr im Bushy Park in Süd-West-London zusammen, um eine Strecke von fünf Kilometern zu walken, zu joggen oder volle Pulle zu rennen – es war ganz ihnen überlassen, wie sie die Sache angingen. Nach dem Lauf gab Paul in einem in der Nähe liegenden Café die Ergebnisse ein, während die Sportler – von denen keiner dafür gesorgt hatte, dass Mo Farah (der Doppelolympiasieger im Langstreckenlauf) sich Sorgen machen musste – ein üppiges Frühstück zu sich nahmen.
»Anfangs waren es nur eine Gruppe von Freunden und ich«, erklärt Paul. »Ich organisierte für sie einen Lauf im örtlichen Park, während ich mit einer Stoppuhr dort herumhing. Ich würde nicht sagen, dass ich damals eine Vision hatte. Nicht wirklich. Doch irgendwie wollte ich etwas tun, was Spaß machte, sozial integrativ und vor allem kostenlos war – etwas, das Menschen, egal welchen Alters und welcher physischen Fähigkeiten, dazu ermutigen würde, regelmäßig Sport zu treiben, sich einen gesünderen, aktiveren Lebensstil anzueignen und vor allem dabeizubleiben.«
16 Jahre, 715 Orte, 166896 Events, 34853835 individuelle Läufe und 174269175 Kilometer später[6] ist der fröhliche wöchentliche ParkrunParkrun am frühen Samstagmorgen für viele – von unheilbar Kranken und Menschen, die sich von schweren Krankheiten und Verletzungen erholen, bis zu Berühmtheiten und Olympia-Goldmedaillengewinnern – ein fester Bestandteil ihres sozialen Lebens als auch ihres Gesundheits- und Fitnessprogramms geworden. Und darüber hinaus ein nationales und internationales Phänomen. Von Australien bis Japan. Von Singapur bis Eswatini.
Der ParkrunParkrun wurde im selben Jahr ins Leben gerufen wie FacebookFacebook





























