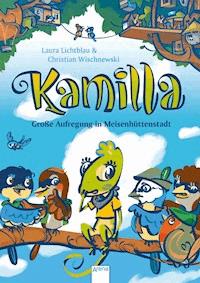13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist kalt geworden in Berlin, es ist die Zeit der Rauhnächte. Lautstarke Propaganda dominiert längst nicht mehr nur die Straßen der Hauptstadt, sondern die Politik des ganzen Landes. Und mittendrin taumeln drei Verlorengegangene, die plötzlich beginnen, sich Fragen zu stellen.
Da ist Burschi, die Johanna liebt, gegen alle Widerstände. Und dabei nicht nur den starken Arm eines Staates zu spüren bekommt, der kein Anderssein mehr duldet, sondern auch die Brüchigkeit menschlicher Beziehungen, wenn die Angst im Nacken sitzt. Da ist Charlie, der in anarchischen Musikerkreisen zwischen Joints und lauten Beats erwachsen wird. Und lernt, sich der allgegenwärtigen Überwachung auf seine Weise zu entziehen. Und da ist Charlotte, seine Mutter, Scharfschützin einer Bürgerwehr, die in ihren Loyalitäten schwankt und dabei droht den Verstand zu verlieren. Ist ihre Militanz vielleicht nur ein missglückter Versuch, dem eigenen Leben zu entkommen? Laura Lichtblau entwirft mit ihrem Debütroman «Schwarzpulver» eine urbane Dystopie. In feiner, gleichzeitig wilder - beinahe wildwüchsiger - Sprache, mit Witz und Leichtigkeit, erzählt sie vom unbewussten Verlangen nach Freiheit in einem Staat, dessen Ziel die absolute Unterdrückung ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Laura Lichtblau
Schwarzpulver
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Es ist kalt geworden in Berlin, es ist die Zeit der Rauhnächte. Lautstarke Propaganda dominiert längst nicht mehr nur die Straßen der Hauptstadt, sondern die Politik des ganzen Landes. Und mittendrin taumeln drei Verlorengegangene, die plötzlich beginnen, sich Fragen zu stellen.
Da ist Burschi, die Johanna liebt, gegen alle Widerstände. Und dabei nicht nur den starken Arm eines Staates zu spüren bekommt, der kein Anderssein mehr duldet, sondern auch die Brüchigkeit menschlicher Beziehungen, wenn die Angst im Nacken sitzt. Da ist Charlie, der in anarchischen Musikerkreisen zwischen Joints und lauten Beats erwachsen wird. Und lernt, sich der allgegenwärtigen Überwachung auf seine Weise zu entziehen. Und da ist Charlotte, seine Mutter, Scharfschützin einer Bürgerwehr, die in ihren Loyalitäten schwankt und dabei droht den Verstand zu verlieren. Ist ihre Militanz vielleicht nur ein missglückter Versuch, dem eigenen Leben zu entkommen?
Laura Lichtblau entwirft mit ihrem Debütroman «Schwarzpulver» eine urbane Dystopie. In feiner, gleichzeitig wilder – beinahe wildwüchsiger – Sprache, mit Witz und Leichtigkeit, erzählt sie vom unbewussten Verlangen nach Freiheit in einem Staat, dessen Ziel die absolute Unterdrückung ist.
Über die Autorin
Laura Lichtblau, 1985 in München geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin sowie als Journalistin für die «SPEX» in Berlin. Ihre Lyrik und kürzere Prosa wurde in zahlreichen Magazinen und Anthologien veröffentlicht. «Schwarzpulver» ist ihr erster Roman.
Inhalt
Burschi
Charlie
Charlotte
Charlie
Burschi
Charlie
Charlotte
Charlie
Burschi
Charlotte
Burschi
Charlotte
Burschi
Charlotte
Charlie
Charlotte
Charlie
Charlotte
Burschi
Charlie
Burschi
Charlotte
Burschi
Charlotte
Charlotte
Burschi
Charlie
Charlotte
Burschi
Charlie
Burschi
Charlie
Burschi
Charlie
Charlotte
Charlie
Burschi
Charlotte
Charlie
Burschi
Charlie
Burschi
Charlotte
Charlie
Burschi
Burschi
Die Wintersonne kippt ihr helles Licht über den Garten und alles gleißt auf; die Regentonne, die Schubkarre ganz hinten in der Ecke, die Rosenkugeln, die aus den Beeten ragen wie leuchtend bunte Kinderköpfe.
Ich trete eine Spur in den Schneeharsch und hole so das Haus an die Straße heran. Es duckt sich hinter den Platanen und Kiefern in die Eiseskälte, hinein in eine Vergangenheit. Der Keller reicht weit hinunter in die Erde, der Dachfirst ragt himmelhoch auf, Er kratzt am Firmament, hat die Traudl gesagt und damit ganz gewaltig übertrieben.
Die Tür ist massiv, ich drücke sie mit beiden Händen auf. Auf dem ausgetretenen Kelimteppich im Flur liegt ein sehr kleines Heft, ich hebe es auf, da zerfällt es mir beinahe beim Blättern. Es ist ein alter Bauernkalender, vierfarbig koloriert; das Burgunderrot fließt über die Ränder der schwarz gedruckten Linien, das Tanngrün, das Karottenrot ist viel zu groß für die Symbole. Die Monde, Ähren, Heiligen im Anschnitt. Vermutlich hat die Traudl etwas vorgehabt, einen Budenzauber sondergleichen. Also stecke ich den Kalender ein und steige dann so leise wie möglich die Treppe hinauf, hinein in einen Stillstand. Die Reisefotografien klettern die Wände entlang wie wilder Wein, Schwarz-Weiß-Aufnahmen von sonnenbeschienenen Tankstellen, die Traudl, die an einem Arm über einem Gebirgsbach baumelt, der Johann, wie er ein kleines, haariges Schwein küsst, Aquarelle, Tonmasken, Gebirgsketten als ein exaktes Panorama, mit schwarzem Fineliner gezeichnet.
Wenn ich meinen Mitbewohnerinnen erzähle, was ich hier mache, dann ziehen sie fast immer eine schräge Miene. Ich sage, Ich bin die Gesellschafterin von Herrn und Frau März, wie soll ich es auch anders nennen? Ich lese ihnen vor. Ich erzähle ihnen, was draußen vor sich geht, Prügeleien und andere Vorkommnisse, von der Dame im Pelzmantel, die den Obdachlosen bei der Ticketkontrolle in der Bahn zu sich zischt und die schützende Haube ihrer Monatskarte über ihn zieht, ihn rettet. Ich gieße die Pflanzen, die aus jeder Ecke ragen, sich an den Wänden entlangranken, die fadendünnen Fangarme nach dem nächsten Halt ausstrecken und so den Putz mit grünen Ornamenten überziehen; der Wintergarten ist ein anarchisches Gewächshaus geworden, in dem sich die Gurkenpflanzen und Myrtensträucher ineinander verworren und verknotet haben, sich umeinander winden, Hibiskus mit den Pfefferpflanzen Symbiosen eingeht, Korallenwein und Hanfpalmen sich gegenseitig beinahe verschlingen. Hier ist das Licht ganz brüchig, grün, wie sehr tief unter Wasser; es zerteilt den Raum in zerbrechliche Fragmente. So wie im Wintergarten hat es früher gerochen, wenn meine Mutter die Heukissen für die Feriengäste vorbereitet hat, und manchmal kriege ich ein damisches Heimweh von dem grünen Duft.
Die meiste Zeit über schleppe ich Erinnerungsstücke zu Frau März. Sie besieht den Zustand der Wüstenrose, der Tischtenniskellen, des aus Holz geschnitzten husarischen Reiters. Wenn Frau März mir einen Suchauftrag gibt, verlasse ich mich ganz auf mein Gespür, auf das leichte Stolpern irgendwo in mir; dann drücke ich die Klinke auf zu einem der Zimmer, in denen es staubt und flüstert. Zum Affenzimmer, dem Eieruhrensalon, der Streichholzschachtelkammer. Oh, Herr und Frau März waren sehr, sehr große Sammler. Nun geht Frau März nicht mehr. Und Herr März spricht nicht mehr. Und beide liegen in einem großen Zimmer, atmen sich gegenseitig die Luft weg und die Schimmelsporen und sterben nicht. Ihr Neffe Ludwig wird langsam sehr unruhig, Das ist tatsächlich bares Geld!, hat er einmal zu mir gesagt, als ich ganz frisch für ihn gearbeitet habe und er einen langen und viel zu ehrlichen Tag hatte. Denn das Haus ist schon verkauft, so gut wie, der Interessent rechnet damit, es innerhalb der nächsten zwei Jahre abreißen oder beziehen zu können, Und das, was Traudl und Johann da noch treiben, das ist doch sowieso kein Leben mehr, hat der Ludwig mir noch ehrlicher gesagt. Das ist das Vegetieren eines Lauchs und einer Frühlingszwiebel, höchstens. Aber woher soll er wissen, wie viel noch los ist in Traudls Kopf und auch in dem vom Johann; ganz sicher ist es noch genug, um sich im Leben zu verhaken. Manchmal steigt Frau März doch aus ihrem Bett. Sie schlägt die steife Decke beiseite und macht sich selbst auf die Suche nach dem gewünschten Objekt, aber sie findet es nicht, nie, findet den Weg nicht zurück, oder nur selten. Sie mottet sich ein in einer Kammer, liegt da und hofft eine gute Weile, dass jemand sie entdeckt. Dass es der Johann ist, das ist die eigentliche Hoffnung. Aber er kann nicht, und meistens bin ich es, die die Traudl findet, oder der Pfleger. Manchmal ist sie dann in einem schlechten Zustand, mürrisch, verkühlt, ich führe sie zurück in ihr Zimmer und sie schüttelt den Kopf, über sich selbst und die misslungene Rettung durch den Johann, der seelenruhig in seinem Bett liegt, den Blick zur Decke gewandt und den Schlafanzug halb aufgeknöpft. Von ihren Strapazen hat er keine Ahnung. Und Frau März knöpft ihm den Schlafanzug wieder zu, vielleicht ein wenig gröber als nötig. Dann legt sie sich in ihr Bett, sie sieht mich an und sagt etwas wie, Ich wusste doch, dass manche Leute nichts vom Schwinghangeln verstehen. Frau März hat klare und unklare Momente, sie weiß, dass sie nur mehr ein wohlgelittener Gast in ihrem eigenen Haus ist. Ein saublödes Gefühl, hat sie mir irgendwann gesagt, als sie gerade echten Durchblick hatte.
Und jetzt stehe ich wieder vor ihrem Zimmer, ich öffne die Tür, ganz leise, und sehe den Johann im Bett liegen, er atmet mühsam und schwer, drückt einen kleinen Beutel mit roten Troddeln an seine Brust und seine Augenlider wehen auf, wehen ab. Hallo Johann, sage ich und schau zur Frau März, die hockt auf einer Fensterbank und sieht raus ins Freie. Die krumme Wirbelsäule zeichnet sich unter dem Stoff ihres Pyjamas ab, kleine knochige Höcker in einem Meer aus Stoff. Frau März wirkt konzentriert, als versuche sie, mit ihrem Blick etwas einzufangen, das durch den kalten Garten springt. Die Sonne scheint in ihren Schoß, ich leg den Bauernkalender sachte auf ihr Knie. Um 12 Uhr sieht man in den Himmel hinein. Da sind die Geister auf der Umfuhr, sagt sie. Wer einen Sautrog ums Haus zieht, dem erscheint der Teufel. Dann kann er ihn fragen, wo der Schatz liegt. Leise gehe ich aus dem Zimmer, Frau März spricht weiter, ihre Stimme klingt dringlich. Und dann beginne ich mit dem hinterrücksen Teil meiner Arbeit, ich sammle Dinge ein, die ich gebrauchen kann, denn es ist so: Ich verkaufe Stück für Stück ihren Hausstand. Die Alten kriegen doch eh nichts mehr mit, hat Ludwig mir gut zugeredet, als ich ihn misstrauisch angesehen habe, Du hilfst ihnen und mir, das Haus zu entrümpeln, ein gutes Gefühl, ein freier Geist und Kohle – win-win, verstehst du? Es ist eine Abmachung, und ich nutze sie, beinahe jedes Mal sammle ich etwas ein, aber es scheint mir manchmal so, als brächte ich dadurch das Leben der Märzens ins Wanken. Als zöge ich vielleicht einmal aus Versehen das entscheidende Steinchen aus dem schlingernden Konstrukt, sodass alles in sich zusammenfällt, der letzte Rest, der allerletzte Rahmen. Als hielte es nicht mehr, wenn zum Beispiel die kleinen Messingfische fehlen, Wandschmuck für die Küche, von Grünspan überzogen. Aber ich mache es trotzdem. Ich habe einen kleinen Internethandel ins Leben gerufen, das Geschäft floriert, weil die Kundinnen und Kunden die Patina mögen, den dunklen Geruch, der den Dingen anhaftet. Und der Handel treibt bunte Blüten auf meinem Konto, nur leider nie üppig genug: Sie verblühen schnell wie Pechnelken.
Ehe ich gehe, schaue ich noch mal nach Frau März. Nach der Traudl. Der Name will mir nicht so richtig aus dem Mund, er ist mir unangenehm wie eine Umarmung im Schlafanzug mit einer Fremden. Frau März steht jetzt am Fenster und schreibt sich eine Notiz auf den Arm, sie macht das schon recht lange so, Denn alles andere verliere ich ja doch, sagt sie. Frau März lässt den Arm sinken. Ich gehe auf sie zu und lese das Wort Wilde Jagd auf ihrer trockenen Haut, die blauen Buchstaben sind groß und locker wie ein Fußschlenkern.
Servus, Traudl, sage ich. Sie dreht sich um und sagt dann, Grüß dich, Burschi. Elisa nennt sie mich nie.
Charlie
Charlotte sagt, in ihrem Kopf werde ich immer gleich alt sein. Und ich weiß nur
eins, ich will raus aus diesem Kopf, denn die Aussicht hier drin ist gar nicht gut, zu viel Angst, zu viel rotes Haar in der Sicht, keine frische Luft, nie. Heute ist zum Beispiel der zweite Weihnachtsfeiertag, also gehen wir essen ins Lon Men, wir sind dort ohnehin jede Woche, es hat sich bewährt. Früher dachte ich, dass ich so etwas mit neunzehn längst schon nicht mehr machen würde, aber da dachte ich auch, wenn ich volljährig bin, ein ausgewachsener Mann und so weiter, da wohn ich längst in einer anderen Wohnung, in einem anderen Kiez, vielleicht sogar in einer anderen Klimazone, nix war’s, wir hocken immer noch beide in der Waldkrugallee 23, keine Änderung in Sicht.
Weil Charlotte morgen schon im Morgengrauen einen Flieger besteigen muss, um über fette Wolken hinweg nach Wien zu entschweben und da einen Vortrag zum Thema Sicherheit in Straßenbahnen zu halten, treffen wir uns heute recht früh. Die große Frage ist, in welcher Verfassung sie gleich sein wird, ob sie mein Geschenk gut fand: ein Gutschein für eine Yogastunde. Die Beschreibung klang fragwürdig, aber alle anderen Kurse waren bereits ausgebucht, Ich bin eine Frau. Inspiriert, göttlich & unbezwingbar, so stand es da, hoffentlich schreckt sie das nicht ab. Wahrscheinlich ist sie nur hingegangen, um mich nicht zu verletzen, gut vorbereitet in einem fliederfarbenen Zweiteiler.
Ich ziehe die Schublade meines Naturholzschrankes auf und merke, dass sie mir schon wieder zwei neue Wollpullover hineingelegt hat, noch mit Preisschild, und auch einen Stapel Unterhosen in verschiedenen gediegenen Tönen, unkommentierte Eindringlinge in meiner Garderobe. Ich sehe hinaus auf das verschneite Rosenbeet des Nachbarn, ich sehe hinüber zur Nachbarin, die hinter der Milchglasscheibe unsichtbare Gegner k.o. boxt, und kriege Lust, das Gleiche mit meiner Mutter zu tun. Dann greife ich nach einem der Pullover. Charlotte meint es nur gut, Rituale sind ihr wichtig, sie geben ihr Halt und sollen auch mir, sagt sie, das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Wir haben viele Rituale, die stapeln sich langsam so hoch wie die Pfandflaschen unter der Spüle, und keiner bringt sie weg.
Wenn wir zum großen All-You-Can-Eat-Abend ins Lon Men gehen, treffen wir uns grundsätzlich zeitig, wir wissen, wenn wir früh da sind, können wir neben dem Büfett sitzen, was einige Vorteile hat, besserer Überblick, kürzere Wege, wenn wir früh da sind, duften die Gerichte in den großen Blechbottichen noch ganz taufrisch. Die Gäste machen sich über das Büfett her wie die Tiere, findet Charlotte außerdem. Wenn sie dabei zusehen muss, vergeht ihr jeglicher Appetit, also sind wir früher da als die anderen – wer isst schon um 17Uhr zu Abend? Wir. Charlotte hat ein Lieblingsbild von mir, darauf bin ich vier und stehe auf der Sommerterrasse des Lon Men. Ich trage ein blaues Kleid, sie hat mir mein Haar gestriegelt und mich vorher ordentlich in die Wangen gekniffen, damit sie noch rosiger leuchten, ich sehe aus wie ein Mädchen und über mir bauscht sich die orangegelbe Markise im warmen Sommerwind. Ich halte ein großes Softeis in der Hand, ich sehe glücklich aus und scheine keine Ahnung zu haben, dass Charlotte mich an diesem Nachmittag bei allen als Mädchen ausgibt. Bei jeder Familienfeier holt sie das Bild raus und zeigt es rum, sie lacht, alle lachen und sagen, Charlie wäre so ein niedliches Mädchen geworden! Und die Chefin des Restaurants, Frau Zhou, nennt mich deswegen heute noch zärtlich Xiăo gӣ niáng, das heißt so viel wie kleines Fräulein, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
Letztes Jahr zum Geburtstag war auch Tante Liese da, samt Onkel Gabriel natürlich, und als Charlotte aufgesprungen ist, um das Foto wieder einmal zu holen, habe ich ihr nachgerufen, ob sie denn nichts anderes zu tun hätte, als mich zu blamieren, ob das wirklich der einzige verdammte Spaß in ihrem traurigen Beamtinnenleben sei. Ich bin sehr laut geworden und außerdem ungerecht, als Präzisionsschützin führt sie ja nicht gerade ein eintöniges Leben, auch wenn sie mir oft genug erzählt hat, wie monoton das stundenlange Observieren der Plätze und Einkaufspassagen sein kann, wenn einfach nichts und nichts passiert. Und Charlotte war sehr still, als sie dann doch ohne Foto zurückkam, und es sah aus, als hätten ihre Locken jegliche Standkraft verloren, sie hingen ihr wie kümmerliche Luftschlangen ums Gesicht, ein trauriger Anblick war das, und ich hatte sofort ein extraordinär schlechtes Gewissen. Charlotte hat mit papierdünner Stimme gefragt, ob noch jemand zuckerfreien Pflaumenkuchen will, und niemand wollte. Onkel Gabriel hat rasch einen Witz zum Besten gegeben, Treffen sich zwei Jäger im Wald, beide tot, keiner hat gelacht. Später hat Charlotte geweint, und Tante Liese hat sie ein wenig unbeholfen in den runden, schweren Armen gehalten und sie an ihr mit silbernem Efeu bedrucktes T-Shirt gepresst, Das meint doch der Junge nicht so, hat sie gesagt, aber ich habe es so gemeint, wie denn sonst? Ich weiß nicht, ob Charlotte lieber ein Mädchen gehabt hätte und auch nicht, warum sie mir diesen Spitznamen gegeben hat, Charlie, Charlotte, vielleicht ist es echt besser, nicht zu viel darüber nachzudenken. Der Stand der Dinge ist jedenfalls der: Ich wohne zu Hause, ich mache ein Praktikum bei einem Musiklabel, Charlotte und ich halten eine Art Burgfrieden, unsere Wohnung hat drei Zimmer, und unser Pfefferstreuer ist geformt wie ein Gorilla. Wenn einer von uns zu viel bekommt, geht er auf den Balkon mit dem Glasvorbau und schreit in einen leeren Blumentopf hinein.
Aber wenn sie morgen ihren Plastikrollkoffer zugeklappt und sich die Fellmütze übergestülpt hat, die Fellmütze, die sie trägt und für die ich mich schäme, weil alle Leute vom Musiklabel das ganz unmöglich fänden, und weil ich mich sowieso für vieles schäme, für Dinge, die sie tut, für Dinge, die ich tue; wenn jedenfalls die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen ist und ein erfrischender Luftzug von der Straße durchs Treppenhaus und durch den Briefschlitz geweht ist, dann werde ich erst einmal sehr laut die neue Single von Kraftausdruck aufdrehen und mitschreien, jede Zeile, Es ist doch sowieso/nichts schmutziger als Money/drum klapp ich mir den Kragen hoch und zieh ne Line mit Ronny. Und dann kaufe ich der Frau aus dem Internet ihr Straßenmusikerequipment ab, wir haben einen Deal gemacht, und ich weiß nicht genau, was zu dem Set gehört, aber ganz sicher ein Mikro, und ich hoffe, dieser erste Schritt löst dann eine Kettenreaktion extraordinärer, unerhörter Ereignisse aus, Berühmtheit zum Beispiel, einen Auszug von daheim, halt irgendetwas in der Art.
Charlotte
Ich liege auf einer Gummimatte. Sie klebt. Es riecht nach Weihrauch. Neben mir dehnt eine Frau ihre Hüfte, sie kugelt zur Seite, sie stöhnt. Es läuft sanfte Musik, Glöckchen, Sitar, aber
ich fühle mich nicht sanft. Die Menschen legen ihre Matten so sachte auf den Boden, als wären sie in Gefahr. Das sind sie aber nicht. Sie legen ihre Korkblöcke ab und ihre Gurte und Wasserflaschen, und wenn jemand auch nur Anstalten macht, nach einem Platz für seine Matte Ausschau zu halten, rücken alle augenblicklich beflissen zur Seite und nehmen ihn auf in ihren Kreis. Ich ahne, dass es eine einigermaßen dumme Idee war, hierherzukommen. Ich hätte eine leichte Beschädigung meiner Beziehung zu Charlie in Kauf nehmen müssen, ihm diplomatisch, aber entschieden sagen sollen, dass das hier gar nichts für mich ist, sondern für Himbeerbubis, schlimme Nulpen. Aber jetzt ist es zu spät.
Hier hinten in der Ecke ist es dämmrig, und ich schließe meine Augen. Ich bemühe mich um eine tiefe, geräuschlastige Atmung und einen klaren, einladenden Kopf. Aber die Füße der anderen patschen um meinen Schädel herum, die Haken klirren, krachen zu Boden, ich kann riechen, wer welches Deodorant trägt und wer die Haare nicht gewaschen hat. Irgendwann liegen endlich alle, platt wie Flundern. Wir schnaufen brav. Wir schweigen still. Wir schnaufen so lange, bis unser Lehrer vorne sagt, Ich begrüße euch, alle zusammen, prima, dass ihr euch entschieden habt, heute eure ewige Strahlkraft zu wecken, eurer urweiblichen Seite mit Liebe und Achtsamkeit zu begegnen.
Ich nicke mir selbst zu und beglückwünsche mich, auch wenn der Kurs eine Zumutung zu sein scheint. Da liege ich also dicht an dicht mit dreißig anderen Städtern, ich kenne sie nicht, und ich atme. Atme tiefer. Alle anderen setzen sich auf. Ich bleibe liegen, und ich habe Hunger, hoffentlich ist das nicht problematisch. Der Lehrer sagt, Ich will euch kennenlernen. Ich will niemanden kennenlernen, und ich will auch nicht kennengelernt werden. Wenn die anderen wüssten, womit ich meinen Tag verbracht habe, hätten sie auch keine Lust mehr darauf, garantiert.
Die Frau hinter mir weint. Jetzt schon? Ich setze mich auf, drehe mich um und schaue sie so kalt und strafend an, wie ich nur kann. Reiß dich zusammen, sagt ihr mein Blick, und ich weiß, der kann Leute einschüchtern und zum Weinen bringen. Selbst meine Kameraden.
Erst jetzt sehe ich, wie der Lehrer tatsächlich aussieht. Er ist ein großer, zäher, braun gebrannter Hering voller Muskeln. Die Augen hat er schwarz umrandet. Er trägt ein Oberteil mit dünnen Trägern und einen weißen Turban. Ich nicht. Eine Frau in der ersten Reihe schon. Ihre Nachbarin meldet sich, sie sagt, Ich lag gestern auf dem Bett, ich habe an die Decke gesehen, da wo die Spinnweben wachsen und der Schimmel manchmal blüht, und auf einmal wuchsen mir Spiralen aus der Stirn, sie schwebten nach oben und glänzten in vielen Farben. Sie dreht sich zu uns um, zuckt mit den Schultern. So war es wirklich.
Der Lehrer klatscht in die Hände. Ich danke dir, sagt er, dass du diese Erfahrung mit uns geteilt hast. Du hattest eine Vision, und das ist ganz unglaublich.
Die Frau hinter mir schluchzt auf. Wann machen wir endlich Sport? Viele andere erzählen ebenfalls von sich. Eine Teilnehmerin sagt, dass sie gestern Abend nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Nicht, als sie in der Kletterhalle an bunten Plastikblöcken hängend eine Wand hinaufgeklettert ist. Nicht, als sie eine Dokumentation über einen Walnussverkäufer im Libanon angesehen hat, dessen größter Wunsch eine vegane Hochzeit war. Nicht, als sie ihrem Sohn einen Gutenachtkuss gegeben hat. Ihr Sohn hat sie angstvoll angesehen, da musste sie noch mehr weinen. Und ich werde ungeduldig. Vor Ungeduld habe ich begonnen, sehr schnell und viel zu atmen. Das merke ich erst, als mir schwindlig wird. An einem leichten Gefühl der Taubheit in den Armen. Aber ich fokussiere mich, so gut ich kann. Ich halte mir meine Wünsche vor Augen. Biss für die Reise. Kraft. Immerhin präsentiere ich ein radikales und konsequent bis zum bitteren Ende durchdachtes Sicherheitskonzept und werde das Publikum bestimmt erschüttern. Ich rechne mit heftigen Reaktionen. Ich mache es mir nicht leicht.
Lasst uns im Sitzen beginnen, sagt der Lehrer. Wir rudern mit den Armen, wir schnaufen, wir boxen die Luft, wir halten absurde Stellungen neun Minuten lang und singen dabei wirres Zeug. Zwischendurch ruft der Lehrer etwas wie Ihr seid nah dran, so nah, so nah! – Woran denn bloß?, frage ich meine Nachbarin pfiffig, doch die schaut nur ganz angestrengt nach vorne.
Wir springen mit ausgestreckten Armen in die Höhe, wir federn in den Knien und schlagen dreimal rhythmisch auf den Boden, wir schreien har, har, har, und hari, wenn wir wieder in die Luft springen. Der Lehrer sagt, Lasst es raus, lasst es hinter euch, lasst es endlich los! Ein paar Menschen stöhnen. Ich finde Loslassen keineswegs zielführend, wenn es Kontrollverlust bedeutet. Für eine Präzisionsschützin kann es nichts Schlimmeres geben. Ich stelle mir vor, wie ich auf dem Hoteldach stehe und die Kontrolle verliere, wie ich unkontrolliert in die falsche Richtung ballere, aufs falsche Weichziel, in falsche Körperteile, ich federe mit den Knien, und als ich hari schreie, hoffe ich tatsächlich, dass ich die Bilder wegschreien kann, aber es geht nicht. Bei jedem Atemzug beobachte ich mich erneut dabei, wie ich einen weiteren und ganz unverzeihlichen Fehler begehe.
Später sollen wir noch laufen wie Elefanten. Wir sollen mit durchgestreckten Beinen unsere Fußknöchel greifen und durch den Raum trampeln. Für so etwas zahlen die Leute hier Geld, das ist doch nicht zu fassen! Ich sehe fast nichts, nur Gummimatten, Parkettboden, verschwitzte Füße. Die Luft ist dick. Mehrfach rempeln Leute mich an, einmal verbrenne ich mich beinahe an dem bauchigen Metallofen in der Ecke. In ihm brennt ein gelbes Feuer, das sehe ich durch das Fenster und frage mich wirklich, wie es um den Brandschutz steht und ob ich diesen Laden vielleicht melden sollte. Danach sitzen wir vollkommen erschossen auf unseren Matten und sollen in unser drittes Auge atmen.
Vorn hat eine Frau ihr T-Shirt ausgezogen, sie sitzt im roten Büstenhalter vor dem Lehrer und heult ihn an, völlig enthemmt. Onkel Gabriel würde es hier ganz, ganz schlecht ertragen, das steht fest. Ich habe etwas sehr Besonderes mit euch vor, sagt jetzt der Lehrer. Das ist nur möglich, weil wir mehr als zwölf Personen sind. Wir sollen einen Kreis bilden und uns an den Händen nehmen. Der Lehrer sagt, dass die Rauhnächte eine besondere Zeit sind. Und die Rauhnächte sind jetzt, und sie sind, angeblich, undurchschaubar. Während der Rauhnächte klopfen die Geister am Diesseits an, sagt der Lehrer, sie schweben über unseren Straßen. In dieser Zeit ist alles wandelbar. Nutzt ihre Energie. Er zündet ein Stück Holz an, es muss ein spezielles sein, denn ich fühle mich noch wirrer als zuvor. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass der Lehrer immer weiter von den Rauhnächten erzählt. Die Frau neben mir greift meine Hand so fest, als hätte sie das Recht dazu. Ich sehe, wie der Lehrer eine weinende Kursteilnehmerin umarmt, und ich denke noch, dass es mit dieser verpäppelten Gesellschaft gewiss ein böses Ende nehmen wird. Und dann kippe ich einfach um.